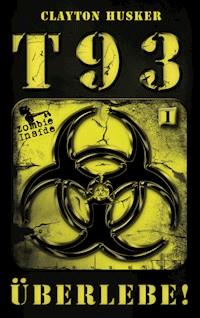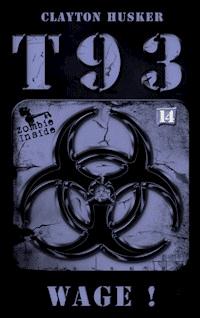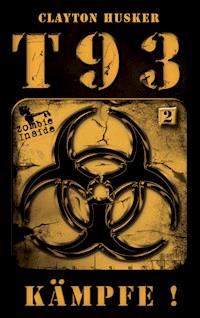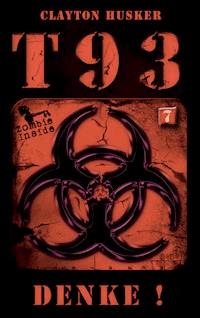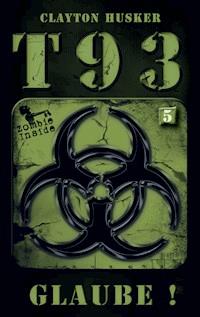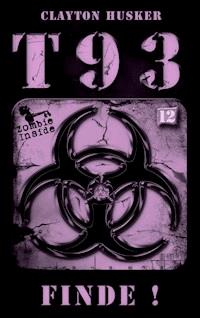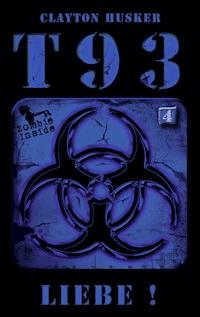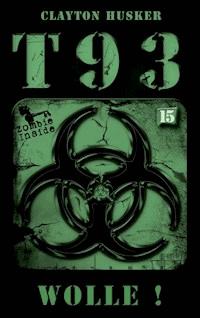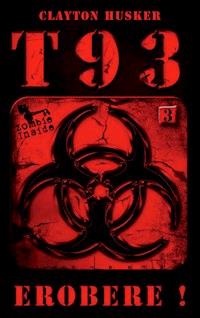7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In Neo Colonia spitzt sich der Machtkampf zwischen den korrupten Kirchenfürsten und der Obersten Kongregation, dem militärischen Orden der Kirche, weiter zu. Doch der Zeitpunkt für einen Putsch könnte nicht ungünstiger sein, denn die Nephilim-Zombies haben bereits begonnen, ihre Klauen nach der Stadt auszustrecken. In den Abwasserkanälen unter der Metropole beginnt ein mörderischer Kampf. Währenddessen macht Xiuna in der legendären Bergfestung Rennes-le-Château den nächsten Schritt auf dem Goldenen Pfad. Ist sie schon mächtig genug, dem Herrscher der Nephilim entgegenzutreten? Xiuna erhält eine erschreckende Nachricht und muss eine Entscheidung treffen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nephilim
Die Zombie-Serie
von
Clayton Husker
Inhalt
Titelseite
Band 4: Stahl im Wind
4. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (I)
4. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (II)
4. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (III)
17. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (I)
17. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (II)
17. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (III)
20. Juli im zweiunddreißigsten Baktun
21. Juli im zweiunddreißigsten Baktun
31. Juli im zweiunddreißigsten Baktun
11. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
11. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
12. August im zweiunddreißigsten Baktun
13. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
13. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
14. August im zweiunddreißigsten Baktun
15. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
15. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
15. August im zweiunddreißigsten Baktun (III)
15. August im zweiunddreißigsten Baktun (IV)
16. August im zweiunddreißigsten Baktun
Empfehlungen
T93
Der zweite Krieg der Welten
Nation-Z
Impressum
Band 4:Stahl im Wind
»Gewissen ist ein Wort für Feige nur,
zum Einhalt für den Starken erst erdacht:
Uns ist die Wehr Gewissen, Schwert Gesetz.«
William Shakespeare: »Richard III.«
4. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (I)
Um sie herum flirrte die Energie. Es bildete sich eine rotierende Wolke aus winzigsten Staubteilchen um ihren Körper. Das Rauschen des Blutes verdichtete sich zu einem Brausen, dem Tosen eines Unwetters gleich, dennoch nach außen völlig lautlos. Jede Zelle ihres Körpers vibrierte in einer Frequenz und Intensität, wie sie es ähnlich zwar schon gespürt hatte, aber noch nie hatte ihr Körper mit dieser Macht Resonanz erzeugt.
Knisternde Elektrizität liebkoste ihre Haut und ließ die feinen Härchen sich aufstellen, sie wiegten sich wie Schilf in einer warmen Sommerbrise. Ein für normale Ohren nicht hörbares Rascheln ihrer langen, schwarzen, über den Rücken fallenden Haare kroch leise in ihr Ohr. Ihre Wahrnehmung verschob sich vollkommen, die energetischen Vorgänge ihres Körpers rückten in übernatürlicher Weise in den Vordergrund des Bewusstseins. Sie hatte desgleichen noch nie in einer solchen Konzentration erlebt.
In ihr sammelte sich die Kraft, welche sie durch ihre Handlung geweckt hatte, die Bioenergie, die ihre Mutter stets als Kundalini Shakti bezeichnet hatte. Die Bewegungen ihres Rückgrats glichen dem Tanz der filigranen Sandhosen, die sich im Aufwind der steilen Nordklippe gelegentlich bildeten, wenn die Thermik dort den feinen Pudersand an dem von der Sonne aufgeheizten Felsen emporriss.
»Rajas, Tamas, Sattva, Shuna.«
Xiuna ließ die Worte des Mantras durch ihren Geist fließen, während sie mit ihrer Atmung dieser Melodie folgte. Ihr Körper bewegte sich auf und nieder. Die Muskulatur ihrer Oberschenkel, im Rhythmus des vierfältigen Atems in den Zustand des Prana-Bindu versetzt, arbeitete präzise wie eine Maschine, ohne dass eine Kontrolle durch das Bewusstsein dafür nötig gewesen wäre.
Gierig sog ihr Körper die verfügbare Energie in sich auf und formte sie in ihrer Wirbelsäule zu einem Feuerstrahl, den es nach oben drängte. Ihr Bruder Terion, der diese Energie freisetzte, schrie wie ein waidwundes Tier, doch Xiuna konnte darauf keine Rücksicht nehmen. Es gab nur einen einzigen Versuch, nur diesen einen, denn noch einen würde ihr geliebter Bruder nicht überleben. Terion bäumte sich auf und begann beinahe spastisch zu zucken.
›Nur noch ein wenig‹, tönte es im hintersten Winkel ihres Geistes, und es war unzweideutig die Stimme ihrer Mutter, bemerkte Xiuna trotz der Ekstase, in die sich ihr Geist emporschwang, ›nur noch einen kleinen Moment, bis …‹
Dann geschah es.
Mit der Macht einer Interkontinentalrakete bewegte sich ein gewaltiger, heißer Energiestrom vom Beckenboden aus senkrecht durch Xiunas Körper und durchdrang ihren Schädel im Bereich der Fontanelle. Ein Geysir aus Licht jenseits des sichtbaren Spektrums schoss aus ihr empor und strömte in den sternenklaren Abendhimmel. Xiuna warf den Kopf in den Nacken und ein lauter Schrei entfuhr ihrer Kehle.
»Hriiiliuuuuu!«
Als sie das letzte Mal ein solches Ritual vollzogen hatte, war sie völlig entkräftet und bewusstlos zusammengebrochen. Diesmal jedoch verhielt es sich anders. Xiuna richtete sich auf und erhob sich langsam. Sie vollzog einige formelle Bewegungen des Prana-Bindu-Trainingsablaufs, wobei sie dazu unverständliche gutturale Laute von sich gab. Aus ihren Körperöffnungen und jeder Pore der Haut traten Flüssigkeiten aus, liefen zu Rinnsalen zusammen und tropften in den warmen Sand.
*
Der völlig kraftlos wirkende Terion schleppte sich aus ihrem Aktionsbereich und lehnte sich erschöpft an einen herumliegenden Stein, der wahrscheinlich aus dem eingestürzten Magdalenenturm stammte – zumindest besaß er einige unbequeme, scharfkantige Grate, was Terion allerdings nicht kümmerte. Er war froh, dass es eine Ecke gab, wo er sich verkriechen konnte, denn was er da auf dem Plateau zu sehen bekam, machte ihm Angst. Seine Schwester hatte ihn eben beinahe umgebracht, so viel war ihm klar. Den größten Teil der Lebensenergie hatte sie ihm entzogen, wie einer dieser furchtbaren Vampire in den alten Filmen, die er früher im Castlegate-Bunker mit Vater so gern geschaut hatte. Er fragte sich, ob sie bis zum Äußersten gegangen wäre, und er konnte sich selbst darauf keine befriedigende Antwort geben.
Dieses Wesen, das dort stand, mit dem sehnigen, muskulösen Körper und den hüftlangen schwarzen Haaren, die ihn wie ein Nemes verhüllten, war das tatsächlich seine Schwester? Oder handelte es sich um einen von der Ordensbruderschaft gezüchteten biologischen Kampfroboter, dessen einziges Ziel darin bestand, seine Mission zu erfüllen und den Gegner zu vernichten, und zwar ohne jede Rücksicht auf Verluste? Im Moment jedenfalls fühlte sich Terion mehr wie ein Kollateralschaden denn wie ein Mensch.
Nach Luft japsend beobachtete er seine Schwester, die vollkommen ruhig wirkte, so, als vollziehe sie gerade ihre Abendgymnastik vor dem Schlafengehen. Sie bewegte sich langsam, zog die Arme an den Körper und ließ ihre ausgestreckten Hände mit weit schweifenden Bewegungen über eine imaginäre Wellenlinie wandern. Dann stieß sie mit den Fäusten plötzlich vor und zog sie wieder zurück, die Hände öffnend. Dabei gab sie Lautäußerungen von sich, die Terion auch mit viel Fantasie keiner Sprache zuzuordnen vermochte. Auch die Tiefe ihrer Stimme verunsicherte ihn zusehends.
Terion wusste zwar, dass seine Schwester ihm im Bereich der spirituellen Energien und magischen Kampftechniken um Längen voraus war, doch was Xiuna dort tat, verstand er nicht im Ansatz. Ihre Hände und Arme begannen, immer komplexere Muster zu verfolgen, sie zog ein Bein an, wirbelte einmal um ihre eigene Achse, und als sie den rechten Fuß wieder stampfend auf die Erde stellte, meinte Terion, der gesamte Berg würde wackeln.
Sie musste Unmengen von Energie in ihrem Körper verarbeiten, mutmaßte Terion, denn die Pfütze zu ihren Füßen wurde langsam dunkler. Es schien seine Schwester nicht zu stören, dass zahlreiche winzige Bäche über ihren Körper liefen; sogar Blut trat an einigen Stellen aus. Im Mondlicht wirkte Xiunas nasse, reflektierende Haut, als bestünde sie aus Metall.
Plötzlich verharrte sie, breitbeinig dastehend, in der Bewegung und zog die Arme mit geballten Fäusten an ihre Taille zurück. Dann führte sie die Hände vor die Brust, legte die Handflächen gegeneinander, ging etwas in die Knie und führte die Hände ruckartig in einem Bogen auseinander, wobei sie sich in einer unerklärlich leichten Bewegung auf den Sohlen einmal um ihre eigene Achse drehte. Um sie herum bildete sich ein Kreis aus gleißendem Licht, den sie von sich absprengte – wie eine Supernova ihre äußere Hülle.
Terion starrte völlig schockiert auf das Ereignis und warf sich zur Seite, weil er fürchtete, dieser seltsame Lichtring, den seine Schwester emittierte, könnte ihm vielleicht den Kopf vom Rumpf trennen. Die obskure Illumination beschädigte jedoch nichts. Sie durchdrang die Materie irgendwie spielerisch leicht, ohne Spuren zu hinterlassen.
Als er wieder aufblickte, stand seine Schwester vor ihm, nackt, wunderschön, aber irgendwie fremd. Etwas hatte sich verändert, aber Terion hätte unter keinen Umständen sagen können, was genau sich verändert hatte.
»Wir können jetzt schlafen gehen, Terion«, sagte sie monoton, »es ist vollbracht. Ich danke dir, Bruder.«
Sie drehte sich um und überquerte den von kleinen Dünen bedeckten Platz in Richtung Osten, wo die ehemalige Grand Rue – jetzt ein winziger, verwehter Sandpfad – zum Haupttor der Bergfestung Rennes-le-Château führte. Dort, in dem Haus des letzten Festungskommandanten, hatten die beiden Quartier bezogen, um etwas über ihre eigene Vergangenheit zu erfahren und die Entwicklung der Dinge abzuwarten, wie seine Schwester es gelegentlich formulierte.
Er schämte sich seiner Blöße, griff nach seinen Sachen und kleidete sich hastig an. Er mochte nicht darüber nachdenken, was hier heute geschehen war, und er würde darüber für den Rest seines Lebens kein Wort verlieren. Er hatte – zumindest passiv – dazu beigetragen, ein Monster zu erschaffen. Ja, seine Schwester war ein Monster. Auch wenn er sie wirklich über alles liebte, nicht zuletzt, weil er sie die meiste Zeit während seines Lebens nicht einmal gekannt hatte und überglücklich darüber war, sie getroffen zu haben. Sie hatte sich zu einer energiestrotzenden Bestie mit telepathischen Fähigkeiten entwickelt, deren Bedeutung und Intensität Terion nicht im Ansatz erahnen, geschweige denn erfassen konnte. Und sie hatte ihn benutzt, seine Lebensenergie absorbiert, um zu dem zu werden, was sie nun war. Ein Monster. Und ein Monster blieb ein Monster, auch wenn es schön war.
*
Xiuna konnte jeden seiner Gedankengänge lesen, auch wenn sie schon die halbe Strecke zum Haus hinter sich gelassen hatte. Sie nahm ihrem Bruder nicht übel, dass er so dachte, wie sollte sie auch? Er hatte ja schließlich recht mit dem, was er annahm. Um ein Haar hätte sie ihn durch die Energieübertragung getötet, dann hätte sie ihren einzigen Bruder jetzt auf dem Gewissen gehabt. Das Schlimmste war, dass es ihr nichts ausmachte. Sie empfand keine Reue über das, was sie getan hatte, denn es handelte sich um eine Notwendigkeit. Nur Terion besaß den genetischen Code, dessen sie bedurft hatte, um auch noch die letzten Facetten ihrer spirituellen Kraft zu erwecken. Selbst wenn sie Terion hätte schonen wollen, es gab nichts auf dieser Welt, das die gerade durchgeführte Aktion hätte ersetzen können. Außerdem hatte Terion schließlich zugestimmt.
Im Vollbesitz ihrer metaphysischen Kräfte wandelte Xiuna von Vovin jetzt auf dem Goldenen Pfad, der sich in seiner Komplexität nun vollends vor ihr entfaltet hatte. Die Summe aller Möglichkeiten und die Fähigkeit, diese exakt zu bestimmen und voneinander zu unterscheiden, machte Xiuna zu einem würdigen Gegner für ihren Widersacher, der danach trachtete, die gesamte verbliebene Menschheit zu unterjochen und in furchtbare Zeds zu verwandeln. Noch schlimmer würde es denen ergehen, die der Fürst der Untoten nicht sofort töten oder umwandeln ließ, denn diese armen Teufel mussten den Nachschub an Menschenfleisch sicherstellen. Dazu pferchte er seine Gefangenen in einem riesigen unterirdischen Höhlensystem ein.
Xiunas Mission war es, diese gottlose Kreatur zu finden, sie zu stellen und sie auszulöschen. Aus diesem Grund – und nur aus diesem – hatte sie sich selbst in etwas verwandelt, das dem Untoten in Grausamkeit und Kampftriebstärke in nichts nachstand. Der letzte Schritt dieser Metamorphose hatte nun seinen Abschluss gefunden. Der Kampf konnte beginnen.
Xiuna schritt, das fahle Licht des vollen Mondes auf ihrer Haut reflektierend, durch die von jedem Leben befreite Gasse auf das Haus zu, das ihnen hier Obdach bot. Sie war durstig, sehr durstig. Dennoch gerieten ihre Schritte nicht aus dem Takt, sie beschleunigten sich nicht. Hinter sich hörte sie das erschöpfte Keuchen ihres Bruders. Er würde Wochen brauchen, um seine Kondition wiederzuerlangen.
4. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (II)
Die Pein der Bestie steigerte sich ins Unbeschreibliche. Der Fürst der Finsternis, Herrscher über Legionen Untoter, wand sich in furchtbarer Agonie. Beißende, rote Gefühle brannten sich in seine Gedanken und er gab ein Brüllen von sich, das den Berg erschütterte. Ein Soliton von unvorstellbarer Kraft hatte ihn über das Netz der Linien der Kraft getroffen – auf sämtlichen Kanälen aus allen Richtungen gleichzeitig. Sogar seine Kommandodrohnen hatten das emotionale Signal empfangen können. Sie kreischten wie irre. Der Anführer der Nephilim, Torg Abila, litt Höllenqualen, und zwar in einer bis dahin nicht gekannten Intensität. Ein ähnliches Gefühl hatte er vor einiger Zeit schon einmal verspürt, als das Höhere Wesen, nach dessen Lebenskraft es ihn verlangte, das Gitter der Linien der Kraft erschüttert hatte. Doch diesmal fühlte es sich tausendmal intensiver, schmerzhafter an. Und das ihm, der ansonsten den Begriff des Schmerzes nur aus den Gedanken derer kannte, deren Erinnerungen er mit ihrem Fleisch verschlang. In seinem grotesken Thronsaal, tief im Berg verborgen, rollte Torg Abila seinen fetten Wanst von einer Seite auf die andere, wobei er durch die mit reptiloider Lederhaut bespannten Spalten zwischen den dicken Chitinplatten, die seinen feisten Leib bedeckten, immer wieder faulig stinkende Dampfwolken ausstieß.
Torg Abila verwuchs mittlerweile zu einer Kreatur, die jede Schöpfung zu verspotten schien. Sein hummerartiger Körper hatte die Größe eines Sattelschleppers erreicht, zahlreiche Beinpaare versuchten mehr schlecht als recht, die Masse in einer Balance zu halten. Mächtige Scherenarme fuchtelten in der Luft herum, und von dem Bereich aus, den man mit viel Fantasie als Hals bezeichnen konnte, wuchsen Tentakel hervor, ähnlich denen eines Kalmars. Der Hals selbst bestand aus länglichen, geteilten Panzerplatten, die sich ständig bewegten. Das einzige Merkmal, das darauf hindeutete, dass diese entsetzliche, die Sinne beleidigende Abscheulichkeit humanoide DNA enthalten könnte, war der im Vergleich zum Leib winzige, haarlose Kopf, der zwar völlig verschoben, aber doch irgendwie menschlich erschien.
In seiner Raserei wälzte sich das Monstrum von einer Seite auf die andere, wobei sich seine direkte Umgebung tunlichst bemühte, aus dem Weg zu kommen, um nicht unter den massiven bräunlich roten Panzerplatten, die den wabbeligen Körper schützten, zerquetscht zu werden. Diese Chitinplatten erzeugten schabende und knirschende Geräusche auf dem steinigen Untergrund des Podests, auf welchem der Oberste der Nephilim thronte. Das Wesen selbst stellte die absolute Karikatur einer ekelerregenden Chimäre dar, und wenn man Torg Abila ansah, dann fühlte man sich an nichts erinnert, außer vielleicht an die kruden Werke eines Hieronymus Bosch, denen dieser manifestierte Albtraum entsprungen zu sein schien. Das Monster vereinte die Merkmale so vieler Lebensformen in sich, dass es im Grunde unmöglich war, diese voneinander zu unterscheiden.
Es dauerte einige Minuten, bis der Anfall vorbei war, und Torg Abila kam langsam wieder zur Ruhe. Das Iad, die Schwarmintelligenz des mutierten Zed-Virus, welches den riesigen Bioroboter steuerte, sprach zu ihm durch die Nervenfilamente, die sich durch den massiven Körper zogen. Es brachte sie wie die Saiten einer Gitarre zum Klingen, um eine Resonanz in Torg Abilas Körperbewusstsein zu erzeugen.
›Nun, schlussendlich musst du die Gefahr erkennen, in der wir uns befinden. Das Wesen, das diese Wellen in den Äther sendet, ist erheblich mächtiger, als wir vorausberechnet haben. Wir müssen seiner Kraft habhaft werden, sie in uns aufnehmen. Es wird eine Zeit geben, und die ist nicht mehr fern, da werden die Kräfte dieses Wesens die unseren übertreffen. Eile dich, Torg Abila, dieses Wesen ausfindig zu machen, und labe dich an seinem Fleisch.‹
Der Fleischkoloss schüttelte sich, als wollte er seine Schale abwerfen, und antwortete:
›Torg Abila wird tun, wie ihm geheißen. Der Hive wird seine Drohnen aussenden, um das Wesen zu finden.‹
Das Bewusstsein des Iad zog sich zurück und Torg Abila überlegte. Das Soliton, das ihn nun bereits zum zweiten Mal tief getroffen hatte, war wesentlich intensiver gewesen als beim ersten Mal. Da hatte er die Quelle noch lokalisieren können, doch in diesem Fall war ihm das nicht möglich gewesen. Entweder die Signalquelle war sehr nah, oder aber das Signal selbst war dermaßen stark, dass es quasi von allen Seiten gleichzeitig kam. Ersteres stellte einen Glücksfall dar, denn seine Drohnen könnten des Wesens sehr schnell habhaft werden. In letzterem Fall allerdings zeugte das von Problemen, an die Torg Abila nicht einmal denken mochte. Wie sollte der Hive ein Wesen besiegen, das über solch massive geistige Kräfte verfügte? Andererseits – wenn dies gelang und er sich am Fleisch des Wesens labte, könnte er große Mengen dieser exotischen Energie in sich aufnehmen und würde an Macht gewinnen. Den gesamten Planeten könnte er sich untertan machen und die unperfekten Lebensformen dominieren.
Die Zeds stellten seiner Ansicht nach die perfektionierte Form der Existenz dar, denn sie waren bereits tot – im biologischen Sinne –, was sie auf eine besondere Art und Weise unvergänglich machte. Die Existenz eines höher organisierten Zeds war für die Ewigkeit konzipiert, und die Verschmelzung des toten Fleisches mit dem überragenden Bewusstsein des Iad schuf eine Daseinsform, die – wenn man äußere Umstände vernachlässigte – eine Existenz ohne zeitliche Begrenzung ermöglichte. Die Nephilim würden sich Menschen als Nahrungsquelle halten, denn ihr Fleisch gab besonders viel Kraft und die darin enthaltenen Zellerinnerungen bereicherten das geistige Spektrum des Iad erheblich.
Das fremde, mächtige Wesen jedoch stand der Ausbreitung des Hive im Wege; es musste beseitigt beziehungsweise assimiliert werden. Torg Abila hatte noch nicht die geringste Ahnung, was ihn erwartete und wie er diese Aufgabe lösen sollte. Auch das Iad selbst schien nicht recht zu wissen, womit man es hier zu tun hatte, andernfalls wäre ihm eine direktere Order erteilt worden. So sehr er auch die Linien der Kraft abtastete und den Äther durchforstete, er konnte die Spur des Wesens nicht aufnehmen. Also blieb ihm nichts weiter, als Erkundungstrupps auszusenden und ansonsten den nächsten Zug des Wesens abzuwarten. Das befriedigte den mächtigen Nephilim wenig. Er war es gewohnt, seine Ziele erfolgreich zu verfolgen.
Der Frust wandelte sich schnell in Ärger, und wenn Torg Abila zornig wurde, stieß er besonders intensiv aromatisierte Dampfwolken aus den Segmentzwischenräumen seines Panzers aus. Und er bekam Hunger. Also instruierte er seine Arbeiterdrohnen, ihm Menschenfleisch zuzuführen, und zwar in ausreichender Menge, um seinen gewaltigen Appetit zu stillen. Die ihn umgebenden Arbeiterdrohnen, die gewissermaßen seinen Hofstaat bildeten, eilten davon und holten wenige Minuten später eine Gruppe völlig verstörter Menschen in den Felsendom.
Es handelte sich um eine Gruppe männlicher Menschen – ausgemergelt und verdreckt von Exkrementen und Kohlestaub –, die von den rundmäuligen Drohnen aus einem dunklen Seitenzugang in die Höhle getrieben wurden. Als sie im dämmrigen Licht, das die bioluminszenten Anhaftungen der Wände hier unten verbreiteten, der Gefahr gewahr wurden, in der sie schwebten, drängten sie sich zusammen und versuchten zu entkommen. Die Drohnen schnappten nach ihnen, bissen zu und drängten sie in die Mitte der Höhle, wo der Horrorlobster auf seinem Podest herumrollte, um sich ihnen zu nähern. Dabei öffneten sich im Halsbereich die Panzerplatten und ein faltiger Sack wurde sichtbar, der sich oben öffnete und schloss. Speichel troff auf den Boden herab und sammelte sich in streng riechenden Pfützen.
Die armdicken Tentakel, die ebenfalls am Hals- beziehungsweise Schulterbereich verankert waren, schnellten vor und griffen nach den in Todesangst hysterisch kreischenden Menschen. Nach und nach zogen sie die entkräfteten Gestalten an den sich immer wieder öffnenden Schlund heran. Über dieser Fressluke von der Größe eines Dachfensters wackelte der kleine, menschenähnliche Kopf hin und her. Diese Szene betrachtend, konnte man meinen, dass – wenn es überhaupt einen Gott gab – der Schöpfer sich längst von diesem Planeten abgewandt hatte.
Was man hier unten in den verlassenen Stollen der alten Kohlegruben zu sehen bekam, ließ sich nicht einmal mehr mit dem Begriff der absoluten Abscheulichkeit treffend beschreiben. Und wer das sah, würde niemals die Gelegenheit bekommen, es jemandem mitzuteilen. Hier endete das Leben der Menschen – auf die eine oder andere Weise. Wobei jene, die von den Nephilim gefressen wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar noch das gnädigere Schicksal ereilte; wobei gnädig hier wirklich ein ausgesprochen relativer Begriff war.
Subjektiv empfanden das die Opfer des Torg Abila wohl nicht so, denn sie schrien ihre grenzenlose Furcht und ihren Schmerz gellend heraus, wenn sich die rasiermesserscharfen Zähne der zahlreichen Saugnäpfe an den Tentakeln in die Haut der Todgeweihten gruben. Einen Körper nach dem anderen riss Torg Abila mit den Fangarmen zu sich heran und stopfte ihn in seinen Schlund, der sich zu einem gewaltigen Kropf auswuchs und die Chitinplatten am Hals weit auseinanderdrückte. Durch die – im Vergleich zum Rest des Körpers – dünne, dehnbare Haut dieses Verdauungssackes konnte man die toten Leiber sehen, die in einer ätzenden Säure aufgelöst und vom Körper des Untoten beinahe vollständig verwertet wurden.
Der gewaltige Nephilim hatte sechs Menschen verschlungen, als sein Appetit langsam verebbte. Ein telepathischer Hinweis an seine Untergebenen veranlasste, dass sich diese wie eine wilde Horde auf die verbliebenen Menschen stürzten. Menschenfleisch und warmes Blut waren für die niederen Ränge in der Nephilim-Hierarchie etwas Besonderes, denn nicht selten mussten die Drohnen sich mit minderwertigem, kaltem Walker-Fleisch begnügen.
Während der unförmige Koloss seinen Nahrungszugang verdaute, schaffte er sich Platz im Gekröse. Torg Abila hob den Hinterleib an und eine der Bauchplatten öffnete einen Spalt im Aftersegment. Er entlud einen immensen Haufen von Exkrementen auf den Boden. Der Gestank in der riesigen Höhle wurde – zumindest für menschliche Geruchssinne – unerträglich. Arbeiterdrohnen eilten herbei und begannen, große Teile des breiigen Haufens fortzutragen. Sie nutzten den Dung als Futter für die Insektenlarven, aus denen die Breipampe gemacht wurde, mit der sie die Menschen versorgten, um diesen wertvollen Bestand am Leben zu erhalten. Der Hive benötigte stets Nachschub an Fleisch, und so hatte Torg Abila die Drohnen angewiesen, die Menschen in den Kavernen mit eiweißhaltigem Nahrungsbrei zu füttern. Etwa ein Viertel des Haufens wurde von anderen Drohnen aufgenommen und an die Wände der Halle geschmiert, denn die biolumineszenten Pilze und Bakterien, die das Gewölbe durch ihr fahles Licht ein wenig erhellten, siedelten auf den Ausscheidungen des Nephilim.
4. Juli im zweiunddreißigsten Baktun (III)
»Scheiße!«
»Was ist los, Radeon?«, fragte Runa besorgt.
»Ach nichts, ich hab mich bloß mit dem Zurrband in den Finger geschnitten.«
Radeon Waldeck kam, am Daumen lutschend, in die Jurte. Er hatte die Zurrbänder draußen nachgezogen und eine kleine Nachlässigkeit mit einer Schnittwunde bezahlt. Bereits seit dem frühen Morgen wütete rund um Neo Colonia und in den angrenzenden Gebieten ein intensiver Sandsturm, der einem das Fleisch von den Knochen nagen konnte, schneller und gründlicher als eine Horde Zeds.
Seit die Kinder in den Süden aufgebrochen waren, stürzte Radeon sich förmlich in die Arbeit. Er erfüllte mittlerweile die Funktion des Anführers im Castlegate-Bunker und zeichnete als Erster der Freelancer dieser Gruppe für den reibungslosen Ablauf in der Gemeinschaft verantwortlich. In dieser Funktion verbrachte er mit der Wartung der technischen Anlagen viel Zeit unter der Erde. Er konnte oftmals nicht zum Schlafen in die Jurte kommen, die Runa sich vor langer Zeit als ihre Heimstatt auserkoren hatte.
Nur in Bedrohungslagen, zum Beispiel bei Zed-Angriffen, suchte auch Runa den Schutz des Bunkers. Sie nahm es ihrem Mann nicht übel, dass er sich so sehr in seine Arbeit vertiefte. Zumal seine Gruppe auf ihn zählte und sich darauf verließ, dass er alles in seiner Macht Stehende tat, um den Menschen im Bunker das Überleben zu ermöglichen. Auch wenn der Megablister durchzog – die gewaltige Todeswolke, die mit DOR-Strahlung immer wieder die Wüste sterilisierte –, stieg Runa in den Bunker hinab. Er war mit speziellen technischen Einrichtungen versehen, welche die relativ kurzlebige DOR-Strahlung tief in die Grundwasserschichten ableiteten, wo sie neutralisiert wurde.
Ansonsten liebte Runa es, die Tage in ihrer Jurte zu verbringen, dem Rascheln des Sandes auf den großen Barchan-Dünen der näheren Umgebung zu lauschen und am Geräusch zu erkennen, wie hoch der Kamm der Düne war und wie steil ihre Flanken abfielen. In dieser entvölkerten Welt, deren Bewohner von den Infizierten gefressen oder von der DOR-Strahlung der Blister dahingerafft worden waren, herrschte eine Stille, die jedes natürliche Geräusch zu Lärm werden ließ.
Tagsüber gab es Zeiten, in denen Runa die gut getarnte Jurte nicht verlassen konnte, denn in bestimmten Abständen überflogen die Augen des Klerus – die von der Kirche genutzten Satelliten vergangener Tage – das Gebiet, in dem der Bunker lag. Niemand wusste genau, inwieweit die Kleriker Zugriff auf diese Maschinen hatten, die unbeirrt von der apokalyptischen Situation auf der Erdoberfläche ihren Dienst versahen, und in welcher Auflösung ihnen die Bilder zur Verfügung standen. Radeon wusste allerdings, dass sie die Augen nutzen konnten, um hier draußen zu sehen.
In den Zeiten, wenn die Augen am Himmel standen, gab Runa sich der Meditation hin oder arbeitete an der Inneneinrichtung ihrer Behausung, die ausgesprochen verspielt mit Liebe zum Detail eingerichtet war. Von Zeit zu Zeit unternahm sie ausgedehnte Exkursionen – Spaziergänge, wie sie die Expeditionen nannte – und sammelte aus verschütteten Ruinen Artefakte einer untergegangenen Welt, die sie selbst schon nicht mehr erlebt hatte. Allerdings hatte sie in Rennes-le-Château die ersten sieben Jahre ihrer Kindheit verbracht. Dort in der Bergfestung hatte es damals in einem begrenzten Rahmen so etwas wie Normalität gegeben, sofern man angesichts der Ereignisse einer Zombieapokalypse überhaupt davon sprechen konnte.
Runa versuchte gelegentlich, sich diese Tage der relativ unbeschwerten Kindheit zurückzuholen, die sie mit ihrer Mutter Birte in der Wagenburg auf dem Kirchenvorplatz hatte verbringen dürfen. Sie sammelte in den Ruinen Haushaltsgegenstände, Nippes, Textilien (die Jurte war inzwischen mit nicht wenigen chinesischen Seidenteppichen ausgekleidet), Werkzeuge, Waffen und vielerlei unterschiedlichen Krempel, der ihr gefiel oder nützlich war. Sogar ein stattliches Eckchen mit Textilblumen und hübschen Schnitzereien gab es in Runas Behausung, außerdem einige Bücher sowie Stifte, mit denen sie die Stützen für das Zeltdach verzierte.
Sie fühlte sich wohl in ihrem unkonventionellen, aber gemütlichen Zuhause, das sie hegte und pflegte. Runa fand, dass die Jurte sie repräsentierte, ein äußeres Ich quasi, ein Raum, in dem sie sich selbst wiederfinden konnte, wenn die Erinnerungen zu schwer wogen und drohten, sie zu erdrücken. Dann setzte sie sich mitten in den fast runden Raum und ließ den Blick über ihre Artefakte einer untergegangenen Zivilisation schweifen.
Sie hatte in den letzten Baktunen – die bei ihr immer noch Jahre hießen – furchtbare Dinge erlebt. Man hatte sie geschlagen, gedemütigt, eingesperrt, ihr das Kind genommen. All dies und der Versuch, sie in einer Zed-Arena hinzurichten, hatten ihr durchaus zugesetzt, auch wenn sie das möglichst nicht zeigte. Nicht mal ihr Gatte wusste, wie es wirklich um sie stand. Sie wandte sich Radeon zu und streckte ihm die Hand entgegen.
»Zeig mal her. Ist die Wunde tief?«, fragte sie.
»Nein, nicht wirklich, nur schmerzhaft. Der Wind hat mir die Leine aus der Hand gerissen.«
»Ich kann dir etwas Reiki geben.«
Anfänglich hatte Radeon über diese merkwürdige Behandlungsmethode geschmunzelt. Für einen Ingenieur war das esoterischer Mummenschanz. Doch von Zeit zu Zeit nutzte er das Angebot seiner Frau, und er fühlte sich danach wirklich besser. Die Zeiten, in denen er sich über esoterische oder magische Dinge hemmungslos lustig gemacht hatte, waren seit dem Tag vorbei, an dem Runa ihn mitgenommen hatte auf eine telepathische Reise ins weit entfernte Königsberg, wo er seine Tochter hatte sehen können. Ebenfalls niemals vergessen würde er die furchtbaren Bilder aus diesem Höhlenlabyrinth, in welchem bestialische Kreaturen Menschen gefangen hielten. Runa hatte ihm auch diese Bilder durch eine Art gedanklicher Verbindung gezeigt, etwas, das Radeon davor niemals für möglich gehalten hätte.
»Ja, das wäre schön. Was riecht hier so gut?«
»Ich habe bei meinem letzten Spaziergang Zimtrinde gefunden und sie mit Rieselgras gekocht. Mit etwas Algenpulver versetzt gab das einen guten Gewürz-Chai. Möchtest du?«
Radeon nickte. Runa rührte das Getränk mit einem Bambusquirl auf, schenkte ihnen Tee in hohe tönerne Becher ein und stellte diese auf das Tischchen bei den ledernen Sitzkissen. Sie nickte ihrem Mann zu und Radeon setzt sich neben sie. Dann nahm sie seine verletzte Hand in die ihre und strich mit der anderen in geringem Abstand darüber. Er verspürte ein leichtes Kribbeln, und es war ihm, als ließe der Schmerz ein wenig nach.
Nach einigen Minuten ließ Runa seine Hand los und reichte ihm einen der beiden Becher. Das Getränk schmeckte leicht scharf, aber durchaus angenehm würzig und sogar süß.
»Hast du etwas von den Kindern gehört?«, fragte Radeon, wobei gehört wohl eine unzureichende Bezeichnung für Runas übersinnliche Fähigkeiten darstellte. Aber er wusste nicht, wie er diese Form der Wahrnehmung sonst nennen sollte, also griff er auf seinen bekannten Wortschatz zurück.
»Nicht direkt«, antwortete sie etwas gedehnt, »aber ich taste vorsichtig den Äther ab, und ich kann keine negativen Schwingungen von ihnen wahrnehmen.«
An der Art, wie sie an ihrer Kleidung zupfte, erkannte Radeon, dass sie ihn gerade belog.
»Sag mir bitte die Wahrheit, Liebes«, sagte er. »Es ist mein Recht zu erfahren, was los ist. Es sind auch meine Kinder.«
Runa schluckte. Es beunruhigte sie, dass ihr Gatte sie dermaßen gut kannte. Andererseits, nach beinahe drei Jahrzehnten, die sie nun schon miteinander liiert waren, wohl auch kein Wunder.
»Natürlich«, stimmte sie zu, »du hast recht, Radeon. Ich wollte dir gegenüber nicht ungebührlich sein, es war nur, weil …«
»… du mal wieder nicht wolltest, dass ich mir Sorgen mache.«
»Ja. Es sind schwierige Zeiten, Radeon, schwierig für uns alle.«
Er nickte.
»Also?«, hakte er nach.
Runa druckste etwas herum, antwortete aber dann schließlich.
»Ich konnte eine sehr starke Erschütterung des Äthers feststellen. Ich vermute, Xiunas Kräfte haben sich zu voller Stärke entfaltet. Genaues konnte ich nicht aufnehmen, sie schirmt sich sehr stark ab.«
»Na ja«, gab Radeon mit geschürzter Unterlippe zurück, »wenn ich allerdings bedenke, dass sie – wie weit, eintausend Kilometer? – von uns weg ist, dann finde ich es schon beachtlich. Obwohl … als sie sich in dieser Ordensburg befand, war sie auch nicht dichter dran, oder?«
»Die Erschütterung war gewaltig. Viel intensiver als beim ersten Erwachen«, berichtete Runa mit dünner Stimme, wie es Radeon von seiner starken Partnerin überhaupt nicht kannte.
»Du meinst, als sie auf diesem Schiff mit … warte … das ist doch wohl nicht dein Ernst, Runa? Sag mir, dass ich gerade etwas völlig Absurdes denke, ja? Bitte!«
Sie sah ihn stumm an. Tränen liefen über ihre Wangen. Das hatte Radeon schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen.
»Soll ich dir etwas sagen?«, fuhr er sie unvermittelt in einer Härte an, die er an sich selbst nicht kannte. »Dein Teil der Familie ist so was von bizarr, dass ich manchmal echte Schwierigkeiten habe, es zu begreifen. Ich weiß, ich weiß: Goldener Pfad und so. Aber … keine Ahnung … könnt ihr euch nicht einfach ein paar abgefahrene Drogen einwerfen, um euer Magieding zu wecken? Muss das denn so passieren? Das sind unsere Kinder da draußen, Runa, unsere Kinder! Ich fasse es nicht!«
Sie sah ihm das Ausmaß seines Zorns an, was sie nur noch mehr betrübte. Dann platzte es aus ihr heraus:
»Ja glaubst du denn, ich würde das zulassen, wenn ich es verhindern könnte, Radeon? Glaubst du ernsthaft, mir gefällt es, wie sich die Dinge entwickeln? Vergiss nicht, dass ich diese Kinder geboren habe, und zwar unter Umständen, die niemand von deinem Teil der Familie auch nur annähernd ausgehalten hätte! Du hast ja keine Ahnung, was ich durchgestanden habe und was unsere Tochter durchgestanden hat und was es für mich bedeutet hat, sie fast zwanzig Jahre lang leiden sehen zu müssen, ohne ihr helfen zu können! Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, sich selbst vor dem eigenen Kind verleugnen zu müssen, nur um diese verschissene Menschheit eines Tages zu retten. Du warst ja immer nur damit beschäftigt, aus deinem Stammhalter einen guten Ingenieur zu machen, damit er dir als Kommandant dieses Haufens von feigen Bunkerratten folgen kann. So wie du deinem Vater gefolgt bist, ohne je wirklich etwas verändert zu haben! Unsere Tochter soll das Überleben der Menschheit sicherstellen, und unser Sohn hat getan, was zu tun war, um sie zu unterstützen. Ich als seine Mutter bin sehr stolz auf Terion, dass er dieses Opfer gebracht hat, obwohl es ihn hätte töten können.«
Radeon war völlig baff. So hatte er seine geliebte Frau noch nie erlebt. Ihre sonst eher traurigen Augen sprühten förmlich Funken, die ganze Art, wie sich plötzlich ihre Körperhaltung veränderte, signalisierte pure Angriffslust. Er zog es vor, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, und stellte seinen Teebecher weg.
»Sicher«, erwiderte er betont gleichmütig, »du hast recht. Ich weiß nichts davon, wie sehr ihr gelitten habt und warum das nötig ist, damit meine feigen Bunkerratten überleben können. Ich werde mich jetzt darum kümmern, die Wasserkreisläufe in Gang zu halten, denn das ist alles, was ich zum Überleben der Menschheit beitragen kann. Du entschuldigst mich jetzt …«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, erhob er sich und verließ die Jurte schnellen Schrittes. Runa starrte ihm nach.
»Radeon …«, flüsterte sie und die Tränenbäche auf ihren Wangen hinterließen dunkle Streifen auf der staubigen Haut. Runa war todunglücklich. Sie hatte ihren Mann nicht so anfahren wollen, aber er hatte sie durch seine Vorwürfe derart in Rage gebracht, dass ihr die Situation entglitten war. Sie schalt sich selbst dafür, ihre Emotionen in diesem entscheidenden Moment nicht vollständig unter Kontrolle gehabt zu haben. Das entsprach überhaupt nicht ihrer Art; wahrscheinlich war sie nur unzufrieden mit ihrer eigenen Handlungsweise. Irgendwie hatte er ja recht, denn sie opferte ihre eigenen Kinder für diese höhere Sache, den Goldenen Pfad, den sie selbst zu beschreiten nicht imstande gewesen war. Ihr war allerdings auch klar, dass sie selbst diese Kraft, die Xiuna entwickelte, niemals hätte aufbringen können. Ebenso wenig wie ihre eigene Mutter die Kraft hatte aufbringen können, ihre Tochter, die kleine siebenjährige Runa, beschützen zu können. Die spirituelle Macht, derer es bedurfte, einen so mächtigen Feind wie den Nephilim zu besiegen, baute sich kaskadierend auf, und mit jeder Generation konzentrierte sich mehr von dieser Macht in einer der Frauen aus dem Hause Radler beziehungsweise Waldeck. Sie hatte es nicht fertiggebracht, Radeon das begreiflich zu machen, und das betrübte Runa sehr. Doch was sollte sie tun? Hinterherlaufen und es ihm, der die Notwendigkeit der Sache nicht verstehen wollte, wieder und wieder erklären und dafür Worte finden, die es eigentlich nicht gab? Ein aussichtsloses Unterfangen. Sie schenkte sich noch einen Becher Tee ein und setzte sich in einer Position in die Mitte der Jurte, die es ihr erlaubte, tief in sich selbst und in den Äther hineinzuhören.
*