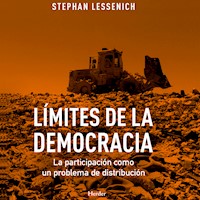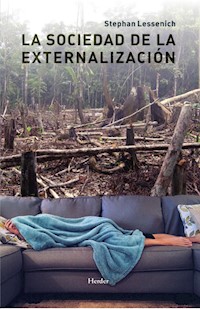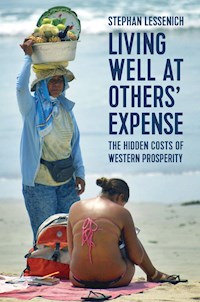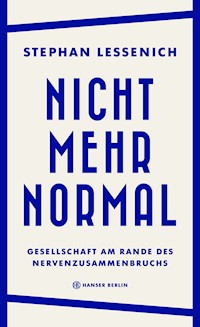
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie geht eine Gesellschaft damit um, dass nichts mehr normal ist? Der Soziologe Stephan Lessenich zeigt, wie die Überwindung einer überholten Normalität gelingen kann.
Die Welt befindet sich im permanenten Ausnahmezustand. Nach der Finanzkrise, der Migrationskrise, der Klimakrise hat die Coronakrise den Alltag jedes Einzelnen erfasst. Und dann gibt es auch noch Krieg in Europa. Es wird immer deutlicher, dass die bewährte Normalität, nach der wir uns sehnen, nicht mehr zurückkehren wird. Stattdessen herrscht allgemeine Verunsicherung. Mit klarem Blick analysiert Stephan Lessenich die Reaktion unserer Gesellschaft auf ihre Krisen und denkt über die Fragen nach, die uns alle umtreiben. Wenn die alte Normalität nicht mehr trägt und auch nicht mehr zu ertragen ist: Was tritt dann an ihre Stelle? Und welche Dynamiken setzen ein, wenn gesellschaftliche Mehrheiten sich an Gewissheiten klammern, die immer drängender in Frage gestellt werden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wie geht eine Gesellschaft damit um, dass nichts mehr normal ist? Der Soziologe Stephan Lessenich zeigt, wie die Überwindung einer überholten Normalität gelingen kann.Die Welt befindet sich im permanenten Ausnahmezustand. Nach der Finanzkrise, der Migrationskrise, der Klimakrise hat die Coronakrise den Alltag jedes Einzelnen erfasst. Und dann gibt es auch noch Krieg in Europa. Es wird immer deutlicher, dass die bewährte Normalität, nach der wir uns sehnen, nicht mehr zurückkehren wird. Stattdessen herrscht allgemeine Verunsicherung. Mit klarem Blick analysiert Stephan Lessenich die Reaktion unserer Gesellschaft auf ihre Krisen und denkt über die Fragen nach, die uns alle umtreiben. Wenn die alte Normalität nicht mehr trägt und auch nicht mehr zu ertragen ist: Was tritt dann an ihre Stelle? Und welche Dynamiken setzen ein, wenn gesellschaftliche Mehrheiten sich an Gewissheiten klammern, die immer drängender in Frage gestellt werden?
Stephan Lessenich
Nicht mehr normal
Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs
Hanser Berlin
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Stephan Lessenich
Impressum
Inhalt
Einleitung — Nicht mehr normal
Kapitel 1 — Der Wille zur Normalität
Kapitel 2 — Die folgenreiche Folgenlosigkeit der Finanzkrise
Kapitel 3 — Deutschland — eine Einwanderungs-gesellschaft?
Kapitel 4 — Fossile Mentalitäten
Kapitel 5 — Wer hat Angst vor der »Identitätspolitik«?
Schluss — Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs
Dank
Nachweise
Literatur
SPIEGEL: Herr Professor, vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung …
Adorno: Mir nicht.
Theodor W. Adorno im SPIEGEL-Interview, 4. Mai 1969
Einleitung
Nicht mehr normal
»Was ich dann so fühle / ist nicht mehr normal«
Ideal, Blaue Augen (1980)
»Deutschland. Aber normal.« Was auch immer man von der AfD, ihrem Programm und ihrem Personal, halten mag: Der Werbeslogan, mit dem die selbsternannte Alternative zum etablierten Parteiensystem in den Bundestagswahlkampf 2021 zog, stellte die Politmarketingkünste der Konkurrenz eindeutig in den Schatten. Die eingängige, in jedem Sinne plakative Sentenz dürfte nicht nur den Nerv der eigenen Gefolgschaft getroffen haben. Sie lässt sich auch als treffender Ausdruck eines Lebensgefühls lesen, das weit über ein als deutschnational sich verstehendes oder als »rechtspopulistisch« etikettiertes Sozialmilieu hinausreicht.
»Normal« war ja tatsächlich kaum mehr etwas, seitdem Anfang 2020 die Pandemie jäh Einzug gehalten hatte in die Lebensrealität nicht nur der Deutschen, sondern gleich der ganzen Welt. Mit jedem Tag, den das, wie es zunächst technisch hieß, »neuartige SARS-Cov2-Virus« sich als das Gegenteil einer Eintagsfliege erwies, gewann ein unheimliches Gefühl an Kraft: dass sich hier eine grundlegende Veränderung ankündigt, eine neue gesellschaftliche Ära anbricht, in der das bislang Gewohnte außergewöhnlich wird, das zuvor Selbstverständliche fraglich — und gerade das Anormale normal. Gaststättenbesuche und Reisen, Freunde einladen und die Oma umarmen, einen Betriebsausflug machen, selbst das alltägliche In-die-Schule-Gehen: Was »einst«, also noch bis vor wenigen Tagen, völlig normal gewesen war, erschien plötzlich wie eine Erinnerung an eine andere, irreal gewordene Welt. Und ebenso plötzlich, wahrhaftig von einem Tag auf den anderen, passierten Dinge, die man eigentlich nur als Szenen aus Katastrophenfilmen kannte: verwaiste Straßen und leergekaufte Regale, tägliche Warnmeldungen und nächtliche Ausgangssperren, eine untergründige Nervosität und allgemeine Verunsicherung.
Unheimlich war das alles, weil die normalitätserschütternden Folgen pandemischer Verhältnisse uns »damals«, im Jahr 2020, weniger unbekannt als vielmehr fremd gewesen waren: Probleme vergangener Generationen und ferner Regionen. Entsprechend erinnerten Expert:innen nun an die Geschichte der Pest (und Camus wurde kurzzeitig zum Verkaufsschlager) oder verwiesen darauf, dass krisengewohnte Bevölkerungen ärmerer Weltgegenden eine besondere Fähigkeit zur »Resilienz« (das wissenschaftlich-politische Zauberwort der Zeit) entwickelt hätten. Das Fremde am Pandemiegeschehen wurde dadurch befördert, dass das Virus aus China kam, und seine Ver-Fremdung weiter gesteigert, indem fleißig an — besagten Katastrophenfilmen nachempfundenen — Schauergeschichten von geheimen Laboren und perversen Essgewohnheiten im Fernen Osten gestrickt wurde.
Im Kern aber lag, und liegt auch heute noch, das Befremdliche am Coronavirus in seiner Eigenschaft als ungebetener Besucher, als Eindringling in eine geordnete, zumindest rückwirkend als heil wahrgenommene Welt. Seit Georg Simmel kennt die Soziologie die Figur des »Fremden«, seines Zeichens sozialer Konterpart zum »Gast«: Während dieser kommt und aber auch wieder geht, was ihm, so er sich anständig benimmt, das Wohlwollen und die Wertschätzung der Gastgebenden bereitet, kommt jener, um zu bleiben — ungefragt, unangekündigt, ungewollt. Genau deswegen ist der Fremde oder, entpersonalisiert und allgemeiner gefasst, das Fremde, auf eine Weise immer auch das Unerhörte, Unvermessene, Unverschämte. Niemand hatte das Virus eingeladen, auf einmal war es da, machte sich breit, setzte sich fest — und nun werden wir es irgendwie nicht mehr los. Unheimlich.
Kein Wunder, dass aus der unheimlich-befremdenden Ausbreitung des »Chinese virus« (Donald Trump) der intensive gesellschaftliche Wunsch nach Normalität erwuchs: Die Sehnsucht nach Wiederherstellung des Alten und Gewohnten, nach Rückkehr der eigenen, heimeligen, anheimelnden Welt. Und noch weniger verwundert ein solcher, den Status quo ante herbeiwünschender, retrosozialer Impuls, wenn man in Rechnung stellt, dass es ja nicht nur »Corona« ist, das uns nach dem gewohnten Leben trachtet. Vielmehr häufen sich inzwischen die Erschütterungen des vor kurzem noch Selbstverständlichen: Mittlerweile soll man nicht mehr rauchen, weil es tödlich, nicht mehr fliegen, weil es umweltschädlich, und kein Fleisch mehr essen, weil es beides ist. Wo man auch hinkommt, überall nur noch Gesundheitsapostel, Menschenfreunde und Klimabewegte; wo man auch hinsieht, alles Mahner und Veganer. Und natürlich Mahner*innen und Veganer*innen, Gendersternchen allenthalben: Nicht einmal reden darf man mehr, wie einem der (männlich-weiße) Schnabel gewachsen ist. Oder?
Deutschland — nicht mehr normal: Wie polemisch, verbissen, ja verrückt — ver-rückt — die Auseinandersetzung mit dem Veränderten von mehr oder weniger »querdenkerischer« Seite auch geführt werden mag, im Kern trügt das Gefühl ja nicht. Im Kern spüren es auch all jene, die man keineswegs zum harten Kern der Coronaleugner, Klimaskeptiker oder Fremdenfeinde zählen würde: Die alte Normalität hat Risse bekommen, sie ist brüchig geworden. Und alle Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt uns: Sie wird nicht wiederkommen. An immer mehr Fronten verschieben sich die Grenzen des Sag- und Machbaren, immer mehr Gruppen meinen öffentlich mitreden zu müssen und politisch mitgestalten zu können. Die alte Normalität, an der keineswegs nur die Alten hängen, ist im Entschwinden begriffen, das Neue ist here to stay (die Inflation der Anglizismen eingeschlossen). Aber noch ist dieses Neue selbst nicht normal, noch erschüttert es nur die alten Selbstverständlichkeiten und Selbstverständnisse — was Tür und Tor öffnet für unkalkulierbare gesellschaftliche Reaktionen.
Um diesen Zusammenhang soll es hier gehen: Darum, wie eine Gesellschaft damit umgeht, dass ihr die bisherige Normalität abhandenkommt. Welche sozialen Dynamiken werden in Gang gesetzt, wenn gesellschaftliche Mehrheiten an Gewissheiten festhalten, die immer häufiger und drängender in Frage gestellt werden? Wie verhält sich die postnormale Gesellschaft zu der allmählich wachsenden Einsicht, dass das, was ihr bislang normal zu sein schien, bei genauerem Hinsehen nicht mehr normal war? Und dazu, dass ein back to normal nicht nur äußerst unwahrscheinlich ist, sondern geradezu irrsinnig wäre? Wenn aber die alte Normalität nicht mehr trägt und sie auch nicht mehr zu ertragen ist: Was kann dann an ihre Stelle treten? Und wie damit umgehen, dass der Wille zur Normalität in der Erfahrung seiner Realitätsfremdheit wohl kaum erlahmen wird, sondern sich im Zweifel aggressiv seinen Weg bahnen dürfte?
Die »Corona-Krise« war nur die vorerst letzte, für uns in Deutschland alltagspraktisch spürbarste Erschütterung des gewohnten Laufs der Dinge — ehe dann auch noch das Äußerste, weithin Unvorstellbare geschah, nämlich Krieg in Europa. Im Verein mit den hinter uns liegenden, zeitweilig unter ihr verborgenen, aber selbst keineswegs ausgestandenen Krisenphänomenen des frühen 21. Jahrhunderts — »Finanzkrise«, »Migrationskrise«, »Klimakrise« — hat die Pandemie den Nerv einer Gesellschaft getroffen, die daraufhin Nerven zeigt. Man kann den von dieser untergründigen Nervosität getragenen Aufstieg von Affektpolitiken beklagen, man kann das leicht entzündliche Erregungspotenzial aktueller gesellschaftspolitischer Debatten mit Sorge beobachten. Klar aber dürfte doch sein, dass genau dies, nämlich die starke Gefühlsaufladung des auch nur noch gewohnheitshalber so genannten öffentlichen »Diskurses«, ein deutliches Zeichen für das ist, was gesellschaftlich auf dem Spiel steht: die Fortschreibung oder aber Überwindung einer Normalität, die nicht vergehen will.
Kapitel 1
Der Wille zur Normalität
Was heißt hier eigentlich »normal«?
Das ist doch nicht mehr normal: Im alltäglichen Sprachgebrauch stellt die Anrufung von vermeintlicher »Normalität« eine immer wieder und wie selbstverständlich in Anspruch genommene Ein- und Ausgrenzungskategorie dar. Mit der Zuordnung eines Phänomens oder Problems zur Sphäre wahlweise des Normalen oder aber nicht (mehr) Normalen wird nicht nur eine — gewissermaßen harmlose — Unterscheidung zweier Welten vorgenommen. Vielmehr steckt in der Trennung des einen vom anderen zugleich immer auch ein Urteil über den Charakter beider Welten: Hier die des Gängigen, Geläufigen, Gewohnten — dort die des von all dem Abweichenden. Die beurteilende Scheidung des Gewöhnlichen vom Außergewöhnlichen zieht Grenzen der sozialen Akzeptanz oder, mehr noch, solche der Akzeptierbarkeit: Was auf der Seite des Normalen verortet wird, wird gebilligt oder ist zumindest hinzunehmen; auf der anderen Seite der Unterscheidung hingegen, jener des Anormalen, findet sich all das wieder, was den Urteilenden als unangemessen und inakzeptabel gilt.
Die Rede vom »nicht mehr« Normalen zeigt allerdings gleichzeitig an, dass in Fragen von Normalität keineswegs nur eindeutige, binäre Unterscheidungen gängig sind: so oder so, 1 oder 0, ganz oder gar nicht. Die soziale Konstruktion von Normalität bewegt sich vielmehr in Grauzonen, in den uneindeutigen Zwischenwelten des noch oder aber schon nicht mehr als normal gelten Könnenden. Beispiele hierfür — und für die damit verbundene Verschiebung von Normalitätsstandards über die Zeit — finden sich im gesellschaftlichen Leben zuhauf. Über eine lange Zeit hinweg galt etwa die Konstruktion der biologisch-sozialen Einheit von Vater-Mutter-Kind als »Normalfamilie«, ja als Familie schlechthin, wohingegen andere, von diesem Modell abweichende Formen der intimen Vergemeinschaftung gar nicht erst den Familienstatus für sich reklamieren konnten.
Bekanntermaßen haben sich die Normalitätsstandards in diesem Feld zuletzt deutlich verschoben, als Familie sind mittlerweile auch verschiedenste alternative Sozialkonstellationen akzeptiert, von dem aus aufgelösten Vorgängerbeziehungen neu zusammengestellten Patchwork-Haushalt bis zur adoptionsrechtlich- oder reproduktionstechnisch erweiterten gleichgeschlechtlichen Paarbeziehung. Allerdings verweist gerade dieses Feld auch auf die Trägheit von gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen: Ganz normal ist es auch heute noch nicht, wenn nebenan Felix und Tobias mit ihrem kleinen Töchterchen wohnen. Und bei Kaffee und Kuchen ist es eben doch immer noch der Rede wert, wenn Scheidungskinder sechs oder mehr Personen als Opa und Oma bezeichnen können. Bei aller rechtlichen Liberalisierung und sozialen Diversifizierung: normal ist etwas anderes, nach wie vor.
Ganz ähnlich verhält es sich im Feld der Integration — selbst eine der zentralen Normalisierungskategorien unserer Zeit — von Migrant:innen. Was hierzulande in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als das Normalste der Welt gilt, nämlich ein stinknormaler Mittelschichtshaushalt (ganz stereotyp vorgestellt: Ehepaar mit Hund und Kindern, bzw. umgekehrt, beide berufstätig, im gepflegten Reihenhaus lebend, er fährt den Mittelklassewagen, sie den kleinen Kompakten), wird umgehend zur Besonderheit, wenn besagter Haushalt zufällig aus Bosnien oder Portugal stammt. Uğur Şahin und Özlem Türeci, das Gründerpaar der Firma BioNTech, werden in der politisch-medialen Öffentlichkeit nicht nur als das gehandelt, was sie eigentlich sind — ganz normale medizinische Unternehmer:innen, die mit einem äußerst marktgängigen Produkt unverhofft ein Vermögen gemacht haben —, sondern auch und vor allem als Vorzeigeintegrierte ausgestellt, die ihren Millionen türkischen oder türkischstämmigen Mitbürger:innen als Vorbild dafür dienen sollen, was in Deutschland normal sein oder wenigstens werden könnte.
Auf besondere Weise aufschlussreich für die soziale Praxis der Konstruktion von Normalität ist eine im Jahr 2016, auf dem Höhepunkt der sogenannten »Flüchtlingskrise«, von dem damaligen CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer öffentlich getätigte Aussage: »Das Schlimmste« für die deutsche Ausländerpolitik sei »ein fußballspielender ministrierender Senegalese« — denn nach drei Jahren im Land »wirst Du [den] nie wieder abschieben«. Interessant an dieser Sentenz ist weniger die offenherzige Enttarnung der offiziellen Integrationsrhetorik durch den skandalumwitterten späteren Bundesverkehrsminister: Abgelehnte Asylbewerber werden nicht geduldet, selbst wenn sie so tun, als seien sie »einer von uns«.1 Bemerkenswert ist aber vor allem die rhetorische Doppelbewegung: Mit nur zwei Worten kann das Bild der jedenfalls in Scheuers niederbayerischen Heimat normalen Lebensführung männlicher Jugendlicher gezeichnet werden — nur um diese idyllisch anmutende Normalitätsvorstellung wiederum durch den Verweis auf ein einziges Merkmal, nämlich das der nicht-deutschen (oder hier wohl maßgeblich: afrikanischen) Herkunft des jungen Mannes, wirkungsvoll zu durchkreuzen. Insofern darf — oder muss — man vermuten, dass aus des CSU-Politikers Mund irgendwie auch Volkes Stimme sprach. Ob integriert oder nicht, ob Asylbewerber, Arbeitsmigrant oder Staatsbürgerin: Schwarze in Deutschland, schwarze Deutsche (ein Oxymoron!) gar — das ist doch nicht mehr normal!?
Die so reformulierte Redewendung, mit Ausrufe- und Fragezeichen versehen, führt zu einer weiteren Dimension der gesellschaftlich gepflegten Normalitätssemantik. Denn der fragende Ausruf ist als Ausdruck von Irritation und Vergewisserungsbedarf zu verstehen, als mehr oder weniger händeringende Suche nach identitärer Bestätigung, zumindest aber nach argumentativer Bestärkung — in diesem Falle all jener, die sich selbst als »normale Deutsche« begreifen. Ganz allgemein aber ist damit eine wesentliche soziale Funktion des Anormalitätsurteils (oder auch nur -verdachts) angesprochen: Hier soll Ungewissheit bearbeitet, Verunsicherung abgebaut werden. Plötzlich begegnen wir Senegalesen, die ministrieren, und Türkinnen, die reüssieren? Auf einmal werden Lesben Mütter und Schwule Gesundheitsminister? Was, bitte schön, soll daran denn normal sein? Wo in Herrgottsnamen leben wir eigentlich?
»Normalität« zwischen Regel und Regelmäßigkeit
Genau: In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Diese Frage, die »ganz normale« Leute ganz alltäglich umtreibt, und zwar in aller Regel ohne jeden definitorischen oder gar wissenschaftlichen Anspruch, ist eine — vielleicht sogar die — zentrale Frage der Soziologie. Und jenseits der zahlreich kursierenden, historisch-konkreten Begriffsbestimmungen (»Risikogesellschaft«, »Wissensgesellschaft«, »Externalisierungsgesellschaft« u. v.a. m.) einerseits, unterschiedlicher soziologischer Glaubensbekenntnisse andererseits, wird man ganz generell sagen können: Wir leben in einer Gesellschaft der Regeln und Regelmäßigkeiten, des Normierten und Normalen.
Die beiden damit benannten Dimensionen des Normalitätsbegriffs gilt es hier von Anfang an analytisch auseinanderzuhalten: »Normal« im soziologischen Sinne ist das, was von einem bestehenden Regelsystem als Richtschnur des sozialen Handelns vorgegeben, mithin als Norm gesetzt wird; »normal« ist zugleich aber auch das, was sich in einem sozialen Zusammenhang faktisch als regelmäßige Gestalt des Handelns etabliert hat, sei es nun aufgrund der Wirksamkeit besagten Regelsystems oder aber gerade auch in Opposition zu ihm. Das gesellschaftlich Normale hat folglich immer eine normative und eine empirische Seite: Was die Leute tun sollen ist das eine, was sie tatsächlich tun das andere.
Beides kann durchaus übereinstimmen: Wenn sich die Handelnden an die vorgegebene Norm halten, dann »gilt« diese faktisch erst und bestimmt die Normalität des Handelns, dann haben die z.B. gesetzlich etablierten Regeln tatsächlich eine normative, handlungsnormierende Wirkung. Allerdings muss dies nicht unbedingt der Fall sein. Denn ebenso gut ist es möglich, dass das von den Akteuren regelmäßig an den Tag gelegte und also in diesem empirischen Sinne normale Handeln an der — und sei es per Gesetz verordneten — Norm vorbeigeht oder ihr sogar zuwiderläuft. In diesem Fall hat die Norm, oder genauer die normgebende Instanz, ein Problem, nämlich das ihres verbreitet missachteten Geltungsanspruchs; ein Problem, auf das entweder mit einer verschärften Kontrolle der Regelbefolgung oder aber mit einer Anpassung der Regel an das tatsächliche Handeln reagiert werden muss. Ob nun aber durch Rigidität oder Flexibilität: So oder so gilt es, die normative und die empirische Dimension des Normalen in Übereinstimmung miteinander zu bringen, um gesellschaftliche Stabilität und soziale Ordnung (wieder) herzustellen.
Verwirrend? Ohne Frage. Zur Illustration des kompliziert anmutenden Verhältnisses von Norm und Normalität mag ein Beispiel aus einem allseits bekannten Feld der Lebenswelt dienen, nämlich dem der Arbeit. Die Norm (Regel) in dieser Gesellschaft ist es, dass jeder Mensch seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit bestreitet. Das Bibelwort »wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen« ist auf eine unergründliche Weise tief und fest verankert sowohl im gesellschaftlichen Wertehaushalt wie auch im gesetzestechnischen Regelwerk. Konkret bedeutet die Arbeitsnorm für die überwiegende Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder, dass sie lohnabhängig sind, sprich existenziell abhängig davon, dass sie eine Arbeit (»Beschäftigung«) finden, für die sie als Vergütung arbeitgeberseitige Lohnzahlungen erhalten. Normalerweise sichern die Leute also ihre Existenz durch Einkommen aus »unselbstständiger« Arbeit (und wenn nicht aus eigener, so aus der von mindestens einem anderen erwerbstätigen Mitglied der Haushaltsgemeinschaft).
Allfällige Ausnahmen bestätigen nur diese Regel, oder genauer: die gesellschaftliche Normalität (Regelmäßigkeit). Denn selbstverständlich gibt es auch Selbstständige, die ohne Chefetage oder Dienstherrn auskommen und auf eigene Rechnung arbeiten — so wie es durchaus auch Personen gibt, die von ihrem ererbten, erspekulierten oder sonst wie zustande gekommenen Vermögen zehren bzw., als »Unternehmer«, von ihren laufenden Einkünften aus der Beschäftigung Lohnabhängiger. Doch solch lohnarbeitsunabhängige Formen der Lebensführung sind in dieser Gesellschaft gerade nicht der Regelfall. Mehr noch: Sie markieren Positionen, die genauer besehen alles andere als unabhängig sind, sondern selbst existenziell von der regulären Existenzweise lohnabhängiger Beschäftigung abhängen. In ihrem Ausnahmestatus — als Betriebseigner, Kapitalbesitzer oder Immobilieneigentümer — leben diese sozialen Positionen regelrecht von der Normalität der Lohnarbeitsgesellschaft, sprich davon, dass andere für sie — ihre Unternehmensrendite, Kapitaleinkünfte, Mieteinnahmen — arbeiten.2
Diese gesellschaftliche Normalität lohnabhängiger Arbeit hat nach dem Zweiten Weltkrieg in den reichen Industriegesellschaften Westeuropas, und gerade in der Bundesrepublik, die institutionalisierte Form als »Normalarbeitsverhältnis« angenommen — erneut ein treffendes Beispiel für das gesellschaftliche Zusammenwirken von Norm und Normalität.3 Denn das abgekürzt so genannte NAV bezeichnet auf der einen Seite einen Satz rechtlicher Regularien, die in einer konkreten historischen Phase gesellschaftlicher Entwicklung eine arbeits- und sozialpolitische Beschäftigungsnorm etablierten, die das Sein-Sollen von Arbeitsverhältnissen bestimmte: Als normal in diesem Sinne galt jene Form der Arbeit, die in einem Betrieb, für (nur) einen Arbeitgeber, tariflich entlohnt, zeitlich unbefristet und mit vollem Stundenpensum erbracht wurde und dabei unter dem Schutz gesetzlicher Regulierung und gewerkschaftlicher Organisation stand. Dass diese Norm in den 1960er und 70er Jahren die Normalität tatsächlicher Arbeitsverausgabung prägte, also das reale Sein abhängiger Beschäftigung, steht außer Zweifel: Sei es, dass real existierende Arbeitsverhältnisse dieser Norm auch wirklich entsprachen, sei es, dass Abweichungen von der Norm als solche verstanden, thematisiert und politisiert werden konnten. Auch wo die Norm nicht galt, oder aber zwar gelten sollte, faktisch aber nicht realisiert wurde, wirkte sie als Maßstab des Rechten und Richtigen bzw. als Bezugspunkt der Problematisierung falscher — nicht normkonformer, »atypischer« — Arbeit.
Zu den Eigentümlichkeiten des Normalarbeitsverhältnisses — und generell von gesellschaftlichen Normalitätskonstruktionen — gehört, dass die Norm (oder Regel) stabiler und gesicherter Erwerbstätigkeit zu keiner Zeit auch die Normalität (Regelmäßigkeit) von Arbeit in dieser Gesellschaft darstellte. Nicht nur genügten selbst in den Hochzeiten von wirtschaftlichem Wachstum und wohlfahrtsstaatlicher Expansion viele Arbeitsverhältnisse nicht den normativ gesetzten Standards: Beschäftigung außerhalb der industriellen Kernsektoren und der betrieblichen Kernbelegschaften, im Dienstleistungsgewerbe und in den schwach oder gar nicht regulierten Grauzonen des Arbeitsmarktes — im Klartext: ein großer Teil weiblicher und migrantischer Lohnarbeit — war und blieb jenseits des Einzugsbereichs und unterhalb des Radars arbeitspolitischer Normsetzungen und -vorstellungen. Die Norm war das eine, die Normalität das andere.
Und dies eben nicht erst seitdem all das einsetzte, was seit den 1980er Jahren wahlweise als Deregulierung des Arbeitsmarktes, Flexibilisierung der Arbeit, Prekarisierung der Beschäftigung oder Um- bzw. Abbau des Wohlfahrtsstaates bezeichnet wird. Vor dem Hintergrund der regulativen Idee und rechtlichen Konstruktion von Arbeit als »Normalarbeit« lässt sich durchaus behaupten, dass Arbeit in diesem Lande im empirischen Sinne niemals normal war, also zu keinem historischen Zeitpunkt die Arbeitsrealität gesellschaftlicher Mehrheiten bestimmte. Zumal dann, wenn man nicht nur die von der Norm abweichenden Verhältnisse lohnabhängiger Beschäftigung in die Rechnung mit einbezieht, sondern auch alle Formen und Felder jener Sorge- und Reproduktionsarbeiten, die immer schon außerhalb des Arbeitsmarktes und damit auch außerhalb beschäftigungspolitischer Normierungsansprüche geleistet worden sind: die soziale Welt abseits von normaler oder auch nicht-normaler Erwerbsarbeit, »das andere« des Normalarbeitsverhältnisses, das dessen zeitweise mehr oder weniger weitreichende Verbreitung überhaupt erst ermöglichte (und bis heute in dieser Ermöglichungsfunktion kaum zur Kenntnis genommen wird).
Am Fall der Lohnarbeit wird eine weitere Eigentümlichkeit gesellschaftlicher Normalitätskonstruktion deutlich: Das vermeintlich Normale wird im Grunde immer nur und erst dann gesellschaftlich zum Thema, wenn es im Entschwinden begriffen ist oder zu sein scheint — und wenn sich zumindest relativ machtvolle soziale Gruppen von dem drohenden Verlust erfahrener oder empfundener Normalität unmittelbar betroffen fühlen. Dass etwa das Normalarbeitsverhältnis als analytischer Begriff erst in den 1990er Jahren zu Prominenz fand, und dies gewissermaßen in der Form von sozialwissenschaftlichen Nachrufen auf eine verloren gehende soziale Errungenschaft, mag repräsentativ für den Sachverhalt stehen, dass das gesellschaftlich Normale sich typischerweise erst im Nachhinein offenbart, und zwar als Phantomschmerz, der durch den Verlust von etwas entsteht, das gewesen ist oder angeblich gewesen sein soll. Und typischerweise wird dieser Schmerz angesichts der Abwesenheit des vormals Normalen von jenen artikuliert, die sich als dessen Repräsentanten und Nutznießer empfinden.
Nicht zufällig fällt die »Entdeckung« des Normalarbeitsverhältnisses und seines sich ankündigenden Endes genau in jene gesellschaftshistorische Zeit, als die tatsächlich »normal« lohnabhängig Beschäftigten — vornehmlich männlichen Geschlechts — von arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Tendenzen einer Entnormalisierung ihrer Lebensführung erreicht wurden: von der zunehmenden zeit-räumlichen Flexibilisierung über die schwindende Tarifbindung der Arbeit bis hin zum Bruch mit dem Prinzip der Lebensstandardsicherung in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Denormalisierungserfahrungen, die für sehr viele Menschen außerhalb der Zonen stabiler Arbeitsmarktintegration, außerhalb des Arbeitsmarktes und auch außerhalb der nationalen Sozialordnung westlicher Lohnarbeitsgesellschaften immer schon normal waren.
Normalisierung als Produktion von Normalität
Am Beispiel der arbeitsgesellschaftlichen Dimension des sozialen Lebens wird deutlich, dass die Frage nach der Normalität im Grunde genommen eine dreifache ist. Erstens: Welche Regelsetzungen werden in einer Gesellschaft vorgenommen, was soll normal sein — wie soll z.B. typischerweise gearbeitet werden? Zweitens: Welche Regelmäßigkeiten stellen sich in einer Gesellschaft ein, was