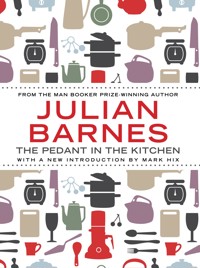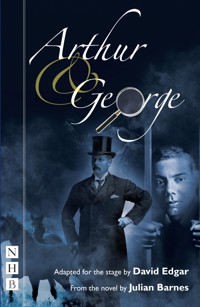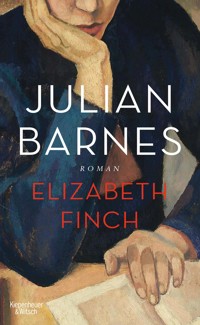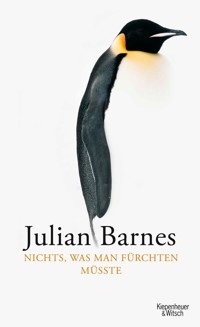
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.« Julian Barnes, brillant, geistreich und witzig wie immer, setzt sich mit einem Thema auseinander, das jeden ein Leben lang betrifft. Es geht um unsere Sterblichkeit, um provozierende Gedanken und aufrüttelnde Ereignisse auf dem Weg zum Ende. Eigentlich müsste man sich nicht davor fürchten. Wirklich nicht?»Was soll eigentlich dieses ganze Tamtam um den Tod?«, fragt nüchtern Julian Barnes' Mutter. Aber ihr Sohn kann deshalb oft nicht schlafen: »Ich erklärte ihr, mir widerstrebe eben der Gedanke daran.« Die Angst vor dem Tod treibt Julian Barnes seit seiner Jugend um, immer wieder umkreist er das Thema in seiner ganzen Unerbittlichkeit und Hoffnungslosigkeit, denn er glaubt nicht an Gott, vermisst ihn aber. Neugierig und um Erkenntnis bemüht sucht er in der Kunst und in der Literatur, in den Naturwissenschaften und in der Musik nach Antworten. Doch Julian Barnes ist Romancier, deshalb entwickelt er seine Gedanken aus Personen und Handlung. Und so erzählt er auch die anekdotenreiche Geschichte vom Leben und Sterben der sehr britisch zugeknöpften Familie Barnes – von den originellen Großeltern, der herrischen Mutter, dem in sich gekehrten Vater, dem besserwisserischen Philosophen-Bruder und dem belesenen, an den Künsten interessierten Julian. Seine wahren Angehörigen und Vorfahren sind für Julian Barnes allerdings nicht die Mitglieder einer englischen Lehrerfamilie, sondern Schriftsteller und Komponisten wie Stendhal, Flaubert und Strawinsky. Mit ihnen erörtert er scharfsinnig und verängstigt, flapsig und tröstlich, ironisch und ernsthaft die Angst vor dem Treppenlift, den Blick in den Abgrund, das Wie und Wo und Wann. Und hat ein aufregendes Buch geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Julian Barnes
Nichts, was man fürchten müsste
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, geboren 1946, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen zunächst als Lexikograf, dann als Journalist. Barnes, der zahlreiche europäische und amerikanische Literaturpreise erhielt, hat ein umfangreiches erzählerisches Werk vorgelegt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.«
Julian Barnes, brillant, geistreich und witzig wie immer, setzt sich mit einem Thema auseinander, das jeden ein Leben lang betrifft. Es geht um unsere Sterblichkeit, um provozierende Gedanken und aufrüttelnde Ereignisse auf dem Weg zum Ende. Eigentlich müsste man sich nicht davor fürchten. Wirklich nicht?
»Was soll eigentlich dieses ganze Tamtam um den Tod?«, fragt nüchtern Julian Barnes’ Mutter. Aber ihr Sohn kann deshalb oft nicht schlafen: »Ich erklärte ihr, mir widerstrebe eben der Gedanke daran.« Die Angst vor dem Tod treibt Julian Barnes seit seiner Jugend um, immer wieder umkreist er das Thema in seiner ganzen Unerbittlichkeit und Hoffnungslosigkeit, denn er glaubt nicht an Gott, vermisst ihn aber. Neugierig und um Erkenntnis bemüht sucht er in der Kunst und in der Literatur, in den Naturwissenschaften und in der Musik nach Antworten. Doch Julian Barnes ist Romancier, deshalb entwickelt er seine Gedanken aus Personen und Handlung. Und so erzählt er auch die anekdotenreiche Geschichte vom Leben und Sterben der sehr britisch zugeknöpften Familie Barnes – von den originellen Großeltern, der herrischen Mutter, dem in sich gekehrten Vater, dem besserwisserischen Philosophen-Bruder und dem belesenen, an den Künsten interessierten Julian. Seine wahren Angehörigen und Vorfahren sind für Julian Barnes allerdings nicht die Mitglieder einer englischen Lehrerfamilie, sondern Schriftsteller und Komponisten wie Stendhal, Flaubert und Strawinsky. Mit ihnen erörtert er scharfsinnig und verängstigt, flapsig und tröstlich, ironisch und ernsthaft die Angst vor dem Treppenlift, den Blick in den Abgrund, das Wie und Wo und Wann. Und hat ein aufregendes Buch geschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Nichts, was man fürchten müsste
Ich glaube nicht an ...
Förderhinweis
Lesetipps
Für P.
Nichts, was man fürchten müsste
Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Das ist meine Antwort auf einschlägige Fragen. Ich habe meinen Bruder, der in Oxford, Genf und an der Sorbonne Philosophie gelehrt hat, um seine Meinung zu diesem Satz gebeten, ohne zu verraten, dass er von mir stammt. Er befand kurz und bündig: »Sentimentaler Quatsch.«
Am besten fange ich mit meiner Großmutter mütterlicherseits an, Nellie Louisa Scoltock, geborene Machin. Sie arbeitete als Lehrerin in Shropshire, bis sie meinen Großvater heiratete, Bert Scoltock. Nicht Bertram, nicht Albert, einfach nur Bert – so getauft, so genannt, so eingeäschert. Er war Rektor mit einem gewissen Faible für die Technik: stolzer Besitzer eines Motorrads mit Beiwagen, danach eines Lanchester, als Rentner dann Fahrer eines recht protzigen Triumph-Roadster-Sportwagens mit einer Dreiersitzbank vorn und zwei Schalensitzen bei geschlossenem Verdeck. Als ich meine Großeltern kennenlernte, waren sie bereits in den Süden gezogen, um ihrem einzigen Kind nahe zu sein. Großmutter hatte das Women’s Institute absolviert; sie kochte Obst ein, marinierte Gemüse, rupfte und briet die von Großvater aufgezogenen Hühner und Gänse. Sie war klein, zierlich und nach außen hin nachgiebig; im Alter waren ihre Gelenke geschwollen – den Ehering bekam sie nur mit Seife ab. Meine Großeltern hatten einen Kleiderschrank voll selbst gestrickter Jacken, wobei die von Grandpa oft ein maskulines Zopfmuster aufwiesen. Beide gingen regelmäßig zur Fußpflege und gehörten der Generation an, die sich auf zahnärztlichen Rat hin sämtliche Zähne auf einmal ziehen ließ. Das war damals ein gängiges Ritual, dieser Sprung von wackeligen Zähnen zur kompletten Keramik-Garnitur, zu bukkalem Schleifen und Klappern, gesellschaftlicher Peinlichkeit und einem sprudelnden Glas auf dem Nachttisch.
Der Wechsel von Zähnen zu Gebiss kam meinem Bruder und mir ebenso tiefgreifend wie anrüchig vor. Doch es hatte im Leben meiner Großmutter noch eine andere ungeheure Wende gegeben, die in ihrem Beisein nie erwähnt wurde. Nellie Louisa Machin, Tochter eines Arbeiters in einer Chemiefabrik, war im methodistischen Glauben erzogen worden, während die Scoltocks der Kirche von England angehörten. Als junge Frau verlor meine Großmutter plötzlich ihren Glauben und fand, der Familiensaga zufolge, prompt einen Ersatz: den Sozialismus. Ich habe keine Ahnung, wie stark ihr religiöser Glaube war und wie ihre Familie politisch dachte; ich weiß nur, dass sie einmal bei den Kommunalwahlen als Sozialistin antrat und verlor. Als ich sie in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kennenlernte, hatte sie sich schon zur Kommunistin gemausert. Sie muss eine der wenigen Rentnerinnen im gutbürgerlichen Buckinghamshire gewesen sein, die den Daily Worker abonniert hatten und – wie mein Bruder und ich uns beharrlich versicherten – etwas vom Haushaltsgeld abzweigten, um es dem Kampffonds der Zeitung zu spenden.
Ende der fünfziger Jahre kam es dann zum chinesisch-sowjetischen Schisma, und die Kommunisten der Welt mussten sich zwischen Moskau und Peking entscheiden. Den meisten Getreuen in Europa fiel die Wahl nicht schwer, auch nicht dem Daily Worker, der sich sein Geld wie auch seine Weisungen aus Moskau holte. Meine Großmutter, die zeit ihres Lebens nicht aus England herausgekommen war und in einer beschaulichen Bungalow-Welt lebte, schlug sich aus unbekannten Gründen auf die Seite der Chinesen. Blanker Eigennutz bewog mich, diese mysteriöse Entscheidung zu begrüßen, denn nun kam zum Worker noch die ketzerische Zeitschrift China Reconstructs hinzu, die per Post direkt aus dem fernen Kontinent angeliefert wurde. Die Briefmarken auf den gelblich braunen Umschlägen hob Grandma für mich auf. Diese Marken priesen gern industrielle Errungenschaften – Brücken, Staudämme, vom Fließband rollende Lastwagen – oder zeigten unterschiedliche Tauben in friedlichem Flug.
Mein Bruder war mir keine Konkurrenz bei diesen Gaben, denn einige Jahre zuvor war es in unserem Haus zu einem Briefmarkensammel-Schisma gekommen. Er hatte beschlossen, sich auf das Britische Empire zu spezialisieren. Um meine Eigenständigkeit zu behaupten, verkündete ich, mein Spezialgebiet sei nunmehr eine Kategorie, die ich – was mir nur logisch erschien – den Rest der Welt nannte. Diese Kategorie definierte sich allein durch das, was mein Bruder nicht sammelte. Ob dies ein Akt der Aggression, der Abwehr oder einfach ein pragmatischer Schritt war, habe ich vergessen. Ich weiß nur noch, dass er im Briefmarkenclub meiner Schule zu einigen bisweilen rätselhaften Gesprächen unter den eben erst den kurzen Hosen entwachsenen Philatelisten führte. »Na, Barnesy, was sammelst du denn?« – »Den Rest der Welt.«
Mein Großvater war ein Brylcreem-Mann, und der Schonbezug auf seinem Parker-Knoll-Sessel – mit hoher Rückenlehne und Seitenteilen, die zu einem Nickerchen einluden – diente nicht nur dekorativen Zwecken. Sein Haar war früher weiß geworden als das von Grandma; er hatte einen militärisch gestutzten Schnurrbart, eine Pfeife mit einem Stiel aus Metall und einen Tabaksbeutel, der seine Strickjackentasche ausbeulte. Außerdem trug er ein klobiges Hörgerät, ein weiterer Aspekt der Erwachsenenwelt – oder besser der Welt jenseits des Erwachsenenalters –, über den mein Bruder und ich uns gern lustig machten. »Wie bitte?«, schrien wir uns spöttisch an, die hohle Hand ans Ohr gelegt. Beide warteten wir gespannt auf den köstlichen Moment, da der Magen unserer Großmutter so laut knurrte, dass Grandpa aus seiner Taubheit aufschreckte und fragte: »Telefon, Ma?« Nach einem verlegenen Grunzen wandten sich dann beide wieder ihrer jeweiligen Zeitung zu. Grandpa in seinem männlichen Sessel, wo von Zeit zu Zeit sein Hörgerät piepte und seine Pfeife blubberte, wenn er daran zog, las kopfschüttelnd den Daily Express, der ihm eine Welt schilderte, in der Wahrheit und Gerechtigkeit beständig von der Roten Gefahr bedroht wurden. Grandmas Sessel – im roten Winkel – war weicher, femininer; dort studierte sie mit leiser Empörung ihren Daily Worker, der ihr eine Welt schilderte, in der eine überarbeitete Version von Wahrheit und Gerechtigkeit beständig von Kapitalismus und Imperialismus bedroht wurde.
Zu der Zeit beschränkte sich Grandpas Religionsausübung schon darauf, dass er sich im Fernsehen Songs of Praise anschaute. Er machte allerlei Holzarbeiten und werkelte im Garten; er baute seinen Tabak selbst an und trocknete ihn auf dem Boden über der Garage, wo er auch Dahlienknollen und alte, mit einem haarigen Bindfaden verschnürte Ausgaben des Daily Express aufbewahrte. Mein Bruder war sein Lieblingsenkel; er brachte ihm bei, wie man einen Meißel schärft, und vermachte ihm seinen Kasten mit Zimmermannswerkzeugen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mir etwas beigebracht (oder vermacht) hätte, aber ich durfte einmal zuschauen, wie er im Geräteschuppen ein Huhn schlachtete. Er klemmte sich das Tier unter den Arm, streichelte es, bis es ruhig war, und legte es mit dem Hals in eine an den Türpfosten geschraubte Wringmaschine aus grünem Eisen. Als er den Hebel herunterdrückte, packte er den Vogel bei dessen letzten Zuckungen noch fester.
Mein Bruder durfte nicht nur zuschauen, sondern auch aktiv mitmachen. Grandpa ließ ihn mehrmals auf den Hebel drücken, während er selbst das Tier festhielt. Doch unsere Erinnerungen an das Schlachten im Schuppen gehen bis zur Unvereinbarkeit auseinander. Bei mir drehte die Maschine dem Huhn lediglich den Hals um; bei meinem Bruder war es eine Guillotine im Kleinformat. »Ich sehe deutlich ein Körbchen unter der Klinge vor mir. Ich sehe (nicht ganz so deutlich) vor mir, wie der Kopf herunterfällt, wie etwas (nicht viel) Blut fließt, Grandpa den enthaupteten Vogel auf den Boden stellt und dieser noch eine Weile herumläuft …« Ist meine Erinnerung gereinigt oder seine von Filmen über die Französische Revolution infiziert? So oder so hat Grandpa meinen Bruder besser mit dem Tod – und seinen schmutzigen Begleitumständen – bekannt gemacht als mich. »Weißt du noch, wie Grandpa vor Weihnachten die Gänse schlachtete?« (Nein, weiß ich nicht.) »Er scheuchte die ausgewählte Gans immer mit einer Brechstange im Stall herum. Wenn er das Tier schließlich hatte, warf er es obendrein noch zu Boden, setzte ihm die Brechstange an den Hals und zerrte an seinem Kopf.«
Mein Bruder erinnert sich auch an ein Ritual – bei dem ich nie zugegen war –, das er die Lesung der Tagebücher nannte. Grandma und Grandpa führten getrennte Tagebücher und unterhielten sich abends manchmal damit, dass sie sich gegenseitig vorlasen, was sie vor Jahren in der und der Woche aufgeschrieben hatten. Die Eintragungen zeichneten sich offenbar durch erhebliche Banalität, aber auch Widersprüchlichkeit aus. Grandpa: »Freitag. Im Garten gearbeitet. Kartoffeln gepflanzt.« Grandma: »Unsinn. ›Den ganzen Tag Regen. Zu nass, um im Garten zu arbeiten.‹«
Außerdem erinnert sich mein Bruder, dass er einmal, als er noch ganz klein war, in Grandpas Garten ging und sämtliche Zwiebeln herauszog. Grandpa schlug ihn, bis mein Bruder heulte, wurde dann ungewöhnlich bleich, beichtete alles unserer Mutter und schwor, niemals wieder die Hand gegen ein Kind zu erheben. In Wirklichkeit kann sich mein Bruder an nichts dergleichen erinnern – weder an die Zwiebeln noch an die Schläge. Er hat die Geschichte nur mehrfach von unserer Mutter erzählt bekommen. Und würde er sich doch daran erinnern, wäre er wahrscheinlich skeptisch. Als Philosoph meint er, Erinnerungen seien oft falsch, »und das in einem Maße, dass man nach dem kartesianischen Prinzip des faulen Apfels keiner Erinnerung trauen darf, es sei denn, sie wird durch äußerliche Beweise gestützt«. Ich bin entweder gutgläubiger oder neige mehr zum Selbstbetrug, darum fahre ich fort, als wären meine Erinnerungen allesamt wahr.
Unsere Mutter wurde Kathleen Mabel getauft. Sie hasste den Namen Mabel und beschwerte sich bei Grandpa darüber, der zur Erklärung angab, er habe einmal »ein sehr nettes Mädel namens Mabel« gekannt. Ob ihr religiöser Glaube stärker oder schwächer wurde, weiß ich nicht, obwohl ich ihr Gebetbuch besitze, das zusammen mit den Hymns Ancient and Modern in weiches braunes Wildleder gebunden ist. In jedem Band steht mit erstaunlich grüner Tinte ihr Name und das Datum »Dec:25th.1932.« Ihre Zeichensetzung finde ich bewundernswert: Zwei Punkte und ein Doppelpunkt, und der Punkt unter dem »th« sitzt exakt zwischen den beiden Buchstaben. So etwas gibt es heute nicht mehr.
In meiner Kindheit waren die üblichen drei Themen tabu: Religion, Politik und Sex. Als meine Mutter und ich später über dergleichen sprachen – das heißt über die ersten beiden Themen, das dritte stand niemals auf der Tagesordnung –, war ihre politische Einstellung erzkonservativ und wahrscheinlich immer gewesen. Was die Religion anging, so erklärte mir meine Mutter mit Bestimmtheit, bei ihrer Beerdigung wolle sie »nichts von diesem Brimborium« haben. Darum antwortete ich dann auf die Frage des Bestattungsunternehmers, ob er die »religiösen Symbole« aus dem Krematorium entfernen solle, dass sie das vermutlich gewünscht hätte.
Dieser Irrealis der Vergangenheit ist meinem Bruder übrigens höchst suspekt. Beim Warten auf den Beginn der Trauerfeier hatten wir nicht gerade einen Streit – das hätte gegen jede Familientradition verstoßen –, aber doch einen Wortwechsel, der deutlich machte, dass mein Denken nach meinen eigenen Maßstäben durchaus rational sein mag, nach seinen aber auf schwachen Füßen steht. Als unsere Mutter durch ihren ersten Schlaganfall behindert war, überließ sie ihr Auto bereitwillig ihrer Enkelin C. Der Wagen war der letzte einer langen Reihe von Renaults, einer Marke, der sie über vier Jahrzehnte hinweg frankophil die Treue gehalten hatte. Nun stand ich mit meinem Bruder auf dem Parkplatz des Krematoriums und hielt Ausschau nach der vertrauten französischen Silhouette, doch dann fuhr meine Nichte am Steuer des Wagens ihres Freundes R. vor. Ich bemerkte, gewiss ganz freundlich: »Ich glaube, Mutter hätte sich gewünscht, dass C. in ihrem Auto gekommen wäre.« Mein Bruder nahm ebenso freundlich Anstoß an der Logik dieses Satzes. Er erklärte, es gebe Wünsche von Verstorbenen, d.h. das, was sich ein Mensch, der nunmehr tot sei, einst gewünscht habe; und es gebe hypothetische Wünsche, d.h. das, was sich ein Mensch möglicherweise gewünscht hätte. »Was Mutter sich gewünscht hätte« sei eine Mischung von beidem: der hypothetische Wunsch einer Verstorbenen und daher doppelt fragwürdig. »Wir können nur tun, was wir selbst wünschen«, erläuterte er; sich im mütterlich Hypothetischen zu ergehen sei ebenso irrational, als wenn er sich nun mit seinen eigenen Wünschen aus der Vergangenheit befasste. Als Antwort trug ich vor, wir sollten uns bemühen, das zu tun, was sie sich gewünscht hätte, weil wir a) auf jeden Fall etwas tun müssten, und dieses Etwas bedeute (es sei denn, wir wollten ihre Leiche einfach im Garten verwesen lassen) eine Entscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten, und weil wir b) hofften, dass andere, wenn wir selbst einmal tot wären, das tun würden, was wir unsererseits uns gewünscht hätten.
Ich sehe meinen Bruder nicht oft und bin daher häufig verblüfft über seine Gedankengänge; dabei ist er ein sehr aufrichtiger Mensch. Als ich ihn nach der Trauerfeier nach London zurückfuhr, hatten wir eine – für mich – noch eigenartigere Auseinandersetzung über meine Nichte und deren Freund. Die beiden waren schon lange zusammen, doch in einer schwierigen Phase hatte C. ein Verhältnis mit einem anderen Mann angefangen. Diesen Eindringling hatten mein Bruder und seine Frau von Anfang an nicht gemocht, und meine Schwägerin hatte ihn offenbar gleich in den ersten zehn Minuten »zur Schnecke gemacht«. Ich fragte nicht, wie sie das angestellt hatte. Stattdessen fragte ich: »Aber R. findet deinen Beifall?«
»Es ist nicht von Belang«, entgegnete mein Bruder, »ob R. meinen Beifall findet oder nicht.«
»Doch, es ist sehr wohl von Belang. Vielleicht will C. ja, dass er deinen Beifall findet.«
»Im Gegenteil, vielleicht will sie, dass er nicht meinen Beifall findet.«
»Aber so oder so ist es für sie von Belang, ob er deinen Beifall findet oder nicht.«
Darüber dachte er eine Weile nach. »Du hast recht«, sagte er dann.
Vielleicht sieht man an diesen Gesprächen, dass er der ältere Bruder ist.
Meine Mutter hatte sich nicht darüber geäußert, welche Musik bei ihrer Beerdigung gespielt werden sollte. Ich wählte den ersten Satz von Mozarts Klaviersonate in Es-Dur, KV 282 – eins dieser langen, erhabenen Stücke, bei denen die Musik fortwährend hin und her wogt und selbst an den munteren Stellen feierlich wirkt. Das Stück schien sich statt der auf dem Cover angegebenen sieben Minuten etwa eine Viertelstunde hinzuziehen, und mitunter fragte ich mich, ob das nun wieder eine mozartische Wiederholung war oder ob der CD-Player des Krematoriums einen Sprung zurück gemacht hatte. Im Vorjahr war ich Gast bei Desert Island Discs gewesen und hatte mir dort das Requiem von Mozart gewünscht. Hinterher rief meine Mutter an und sprach mich darauf an, dass ich mich in der Sendung als Agnostiker bezeichnet hatte. Sie meinte, das habe Dad auch immer getan – sie hingegen sei Atheistin. Bei ihr klang das so, als sei Agnostizismus eine windelweiche liberale Haltung, während der Atheismus sich ehrlich zur knallharten Realität des freien Marktes bekannte. »Was soll eigentlich dieses ganze Tamtam um den Tod?«, fuhr sie fort. Ich erklärte, mir widerstrebe eben der Gedanke daran. »Du bist genau wie dein Vater«, entgegnete sie. »Vielleicht liegt es an deinem Alter. Wenn du mal so alt bist wie ich, macht dir das nicht mehr viel aus. Ich habe mein Leben sowieso hinter mir. Und denk nur ans Mittelalter – da war die Lebenserwartung wirklich gering. Heute werden wir siebzig, achtzig, neunzig Jahre alt … Die Leute glauben nur an die Religion, weil sie Angst vor dem Tod haben.« Das war typisch für meine Mutter: hellsichtig, schulmeisterlich und keine andere Meinung gelten lassend. Mutters dominierende Stellung in der Familie und ihre Gewissheiten über die ganze Welt ließen mir als Kind alles schön klar erscheinen, als Jugendlicher fand ich ihre Ansichten repressiv und als Erwachsener nervtötend monoton.
Nach der Einäscherung holte ich mir meine Mozart-CD von dem »Organisten« zurück, der, wie ich unwillkürlich dachte, heutzutage wohl sein volles Honorar dafür bekommt, dass er eine CD einschiebt, eine einzige Nummer abspielt und die Scheibe wieder herausholt. Mein Vater war fünf Jahre zuvor in einem anderen Krematorium verbrannt worden, und dort hatte sich der Organist sein Geld mit ehrlicher Arbeit und einem Stück von Bach verdient. War es das, »was er sich gewünscht hätte«? Ich glaube, er hätte nichts dagegen gehabt; er war ein sanfter, liberal gesinnter Mensch, der sich nicht sonderlich für Musik interessierte. Auf dem Gebiet fügte er sich, wie auf den meisten anderen, seiner Frau – nicht ohne die eine oder andere leise ironische Nebenbemerkung. Wie er sich kleidete, in welchem Haus sie wohnten, welches Auto sie fuhren – das bestimmte sie. In meiner gnadenlosen Jugendzeit hielt ich ihn für einen Schwächling. Später fand ich ihn unterwürfig. Noch später war er für mich jemand, der sich seine eigenen Gedanken machte, aber keine Lust hatte, sich dafür zu streiten.
Als ich das erste Mal mit meiner Familie in die Kirche ging – anlässlich der Hochzeit einer Kusine –, beobachtete ich verwundert, wie Dad auf der Kirchenbank niederkniete und dann eine Hand über Stirn und Augen legte. Wo hat er das denn her, fragte ich mich, bevor ich eine halbherzig nachahmende fromme Geste machte und dabei verstohlen durch die Finger blinzelte. In solchen Momenten staunt man über die eigenen Eltern – nicht, weil man etwas Neues über sie erfahren hätte, sondern weil man einen weiteren weißen Fleck der Unwissenheit entdeckt hat. Wollte mein Vater nur höflich sein? Meinte er, wenn er sich einfach auf seinen Platz fallen ließe, würde man ihn für einen Atheisten à la Shelley halten? Ich habe keine Ahnung.
Er starb einen modernen Tod: im Krankenhaus, ohne seine Familie, in den letzten Momenten von einer Krankenschwester begleitet, und das Monate – ja, Jahre, nachdem die medizinische Wissenschaft sein Leben so weit verlängert hatte, dass die Bedingungen, unter denen es ihm gewährt wurde, recht bescheiden waren. Meine Mutter hatte ihn noch wenige Tage vorher besucht, erkrankte dann aber an einer Gürtelrose. Bei diesem letzten Besuch war er sehr verwirrt gewesen. Sie hatte ihn – auf ihre typische Art – gefragt: »Weißt du, wer ich bin? Das letzte Mal wusstest du nämlich nicht, wen du vor dir hast.« Mein Vater hatte – ebenso typisch – erwidert: »Ich glaube, du bist meine Frau.«
Ich fuhr meine Mutter ins Krankenhaus, wo man uns eine schwarze Plastiktüte und eine beige Reisetasche aushändigte. Sie durchsuchte beide sehr schnell und wusste genau, was dem Krankenhaus überlassen werden – oder zumindest dort bleiben – sollte. Es sei doch schade, meinte sie, dass er nie die großen braunen Hausschuhe mit den bequemen Klettverschlüssen getragen habe, die sie ihm erst vor ein paar Wochen gekauft hatte; die nahm sie unerklärlicherweise – für mich unerklärlicherweise – mit nach Hause. Sie äußerte sich entsetzt über die Möglichkeit, man könne sie fragen, ob sie Dads Leiche sehen wolle. Bei Grandpas Tod, erzählte sie mir, sei Grandma »zu nichts nütze« gewesen und habe alles ihr überlassen. Im Krankenhaus habe sich dann aber ein ehefrauliches oder atavistisches Bedürfnis gemeldet, und Grandma habe unbedingt die Leiche ihres Mannes sehen wollen. Meine Mutter versuchte ihr das auszureden, doch sie ließ sich nicht beirren. Sie wurden in eine Art Leichenschauraum geführt, wo man ihnen Grandpa zeigte. Grandma drehte sich zu ihrer Tochter um und sagte: »Sieht er nicht entsetzlich aus?«
Als meine Mutter starb, fragte der Bestattungsunternehmer aus einem Nachbardorf, ob die Familie sie noch einmal sehen wolle. Ich sagte Ja, mein Bruder Nein. Genauer gesagt lautete seine Antwort, als ich ihm die Frage telefonisch weitergab: »Um Gottes willen, nein. In der Hinsicht halte ich es mit Plato.« Mir war der betreffende Text nicht sofort präsent. »Was sagt Plato denn?«, fragte ich. »Dass ihm nichts daran liegt, sich Leichen anzusehen.« Als ich dann allein in dem Bestattungsinstitut erschien – das nichts als ein rückwärtiger Anbau an einem Abschleppunternehmen war –, erklärte der Inhaber entschuldigend: »Im Moment ist sie leider nur im Hinterzimmer.« Ich sah ihn verständnislos an, und er erläuterte: »Sie liegt auf einer Rollbahre.« Ohne nachzudenken, antwortete ich: »Ach, sie hat nie viel Wert auf Formalitäten gelegt«, obwohl ich nicht behaupten konnte, ich hätte gewusst, was sie unter diesen Umständen gewollt oder nicht gewollt hätte.
Sie lag in einem kleinen, sauberen Raum mit einem Kreuz an der Wand, tatsächlich auf einer Rollbahre und mit dem Hinterkopf zu mir, was mir beim Eintreten eine unmittelbare Konfrontation von Angesicht zu Angesicht ersparte. Sie wirkte, nun ja, ausgesprochen tot: Die Augen geschlossen, der Mund leicht geöffnet, links etwas mehr als rechts, was genau ihre Art war – in aller Regel hatte sie eine Zigarette im rechten Mundwinkel und sprach aus dem linken, bis die Asche zu gefährlicher Länge anwuchs. Ich versuchte, mir ihren Bewusstseinszustand, wenn man es denn so nennen kann, im Moment des Hinscheidens vorzustellen. Dieser Zustand war einige Wochen nach ihrer Verlegung aus dem Krankenhaus in ein Pflegeheim eingetreten. Da war sie schon mehr oder weniger dement, eine Demenz, die wechselnde Formen annahm: Einmal wähnte sie, noch alles unter Kontrolle zu haben, und stauchte die Schwestern unablässig wegen imaginärer Fehler zusammen; dann wieder gestand sie sich ihre Hilflosigkeit ein, wurde wieder zum Kind, alle ihre verstorbenen Angehörigen waren noch am Leben, und die letzte Bemerkung ihrer Mutter oder Großmutter war von höchstem Belang. Vor ihrer Demenz hatte ich mich oft dabei ertappt, dass ich während ihrer solipsistischen Monologe einfach abschaltete; dann wurde meine Mutter plötzlich auf schmerzliche Weise interessant. Ich fragte mich ständig, wo das alles herkam und wie das Gehirn diese falsche Realität zustande brachte. Auch konnte ich es ihr jetzt nicht mehr übel nehmen, dass sie nur über sich selbst reden wollte.
Man sagte mir, im Moment ihres Todes seien zwei Schwestern bei ihr gewesen, die sie eben auf die andere Seite drehen wollten, und da sei sie einfach »verschieden«. Ich stelle mir gern vor – weil es typisch für sie gewesen wäre, und ein Mensch sollte so sterben, wie er gelebt hat –, dass ihr letzter Gedanke ihr selbst galt und etwas in der Art war wie: »Na los, bring es hinter dich.« Aber das ist eine sentimentale Vorstellung – was sie sich gewünscht hätte (besser gesagt, was ich mir für sie gewünscht hätte) –, und wenn sie überhaupt etwas dachte, bildete sie sich vielleicht ein, sie sei wieder ein fieberndes Kind und werde von zwei längst verstorbenen Verwandten auf die andere Seite gedreht.
Im Bestattungsinstitut berührte ich nun mehrmals ihre Wange und gab ihr dann einen Kuss auf den Haaransatz. War sie so kalt, weil sie in einer Kühlkammer gelegen hatte, oder sind Tote von Natur aus so kalt? Und nein, sie sah nicht entsetzlich aus. Sie war nicht überschminkt, und es hätte sie gefreut, dass ihre Haare glaubwürdig zurechtgemacht waren (»Natürlich färbe ich sie nicht«, hatte sie einmal vor der Frau meines Bruders geprahlt. »Das ist alles Natur.«). Der Wunsch, sie tot zu sehen, entsprang, das muss ich zugeben, eher schriftstellerischer Neugier als kindlichem Gefühl; doch nach all meiner verzweifelten Wut über sie musste auch anständig Abschied genommen werden. »Gut gemacht, Ma«, sagte ich leise zu ihr. Sie hatte das Sterben in der Tat »besser« bewältigt als mein Vater. Er hatte mehrere Schlaganfälle erlitten und dann über Jahre hinweg abgebaut; sie hatte den Weg vom ersten Anfall bis zum Tod alles in allem zügiger und schneller zurückgelegt. Als ich im Pflegeheim (heutzutage heißt das »Seniorenresidenz« – ein Ausdruck, bei dem ich mich immer frage, wie Pflegefälle wohl »residieren« können) die Tasche mit ihren Kleidern abholte, fand ich sie unerwartet schwer. Als Erstes entdeckte ich eine volle Flasche Harvey’s Bristol Cream darin und dann, in einer quadratischen Pappschachtel, eine unangetastete Geburtstagstorte, fertig gekauft von Freunden aus dem Dorf, die sie an ihrem letzten, dem zweiundachtzigsten Geburtstag besucht hatten.
Mein Vater war im selben Alter gestorben. Ich hatte immer geglaubt, sein Tod würde mich schwerer treffen, weil ich ihn mehr geliebt hatte, während ich meine Mutter bestenfalls zähneknirschend gernhaben konnte. Doch dann war es genau umgekehrt: Der Tod, den ich mir nicht so schwerwiegend vorgestellt hatte, erwies sich als komplizierter und bedrohlicher. Sein Tod war einfach nur sein Tod; ihr Tod war beider Tod. Und die anschließende Haushaltsauflösung wurde zu einer Exhumierung dessen, was wir als Familie waren – nicht, dass wir nach meinen ersten dreizehn oder vierzehn Lebensjahren noch wirklich eine Familie gewesen wären. Jetzt durchsuchte ich zum ersten Mal die Handtasche meiner Mutter. Von den üblichen Dingen abgesehen, war auch ein Ausschnitt aus dem Guardian darin mit einer Liste der fünfundzwanzig größten Cricket-Schlagmänner der Nachkriegszeit (dabei las sie den Guardian gar nicht) sowie ein Foto von Max, dem Hund – einem Golden Retriever –, den wir in unserer Kinderzeit hatten. Auf der Rückseite stand in einer mir unbekannten Handschrift: »Maxim: le chien«; das Bild musste Anfang der 1950er-Jahre von P., einem der französischen Assistenzlehrer meines Vaters, aufgenommen oder zumindest beschriftet worden sein.
P. kam aus Korsika, ein unbeschwerter Bursche mit der – wie meine Eltern fanden – typisch gallischen Eigenschaft, sein Monatsgehalt gleich nach Erhalt zu verpulvern. Er war für ein paar Tage zu uns gezogen, bis er eine eigene Unterkunft gefunden hatte, und blieb am Ende das ganze Jahr. Mein Bruder ging eines Morgens ins Bad und entdeckte dort diesen fremden Mann vor dem Rasierspiegel. »Wenn du weggehst«, erklärte ihm das schaumbedeckte Gesicht, »erzähle ich dir eine Geschichte von Mister Beezy-Weezy.« Mein Bruder ging weg, und wie sich herausstellte, kannte P. eine ganze Reihe von Abenteuern, die Mister Beezy-Weezy widerfahren waren und an die ich mich alle nicht mehr erinnern kann. P. hatte auch eine künstlerische Ader: Er bastelte Bahnhöfe aus Cornflakespackungen und schenkte meinen Eltern einmal – vielleicht anstelle der Miete – zwei kleine selbstgemalte Landschaften. Sie hingen meine gesamte Kindheit über an der Wand und erschienen mir unglaublich gelungen; allerdings wäre mir damals jede halbwegs gegenständliche Darstellung unglaublich gelungen erschienen.
Und Max war uns kurz nach dieser Aufnahme entweder weggelaufen oder – da wir uns nicht vorstellen konnten, dass er uns verlassen wollte – gestohlen worden; wo immer er abgeblieben war, er musste nun schon über vierzig Jahre tot sein. Mein Vater hätte zwar gern einen neuen Hund gehabt, doch meine Mutter wollte danach nie wieder einen.
Bei diesem familiären Hintergrund einer wässrigen Gläubigkeit in Kombination mit energischer Gottlosigkeit hätte ich im Zuge pubertärer Auflehnung wohl fromm werden können. Jedoch wurde weder der Agnostizismus meines Vaters noch der Atheismus meiner Mutter jemals klar formuliert, geschweige denn als vorbildlich hingestellt, sodass beides vielleicht keine Revolte wert war. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich vermutlich auch Jude werden können. Auf meiner Schule waren unter 900 Jungen etwa 150 Juden. Im Großen und Ganzen hatten sie den anderen sowohl im gesellschaftlichen Umgang als auch in ihrer Kleidung etwas voraus; sie trugen bessere Schuhe – ein Altersgenosse besaß sogar ein Paar Stiefeletten mit Elastikeinsatz – und kannten sich mit Mädchen aus. Außerdem hatten sie zusätzliche Feiertage, ein offenkundiger Vorteil. Und es hätte meinen Eltern einen schönen Schock versetzt, die wie viele ihres Alters und ihrer Gesellschaftsschicht unterschwellig antisemitisch eingestellt waren. (Wenn nach einem Fernsehfilm ein Name wie Aaronson im Abspann auftauchte, bemerkte einer von beiden gern sarkastisch: »Wieder so ein Waliser.«) Nicht, dass sie sich meinen jüdischen Freunden gegenüber irgendwie anders verhalten hätten, von denen einer, anscheinend völlig zu Recht, Alex Brilliant hieß. Alex war der Sohn eines Tabakhändlers, las mit sechzehn Wittgenstein und schrieb von Vieldeutigkeit durchpulste Gedichte – die Ambiguitäten waren zweifach, dreifach, vierfach angelegt wie ein Herz-Bypass. In Englisch war er besser als ich und ging mit einem Stipendium nach Cambridge; danach verlor ich ihn aus den Augen. Im Laufe der Jahre malte ich mir hin und wieder seinen mutmaßlichen Erfolg in einem geisteswissenschaftlichen Beruf aus. Ich war schon über fünfzig, als ich erfuhr, dass diese biografischen Mutmaßungen müßige Gedankenspiele waren. Alex hatte sich mit Ende zwanzig umgebracht – mit Tabletten, wegen einer Frau –, und ich hatte inzwischen doppelt so lange gelebt.
Ich hatte also keinen Glauben, den ich verlieren konnte, nur einen Widerstand, der sich heroischer anfühlte, als er tatsächlich war, und sich gegen das mit einer englischen Erziehung einhergehende milde Regime der Gottesverweise richtete: Bibelunterricht, morgendliche Gebete und Choräle, der alljährliche Erntedank-Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral. Und damit hatte es sich auch schon, wenn man von der Rolle des Zweiten Schäfers in einem Krippenspiel an meiner Grundschule absieht. Ich wurde nie getauft, nie in die Sonntagsschule geschickt. Ich habe mein Leben lang nie einen normalen Gottesdienst besucht. Ich gehe zu Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Ich bin ständig in Kirchen, aber aus architektonischen Gründen und im weiteren Sinne, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was einst englische Wesensart ausmachte.
Mein Bruder war liturgisch ein klein wenig erfahrener. Als Wölfling nahm er ein paar Mal am regulären Gottesdienst teil. »Ich meine mich an ein Gefühl verwunderten Staunens zu erinnern, wie ein kindlicher Anthropologe unter Kannibalen.« Auf meine Frage, wie er seinen Glauben verloren habe, antwortet er: »Ich habe ihn nie verloren, da ich nie einen zu verlieren hatte. Aber dass das Ganze ein Haufen Blödsinn ist, wurde mir am 7. Februar 1952 um 9 Uhr klar. Mr Ebbets, der Rektor der Derwentwater Primary School, gab bekannt, der König sei gestorben, er sei in die ewige Seligkeit eingegangen und nun bei Gott im Himmel, und deshalb sollten wir alle einen Monat lang einen schwarzen Trauerflor tragen. Ich dachte, da stimmt doch was nicht, und damit hatte ich verdammt recht. Mir fielen keine Schuppen von den Augen, ich empfand keinen Verlust, keine Leere in meinem Leben usw. usf. Ich hoffe«, sagt er weiter, »dass diese Geschichte wahr ist. Auf jeden Fall ist es eine sehr deutliche und anhaltende Erinnerung; aber du weißt ja, wie das mit Erinnerungen so ist.«
Als George VI. starb, war mein Bruder gerade mal neun Jahre alt (ich war sechs und auf derselben Schule, habe aber keinerlei Erinnerung an die Rede von Mr Ebbets und schwarze Trauerflore). Ich selbst war schon älter, als ich den letzten Rest – oder die Möglichkeit – einer Religion endgültig aufgab. Wenn ich als Jugendlicher im häuslichen Bad über einem Buch oder einer Zeitschrift hockte, redete ich mir immer ein, es könne gar keinen Gott geben, denn die Vorstellung, er würde mir beim Onanieren zuschauen, war absurd; noch absurder war die Vorstellung, alle meine toten Ahnen seien in einer Reihe angetreten und schauten ebenfalls zu. Ich hatte auch andere, rationalere Argumente, doch mit diesem durchschlagend überzeugenden Gefühl war Gott erledigt – was natürlich auch in meinem eigenen Interesse lag. Der Gedanke, dass Grandma und Grandpa beobachteten, was ich da trieb, hätte mich ernstlich aus dem Takt gebracht.
Doch während ich dies schreibe, frage ich mich, warum ich nicht auch andere Möglichkeiten in Betracht zog. Warum nahm ich an, dass Gott, falls er denn zusah, zwangsläufig missbilligen sollte, wie ich meinen Samen vergoss? Warum kam ich nicht auf die Idee, der Himmel könnte angesichts meiner eifrigen und unermüdlichen Selbstbefleckung vielleicht deshalb nicht einstürzen, weil das im Himmel nicht als Sünde galt? Ich hatte auch nicht genügend Fantasie, um mir auszumalen, meine toten Ahnen könnten mein Treiben ebenfalls belächeln: Nur zu, mein Sohn, genieß es, solange du kannst; bist du erst mal ein körperloser Geist, ist es damit so ziemlich vorbei, also machs noch mal für uns mit. Grandpa hätte vielleicht seine himmlische Pfeife aus dem Mund genommen und verschwörerisch geflüstert: »Ich kannte einmal ein sehr nettes Mädel namens Mabel.«
In der Grundschule wurden unsere Stimmen geprüft. Wir traten einzeln vor die Klasse und versuchten, zur Begleitung des Lehrers eine einfache Melodie zu singen. Dann wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt: hohe Stimmlagen und niedere Stimmlagen (ein musikalischer Rest der Welt). Diese Bezeichnungen waren freundliche Euphemismen, schließlich würde es noch Jahre dauern, bis wir in den Stimmbruch kamen; ich weiß noch, wie nachsichtig meine Eltern meinen Bericht davon aufnahmen, in welche Gruppe ich gekommen war, als wäre das eine Auszeichnung. Mein Bruder war ebenfalls eine niedere Stimmlage, allerdings stand ihm eine noch größere Demütigung bevor. In unserer nächsten Schule wurden wir wiederum geprüft und – wie mein Bruder mir in Erinnerung ruft – in die Gruppen A, B und C eingeteilt, und zwar von »einem widerlichen Mann namens Walsh oder Welsh«. Der Grund für den auch nach mehr als einem halben Jahrhundert nicht verrauchten Zorn meines Bruders? »Er hat extra für mich eine Gruppe D geschaffen. Ich habe Jahre gebraucht, um meinen Hass auf die Musik loszuwerden.«
In dieser Schule brach die Musik jeden Morgen mit einer dröhnenden Orgel und unsinnigen Chorälen über uns herein. »There is a green hill far away / Without a city wall / Where the dear Lord was crucified / Who died to save us all.« Die Melodie war nicht ganz so trübselig wie viele andere; aber wieso sollte man überhaupt eine Stadtmauer um einen grünen Hügel herum bauen? Später, als ich begriff, dass »without« hier »außerhalb« heißt und nicht »ohne«, zerbrach ich mir den Kopf über das Wort »green«. Da soll ein grüner Hügel liegen? In Palästina? Wir trugen jetzt schon lange Hosen und hatten nicht mehr viel Geografie (wer schlau war, wählte das Fach ab), doch selbst ich wusste, dass es dort nichts als Sand und Steine gab. Ich kam mir nicht vor wie ein Anthropologe unter Kannibalen – der Skeptizismus hatte in meinen Kreisen genügend Anhänger –, spürte aber doch eine Kluft zwischen mir vertrauten Wörtern und der ihnen zugeschriebenen Bedeutung.
Einmal im Jahr, am Lord Mayor’s Prize Day, sangen wir »Jerusalem«, das zur Schulhymne erkoren worden war. Ungezogene Jungen – eine Bande von unverbesserlichen niederen Stimmen – brachen an einer bestimmten Stelle traditionsgemäß in ein nicht vorgesehenes und mit Stirnrunzeln aufgenommenes Fortissimo der Begierde aus: »Bring me my arrows [winzige Pause] OF-DEE-SIRE.« Wusste ich, dass der Text von Blake stammte? Vermutlich nicht. Es gab auch keine Versuche, uns die Religion durch ihre sprachliche Schönheit nahezubringen (vielleicht, weil man diese für offenkundig hielt). Wir hatten einen älteren Lateinlehrer, der gern vom Text abschweifte; diese als persönliche Überlegungen getarnten Gedankengänge waren, wie mir jetzt klar ist, in Wirklichkeit eine genau berechnete Technik. Er gab sich wie ein pedantischer, nüchterner Geistlicher, doch dann murmelte er, als sei ihm das eben in den Sinn gekommen, so etwas wie: »Nun waren die Kinder Israel endlich ausgezogen – der längste Striptease aller Zeiten« – ein viel zu gewagter Witz, um ihn meinen Eltern wiederzuerzählen, die selbst Lehrer waren. Ein andermal machte er satirische Bemerkungen über ein Buch mit dem absurden Titel Die Bibel als Literatur gelesen. Wir kicherten mit ihm, aber aus ganz anderen Gründen: Die Bibel (langweilig) war ganz offensichtlich nicht dazu da, als Literatur (spannend) gelesen zu werden, quod erat demonstrandum.
Unter uns, die wir dem Namen nach Christen waren, gab es ein paar fromme Jungen, aber die galten als leicht verrückt, als ebenso seltene – und ebenso verrückte – Erscheinungen wie der Lehrer, der einen Ehering trug und zum Erröten gebracht werden konnte (auch er war fromm). Gegen Ende meiner Jugendzeit hatte ich einmal, womöglich auch zweimal, ein außerkörperliches Erlebnis: das Gefühl, oben an der Decke zu schweben und auf meinen leeren Körper herunter zu schauen. Das erzählte ich dem Schulfreund mit den Elastikeinsatz-Stiefeletten – nicht aber meiner Familie; und während ich darüber einen gelinden Stolz empfand (endlich passiert mal was!), leitete ich nichts Bedeutungsvolles, geschweige denn Religiöses daraus ab.
Vielleicht war es Alex Brilliant, der uns Nietzsches Botschaft übermittelte, Gott sei offiziell tot, was hieß, dass wir alle fröhlich weiter onanieren konnten. Jeder hatte sein Leben selbst in der Hand, nicht wahr – das war doch der Kern des Existentialismus. Und unser schwungvoller Englischlehrer war sowieso gegen die Religion. Zumindest zitierte er uns den Spruch von Blake, der sich wie das Gegenteil von »Jerusalem« anhörte: »For Old Nobodaddy aloft / Farted & Belch’d & cough’d.« Gott furzte! Gott rülpste! Das war doch der Beweis, dass es ihn nicht gab! (Wieder kam es mir nie in den Sinn, diese menschlichen Züge als Beleg für die Existenz, ja für das verständnisvolle Wesen der Gottheit zu sehen.) Dieser Englischlehrer zitierte uns auch Eliots düstere Zusammenfassung eines Menschenlebens: Geburt, Koitus und Tod. Nach der Hälfte seiner natürlichen Lebenszeit brachte er sich dann um, wie Alex Brilliant – ein Selbstmordpakt mit seiner Frau mittels Tabletten und Alkohol.
Ich ging zum Studium nach Oxford. Ich sollte mich beim College-Geistlichen melden, der mir mitteilte, als Stipendiat habe ich das Recht, im Gottesdienst den Bibeltext zu verlesen. Frisch von den Zwängen scheinheiliger Gottesverehrung befreit, antwortete ich: »Bedaure, ich bin glücklicher Atheist.« Daraufhin passierte gar nichts – kein Donnerschlag, kein Entzug der akademischen Robe, keine Schockstarre des Entsetzens; ich trank meinen Sherry aus und ging. Ein, zwei Tage später klopfte der Kapitän der Rudermannschaft bei mir an und fragte, ob ich mich für das College-Team bewerben wolle. Ich antwortete, vielleicht kühn geworden durch die Erfahrung, dass ich schon dem Geistlichen die Stirn geboten hatte: »Bedaure, ich bin Ästhet.« Jetzt möchte ich mich vor Scham über meine Antwort am liebsten in den Boden verkriechen (und wünschte, ich hätte doch gerudert); doch wiederum passierte nichts. Es fiel keine Bande von Sportsmännern bei mir ein, um das blaue Porzellan zu zerschlagen, das ich nicht besaß, oder meinen Bücherwurmkopf in die Kloschüssel zu drücken.
Ich konnte meine Meinung sagen, traute mich aber nicht, sie auch zu vertreten. Hätte ich mich besser ausdrücken können – oder mehr Dreistigkeit besessen –, dann hätte ich dem Geistlichen wie dem Ruderer womöglich erklärt, Atheismus und Ästhetik gehörten zusammen, so wie ein muskulöser Körper und Christentum einst für sie zusammengehörten. (Allerdings liefert uns der Sport vielleicht dennoch eine nette Analogie: Hat Camus nicht gesagt, die angemessene Reaktion auf die Sinnlosigkeit des Lebens sei das Erfinden von Spielregeln, wie wir sie für den Fußball erfunden hatten?) Weiterhin hätte ich in meiner imaginären Beweisführung ein Zitat von Gautier anführen können: »Les dieux eux-mêmes meurent. / Mais les vers souverains / Demeurent / Plus forts que les airains.« [Selbst Götter sterben, die Dichtkunst aber, stärker noch als Erz, überdauert alles.] Ich hätte darlegen können, an die Stelle der religiösen Verzückung sei längst eine ästhetische Verzückung getreten, und zur Krönung des Ganzen hätte ich vielleicht noch eine feixende Bemerkung darüber machen können, dass die Heilige Teresa in der berühmten ekstatischen Statue offenkundig nicht Gott sah, sondern sich einem ausgesprochen körperlichen Genuss hingab.
Wenn ich mich als glücklichen Atheisten bezeichnete, sollte das Adjektiv nur auf dieses Substantiv bezogen werden und sonst nichts. Ich war glücklich, nicht an Gott zu glauben; ich war glücklich, dass ich mit dem Studium soweit gut vorankam; aber das war auch ungefähr alles. Ich wurde von Ängsten verzehrt, die ich zu verbergen suchte. Trotz meiner intellektuellen Fähigkeiten (wobei ich argwöhnte, ich sei vielleicht nur ein geübter Examensbesteher) war ich sozial, emotional und sexuell unterentwickelt. Und wenn ich glücklich war, von Old Nobodaddy befreit zu sein, stimmten mich die Konsequenzen daraus nicht fröhlich. Kein Gott, kein Himmel, kein Leben nach dem Tode; damit bekam der Tod, wie fern er auch sein mochte, einen ganz anderen Stellenwert.
Während meiner Studienzeit verbrachte ich ein Jahr in Frankreich und unterrichtete an einer katholischen Schule in der Bretagne. Zu meiner Überraschung waren die Priester, mit denen ich dort zusammenlebte, menschlich so verschieden wie Bürger in Zivil. Einer züchtete Bienen, ein anderer war Druide; einer wettete bei Pferderennen, wieder ein anderer war Antisemit; ein junger Priester sprach mit seinen Schülern über Onanie, ein alter war süchtig nach Fernsehfilmen, selbst wenn er sie hinterher gern mit einem hochmütigen »uninteressant und noch dazu unmoralisch« abtat. Einige Priester waren intelligent und weltgewandt, andere dumm und leichtgläubig; manche offenkundig fromm, andere skeptisch bis zur Blasphemie. Ich weiß noch, wie schockiert die Runde am Refektoriumstisch war, als der subversive Père Marais den druidischen Père Calvard in eine Debatte darüber verwickelte, auf welches ihrer Heimatdörfer zu Pfingsten der qualitativ bessere Heilige Geist ausgegossen würde. Hier sah ich auch meine erste Leiche: die von Père Roussel, einem jungen Priester und Lehrer. Er war in einem Vestibül am Haupteingang der Schule aufgebahrt; Schüler und Lehrerschaft wurden ermuntert, ihn dort zu besuchen. Ich spähte nur durch die Scheiben der Flügeltüren und redete mir ein, das geschehe aus Taktgefühl; dabei war es höchstwahrscheinlich nichts als Angst.
Die Priester waren freundlich zu mir, hänselten mich ein bisschen und behandelten mich ein bisschen verständnislos. »Ah«, sagten sie, wenn sie mich auf dem Flur anhielten und mit scheuem Lächeln am Arm fassten, »La perfide Albion.« Es gab dort auch einen gewissen Père Hubert de Goësbriand, ein schlichtes Gemüt, aber ein gutmütiger Kerl; er hätte seinen prachtvollen bretonischen Adelsnamen in der Lotterie gewonnen haben können, so wenig passte er zu ihm. Père de Goësbriand war Anfang fünfzig, dicklich, schwerfällig, kahlköpfig und taub. Das größte Vergnügen seines Lebens bestand darin, während der Mahlzeiten dem schüchternen Schulsekretär Monsieur Lhomer Streiche zu spielen: Er steckte ihm heimlich Besteck in die Tasche, blies ihm Zigarettenrauch ins Gesicht, kitzelte ihn im Nacken oder hielt ihm unverhofft das Senftöpfchen unter die Nase. Der Schulsekretär ertrug diese lästigen täglichen Provokationen mit wahrhaft christlicher Geduld. Mich knuffte Père de Goësbriand anfangs bei jeder Begegnung in die Rippen oder zog mich an den Haaren, bis ich ihn fröhlich einen Blödmann nannte und er damit aufhörte. Er war im Krieg an der linken Gesäßhälfte verwundet worden (»Wolltest wohl weglaufen, Hubert!« – »Nein, wir waren eingekesselt.«), darum reiste er zu ermäßigtem Preis und hatte eine Zeitschrift für Anciens Combattants abonniert. Die anderen Priester behandelten ihn mit kopfschüttelnder Nachsicht. »Pauvre Hubert« war die Bemerkung, die man bei den Mahlzeiten am häufigsten hörte, ob beiseite gemurmelt oder ihm direkt ins Gesicht geschrien.
De Goësbriand hatte gerade sein fünfundzwanzigjähriges Priesterjubiläum gefeiert und eine sehr direkte Glaubensauffassung. Er war entsetzt, als er eines Tages ein Gespräch zwischen Père Marais und mir mit anhörte und feststellen musste, dass ich nicht getauft war. Pauvre Hubert machte sich sogleich Sorgen um mich und legte mir die fatalen theologischen Folgen dar: Als Ungetaufter hätte ich keine Chance, in den Himmel zu kommen. Vielleicht lag es an meinem Außenseiterstatus, dass er mir manchmal die Frustrationen und Restriktionen des Priesterlebens anvertraute. Einmal bekannte er verhalten: »Sie glauben doch nicht, ich würde das alles auf mich nehmen, wenn ich am Ende nicht in den Himmel käme?«
Damals war ich halb beeindruckt von solch praktischem Denken, halb entsetzt über ein in vergeblicher Hoffnung vergeudetes Leben. Dabei stand Père de Goësbriands Rechnung in einer großen Tradition, und ich hätte sie als eine Alltagsausgabe der berühmten Pascal’schen Wette erkennen können. Diese Wette klingt ganz einfach. Wenn man an Gott glaubt, und es stellt sich heraus, dass es Gott gibt, hat man gewonnen. Wenn man an Gott glaubt, und es stellt sich heraus, dass es keinen Gott gibt, hat man verloren, aber längst nicht so hoch, als wenn man nicht an Gott geglaubt hätte und nach dem Tod feststellen müsste, dass es ihn doch gibt. Das mag weniger eine Beweisführung sein als vielmehr eine eigennützige Interessenvertretung, die des französischen diplomatischen Corps würdig wäre; allerdings geht die Hauptwette auf die Existenz Gottes mit einer zweiten, zeitgleichen Wette auf das Wesen Gottes einher. Was wäre, wenn Gott nicht so ist, wie man ihn sich vorstellt? Wenn er zum Beispiel etwas gegen Spieler hat, besonders gegen solche, deren vorgeblicher Glaube an ihn auf einer Hütchenspielermentalität beruht? Und wer entscheidet darüber, wer gewinnt? Wir nicht – womöglich liebt Gott ja den ehrlichen Zweifler mehr als den berechnenden Schleimer.
Die Pascal’sche Wette zieht sich durch alle Jahrhunderte, und immer wieder schlägt jemand ein. Ein Mann ging gleich aufs Ganze. Er ließ sich im Juni 2006 im Kiewer Zoo an einem Seil in das abgesonderte Gehege mit den Löwen und Tigern hinab. Dabei rief er der gaffenden Menge etwas zu. Ein Zeuge will den Satz gehört haben: »Wer an Gott glaubt, dem können Löwen nichts anhaben«, ein anderer den noch provozierenderen: »Gott wird mich retten, wenn es ihn gibt.« Der metaphysische Provokateur kam unten an, zog die Schuhe aus und ging auf die Tiere zu; worauf ihn eine aufgebrachte Löwin zu Boden schlug und ihm die Halsschlagader durchbiss. Beweist das, a) dass der Mann verrückt war, b) dass es keinen Gott gibt, c) dass es einen Gott gibt, der sich aber nicht mit so billigen Tricks hervorlocken lässt, d) dass es einen Gott gibt und er sich eben als Ironiker erwiesen hat oder e) nichts von alledem?
Ein andermal hört sich die Wette fast nicht mehr nach einer Wette an: »Glaube du! Es schadet nicht.« Diese verwässerte Fassung, das matte Gemurmel eines Menschen mit metaphysischen Kopfschmerzen, stammt aus Wittgensteins Aufzeichnungen. Wenn man selbst ein Gott wäre, fände man so eine lauwarme Rückenstärkung wohl nicht sonderlich eindrucksvoll. Wahrscheinlich ist es zuweilen wirklich so, dass es »nicht schadet« – es ist nur nicht wahr, und das mag manch einer für einen absoluten, unbestreitbaren Schaden halten.
Ein Beispiel: Zwanzig Jahre vor diesem Eintrag arbeitete Wittgenstein als Lehrer in verschiedenen abgelegenen Dörfern Niederösterreichs. Bei den Einheimischen galt er als streng und exzentrisch, doch seinen Schülern herzlich zugetan; außerdem als ein Mann, der trotz seiner religiösen Zweifel jeden Tag bereitwillig mit einem Vaterunser begann und beendete. Als Wittgenstein in Trattenbach unterrichtete, machte er mit seinen Schülern einen Ausflug nach Wien. Der nächste Bahnhof war im neunzehn Kilometer entfernten Gloggnitz, daher begann der Ausflug mit einer Lehrwanderung durch den dazwischen liegenden Wald, bei der die Kinder Pflanzen und Steine bestimmen sollten, die sie im Unterricht kennengelernt hatten. In Wien taten sie zwei Tage lang dasselbe mit Beispielen aus Architektur und Technik. Dann fuhren sie mit der Bahn nach Gloggnitz zurück. Bei ihrer Ankunft dämmerte es bereits. Sie machten sich auf den neunzehn Kilometer langen Rückweg. Da Wittgenstein spürte, dass viele Kinder Angst hatten, ging er von einem zum anderen und fragte leise: »Hast du Angst? Dann denke nur an Gott.« Sie tappten wortwörtlich im Dunkeln. Glaube du! Es schadet nicht. Und vermutlich hat es auch nicht geschadet. Ein nicht existierender Gott kann die Menschen zumindest vor nicht existierenden Elfen, Kobolden und Waldgeistern beschützen, wenn auch nicht vor tatsächlich existierenden Wölfen und Bären (und Löwinnen).
Ein Wittgensteinforscher meint, der Philosoph sei zwar kein religiöser Mensch gewesen, habe aber in gewissem Sinn die Möglichkeit einer Religion zugelassen; allerdings habe sich seine Vorstellung von Religion weniger auf den Glauben an einen Schöpfer gegründet als vielmehr auf den Begriff der Sünde und den Wunsch nach einem göttlichen Strafgericht. Wittgenstein schrieb, das Leben könne zum Glauben an Gott erziehen – dies ist eine seiner letzten Aufzeichnungen. Er überlegte auch, was er antworten würde, falls man ihm die Frage stellte, ob er nach dem Tod weiterleben werde. Dann werde er sagen, er wisse es nicht: nicht aus den Gründen, die Sie oder ich anführen würden, sondern weil »ich keine klare Vorstellung von dem habe, was ich sage, wenn ich sage ›Ich höre nicht auf zu existieren‹«. Ich glaube, das gilt für viele von uns, außer für fundamentalistische Selbstmordtäter, die sich für ihr Opfer einen ganz bestimmten Lohn erwarten. Die Bedeutung dieses Satzes können wir sehr wohl begreifen, nicht aber die weiteren Implikationen.
Wenn ich mich mit zwanzig als Atheist bezeichnete und mit fünfzig und sechzig als Agnostiker, heißt das nicht, dass ich in der Zwischenzeit mehr Wissen erlangt hätte – nur ein größeres Bewusstsein meiner Unwissenheit. Wie können wir sicher sein, dass wir genug wissen, um zu wissen? Als neodarwinistische Materialisten des einundzwanzigsten Jahrhunderts sind wir der Überzeugung, Bedeutung und Mechanismen des Lebens seien erst seit dem Jahr 1859 völlig geklärt, und halten uns kategorisch für klüger als die leichtgläubigen Betschwestern und Betbrüder, die noch vor Kurzem an eine göttliche Vorsehung, eine heile Welt, die Auferstehung und ein Jüngstes Gericht glaubten. Heute sind wir zwar besser informiert, aber deshalb nicht höher entwickelt und ganz bestimmt nicht intelligenter als sie. Was macht uns so sicher, dass unser Wissen endgültig ist?
Meine Mutter hätte gesagt – und hat ja auch gesagt –, es sei »mein Alter«, als ließen metaphysische Vorsicht und schiere Angst mich jetzt, da das Ende nähergerückt ist, in meiner Überzeugung wanken. Doch da hätte sie sich getäuscht. Bei mir setzte das Todesbewusstsein schon früh ein, mit dreizehn oder vierzehn Jahren. Der französische Kritiker Charles du Bos, Freund und Übersetzer von Edith Wharton, hat einen passenden Begriff für diesen Moment geprägt: le réveil mortel. Wie ließe sich das am besten übersetzen? »Weckruf zur Sterblichkeit« klingt etwas nach Hotel-Service. »Todeswissen«, »Todeserwachen« – ein bisschen zu germanisch. »Todesbewusstsein«? Doch das lässt eher an einen Zustand als an einen speziellen kosmischen Schlag denken. In mancherlei Hinsicht ist die (erste) schlechte Übersetzung von du Bos’ Ausdruck die treffende: Es ist tatsächlich, als wäre man in einem fremden Hotelzimmer, wo der Wecker noch vom vorherigen Bewohner eingestellt ist, und dann wird man plötzlich zu einer unchristlichen Zeit aus dem Schlaf in Finsternis, Panik und die grausame Erkenntnis gerissen, dass man nur vorübergehend Gast auf dieser Welt ist.
Vor Kurzem fragte mich mein Freund R., wie oft ich an den Tod denke und unter welchen Umständen. Mindestens einmal an jedem wachen Tag, antwortete ich; dazu kommen periodisch auftretende nächtliche Attacken. Oft dringt die Sterblichkeit als ungebetener Gast in mein Bewusstsein ein, wenn die Außenwelt mir eine offenkundige Parallele bietet: bei Einbruch der Nacht, beim Kürzerwerden der Tage oder am Ende einer langen Wanderung. Etwas origineller ist vielleicht, dass mein Weckruf häufig zu Beginn einer Sportübertragung im Fernsehen schrillt, aus irgendeinem Grund vor allem während des Fünf- (jetzt Sechs-) Länder-Rugbyturniers. Das alles erzählte ich R., wobei ich mich für diese anscheinend maßlose Beschäftigung mit dem Thema entschuldigte. Er erwiderte: »Deine Todesgedanken kommen mir GESUND vor. Nicht abnorm wie bei [unserem gemeinsamen Freund] G. Meine sind hochgradig abnorm. Immer gewesen – so nach dem Motto TU’S JETZT. Gewehr in den Mund. Viel besser geworden, seit die Thames Valley Police hier war und meine .12er-Flinte mitgenommen hat, weil sie mich auf Desert Island Discs gehört hatte. Jetzt hab ich nur noch das Luftgewehr [seines Sohnes]. Bringt nichts. Kein Schmackes. Also WERDEN WIR ZUSAMMEN ALT.«
Früher wurde unbefangener über den Tod gesprochen: nicht über den Tod und das Leben danach, sondern über Tod und Vernichtung. In den 1920er-Jahren ging Sibelius in Helsinki in das Restaurant Kämp und setzte sich an den sogenannten »Zitronentisch«; die Zitrone ist das chinesische Todessymbol. Dort war ihm und seinen Tischgenossen – Malern, Industriellen, Ärzten und Juristen – nicht nur erlaubt, über den Tod zu sprechen, es wurde geradezu verlangt. Einige Jahrzehnte zuvor diskutierte in Paris ein lockerer Zusammenschluss von Schriftstellern – Flaubert, Turgenew, Edmond de Goncourt, Daudet und Zola – bei den Diners im Café Magny das Thema friedlich in geselliger Runde. Alle waren Atheisten oder eingefleischte Agnostiker; sie fürchteten den Tod, sahen ihm aber tapfer ins Auge. »Menschen wie wir«, schrieb Flaubert, »sollten der Religion der Verzweiflung anhängen. Man muss seinem Schicksal ebenbürtig sein, soll heißen, ebenso gleichmütig. Man sagt ›So ist es! So ist es!‹, schaut in die schwarze Grube zu seinen Füßen hinab und bleibt dadurch ruhig.«
Ich wollte nie den Geschmack eines Gewehrlaufs im Mund haben. Gemessen daran ist meine Todesangst moderat, vernünftig, praktisch. Und wollte man einen neuen Zitronentisch einberufen oder wieder Magny-Diners zu diesem Thema veranstalten, könnte das Problem auftauchen, dass einige Anwesende vom Konkurrenzfieber gepackt werden. Warum sollten Männer mit ihrer Sterblichkeit weniger angeben als mit ihren Autos, ihrem Einkommen, ihren Frauen, der Länge ihres Schwanzes? »Nächtliche Schweißausbrüche und Schreie – ha! – das ist Kinderkram. Wart nur, bis du auch …« Damit wird unsere persönliche Qual nicht nur als trivial entlarvt, sondern auch als schlappschwänzig. MEINE TODESANGST IST GRÖSSER ALS DEINE, UND MIR KOMMT SIE ÖFTER.
Andererseits zieht man bei dieser Männerprahlerei vielleicht gerne den Kürzeren. Es könnte ein kleiner Trost sein, dass es beim Todesbewusstsein immer – fast immer – jemanden gibt, der noch schlimmer dran ist als man selbst. Nicht nur R., sondern auch unser gemeinsamer Freund G. Der hat längst die Goldmedaille der Thanatophoben gewonnen, da le réveil mortel ihn schon mit vier Jahren (vier! Unverschämtheit!) aufschreckte. Die Botschaft erschütterte ihn dermaßen, dass seine gesamte Kindheit vom ewigen Nicht-Sein und von der schrecklichen Unendlichkeit überschattet blieb. Auch als Erwachsener wird er noch stärker vom Tod und von viel tieferen Depressionen heimgesucht als ich. Eine depressive Erkrankung lässt sich an neun Grundmerkmalen erkennen (von anhaltender Niedergeschlagenheit über Schlaflosigkeit und mangelndes Selbstwertgefühl bis zu wiederkehrenden Todesgedanken und wiederholter Selbstmordabsicht). Liegen fünf dieser Symptome über mehr als zwei Wochen hinweg vor, kann eine Depression diagnostiziert werden. Vor etwa zehn Jahren begab G. sich in stationäre Behandlung, nachdem er es auf ganze neun von neun Punkten gebracht hatte. Diese Geschichte erzählte er mir ohne jedes Konkurrenzgehabe (ich habe es längst aufgegeben, mit ihm konkurrieren zu wollen), wohl aber mit einem gewissen bitteren Triumphgefühl.