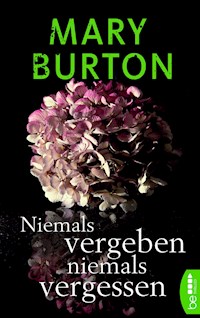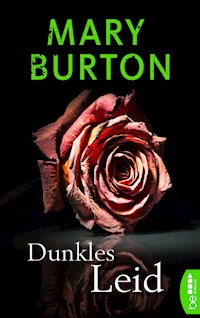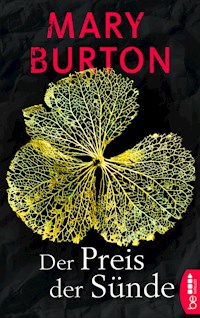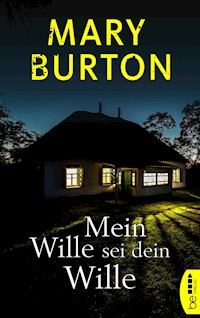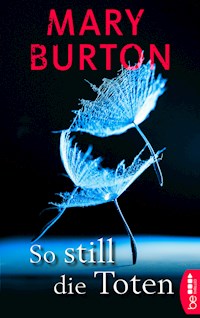4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Richmond-Reihe - Romantic Suspense
- Sprache: Deutsch
Sie muss ihn finden, bevor er sie töten kann ...
Am Ufer eines Flusses wird eine erdrosselte Frau gefunden, und bald tauchen weitere Leichen auf. Die Fernsehreporterin Kendall Shaw wittert eine heiße Story und nimmt die Recherche auf. Den beiden ermittelnden Detectives Jacob Warwick und Zach Kier ist das ein Dorn im Auge, denn Kendall ist stets vor Ort und der Polizei oft einen Schritt voraus. Hat sie einen geheimen Informanten? Als Jacob auffällt, dass alle Todesopfer eine überraschend große Ähnlichkeit mit Kendall aufweisen, macht er sich gemeinsam mit der Reporterin auf die Suche nach dem Täter. Denn schon das nächste Opfer könnte Kendall selbst sein ...
"Einfach fantastisch! Leidenschaft, Spannung und Intrigen halten sich in diesem erstklassigen Krimi die Waage!" The Romance Readers Connection
"Liebesgeschichte und Krimihandlung sind meisterhaft miteinander verwoben!" Publishers Weekly
Weitere Romantic-Suspense-Titel von Mary Burton bei beTHRILLED:
Die Alexandria-Reihe: Das Flüstern der Albträume. So still die Toten. Der Preis der Sünde.
Die Richmond-Reihe: Mein Wille sei dein Wille. Niemand hört dich schreien.
Die Texas-Reihe: Das siebte Opfer. Dunkles Leid. Niemals vergeben, niemals vergessen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Die Alexandria-Reihe
Band 1: Das Flüstern der Alpträume
Band 2: So still die Toten
Band 3: Der Preis der Sünde
Die Richmond-Reihe
Band 1: Mein Wille sei dein Wille
Die Texas-Reihe
Band 1: Das siebte Opfer
Band 2: Dunkles Leid
Band 3: Niemals vergeben, niemals vergessen
Über dieses Buch
Sie muss ihn finden, bevor er sie töten kann …
Am Ufer eines Flusses wird eine erdrosselte Frau gefunden, und bald tauchen weitere Leichen auf. Die Fernsehreporterin Kendall Shaw wittert eine heiße Story und nimmt die Recherche auf. Den beiden ermittelnden Detectives Jacob Warwick und Zach Kier ist das ein Dorn im Auge, denn Kendall ist stets vor Ort und der Polizei oft einen Schritt voraus. Hat sie einen geheimen Informanten? Als Jacob auffällt, dass alle Todesopfer eine überraschend große Ähnlichkeit mit Kendall aufweisen, macht er sich gemeinsam mit der Reporterin auf die Suche nach dem Täter. Denn schon das nächste Opfer könnte Kendall selbst sein …
Über die Autorin
Mary Burton ist im Süden der USA aufgewachsen und hat an der Universität von Virginia Englisch studiert. Nach einer Karriere im Bereich Marketing begann sie äußerst erfolgreich Thriller zu schreiben. Burton lebt und arbeitet in Virginia. Weitere Informationen über die Autorin finden Sie unter: www.maryburton.com.
MARY BURTON
Niemand hört dich schreien
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Will
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Mary Burton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Dead Ringer«
Originalverlag: Zebra Books als Teil der Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA
Published by arrangement with Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2019 by LYX/Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Claudia Schlottmann
Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: AlexanderTrou | Mopic
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-7557-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Sonntag, 6. Januar, Sonnenuntergang
»Es ist Zeit, Ruth.«
In den leisen Worten des Mannes lag eine düstere Endgültigkeit. Das Herz wurde ihm wahrhaft schwer, als er jetzt aus dem vom Frost beschlagenen Fenster blickte. Draußen bogen sich die Kiefern unter dem Gewicht des Eises. Arktische Windböen jagten über die Felder, wirbelten den Schnee auf und zeichneten kleine Spiralen hinein.
»Ich will nicht, dass du gehst«, sagte er und drehte sich zu Ruth um.
Die Frau saß mit gesenktem Kopf auf einem hölzernen Stuhl. Das dunkle Haar fiel ihr ins tränenüberströmte Gesicht. »Bitte«, flehte sie.
Eine hellrosa Tapete, weiße, durchscheinende Vorhänge und ein großer geflochtener Teppich aus gelben, violetten und blauen Strängen zierten den Raum; beherrscht wurde er jedoch von einem weißen Himmelbett, auf dem eine rosa Decke und Dutzende von Stofftieren lagen. Er hatte das Zimmer eigens für sie und die anderen eingerichtet.
»Schsch. Ich muss dich gehen lassen. Wir wussten doch beide, dass es irgendwann so weit sein würde.« Traurigkeit schnürte ihm die Kehle zu.
Ruth hob kaum merklich den Kopf. Sie sah auf ihre Handgelenke hinunter, die an die Armlehnen gefesselt waren. »Nein. Nein. Ich will nicht weg, ich will bei dir bleiben.«
Das heisere Flüstern war gelogen. Instinktiv begriff sie, was Weggehen bedeutete. Sterben.
In der Hoffnung, sie beruhigen zu können, durchquerte er den Raum. »Du brauchst keine Angst zu haben.« Er ging neben ihr in die Knie und legte die Hand auf die Schnur, mit der ihr weißes Handgelenk festgebunden war. Nach Tagen vergeblichen Kampfes war es wund und blutete. »Schon gut, Ruth. Es geschieht zu deinem Besten. Bald wirst du es verstehen«, sagte er zärtlich.
Tränen strömten ihr über das Gesicht. »Nein. Lass mich doch hierbleiben.« In ihren Augen stand Verzweiflung. »Wir können immer noch eine Familie sein.«
»Du musst Vertrauen zu mir haben, Ruth. Ich weiß, was das Beste für dich ist.« Sanft berührte er ihre Wange.
Sie zuckte zusammen, bemühte sich dann aber um ein Lächeln, als ihre blassgrünen Augen seinem Blick begegneten. »Allen, bitte.«
Er hatte es gern, wenn sie seinen Namen sagte. »Ich kann nicht. Das weißt du doch.«
Liebevoll umfasste er ihr Kinn und hob es leicht an, um ihr in die Augen zu sehen. Erneut rannen ihr Tränen über das Gesicht und benetzten seine schwielige Hand. Für einen Augenblick geriet sein Entschluss ins Wanken. Eigentlich wollte er sie gar nicht wegschicken. Liebend gerne hätte er sie für immer hierbehalten.
Doch das ging nicht.
Das konnte er nicht tun.
Er erhob sich und trat hinter sie. Sanft strich er ihr übers Haar, das jetzt nicht mehr nach Kokosnuss und Sommer, sondern nach Angst und Schweiß roch. »Ich fand unsere gemeinsame Zeit ebenfalls wunderschön. Ich war vorher so lange allein. Aber jetzt musst du zur Familie.«
Sie schüttelte den Kopf, war jedoch nicht imstande, zu ihm aufzublicken. »Bitte«, wimmerte sie. »Nicht.«
Allen schob das Haar aus ihrem schlanken Nacken. »Am Ende wirst du mir dankbar sein.«
Jahrelang hatte er sie gesucht und immer gewusst, dass er sie eines Tages finden würde. Dass sie wieder zusammen sein würden. Als er sie dann gefunden hatte, hatte er innerlich gejubelt. Wochenlang hatte er sie beobachtet: wie sie zur Kirche ging, zu ihrem Sekretärinnenjob in einem Ingenieurbüro fuhr, einkaufte. Er war dabei gewesen – im Schatten verborgen –, als sie am Grab ihrer Eltern geweint hatte. Er hatte sie genau studiert, sie bewundert und auf die perfekte Gelegenheit gewartet, sie hierher zu bringen, an diesen besonderen Ort, den er erschaffen hatte.
Er ließ die Hände unter Ruths dichte Mähne gleiten und streichelte die weiche Haut an ihrem Hals. Sie fühlte sich kühl an, und unter seinen Fingern pochte ihr schwacher Herzschlag. Die Wirkung der Medikamente, die sie schläfrig und kaum ansprechbar machten, ließ langsam nach. Bald würde sie wieder kämpfen und schreien, bis sie heiser war.
Er hatte ihr die Medikamente nicht geben wollen, doch sie hatte so viel Widerstand geleistet, hatte sich geweigert, mit ihm zu sprechen. Sie hatte sich gewehrt, ihn beschimpft und zurückgestoßen. Die Medikamente hatten sie ruhiger werden lassen, sodass sie imstande war, das Gute in ihm zu erkennen.
»Ich wünschte, uns bliebe mehr Zeit«, sagte er.
Sie drehte den Kopf zur Seite und schaute zu ihm hoch. Ihr Blick war voller Verzweiflung. »Wir könnten doch immer noch eine Familie sein.«
Um seinen Mund zuckte ein Lächeln. »Nicht so, dass es etwas ändern würde. Es gibt zu viel, das uns auseinanderbringen könnte.«
»Dieses Mal wird es anders. Du wirst sehen, ich werde dich lieben. Ich verspreche es.«
Liebe. Einen Augenblick lang schloss er die Augen und ließ das Wort in seinem Geist widerhallen. Schon so lange hatte ihn niemand mehr geliebt. »Du kannst mich nicht richtig lieben, bevor du ein Teil der Familie geworden bist.«
»Doch, ich kann es!«
Er machte ihr keinen Vorwurf daraus, dass sie log. Sie hatte Angst vor dem Übergang, das wusste er. Hinüberzugehen machte den Mädchen immer Angst. In diesem Stadium hätte sie einfach alles gesagt. Er war ihr nicht böse, er hatte Verständnis.
»Schsch. Alles wird gut, Ruth.«
Sie schluchzte leise auf. »Ich bin nicht Ruth. Ich bin nicht Ruth.«
Er ließ die Daumen in ihrem Nacken kreisen, dann schloss er seine langen Finger um ihren Hals. »Wehr dich nicht dagegen. Es ist so viel leichter, wenn du dich nicht gegen das wehrst, was am besten für dich ist.«
»Nein.«. Sie wand sich in ihren Fesseln und schlug mit dem Kopf nach ihm. »Ich will nicht gehen!«
Er verstärkte seinen Griff und begann zuzudrücken.
Zunächst warf sie den Kopf noch heftiger hin und her. Aus ihrem Mund drang ein erstickter Schrei. Doch der Druck um den Hals nahm ihr Sauerstoff und Kraft, und die Laute verstummten. Schon würgte sie und rang nach Atem, stemmte sich gegen die Fesseln, die schlanken Finger krümmten sich zur Faust.
»Ruth, du warst doch immer die Starke, die Tapfere.«
Er drückte noch fester zu und kostete das Gefühl der Macht aus, das seinen Körper durchströmte, die unglaubliche Erregung. Obwohl das Zimmer eiskalt war, wurde ihm warm. Er fühlte sich lebendig, mit allem verbunden.
So lange war er allein gewesen, verloren, auf der Suche. Nun würde Ruth zu seiner Familie gehören. Sie würde für immer bei ihm sein.
»Familie. Das ist einfach alles. Ohne eine Familie ist das Leben nicht viel wert. Die Menschen begreifen das heutzutage nicht. Immer sind sie so beschäftigt, so gehetzt, nehmen sich keine Zeit füreinander.«
Sie spannte die Halsmuskeln an und drehte den Kopf hin und her, würgte, versuchte sich zu befreien.
Seine Arme und Hände schmerzten, doch sein Griff blieb eisern. Ihr Puls hämmerte wild, ein Zeichen dafür, wie sehr ihre Lungen nach Sauerstoff verlangten. Und dann setzte das Pochen für einige Schläge aus. Sein Herz begann zu rasen. Noch ein paar unregelmäßige Pulsschläge, dann wurde sie ruhig.
Das Leben rann aus Ruths Körper wie Wasser in einen Abfluss. Sie sackte nach vorn. Stille umgab sie, eine Stille, die nur der Tod hervorbringt.
Liebevoll legte er ihr die Hand auf den Kopf. »So ist es besser, nicht wahr? Endlich hast du Frieden. Jetzt bist du frei von Kummer und Sorgen.«
Sie regte sich nicht. Es gab kein Aufbegehren mehr. Kein Flehen, er möge ihr die Freiheit wiedergeben.
»Gepriesen sei der Herr«, flüsterte er.
Er zog eine goldene Kette mit einem ovalen Anhänger aus der Tasche. Auf dem Anhänger war Ruth eingraviert. Er legte ihr die Kette um den Hals. Der Verschluss war winzig, und seine großen Hände nestelten ungeschickt daran herum, bis die Öse schließlich einrastete.
Er ging um den Stuhl herum und kniete sich vor Ruth hin. Das Amulett lag in ihrer Halsgrube, genau über ihren Brüsten. Es war ein schöner Anhänger, ein edles Schmuckstück, und er hatte mehrere Wochen gebraucht, um ihn anzufertigen. Doch sie war es wert. Er berührte das goldglänzende Metall.
Ruth verdiente das Allerbeste.
Er band ihre Handgelenke los und ergriff ihre Hände, küsste die kalten Finger und drückte sie an seine Wange. »Ich liebe dich so sehr.«
Er schob seine Hand unter ihr Kinn und neigte ihren Kopf nach hinten. Unter halb geöffneten Lidern starrten ihn ihre blicklosen Augen an. Er glaubte, ein Lachen in den glasigen Untiefen zu sehen.
»Du wirst nicht mehr lange allein sein, Ruth.« Er legte ihre Hände sittsam in ihren Schoß. »Bald werde ich die anderen finden und zu dir schicken.«
Bei dem Gedanken an die anderen lächelte Allen, und Freude wallte in ihm auf. »Bald werden wir alle zusammen sein – so, wie die Familie es immer hätte sein sollen.«
1
Dienstag, 8. Januar, 8:10 Uhr
Detective Jacob Warwick vom Morddezernat beugte und streckte die Finger der rechten Hand, um die Steifheit in den Gelenken loszuwerden, während er über den gefrorenen Boden auf die blinkenden Blaulichter zuging. Die fünf Polizeiwagen parkten auf einem Feld am Ufer des James River. Der Schneesturm vom Freitag hatte die Landschaft in ein grelles Weiß getaucht, ihr jegliche Farbe und alles Leben genommen. Morgendlicher Dunst lag über dem südlichen Flussufer und dem größten Teil des ruhig fließenden Wassers.
Die Temperaturen bewegten sich um den Gefrierpunkt, doch durch den kalten Wind, der seine Lederjacke durchdrang, als wäre sie aus dünnem Baumwollstoff, erschienen sie Jacob weitaus niedriger.
Die Kälte setzte seinen mitgenommenen Fingerknöcheln zu, und er bedauerte, dass er die Handschuhe zu Hause gelassen hatte. Er schlug den Kragen seiner abgetragenen Jacke hoch und schob die Fäuste in die Taschen. Eine Mütze bedeckte sein militärisch kurz geschnittenes Haar, und ein schwarzer Schal hielt seinen Hals warm.
Noch vor einer Stunde war Jacob im Sportstudio gewesen und hatte seinen freien Tag genutzt, um sich am Sandsack auszutoben. Die körperliche Anstrengung ließ reichlich Endorphine durch sein Gehirn fließen und linderte für eine kleine Weile die hartnäckige Anspannung, die ihm zusetzte.
Mitten im Training hatte sein Handy geklingelt. Mit einem derben Fluch hatte er den wild schaukelnden Sandsack angehalten, sich den Schweiß aus dem Gesicht gewischt und sein Telefon aus der Sporttasche geangelt.
Sein Partner, Detective Kier, hatte ihm die nüchternen Fakten durchgegeben. Weibliches Mordopfer, Mitte dreißig, weiß. Die Leiche war am Ufer des James River abgelegt, und zwar auf der Alderson-Baustelle, die etwa zwanzig Kilometer hinter dem Flughafen im Osten des Countys lag. Unter der Dusche hatte Jacob sein Gesicht in den heißen Strahl gehalten und bedauert, dass er nicht länger bleiben konnte.
Ein eisiger Windstoß aus Richtung des Flusses ließ Jacob noch ein wenig tiefer in seiner Jacke versinken. Das Land hier bestand aus unbestellten Feldern mit dürren Zypressen dazwischen, doch wenn er dem Schild, an dem er unterwegs vorbeigekommen war, Glauben schenken konnte, würde die Alderson-Baugesellschaft das alles in einen weitläufigen Golfplatz verwandeln, umgeben von Backsteinhäusern mit perfekt angelegten Blumenbeeten und wohlplatzierten Bäumen. Neben dem ebenfalls vorgesehenen Klubhaus waren Tennisplätze und ein beheizter Swimmingpool geplant.
Ab 900 000 Dollar. Die glänzenden Reklametafeln versprachen den künftigen Käufern der am Fluss gelegenen Häuser nicht nur die denkbar beste Ausstattung, sondern auch gleich den richtigen Status und ein glückliches Leben als Bilderbuchfamilie. Jacob hatte das Leben beigebracht, dass es keine Garantien gab. Und in den dreizehn Jahren bei der Polizei hatte er gelernt, dass das Elend in Prachtvillen wie in Bruchbuden gleichermaßen zu finden war.
Vor einem schlammbedeckten schwarzen Geländewagen erblickte Jacob ein paar zerlumpt wirkende Männer in Overalls und Tarnjacken. Es war der Vermessungstrupp der Alderson Company, und das hier war ihre Baustelle. Gleich nach Sonnenaufgang waren sie hergekommen, um das Nordufer des James River zu vermessen, und sie waren es gewesen, die die Leiche gefunden hatten.
»Hey, wann lassen Sie uns weiterarbeiten oder nach Hause gehen?«, rief ihm einer der Landvermesser zu. Aus dem Kaffeebecher in seiner Hand stieg Dampf auf.
»Kann ich nicht sagen«, antwortete Jacob. »Aber bleiben Sie vor Ort.«
Jacob ging zu einem älteren Polizeibeamten mit Stoppelhaarschnitt und mürrischem Gesicht hinüber. Der Polizist stampfte mit den Füßen und rieb die behandschuhten Hände aneinander. »Kalt, was? Meine Knochen haben langsam genug von diesem verdammten Frost.«
Jacob tat vom Boxkampf der letzten Woche immer noch alles weh. »Meine auch.«
»Was beschweren Sie sich? Ich bin schon eine Stunde hier.«
Jacob lächelte. »Sie sind härter im Nehmen als ich.«
»Meine Güte.« Watson warf einen Blick auf Jacobs Gesicht, und seine Augen verengten sich. »Sind das die Überreste von einem Veilchen?«
»Ja. Der andere Kerl hatte einen ziemlich fiesen rechten Haken.« Doch das hatte Jacob nicht daran gehindert, den Boxkampf der Wohltätigkeitsveranstaltung zu gewinnen.
Watson betrachtete ihn eingehend. »Wie alt sind Sie jetzt? Vierunddreißig, fünfunddreißig?«
»So ungefähr.«
Watson schüttelte den Kopf. »Sie werden langsam zu alt für solche Mätzchen. Sie sind keine achtzehn mehr, sie sollten aufhören, solange noch alles an Ihnen dran ist.«
Sechsunddreißig war eigentlich kein Alter, aber für einen Boxer war es uralt. In der Army hatte Jacob bei den Golden-Gloves-Meisterschaften geboxt. Seither war er immer Freizeitboxer gewesen. Boxen bedeutete für ihn Nervenkitzel, es bewies ihm, dass er es immer noch draufhatte. Was auch immer es war.
Doch der Sport forderte seinen Tribut. Jacob kam inzwischen nicht mehr so schnell auf die Beine wie früher. In den letzten Monaten hatte er so viele Hiebe eingesteckt, dass es kaum einen Tag gab, an dem ihm nicht alles wehtat. Watson hatte recht. Er erholte sich nicht mehr so gut wie mit zwanzig. »Ich lass es mir durch den Kopf gehen.«
Watson musterte ihn. »Blödsinn. Sie hören ja doch nicht auf.«
Damit entlockte er Jacob ein schuldbewusstes Grinsen.
Die meisten Außenstehenden – Leute, die nicht bei der Polizei waren – verstanden nicht, wie man im Angesicht des Todes über Alltägliches plaudern und so locker sein konnte. Doch diese Art Geplänkel, selbst der Humor, war ein Mittel, Dampf abzulassen, der Anspannung die Spitze zu nehmen und nicht durchzudrehen.
Jacob zog Gummihandschuhe aus der Jackentasche. »Ist die Spurensicherung noch nicht da?«
»Hing noch an einem anderen Tatort fest, soll jede Minute hier sein.«
»Gut.« Er tauchte unter dem gelben Absperrband durch und schlenderte zu seinem Partner Zack Kier hinüber.
Zack hatte das Gesicht dem eisigen Fluss zugewandt. Er war groß, breitschultrig und von schlanker Statur, die bestens zu dem von ihm so geliebten Triathlon passte. Seine Haut war für die Jahreszeit ungewöhnlich stark gebräunt, ein Souvenir von seinem Karibikurlaub, den zweiten Flitterwochen mit seiner Frau Lindsay. Sein schwarzer Mantel reichte ihm bis zu den Knien, und er trug Plastikhandschuhe über den schwarzen Fäustlingen.
»Also, was haben wir?«, fragte Jacob und zog sich die Handschuhe über.
Beim Klang von Jacobs Stimme drehte Zack sich um und nickte in Richtung des vereisten Flussufers. »Sieh es dir selbst an.«
Jacob folgte Zack die Böschung zum Fluss hinunter. Wo Wasser und Land aufeinandertrafen, lag bäuchlings eine Frau. Sie trug einen kamelfarbenen Mantel, Handschuhe und Schal, eine dunkelblaue Hose und flache Schuhe. Ihre Kleidung war völlig durchnässt. Ihre Arme waren seitlich ausgestreckt, eine behandschuhte Hand lag im Wasser, die andere an Land. Das Gesicht der Frau war dem Fluss zugewandt, und das lange, braune Haar fiel ihr wie ein dunkler Vorhang über die Wange. Kleine Wellen schwappten gegen ihren Körper.
Jacob ging auf die Leiche zu, blieb aber in drei Meter Entfernung stehen. Er wollte den Tatort nicht unnötig verändern, bevor das Team der Spurensicherung eintraf. Er stieß einen tiefen Seufzer aus, der in der eisigen Luft gefror. »Wissen wir, wer sie ist?«
Zack schüttelte den Kopf. »Bisher nicht. In keiner ihrer Taschen war ein Ausweis. Und eine Handtasche haben wir auch nicht gefunden.«
Jacob ging in die Hocke. Er schaute in ihr Gesicht, das größtenteils von dem dichten braunen Haar verdeckt wurde. Wie kam eine sorgfältig gekleidete Angehörige der Mittelschicht hierher? »Flussabwärts gibt es ein paar Brücken und jede Menge Docks. Selbstmord?«
Zack machte ein finsteres Gesicht. »Das dachte der erste Beamte vor Ort auch.«
Jacob runzelte die Stirn. »Und?«
»Als er ankam, hat er ihren Puls gefühlt, dazu musste er die Haare zur Seite schieben.« Zack spannte seine Kiefermuskulatur an. »Um ihren Hals sind dunkle Abdrücke.«
»Erwürgt.«
»Er hat auch an den Handgelenken Male gefunden. Sehen aus wie Scheuerwunden von einem Seil.«
Jacobs Blick wanderte zum Saum ihres Mantelärmels. Gerne hätte er den nassen Stoff hochgeschoben, um die Scheuermale selbst zu sehen, doch er würde auf die Spurensicherung warten. »Hat der Beamte die Tote sonst irgendwo angefasst?«
»Nein. Nur am Hals und am Handgelenk, um den Puls zu fühlen.«
Die Spurensicherung brauchte eine genaue Aufstellung über jeden, der die Leiche berührt hatte. »Gut.«
Jacob betrachtete das Handgelenk des Opfers. »Wer auch immer das getan hat, hat sie gefangen gehalten, bevor er sie getötet hat.«
»Das denke ich auch.«
Das Opfer war vollständig bekleidet, bis hin zu Schal und Handschuhen. Dennoch konnte es sein, dass sie ausgezogen und vergewaltigt worden war. Es kam öfters vor, dass Mörder, besonders beim ersten Mal, dem Opfer gegenüber Reue empfanden. Der Täter könnte versucht haben, ihre Würde zu wahren, indem er sie wieder anzog. »Wir müssen sichergehen, dass der Pathologe sie auf Vergewaltigung hin untersucht.«
»Ist schon veranlasst.«
Jacob beugte und streckte die rechte Hand, um die Steifheit daraus zu vertreiben. Eingehend musterte er das, was vom Gesicht des Opfers zu sehen war. Es würde schwierig werden, den Todeszeitpunkt genau zu bestimmen. Die Kälte hatte zweifellos den Verwesungsprozess verlangsamt. »Gibt es irgendwelche Vermisstenmeldungen?«
Ein kalter Windstoß ließ Zack den Kopf einziehen. »Ich habe vor einer Viertelstunde angerufen. Es ist niemand als vermisst gemeldet, auf den ihre Beschreibung passt, aber vielleicht ändert sich das noch.«
Es gab hundert mögliche Gründe dafür, dass keine Vermisstenmeldung eingegangen war. Vielleicht war das Opfer verreist gewesen. Vielleicht hatte sie sich mit ihrem Mann gestritten, oder sie hatte allein gelebt und nur wenige Freunde gehabt. Doch früher oder später wurden die meisten Menschen von irgendjemandem vermisst.
Flussaufwärts waren keinerlei Docks, Boote oder Anlegestellen zu sehen, von wo aus man sie hätte ins Wasser werfen können. »Sie ist klitschnass, aber ihre Haut ist nicht verfärbt, wie sie es nach einem Aufenthalt im Wasser wäre. Und wenn sie im Fluss gelegen hätte, müssten Algen oder Gras an ihr haften.«
»Der eiskalte Regen von gestern hätte jeden bis auf die Haut durchnässt.«
Jacob konnte sich so einige Möglichkeiten vorstellen, wieso eine Frau aus der Mittelschicht auf diese Weise endete: heimliche Drogensucht, häusliche Gewalt … zum jetzigen Zeitpunkt konnte man nur raten.
Er starrte auf ihre Leiche. »Warum sie hier deponieren?« Zack kritzelte etwas in seinen Notizblock. »Vielleicht hat der Täter geglaubt, man würde sie eine ganze Weile nicht finden.«
»Oder er hat im Gegenteil gedacht, man würde sie rasch finden. Hier treiben sich seit Wochen überall die Leute von der Baufirma herum.«
»Das würde eine Reihe neuer Fragen aufwerfen.«
Die meisten Mörder wollten ihre Tat vertuschen. Falls die Frau bewusst hier abgelegt worden war, traf Zacks Vermutung zu. Dann hatten sie es mit einer viel schlimmeren Geschichte zu tun.
Motorengeräusch ertönte, und die beiden schauten den Hang hinauf. Der Wagen der Spurensicherung war da. Auf dem Fahrzeug stand in blauen Buchstaben auf weißem Grund Henrico County Forensics.
Die Fahrertür wurde geöffnet, und eine junge, dunkelhaarige Frau stieg aus – Tess Kier, Zacks Schwester. Tess war seit drei Jahren bei der Spurensicherung und galt als äußerst gründlich, eine der Besten im ganzen Land.
Sie war groß für eine Frau, hatte scharf geschnittene Gesichtszüge und einen schlanken Körper. Mehr als einmal hatte Jacob daran gedacht, etwas mit ihr anzufangen, doch er hatte nie die Initiative ergriffen. Sie war nicht nur die jüngere Schwester seines Partners, Jacob und sie trafen auch oft an Tatorten aufeinander. Finger weg von den Kolleginnen. Das war ein Lieblingsspruch seines Sergeants bei der Army gewesen. Weise Worte, die Jacob zu beherzigen versuchte.
Zacks angespannte Gesichtszüge wurden ein klein wenig weicher, und er ging Tess entgegen.
Jacob blieb unten am Fluss, in der Nähe des Opfers. Er drehte sich um und sah hinaus aufs Wasser, ohne zu wissen, wonach er suchte. Was für ein trauriger, trostloser Ort. »Niemand verdient so etwas.«
Tess kam die Böschung herunter, in Overall, Stiefeln und Handschuhen. Um ihren Hals baumelte eine Digitalkamera, und in der Hand hielt sie ein Klemmbrett. Aus ihrem rabenschwarzen Pferdeschwanz ragte ein Bleistift. Sie warf einen Blick auf Jacobs Hände, als sie bei ihm angekommen war.
Jacob las in ihr wie in einem offenen Buch. Er wackelte mit den Fingern. »Ich war brav und hab meine Handschuhe angezogen.«
»Gut.« Tess’ glatte, helle Haut betonte ihre strahlend blauen Augen. »Ich kann niemanden gebrauchen, der mir den Tatort kontaminiert.« Sie warf ihrem Bruder einen bedeutungsvollen Blick zu. »Dir muss ich ja nichts über die richtige Ausrüstung erzählen.«
Zack wirkte gelangweilt, als hätte er diese Ansprache schon tausendmal gehört. »Hat dir mal jemand gesagt, dass du morgens ätzend bist?«
»Ja, mein Exfreund.« Tess klemmte sich das Brett unter den Arm und begann, Fotos zu machen.
Im schwachen Licht der Morgensonne tauchte der Kamerablitz die Leiche in grausame Helligkeit. Alle verstummten. Stille senkte sich über die Szenerie.
Tess nahm die Leiche aus jedem erdenklichen Blickwinkel auf. Zunächst stand sie auf der Böschung, dann ging sie hinunter ins seichte, kalte Wasser und schoss noch mehr Fotos. Sie fertigte Zeichnungen an und machte sich Notizen.
Jacob betrachtete das Opfer eingehend, während die Kamera blitzte. Er versuchte, sich in die Frau hineinzuversetzen, so zu denken, wie sie es getan hatte.
Ihre Schuhe und Kleidung wirkten vernünftig, fast schon bieder. Die Haare trug sie offen, doch er vermutete, dass sie sie normalerweise zu einem Pferdeschwanz zurückband. Ein derart praktischer Stil hätte auch zu ihren Nägeln gepasst, die sauber, kurz geschnitten und unlackiert waren. Der Schal um ihren Hals war ordentlich geknotet.
Sie sah aus wie eine Bibliothekarin. Wie eine Kirchgängerin, jemand, der immer auf der richtigen Straßenseite ging. Sie war die Art Mensch, deren Verschwinden auffallen würde.
Die Kälte kroch Jacob in die Glieder, und er wurde langsam unruhig. Er verlagerte sein Gewicht auf den anderen Fuß und versuchte, die Blutzirkulation in Gang zu bringen. Sengende Hitze oder Feuchtigkeit empfand er als nicht weiter tragisch, doch die Kälte machte ihn fertig.
Jacob sah zu der Gruppe Landvermesser hinüber. »Ich rede mal mit den Leuten.«
Zack nickte. »Okay.«
Der gefrorene Boden knirschte unter Jacobs Schritten, als er die Böschung erklomm. Er blieb vor den Männern bei dem schwarzen Geländewagen stehen.
Ein großer Mann im Zentrum der Gruppe nickte ihm zu. Er wog mindestens hundert Kilo, hatte einen auffallend dichten, schwarzen Bart und ein Tattoo von einem gefallenen Engel am Hals. Die anderen Vermesser sahen jünger aus, zwischen zwanzig und dreißig, und ihre geröteten Augen ließen darauf schließen, dass sie letzte Nacht schwer gebechert hatten.
»Wer von Ihnen hat die Leiche gefunden?«, fragte Jacob.
Der Große antwortete ihm. »Ich. Ich bin der Truppleiter.«
»Wie heißen Sie?«
»Frank Burrows.« Er sprach den Nachnamen schleppend aus, mit schwerem Südstaatenakzent, was die Vermutung nahelegte, dass er aus dem Südwesten Virginias stammte.
»Erzählen Sie mir der Reihe nach, was Sie gesehen haben«, sagte Jacob.
Der Mann runzelte angestrengt die Stirn und warf einen Blick zum James River hinüber, bevor er Jacob ansah. »Ich war gerade dabei, die Vermessung am Fluss entlang vorzubereiten. Rob hier«, er deutete mit dem Daumen auf den Mann zu seiner Rechten, »war ein paar Schritte hinter mir.«
Rob wechselte das Standbein. »Ich musste mal pinkeln.«
Burrows verdrehte die Augen. »Ich hatte gerade das Stativ aufgestellt, da hab ich den Mantel von der Frau gesehen. Ich dachte, er wäre vom Sturm angeschwemmt worden. Wir finden dauernd irgendwelches Zeug im Wasser – Reifen, Schuhe, Kleidung, Möbel. Ich bin also rüber, um ihn mir genauer anzusehen. Als ich gemerkt hab, dass es eine Frau war, habe ich die Rettungsstelle angerufen.«
»Haben Sie sie angerührt?«
Burrows verschränkte die Arme vor der Brust. »Nein, verdammt. Sie hat nicht so ausgesehen, als würde sie atmen, und ich wollte nicht so nah rangehen.«
»Sie haben nicht den Puls gefühlt?«
Burrows zog die Nase hoch und schien innerlich in Verteidigungshaltung zu gehen. »Nein.«
»Hat einer Ihrer Leute sie angerührt?«
»Nein.«
Jacob sah die Männer an. »Haben Sie irgendjemanden in der Nähe gesehen, der nicht hierher gehört?«
Alle schüttelten den Kopf.
Burrows ergriff das Wort. »Das hier ist kein Ort, wo die Leute im Winter einfach so zum Spaß hinkommen. In einem der Bäume gibt es einen alten Hochsitz, es waren also manchmal Jäger hier. Das war allerdings früher, bevor Alderson das Gelände gekauft hat. Wir haben ein paar illegale Müllkippen gefunden, aber die meisten waren schon ein paar Monate alt.«
»Es hat sich niemand hier herumgetrieben?«
»Mit dem Auto kommt man nur über die Straße hierher, auf der Sie gekommen sind. Sie endet ungefähr hundert Meter hinter dem Abzweig.«
»Wie sieht es mit Reifenspuren auf der Straße aus? Haben Sie irgendwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges gesehen?«
»Schwer zu sagen, welche Spuren von uns sind und welche von jemand anderem. Und der Schnee letzte Nacht hätte sowieso alle neuen Spuren zugedeckt.«
»Was ist mit dem Zugang vom Fluss her?«
»Ein Boot mit flachem Kiel könnte hier fahren, aber wir haben keins gesehen.« Burrows zupfte nervös an einem Faden, der vom Saum seiner Jacke herabhing.
»Stimmt was nicht?«, fragte Jacob.
Ein Lachen, das ein halbes Fluchen war, platzte aus Burrows heraus. »Was glauben Sie denn? Ich habe auf meiner Baustelle eine tote Frau gefunden. Alles, was ich jetzt will, ist, in einer Bar im Warmen sitzen und ein kühles Bier trinken.«
»Warwick«, rief Zack vom Fluss herauf. »Tess hat was gefunden.«
Jacob drehte sich zu ihm um. »Komme gleich.«
Burrows wirkte nervös. »Kann ich meine Leute gehen lassen? Sie haben nichts gesehen, und wir haben noch einen Vermessungsauftrag, mit dem wir weitermachen könnten. Dann war der Tag nicht ganz umsonst.«
Jacob schüttelte den Kopf. »Bleiben Sie noch ein bisschen hier.«
Der Truppleiter fluchte. »Wenn ich gewusst hätte, dass uns das so lange aufhält, hätte ich die Cops erst nach Arbeitsschluss gerufen. Ein paar Stunden mehr hätten ihr auch nichts mehr ausgemacht.«
Jacob starrte den Mann an, bis der klug genug war, den Blick abzuwenden. Gereizt machte Jacob sich auf den Weg zurück zum Flussufer. Tess hatte das Opfer inzwischen auf den Rücken gedreht.
Der Kopf der Frau war zur Seite gedreht, Jacob konnte jedoch erkennen, dass sie ein flächiges Gesicht hatte, mit hohen Wangenknochen und heller Haut. Ihre Augen waren geschlossen. Die Male am Hals der Unbekannten waren jetzt deutlich zu sehen, genau wie die Wunden an ihren Handgelenken. Im grauen Licht des Morgens glich sie mit ihren erstarrten Gesichtszügen eher einer Schaufensterpuppe als einem Menschen. Dennoch, irgendwie kam sie ihm bekannt vor.
Jacob schluckte. Die Leiche als Person zu sehen, würde ihm seine Objektivität nehmen. Letzten Endes konnte er seine Arbeit besser machen, wenn er den Leichnam einfach als Beweismittel betrachtete.
»Sieh dir mal ihren Schmuck an«, sagte Tess.
Jacob beugte sich vor. An einer Kette um ihren Hals hing ein goldenes Amulett. Der eingravierte Name lautete Ruth. »Sie heißt Ruth?«
Zack kritzelte etwas auf seinen Spiralblock. »Die Kette ist hübsch.«
Tess nickte, schoss Fotos und machte Nahaufnahmen von Hals und Amulett. »Sehr hübsch. Ich würde sagen, sie hat eine Stange Geld gekostet.«
»Die Frau sieht nicht aus wie jemand, der teuren Schmuck trägt«, bemerkte Jacob. »Sie wirkt durch und durch praktisch.«
»Vielleicht war es ein Geschenk?«, schlug Tess vor.
»Vielleicht.« Manchmal konnte ein einzelnes Detail in einer Ermittlung Jacob wochenlang beschäftigen. Vergangenes Jahr hatte er es mit einem Selbstmord zu tun gehabt. Der Mann hatte sich allem Anschein nach erschossen. Das Haus war sauber, alles war an seinem Platz. Nur der Schlips und die Anzugjacke des Mannes lagen als unordentlicher Haufen auf dem Boden. An sich nichts Besonderes, doch diese Einzelheit hatte nicht ins Bild gepasst. Jacob hatte lange an dem Tatort gesessen, bis er zu dem Schluss kam, dass der Mann die Sachen in einem letzten Akt der Rebellion aufgetürmt hatte.
Und nun war da ein teurer Anhänger am Hals einer Frau, die aussah, als würde sie ihre Kleidung in Discountläden kaufen. Vielleicht bedeutete es nichts weiter, genau wie die weggeworfenen Kleidungsstücke. Dennoch störte es Jacob.
»Ich überprüfe die Halskette«, sagte Zack.
Jacob nickte und betrachtete die Unbekannte. Trotz der Spuren, die der Tod und die Elemente an ihr hinterlassen hatten, hatte er das Gefühl, sie schon einmal gesehen zu haben. »Sie kommt mir bekannt vor.«
Tess nickte. »Ich hatte den gleichen Gedanken. Ich versuche schon die ganze Zeit, sie einzuordnen.«
Woher kannte er sie?
Sanft legte Tess die Fingerspitzen unter das Kinn der Frau und drehte ihr Gesicht in seine Richtung. Als er sie von vorne sah, erschrak er, und langsam dämmerte es ihm.
Die Unbekannte. Ruth.
Sie sah genauso aus wie die Nachrichtenmoderatorin von Channel 10. Kendall Shaw.
2
Dienstag, 8. Januar, 10:10 Uhr
Die Schreie einer Frau hallten in den Ohren des kleinen Mädchens wider, als es sich in eine Ecke des Schrankes drückte. Die Beine hatte sie unter dem Rock so dicht an den Körper gezogen, dass ihre Muskeln sich verkrampften. Keuchend hielt sie sich die Ohren zu, Schweiß klebte auf ihrer Haut.
»Mach, dass das Schreien aufhört«, flüsterte sie vor sich hin. »Mach, dass es aufhört.«
Und dann hörten die verängstigten Schreie mit einem Mal tatsächlich auf. Unheimliche Stille breitete sich aus. Das Mädchen hob den Kopf. Unter der Tür drang Licht zu ihr herein, und in der Stille hörte sie das gleichmäßige Geräusch sich nähernder Schritte. Der Türgriff drehte sich.
»Komm raus. Komm raus, wo immer du bist.« Die Stimme klang beruhigend, sanft, dennoch furchterregend.
Der Traum hatte Kendall Shaw letzte Nacht um zwei Uhr geweckt und sie derart verstört, dass sie nicht mehr hatte einschlafen können. Nun pochte ein dumpfer Schmerz hinter ihren Schläfen.
Seit Monaten schon suchte dieser Traum sie immer wieder heim. Zunächst hatte sie es auf ihre Schulteroperation im Sommer geschoben und auf die schweren Schmerzmittel, die ihr der Chirurg verschrieben hatte. Doch inzwischen hatte sie beinahe alle Physiotherapie-Sitzungen hinter sich, und die Medikamente hatte sie einige Wochen nach der Operation abgesetzt.
Und doch nahmen die Träume an Häufigkeit und Heftigkeit zu. Immer war sie danach hellwach und verängstigt. Jedes Mal stand sie aus dem Bett auf und überprüfte Fenster und Türen. Sie waren stets verschlossen, doch das half nicht gegen die Angst.
Selbst jetzt noch ließ die Erinnerung ihren Puls rasen, und ihre Hände waren schweißnass.
»Das reicht allmählich«, murmelte Kendall und rieb sich die Schulter. »Reiß dich zusammen.« Sie griff nach dem Fläschchen Aspirin, das im Schrank neben der Spüle stand, schraubte den Deckel auf und steckte sich zwei Tabletten in den Mund. Sie spülte sie mit Wasser hinunter und stellte das Glas auf die Arbeitsplatte. »Dummer, alberner Traum.«
Seit fünf Monaten moderierte sie die Abendnachrichten von Channel 10. Die Quoten waren während dieser Zeit in die Höhe geschnellt, und es war bereits davon die Rede, dass sie ihre eigene Talkshow bekommen sollte.
Kendall sah auf ihre schmale Armbanduhr. Viertel nach zehn. Meistens erschien sie nicht vor drei Uhr im Sender. Wenn sie dann dort war, gab es ein kurzes Treffen mit den Produzenten, der Nachrichtenredakteurin, manchmal auch dem Redaktionsleiter, und mit allen anwesenden Reportern, um die aktuellen Nachrichten zu besprechen. Dabei wurde festgelegt, welcher Reporter welche Story übernehmen und welche davon in die nächste Sendung kommen würde. Anschließend erneuerte Kendall Frisur und Make-up und nahm die Vorankündigungen für die Abendnachrichten auf.
Es war noch viel zu früh, um zur Arbeit zu fahren, doch sie fühlte sich ruhelos und konnte die Ablenkung gut gebrauchen. »Nicole, ich bin weg!«, rief sie. Letzten Sommer war Kendall hinter einer Story über einen Serienmörder her gewesen, und Nicole war vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen. Beide waren durch die Hand dieser Männer beinahe ums Leben gekommen.
Die Frauen hatten einander im Krankenhaus kennengelernt und dort Freundschaft geschlossen. Als Kendall dann im November ein historisches Stadthaus in der Grove Avenue gekauft hatte, hatte sie Nicole gefragt, ob sie bei ihr einziehen wolle. Keine der beiden betrachtete es als Dauerlösung, doch im Moment wohnten sie lieber mit jemandem zusammen. Die Nächte waren weniger unheimlich, wenn man wusste, dass am Ende des Korridors noch jemand schlief.
Schritte waren zu hören, und Nicole erschien in der Tür. Ihr dunkles Haar fiel ihr über die schmalen Schultern und betonte ihre tiefblauen Augen. Sie hatte blasse Haut und volle Lippen, die sich zu einem breiten Grinsen öffnen konnten. Ihr Outfit – verspielte Bluse, Jeans, silberne Kreolen und abgetragene Stiefel – ließ ihre Künstlernatur erahnen. Im Moment war Nicoles hervorstechendstes Merkmal jedoch der gewaltige Bauch, über dem sich ihre Bluse spannte. In wenigen Wochen würde sie das Kind ihres verstorbenen Mannes zur Welt bringen.
Die Schwangerschaft war ein furchtbarer Schock gewesen, doch Nicole hatte sich entschlossen, das Kind auszutragen. Zwar war sie keine Abtreibungsgegnerin, doch sie konnte sich nicht zu einem Abbruch durchringen. Sie sprach nur selten über das Baby, und einige Male war sie bei einer Adoptionsagentur gewesen, doch bisher hatte sie der Adoption noch nicht zugestimmt.
Lächelnd blickte Nicole von der Kamera auf, die sie in den Händen hielt. In der Vergangenheit hatte sie sich an der Westküste einen Namen als Fotografin gemacht, doch bei der Flucht vor ihrem Mann hatte sie alles aufgeben müssen. Im Moment war sie dabei, ihren alten Beruf wieder aufzunehmen – mit bemerkenswertem Erfolg. »Gehst du heute früher?«
»Ich habe einen Berg Arbeit vor mir.« Kendall lächelte, während sie das sagte. Es war nicht nötig, Nicole mit verstörenden Träumen zu beunruhigen.
»Du arbeitest zu viel. Wann schaltest du mal einen Gang zurück und genießt das Leben?«
»Wer rastet, der rostet. Und außerdem bin ich nicht die Einzige, die so ranklotzt. Du hast in letzter Zeit auch ganz schön geschuftet.«
Nicole legte eine Hand auf ihren Bauch. »Mir sitzt ein Termin im Nacken.«
»Du brauchst Ruhe.«
»Ich ruhe mich doch aus.«
Kendall verdrehte die Augen. »Also bitte. Ich kenne doch deine Arbeitszeiten. Das ist nicht gut für dich und das Kind.«
Nicole senkte den Blick und überprüfte den Akku ihrer Kamera. »Ich dachte, der Schreiner kommt heute.«
Abrupte Themenwechsel waren bei Nicole nicht ungewöhnlich, wenn Kendall das Baby erwähnte. »Er hat um acht angerufen, es gab wohl ein Problem mit einem anderen Auftrag. Er kommt am Freitag.«
»Ganz schön knapp für eine Absage.«
Das sah Kendall genauso. Wäre sie heute früh besser in Form gewesen, hätte sie den Kerl zusammengestaucht. »Na ja, Handwerker lassen einen eben oft hängen.« Sie versuchte, es mit Humor zu nehmen. »Bei der Renovierung der Badezimmer im November hatte ich drei Tage Stillstand, weil ›Schwarzpulversaison‹ war, was auch immer das sein mag.«
Nicole lachte. »Jagdsaison.«
»Um Himmels willen.«
Das Haus war im neunzehnten Jahrhundert erbaut worden, und Nicole hatte es mit dem Geld gekauft, das sie von ihrer verstorbenen Mutter geerbt hatte. Es lag im Fan-Distrikt, dem historischen Viertel der Stadt, und im Grunde war es großartig mit seinen dreieinhalb Meter hohen Decken, dem Parkett, der Treppe mit dem geschwungenen Geländer, dem Stuck und den offenen Kaminen. Doch mit dem altmodischen Charme des Hauses gingen auch eine veraltete Küche und unzumutbare Badezimmer einher. Die Bäder hatte Kendall vor dem Einzug auf den neuesten Stand bringen lassen, aber bei der Küche war das nicht so einfach. Die Renovierung würde teuer werden, und sie wollte nichts übers Knie brechen. Sie hatte vor, Gäste zu bewirten, und dafür brauchte sie eine Küche. Anders als ihre Mutter, die eine wunderbare Köchin gewesen war, reichten Kendalls diesbezügliche Fähigkeiten gerade einmal für das Bedienen der Kaffeemaschine und das Anheuern eines Caterers. Doch trotz ihrer mangelnden Kochkünste war ihr klar, dass die Küche das Herz des Hauses darstellte.
Sie hatte fast den ganzen November mit dem Innenarchitekten zugebracht und danach wochenlang nach einem Schreiner gesucht. Anscheinend hatte sie einen der besten Handwerker der Region an Land gezogen; wie es hieß, war er den Aufwand wert. Bislang war sie allerdings alles andere als beeindruckt.
Nicole betrat die Küche, die Schultern gestrafft, wegen ihres vorgewölbten Bauches jedoch mit schwerfälligem Gang. »Und, für welche Küche hast du dich entschieden? Französisches Landhaus, italienisch oder ultramodern? Ich hab den Überblick verloren.«
Kendall holte ihren schwarzen doppelreihigen Mantel aus dem kleinen Flurschrank neben der Küche und zog ihn über ihr cremeweißes Strickkleid. »Französisches Landhaus.«
Nicole legte die Kamera auf die Arbeitsplatte, nahm einen Teebeutel aus einer Plastikdose und ließ ihn in eine Tasse fallen. Sie füllte sie mit Wasser und stellte sie in die Mikrowelle, dann drückte sie die Zwei-Minuten-Taste. »Du hast Stil und Geschmack.«
Kendall grinste. »Ich weiß.«
Nicole lachte. »Und bescheiden bist du auch.«
Kendall hob eine sorgfältig gezupfte Braue. »In mir ist kein Fünkchen Bescheidenheit, und das weißt du.« Sie gab gerne zu, dass sie schöne Dinge mochte.
»Das schätze ich an dir, Kendall. Du weißt, was du willst, und hast den Mumm, es dir zu holen. Wenn ich mal groß bin, will ich auch so werden wie du.«
Kendall nahm eine große schwarze Coach-Tasche von der Arbeitsplatte, gefüllt mit allem, was sie brauchte, von Make-up, Snacks und Notizblöcken bis hin zu Laptop, Diktiergerät und einem Reserveschal von Fendi. Es war ihre Survival-Tasche. »Das Leben ist zu kurz, um zu zaudern.«
Nicole dachte unwillkürlich an das Baby und wurde ernst. »Stimmt.«
Kendall war zumute, als hätte sie einem Welpen einen Tritt versetzt. Mit ihrer direkten Art war sie eine sehr gute Reporterin, aber nicht gerade eine unkomplizierte Freundin. »Und, was hast du heute vor?« Sie legte so viel Fröhlichkeit wie möglich in ihre Worte.
»Filme entwickeln.« Nicole lächelte und bemühte sich sichtlich, die unguten Gedanken abzuschütteln. »Ich hatte ein großes Shooting mit einer Familie aus der River Road, fünf erwachsene Kinder samt Eltern. Alle mit vollgestopften Terminkalendern – ein logistischer Albtraum. Aber ich habe ein paar gute Bilder zusammenbekommen. Sie werden zufrieden sein.«
»Verwendest du die Fotos für eine Ausstellung?«
»Nein, das ist nur zum Geldverdienen. Ich habe so viele bezahlte Aufträge, dass ich die Kunst vorerst auf Eis legen musste.«
»Ist das gut?«
Nicole zuckte die Achseln. »Ja und nein.«
»Und was sind deine nächsten Aufträge?«
Nicole wirkte sehr zufrieden mit sich. »Ein Porträt für einen Empfangsbereich und Werbeaufnahmen für Dana Miller, nächsten Donnerstag. Sie hat den Zuschlag für den Verkauf von Adam Aldersons Immobilien in River Bend bekommen.«
Kendall hatte schon von der Frau gehört. »Berechne ihr den Höchstsatz. Sie ist prominent und hat eine Menge Geld.«
»Es ist gut bezahlt.« Nicole presste eine Hand auf ihren Bauch.
Kendall runzelte die Stirn. »Alles in Ordnung?«
»Ja. In letzter Zeit bewegt sie sich nur ziemlich viel. Kommt wohl von dem mexikanischen Essen vor ein paar Tagen.«
Kendall spürte leichte Panik in sich aufsteigen. »Du sagst mir aber auf jeden Fall, wenn die Wehen einsetzen? Ich will nämlich nicht, dass du dein Kind auf meinem Küchenboden bekommst.«
»Das wäre blöd, besonders, wenn der italienische Marmor dann schon verlegt ist.«
Wieder runzelte Kendall die Stirn. »Ich meine es ernst. Ich möchte, dass das Kind in einem Krankenhaus zur Welt kommt, wo man sich anständig um dich kümmern kann.«
Das Signal der Mikrowelle ertönte, und Nicole nahm den heißen Tee heraus. »Keine Sorge, ich bin noch nicht so nah am Termin. Es dauert noch mindestens drei Wochen bis zu ihrem Auftritt, hat der Arzt gesagt.«
Kendall hatte sich geschworen, Nicole nicht in eine bestimmte Richtung zu drängen, was die Adoption betraf. Doch sosehr sie sich auch bemühte, es gelang ihr nicht mehr, das Thema zu meiden. »Hast du dich denn mal wieder bei der Adoptionsagentur gemeldet?«
Nicole nippte an ihrem Tee. »Nein.«
Kendall war beunruhigt. »Nicole, du darfst das nicht vor dir herschieben. Das Baby kommt auf jeden Fall. Drei Wochen, das ist nicht mehr so lange.«
»Ich weiß.«
Kendalls Stimme wurde sanfter. »Du schuldest es dir und dem Kind, dass du dir darüber klar wirst, was du willst.«
Nicole errötete und schaute zu Boden. »Ich weiß.«
Kendall seufzte. »Hey, mir ist schon klar, dass ich manchmal zu direkt bin. Und dass ich eine Nervensäge sein kann. Aber ich mag dich, und ich möchte nicht zusehen, wie du leidest. Und ich glaube, je mehr du vorausplanst, desto leichter wird es für dich sein.«
Nicole hob den Blick, in ihren Augen glänzten Tränen. »Gott, ich wünschte, ich hätte eindeutige Antworten. Ich möchte das Beste für das Kind. Ich weiß bloß nicht, ob ich der Mensch bin, der ihm das geben kann. Trotzdem schaffe ich es nicht, mich mit einem Adoptionsverfahren auseinanderzusetzen.«
Kendall dachte an das komplizierte Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter, die sie im Alter von drei Jahren adoptiert hatte. Ihr Zuhause war sehr liebevoll gewesen, doch Kendall hatte schon früh gemerkt, dass ihre Mutter nicht gern über die Adoption sprach. Selbst heute noch bewahrte Kendall Stillschweigen über die Tatsache, dass sie adoptiert war – teils aus Loyalität gegenüber ihrer Mutter, teils aus Furcht vor dem Unbekannten. »Es gibt kaum jemals Garantien. Wir alle können nicht mehr tun, als unser Bestes zu geben.«
Nicole legte den Kopf in den Nacken, um die Tränen zurückzuhalten. »Ich weiß. Du hast recht.«
»Also redest du zumindest mit der Agentur, damit du auf jeden Fall alle Möglichkeiten kennst?«
»Ja, das mache ich.« Jetzt rannen ihr die Tränen doch über das Gesicht. »Ganz bestimmt.«
Kendall legte Nicole eine manikürte Hand auf die Schulter. »Nicht weinen, Nicole. Ich möchte meinen Tag nicht mit dem Bewusstsein beginnen, dass ich eine Schwangere zum Weinen gebracht habe. Das ist ganz schlechtes Karma.«
Nicole lachte etwas zittrig und wischte sich die Tränen von den Wangen. »Keine Tränen mehr.«
»Gut. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das, Schritt für Schritt.«
»Danke.« Nicole schluckte und zog die Nase hoch. »Und wieso warst du gestern Nacht so spät noch auf?«
Kendall verkrampfte sich. Sie hatte mit niemandem über die Träume gesprochen und wollte das auch jetzt nicht tun. Die Bilder in Worte zu fassen, würde ihnen gewissermaßen größere Bedeutung verleihen. »Du hast mich gehört?«
»Ich muss jede Stunde pinkeln, schon vergessen?«
»Ach ja.« Kendall fuhr sich mit den Fingern durch das dichte braune Haar. »Es war nichts weiter, ich konnte nur nicht schlafen.«
Nicole nahm einen Schluck Tee. »Sonst schläfst du doch immer wie eine Tote.«
Als Kind konnte Kendall den ganzen Tag in Bewegung sein, hatte ihre Mutter immer erzählt. Doch sobald ihr Kopf am Abend das Kissen berührte, schlief sie ein und wachte erst am nächsten Morgen wieder auf. Das war immer so gewesen – bis letzten Sommer. »Ich weiß.«
»Was hat dich denn wach gehalten?«
»Probleme bei der Arbeit. Ich stehe wegen der Verhandlungen für die neue Show ein bisschen unter Strom. Bestimmt nur vorübergehend. Ich muss wohl das Koffein etwas reduzieren.«
»Und sonst läuft es gut beim Sender?«
»Bestens. Ich liebe die Arbeit.« Das entsprach im Großen und Ganzen der Wahrheit. Doch ihr fehlte der Kick, den ihr die Arbeit als Live-Reporterin gegeben hatte.
»Keine gefährlichen Storys mehr?«
Im vergangenen Sommer war Kendall bei der Jagd nach der Story über den »Hüter« hohe Risiken eingegangen. Damals hatte sie darauf gebrannt, dass die großen Fernsehsender auf sie aufmerksam wurden. Sie wollte einen anderen Job und fort aus Richmond. Nachdem der Hüter sie jedoch angeschossen hatte, war der Drang verschwunden, vor der Vergangenheit zu fliehen. Inzwischen war es sogar andersherum. Sie hatte begonnen, immer mehr über ihre Vergangenheit nachzudenken, und als die Stelle bei den Abendnachrichten frei wurde, hatte sie zugegriffen.
»Letzte Woche habe ich live von der Frauenmesse berichtet«, neckte sie Nicole. »Die Kaltentwachsung war echt haarig.«
Diesmal ließ sich Nicole nicht durch Kendalls Scherze ablenken. »Bist du sicher?«
»Ja. Keine schlimmen Storys mehr für mich.« Kendall schaute auf die Uhr, entschlossen, ihre Ängste beiseitezuschieben. Der Traum war nur ein Traum. »Ich muss zum Sender und mich auf die Abendnachrichten vorbereiten.«
Nicole schien zu spüren, dass sie einen wunden Punkt getroffen hatte, hakte aber nicht nach. »Klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag.«
»Wenn was ist, ruf mich an.«
»Mach ich.«
Kendall winkte Nicole zu und verließ das Haus durch die Hintertür. Ihre hohen Absätze knirschten auf dem Splitt, den sie nach dem Schneesturm auf der Veranda gestreut hatte. Vorsichtig ging sie die Stufen hinunter und über den spiegelglatten Gehweg zur Garage. Dann stieg sie in ihren schwarzen BMW, der neben Nicoles zerbeultem Toyota stand. Als sie den Motor anließ, sah sie, dass das Thermostat minus fünf Grad anzeigte.
Sie drückte auf einen Knopf. Das Garagentor glitt nach oben, sie legte den Rückwärtsgang ein und fuhr auf den schmalen Schotterweg, der die Häuser in ihrer Straße von denen in der Parallelstraße trennte. Zerstreut schaute sie hinüber zu dem leerstehenden Haus direkt hinter ihrem und zu dem Verkaufsschild am Zaun. Sie schaltete in den ersten Gang, dann beschleunigte sie und bog in die Seitenstraße.
Zehn Minuten später war sie beim Sender angelangt, stieß die Eingangstür von Channel 10 auf und winkte der Empfangsdame zu. »Hi, Sally. Wie läuft’s an der Front?«
Die blonde junge Frau hatte gerade erst ihr Journalistikstudium abgeschlossen. Sie lächelte breit. »Prima.«
»Schön.« Kendall eilte durch den Gang zu ihrem Büro, vorbei an den riesigen Fotos von ihr selbst und den anderen Moderatoren des Senders. Sie ließ die Handtasche auf ihren ordentlich aufgeräumten Schreibtisch fallen. Nachdem sie den Job übernommen hatte, hatte sie einen Maler engagiert und die Wände blassviolett streichen lassen. Sie hatte Kunstdrucke, ein paar Zimmerpflanzen und einen Orientteppich mitgebracht. Anstelle der Neonbeleuchtung benutzte sie zwei Stehlampen und eine Schreibtischlampe. Das einst sterile Büro wirkte jetzt behaglich.
Ihr Chefredakteur, Brett Newington, erschien in der Tür. »Was führt dich denn so früh hierher?«
Seine markanten Gesichtszüge, das dichte blonde Haar und sein durchtrainierter Körper verliehen ihm einen jungenhaften Charme, und genau der war Kendall vor zwei Jahren aufgefallen. Sie waren zusammengekommen, und zunächst war alles wunderbar gewesen. Sie schienen perfekt zueinander zu passen. Dann war Kendalls Mutter an Krebs erkrankt. Kendall hatte ihre Wohnung gekündigt und war zu ihr gezogen, um sie zu pflegen. Brett hatte ihr übel genommen, dass sie so viel Zeit mit ihrer Mutter verbrachte, und plötzlich hatte Kendall gemerkt, dass ein markantes Gesicht und maßgeschneiderte Hemden nicht genügten.
Sie hatte Schluss gemacht. Zunächst schien er erleichtert und hatte sogar begonnen, mit anderen Frauen auszugehen. In letzter Zeit allerdings machte er des Öfteren Anspielungen auf einen Neubeginn ihrer Beziehung, die sie nach Kräften ignorierte.
»Ich arbeite ein paar Sachen auf.«
Er sah sie argwöhnisch an. »Dann hast du es noch nicht gehört?«
»Was denn?« Sie zog den Mantel aus.
»Es wurde ein Mord im East End gemeldet. Auf dem Gelände der Alderson-Baugesellschaft an der Flussbiegung haben sie eine Leiche gefunden.«
»Wer ist denn ermordet worden?«
»Du hast also wirklich noch nichts davon gehört?«
Brett glaubte offenbar, sie habe Wind von der Story bekommen und sei früher gekommen, damit sie darüber berichten konnte. Kluger Mann. Wenn sie davon gehört hätte, hätte sie tatsächlich genau das getan. »Wer wurde ermordet?«
»Ich weiß nicht. Irgendeine Frau.«
Irgendeine Frau. Irgendeine Frau, die einen Namen gehabt hatte und ein Leben, das nun zu Ende war.
Im letzten Sommer wäre Kendall beinahe gestorben, und das hatte ihre Herangehensweise bei den Storys verändert. Sie nahm mehr Anteil am Leben der Beteiligten, deren Schicksale gingen ihr jetzt näher. »Sie wird doch einen Namen haben.«
Brett blätterte durch die Seiten, die er in der Hand hielt, als suchte er nach einer Antwort. »Bis jetzt noch nicht. Sie wurde noch nicht identifiziert.«
Im letzten Sommer wäre sie selbst beinahe irgendeine Frau gewesen. »Ich möchte das machen«, sagte sie.
»Nein. Ich brauche dich hier am Schreibtisch. Ich werde Ted schicken.«
Seine Reaktion bewirkte nur, dass sie die Story umso mehr wollte. »Ich habe wochenlang nicht mehr vor Ort recherchiert, und sogar du hast gesagt, den Umfragen zufolge mögen es die Zuschauer, wenn ich mitten im Geschehen bin. Außerdem bin ich besser darin als Ted.«
Brett kratzte sich am Kopf. »Die Leute sehen dich gerne bei Wohlfühlveranstaltungen wie bei der Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung in der City. Sie wollen nicht sehen, wie du dich an einem Tatort abmühst.«
»Mal ehrlich, sie werden doch alle einschalten, wenn sie wissen, dass ich an der Story dran bin.« Den nächsten Satz sagte sie höchst ungern. »Seit dem letzten Sommer hatte ich keine harte Story mehr, und sie werden alle wissen wollen, wie ich damit umgehe. Denk an die Einschaltquoten.«
Einschaltquoten. Das war das Zauberwort. »Warum gerade diese Story?«
Sie konnte nicht erklären, was sie selbst nicht verstand. »Ich bin wirklich gut in so etwas, Brett. Das wissen wir doch beide.«
Er betrachtete sie. »Man kann dir nur schwer etwas abschlagen.«
»Ach, komm schon. Es ist doch klar, dass du Nein sagen würdest, wenn du es für eine schlechte Idee hieltest. Und es ist eine super Idee.«
Er grinste. »Na gut, die Story gehört dir.«
Kendall ignorierte entschlossen ihre flatternden Nerven, ging zu einem kleinen Schrank und entnahm ihm ein Paar abgetragene Wanderschuhe, die sie für schwieriges Gelände griffbereit hielt. Das Land um River Bend lag brach und war jetzt schneebedeckt. »Ruf Mike an, er soll schon mal den Wagen vorheizen. Ich bin in fünf Minuten am Eingang.«
Allen beobachtete, wie sie durch die Kälte ging, den Kopf zum Schutz gegen den Wind eingezogen. Die schmalen Hände hatte sie in die Taschen ihres weiten, dunklen Mantels geschoben. Ihre Stiefel waren feucht und schlammverschmiert, der Schal um ihren Hals an den Enden verschmutzt.
Es machte ihn traurig, wenn er daran dachte, wie schwer sie für ihren Lebensunterhalt arbeiten musste. Sie rackerte sich so sehr ab.
So tapfer.
Er wusste außerdem, dass sie einsam und verängstigt war. Neulich nachts hatte er gesehen, wie sie an ihrem Schlafzimmerfenster stand und weinte. Er empfand Mitleid mit ihr. In der großen, weiten Welt war sie verloren. Sie brauchte ihre Familie.
Sie hatte Besseres verdient, genau wie Ruth. Und er beabsichtigte, ihr all das zu geben, was ihr zustand.
Bald würde sie nicht mehr allein sein. Sie würde ein Teil seiner Familie sein. Bald würde sie bei denen sein, die sie so sehr liebten.
Seine Finger kribbelten vor Aufregung. Er brannte darauf, sie zu Ruth zu bringen. Er brannte so sehr darauf, dass er Mühe hatte, den nötigen Abstand zu wahren.
Das Haus war so still, seit er Ruth fortgeschickt hatte. So einsam. Er ertappte sich jetzt oft dabei, wie er durch die Zimmer tigerte. Er verabscheute die Stille und die Art, wie der Wind die Fensterläden zum Quietschen brachte.
Ohne Ruth war das Haus nicht mehr dasselbe. Sie hatte Leben hineingebracht.
Gott, er hasste die Einsamkeit.
Er schluckte den Kloß in seiner Kehle hinunter.
Bald würde die Einsamkeit ein Ende haben.
3
Dienstag, 8. Januar, 12:10 Uhr
Der wolkenverhangene Himmel ließ Jacob in dem eisigen Wind, der durch seine Lederjacke blies, noch mehr frösteln. Er stampfte mit den Füßen, um seinen Kreislauf anzuregen und wieder Gefühl in den Zehen zu bekommen.
Der Vermessungstrupp schien die Kälte ganz selbstverständlich hinzunehmen. Die Männer hatten während des gesamten Vormittags nicht gearbeitet und völlig unbeteiligt die Polizeiarbeit beobachtet, als würde es sich um Dreharbeiten für einen Fernsehkrimi handeln. Vor einer Viertelstunde hatten sie dann ihre Verpflegung ausgepackt. Die Gruppe war durch nichts aus der Ruhe zu bringen.
So gern Jacob gegangen wäre, kam dies weder für ihn noch für Zack infrage. Sie wollten abwarten, bis Tess mit ihren Fotos und Tatortskizzen fertig war und den Leichnam für die Pathologie freigab.
Tess hatte die Taschen der Toten durchsucht und zerknüllte Papiertaschentücher sowie den Kassenzettel eines Supermarkts gefunden, jedoch nichts, wodurch man sie hätte identifizieren können. Außerdem hatte sie den Boden rund um die Leiche auf Spuren hin untersucht, war aber bisher auf nichts Ungewöhnliches gestoßen. Der Wind machte diese Aufgabe auch nicht gerade leichter; es war gut möglich, dass er Beweisstücke fortgeweht hatte. Jacob hatte den Suchradius ausgeweitet und die Polizeibeamten angewiesen, das Gebiet großflächig abzusuchen.
Tess wollte möglichst viele Spuren retten, die sich möglicherweise an der Leiche befanden. Auf ihre Anordnung hin war die Tote in einiger Entfernung vom Wasser abgelegt und in ein sauberes weißes Tuch gehüllt worden. Sobald man sie in die Pathologie gebracht hatte, würde Tess sich die Tote noch einmal vornehmen und auf Haar- und Gewebespuren untersuchen.
Mit grimmigem Gesichtsausdruck stapfte sie den Hang hinauf, die Wangen gerötet, die Lippen aufgesprungen. Unter ihrer Mütze lugten dunkle Strähnen hervor.
Jacob hob das gelbe Absperrband für sie an.
Tess tauchte darunter hindurch und streckte dann den Rücken, um die Verspannungen zu lösen, die durch das stundenlange Verharren in gebückter Haltung entstanden waren. »Danke.«
»Gern geschehen.«
Zack hatte bei den uniformierten Polizisten gestanden, kam aber nun zu ihr herüber. »Du brauchst einen starken Kaffee.«
»Ich werde mir einen holen, sobald ich in der Pathologie bin. Wenn mir wieder warm ist, schaue ich mir die Leiche noch mal an.«
Zack sah aus, als hätte er seiner jüngeren Schwester gern widersprochen, doch er wusste, dass sie es nicht mochte, wenn er sie wie ein kleines Kind behandelte. »Okay.«
»Ich habe den Leichentransport angerufen«, fügte sie hinzu. »Sie werden in ein paar Minuten hier sein.«
»Hast du was gefunden?«, fragte Jacob.
Tess schüttelte den Kopf. »Bisher nicht. Und es ist so schweinekalt, dass unser Mörder wahrscheinlich auch nicht ins Schwitzen geraten ist, als er sein Opfer abgeladen hat.«
Schweiß ergab zusammen mit Hautfett eine Mischung, die Fingerabdrücke hinterließ. Ohne Schweiß entstanden seltener Fingerabdrücke. »Tu, was du kannst.«
»Mache ich.«
Zack stemmte sich gegen den Wind. »Kannst du uns schon irgendwas sagen, Tess?«
Sie atmete hörbar aus. »Der Pathologe wird es noch bestätigen müssen, aber ich glaube, dass derjenige, der sie gefangen gehalten hat, ihr auch etwas injiziert hat.«
»Wieso denkst du, dass es der Mörder war?«, fragte Jacob. »Verkappte Süchtige gibt es in allen Gesellschaftsschichten.«
Tess rümpfte die Nase. »Die Einstiche an ihren Armen sind frisch. Und es gibt keinerlei Anzeichen für frühere Einstiche, aus denen man schließen könnte, dass sie sonst auch gespritzt hätte.«
»Sie könnten in ihren Kniekehlen sein«, bemerkte Jacob. Das war bei seiner Mutter die bevorzugte Stelle gewesen.
Tess zuckte die Achseln. »Wir werden es schon erfahren. Aber ich glaube nicht, dass sie ein Junkie ist. Sie sieht nicht danach aus.«
Viele Süchtige sahen nicht danach aus, wenn die Sucht noch nicht lange bestand. »Warum glaubst du, dass der Mörder ihr etwas gespritzt hat? Vielleicht hat sie es doch selbst getan. Hat sich vollgepumpt.«
Tess wirkte genervt. »Wie gesagt, ich glaube es nicht. Sie hat gesunde Zähne, ihre Fingernägel sind nicht eingerissen – was beides Anzeichen für fortgesetzten Drogenmissbrauch wären. Ich glaube, jemand hat sie gekidnappt, gefesselt, und zwar wahrscheinlich an einen Stuhl, mehrere Tage gefangen gehalten und mit Medikamenten vollgepumpt. Und dann hat er sie erdrosselt.«
Kurz blitzte das Gesicht des Opfers vor Jacobs innerem Auge auf, und wieder musste er an Kendall Shaw denken. Er schob den Gedanken mit aller Macht beiseite, in der festen Absicht, die Leiche nur noch als Beweismittel zu betrachten. »Irgendwelche Anzeichen für ein Sexualverbrechen?«
»Kann ich nicht einschätzen. Ihre Kleidung ist unversehrt, aber du weißt ja, dass das nichts heißen muss.«
Der Leichenwagen näherte sich über die holprige Baustellenstraße und hielt etwa hundert Meter von ihnen entfernt an. Der Fahrer ließ den Motor laufen und stieg zusammen mit einem anderen Mann aus, beide waren groß und breitschultrig.
Lässig holten sie die Trage hinten aus dem Wagen und kamen zu ihnen herüber. Tess führte sie zu der Toten, die sie inzwischen in einen schwarzen Leichensack gesteckt hatte. Der Sack war mit einem Schloss gesichert, das erst bei Ankunft in der Pathologie geöffnet werden würde. Wortlos hoben die beiden Männer die Leiche auf die Trage, trugen sie die Böschung hinauf und luden sie in den Wagen.
Zack und Jacob folgten Tess zu ihrem Auto. Sie blieben stehen, während sie den Motor anließ und die Heizung voll aufdrehte. Sie schloss die Tür, öffnete das Fenster aber einen Spaltbreit.
Sie hielt die Hände vor das Gebläse. »Mir wird wohl nie wieder warm werden.«
»Wann hast du Dienstschluss?« Zack beugte sich zu ihr nach unten.
»Um vier. Hoffentlich bin ich bis dahin fertig mit unserer Unbekannten. Ich hab Mom versprochen, den Christbaumschmuck mit ihr wegzupacken.«
Zack nickte. »Danke, dass du das machst.«
»Nächstes Jahr bist du dran.«
Zack grinste. »Nein, Malcolm. Er schuldet mir noch einen Gefallen.« Malcolm, der Bruder der beiden, arbeitete bei einer Spezialeinheit.
»Was hast du für ihn getan?«, fragte sie mit einem Lächeln.
Wieder grinste Zack. »Sagen wir einfach, er und ich haben gewettet, und er hat verloren.«
Tess lachte herzhaft. »Etwas, das ich wissen sollte?«
»Nein«, erwiderte Zack.
Jacob beneidete die Geschwister um ihr entspanntes, vertrautes Verhältnis. Er selbst hatte so etwas nie kennengelernt. Sein Vater hatte sich noch vor seiner Geburt aus dem Staub gemacht, und Jacob hatte keine Geschwister. Seine Mutter war drogen- und alkoholabhängig gewesen, als Kind hatte er für sie nur eine Last bedeutet. Als Jacob zwölf gewesen war, hatte ein gutherziger Mann namens Pete Myers ihn aufgenommen und ihm ein echtes Zuhause gegeben. Im letzten Sommer hatte sich allerdings herausgestellt, dass Pete ein zutiefst gestörter Mensch gewesen war.
Verdammt. Auch mit viel Fantasie hätte Jacob sich keine schlimmere Lebensgeschichte für sich selbst ausdenken können.
Zack und Tess wechselten noch ein paar Worte, dann kurbelte sie das Fenster hoch. Der Leichenwagen fuhr davon, und Tess folgte ihm mit ihrem Transporter.
Zack rieb die Hände aneinander, um sie aufzuwärmen. »Ich fahre zurück ins Büro.«
»Ich komme gleich nach. Ich will nur noch mal den Tatort abgehen.« Jacob brannte darauf, in seinen Wagen zu steigen und die Heizung anzustellen, doch der Ort ließ ihn nicht los. Noch nicht.
Zack war gerade aufgebrochen und Jacob auf dem Weg zurück zum Fluss, als er jemanden fragen hörte: »Wer ist hier der Verantwortliche?«
Die Stimme war tief, zornig und klang äußerst anmaßend.
Jacob drehte sich um und zog die geballten Fäuste aus den warmen Taschen. Vor der Absperrung stand ein Mann, der einen dunklen Anzug und darüber einen eleganten Mantel trug. Man brauchte keinen Harvard-Abschluss, um zu erkennen, dass Anzug und Mantel mehr gekostet hatten, als Jacob in einem Monat verdiente. Der Mann war nicht sehr groß, höchstens eins fünfundsiebzig, und trug das braune Haar zurückgegelt. Am kleinen Finger seiner linken Hand glitzerte ein Goldring. Der Kerl wirkte aalglatt.
Mit energischen Schritten ging Jacob auf den geschniegelten Typ zu. Er war in Streitlaune und brauchte ein Ventil für seine innere Anspannung. »Kann ich Ihnen helfen?«
Der Mann hob eine Braue. »Sind Sie hier zuständig?«
Wieder trieften seine Worte vor Überheblichkeit. Jacobs Nackenhaare stellten sich auf. Er hatte nichts gegen Fragen, aber Arroganz konnte er nicht ausstehen. »Ich bin Detective Jacob Warwick. Ich leite die Ermittlungen in diesem Mordfall.«