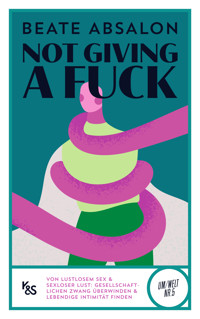
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Endlich keinen Sex mehr! Der Druck, großartigen Sex haben zu müssen, ist heute allgegenwärtig. Beate Absalon lädt dazu ein, ihn abzuschütteln und Möglichkeiten eigensinniger und erfinderischer Lust auszuloten. Der Sex kann einem leidtun. Er wäre ein Refugium für gegenseitiges Wohltun und nutzlose Verrücktheiten – aber er ist zum verkrampften Projekt geworden, das unbedingt gelingen muss, damit auch wir als gelungen gelten, selbst da, wo wir es queer-feministisch schon besser machen. Doch Sex ist nicht die Antwort auf die Frage, womit sich Sex befreien lässt. Auf der Suche nach Entstressung blickt Beate Absalon kulturhistorisch fundiert auf die abgeschiedene, aber nur vermeintliche Gegenseite des Sexuellen: Unlust, Asexualität, Zölibat und Dysfunktion, die der sexuellen Dienstpflicht genüsslich den Gehorsam verweigern und unerhörte Spielräume öffnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UM/WELTNR.5
BEATE ABSALON
NOT GIVINGA FUCK
VON LUSTLOSEM SEX & SEXLOSER LUST –
GESELLSCHAFTLICHEN ZWANGÜBERWINDEN & LEBENDIGEINTIMITÄT FINDEN
Inhalt
Einleitung
Einladung zur Inventur
Warum Sex?
Botschaft für die Impotenten
Alles kann, nichts muss. Experimentierfelder nicht_sexueller Befreiung
Krise als Chance
Alles muss, nichts kann. Zwangssexualität verstehen
Über Sexualität hinaus, über Asexualität hinaus
Es liegt nicht an mir – es liegt an dir!
Desexualisieren ist auch keine Lösung
Rezept für eine nicht_sexuelle Befreiung
Feministisches Zölibat
Lustig, sage ich zur Unlust,
alles lässt sich auf Französisch dekonstruieren,
ein ‚dé(s)‘ vorm Wort genügt,
déréalité, désintérêt, désamour –
Nur dich bekomme ich so nicht aus dem Weg geräumt, dédésir,
stottere ich,
je te dédésire,
ich unbegehre entbegehre abbegehre dich.
kein großer Verlust!
ich geh mich verlustieren!
– Odile Kennel, „Lust“
Einleitung
UNLUSTIGER SEX, SEXLOSE LUST
„Ronnie, ich denke, du bist nur wegen der Seilrutsche hier“, enttarnt die Bachelorette der Datingshow Summer Loving einen der Kandidaten. Während alle anderen Männer mit ihren Sixpacks und Verführungskünsten um die Gunst der attraktiven Junggesellin buhlen, scheint Ronnies einziges Begehr darin zu liegen, sich möglichst oft mit der Seilrutsche in den Pool der Villa zu schwingen. Die Elimination würde sein Herz brechen. Ronnie und die Zipline, das ist die wahre Romanze des Sommers.
Zu schön, um wahr zu sein. Die Szene ist in Wirklichkeit ein Sketch aus der Comedy-Sendung I Think You Should Leave und verpasst den Begehrensstrukturen von Reality-TV-Sendungen einen Knick. Sonst dreht sich in ihnen alles um das hochgeschaukelte Drama von Paarungswilligen, die bei ihrer Traumpartnersuche viel rummachen, eifersüchtig werden, Rivalitäten auskämpfen. Entscheidendes Kriterium: Sexappeal. Doch warum sollte gerade der die höchste Anziehungskraft haben? Warum nicht eine ebensolche Obsession hegen für die Seilrutsche samt vergnüglichem Platscher ins kühle Nass? Wie unverschämt, den Sex nicht so wichtig zu nehmen. Wie unanständig, ihm seine Strahlkraft streitig zu machen. Wie queer, etwas anderes noch anziehender zu finden. Der Sketch wirkt auf mich wie Eukalyptusbalsam. Erfrischt atme ich auf. Anscheinend liegen mir die banalen Hyperinszenierungen von der Alleinherrschaft des Sex schwer auf der Brust. Die Parodie pustet das frei, indem sie so herrlich irritierend mit dem Erwarteten bricht. Und sie erwärmt auch mein Herz und spendet Trost.
Ronnie, ich fühl’s! Seilrutschen sind geil. Und von genau dieser anarchischen Lust will ich mehr sehen. Mehr Bilder, mit denen dem Big Player Sex Konkurrenz gemacht wird, unbeeindruckt von seinem mächtigen Gravitationsfeld, das sonst immer alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. So geizig, der Sex. Dabei wird über die Lust doch genau das Gegenteil gesagt, dass sie richtungslos wuchere und schäume, mit allem und allen was am Laufen habe. Wo sind ihre Spendierhosen hin?
Ich mache mich auf die Suche. Mit Ronnies libidinöser Besetzung der Seilrutsche beginnt meine Sammlung seltener medialer Bilder, mit denen sich ein solcher Sturm auf die Bastille und eine Demokratisierung der Gelüste ausmalen lässt. Bilder der Gehorsamsverweigerung, bei der scheinbar folgerichtigen Aktionsketten sexueller Verlaufsformen nicht gefolgt wird. Denn in der abgelatschten Ordnung des Sex steht alles immer schon fest: Lernen sich zwei kennen, läuft es unweigerlich auf was sonst als Übereinanderherfallen hinaus und ebenso klar ist die Hölle los, wenn einer es aber mit wem anderen macht, vor allem, wenn dabei ein Penis in einer Vagina landet, denn das ist die alles entscheidende Königsdisziplin, deren Fehlen ebenso untrügliches Zeichen einer dem Untergang geweihten Beziehung ist. Wer auch immer diese Gesetze festgelegt hat, kaum jemand bringt ihre Absurdität besser auf den Punkt als die Dragqueens Trixie Mattel und Katya, deren Job darin besteht, Datingshows zu kommentieren. Bereits Fremdküssen gleicht da einer nationalen Krise. Dabei müssten die Skandale eher so klingen: „Du hast seine Wäsche gemacht?!“, „Du hast sie zum Flughafen gefahren?!“ Drücken nicht eher solche Handlungen wahre Intimität und Verbindlichkeit aus? „OK, du hast mein Haus abgefackelt – das ist verzeihlich. Aber eine andere Frau küssen? Ich will dich nie wieder sehen!“, gaukeln sie weiter.
Liegt das Problem mal wieder an der ganzen Misere unserer heteronormativen Kultur? Mein Appetit nach anderen Bildern führt mich zu LGBTQ-Erotica, mit ihrer wohltuenden Vielfalt an Geschlechterkonstellationen, Körperformen und sexuellen Spielarten. Doch stillen auch die queeren Inszenierungen meinen Hunger nicht. Denn es geht mir nicht um Variationen, ob nun boy meets girl, girl meets girl oder polycule meets nonbinary unicorn. Solange sich auch hier nur in neuem Gewand der Platzhirsch Sex breitmacht, interessiert mich das nicht. Es geht mir um Grundlegenderes: um die Dezentralisierung des Sex im intimen Miteinander. Wie kann diese gelingen?
Eher zufällig stolpere ich über die Fundstücke, die es mir antun und in meinem kontrasexuellen Archiv landen. Hier ein ausführlicher Einblick in die Vielgestaltigkeit meiner liebsten Exemplare: Clips aus Amateurpornografie, in denen das Liebesspiel unterbrochen wird, weil etwas getrunken werden muss, die beiden kurz miteinander abchecken, wie es ihnen geht, dann aber in ihrer Unterhaltung abschweifen und vergessen, worum es hier „eigentlich“ geht – und dann nur noch zärtlich plauschend im Bett liegen, zu faul, die Kamera auszuschalten. Dazu passt der Ansatz von Andy Warhol, der einmal sagte, dass Sex im Bett nicht schlecht sei, aber: „unter der Bettdecke liegen und Witze reißen ist das Beste. ‚Wie es für mich war? Gut, du warst heute Abend wirklich umwerfend lustig!‘ Wenn ich heute noch zu einer Dame ginge, würde ich sie wahrscheinlich dafür bezahlen, mir Witze zu erzählen.“
In meiner Sammlung landet auch die Instagram-Story von zwei Freundinnen, die beschließen, zusammenzuziehen und füreinander die primäre Bezugsperson zu sein, Finanzen sowie Aufgaben im Haushalt und der Kindererziehung zu teilen. Eventuelle Partner müssen sich an ihre „Freundinnen-Ehe“ als zweite Geige anpassen. Das Entscheidende: Es ist keine lesbische Beziehung. Sie sind Freundinnen. Mein kleines Archiv enthält eine Folge der Sitcom Broad City, in welcher die Protagonistin Ilana den NBA-Basketballspieler Blake Griffin abschleppt, mit dem Ziel, eine heiße Nacht mit ihm zu verbringen. Aufgrund seines großen Penis ist den beiden der Koitus zwar unmöglich. Doch statt zu verzagen, denken sie sich ein Potpourri an Nicht-Sex-Sex aus: Er sitzt nackt mit ausgebreiteten Armen auf dem Bett und Ilana schleckt den ganzen Weg vom Finger über den Arm, Rücken, hin zum anderen Finger entlang, wie eine Schnecke, die eine Schleimspur hinterlässt. Er liegt mit dem Rücken auf dem Boden, die Füße in die Luft gestreckt, sie balanciert darauf und scheint wie ein Vogel über ihm zu fliegen. Die nächste Szene zeigt Griffin, der die wie ein Kleinkind in ein Laken gewickelte und heulende Ilana in seinen Armen wiegt, nur um daraufhin gegen sie das Fingerklopf-Schulhofspiel zu spielen, bei dem der eins auf die Finger bekommt, der nicht rechtzeitig die Hand wegzieht. Nach Meditation und Dehnung zeigt das große Finale Griffin auf allen Vieren mit Ilana auf seinem Rücken durch das Zimmer krabbeln, während beide „Oh ja, ich komme gleich!“ stöhnen.
In meiner Sammlung finden sich Workshopbeschreibungen der sexpositiven Szene, welche das Selbstverständnis der Szene auf den Kopf stellen, wie die Bore-gy der Performancekünstlerin Anna Natt, die das Experiment einer möglichst gelangweilten Orgie wagt, in der man den Luxus genießt, sich gerade jenen zuzuwenden, mit denen die Chemie nicht stimmt und nichts in Fahrt kommt.
Ich sammle Zitate: „Das große Geheimnis über Sex ist, dass die meisten Leute ihn nicht mögen“ (Leo Bersani). „Viele Menschen haben ihre tiefgreifendsten Erlebnisse mit den Sexualakten, die sie nicht ausführen oder gar nicht Wirklichkeit werden lassen wollen“ (Eve Kosofsky Sedgwick). Auch Songtexte landen hier, wie Okay Kayas Replik auf den Kuschelrock-Hit Sexual Healing, dem sie mit Asexual Wellbeing begegnet. Ein Song darüber, eine mittelmäßige Liebhaberin zu sein, was ermöglicht, auf Heilsversprechen verzichten und sich stattdessen auf ihr Gegenüber wirklich einlassen zu können.
Auch viele TikTok-Funde habe ich gesammelt. Videos, in denen die Ausführung einer Influencerin, die gerade ansetzt zu sagen: „Das solltest du tun, wenn du mit einer Frau intim werden möchtest“, unterbrochen wird mit einem simplen „Nein, danke“ und darauf folgen dann begeisterte Erklärungen zu einem ganz anderen, meist nerdigen Thema, wie dem Aufbau eines Flugzeugs.
In einem meiner liebsten Videos spielen zwei Musiker George Michaels Pop-Ballade Careless Whisper – bekannt für das passionierte Saxofonsolo – nur dass der Keyboarder die Grundmelodie spielt, während der Saxofonist regungslos danebensteht. Verfolgt man, wofür dieser Sound von anderen TikTokern verwendet wird, fällt auf, dass die Sax-Abwesenheit des Songs wunderbar Anekdoten der Sex-Abwesenheit untermalt. Asexuelle Personen illustrieren damit, wie sich Sex für sie anfühlt, was sie beim Schauen einer heißen Filmszene (nicht) empfinden oder warum sie beim Mädelsabend nicht verstehen, was das aufgeregte Reden über Datingdetails soll. Auffällig sind dazwischen immer wieder Uservideos, die den Witz irgendwie nicht verstehen und den Song als Einladung zur Karaoke auffassen, weil sie selber das Saxofon dazu spielen. Als könne die Lücke nicht für sich stehen, als müsse sie sogleich gefüllt werden.
Wir sind alle sexuelle Wesen, die Sex haben, die ihn wollen, und die ihn auch haben und wollen sollten, sonst stimmt etwas nicht mit uns. Diesen Satz zu hinterfragen, das ist das Interesse dieses Buchs. Weil er zu mehr Frust als Lust führt, will ich nach Auswegen suchen. Will das Thema entkrampfen und Druck rausnehmen. Will mich nicht nur für die Freiheit einsetzen, sich sexuell ausleben zu können, wenn man das denn möchte, sondern auch für die Freiheit, keinen Bock haben zu dürfen. Will verstehen, wie es dazu kam, dass Sex zu einer schier unumgänglichen Selbstverständlichkeit wurde, der eine so große Bedeutung beigemessen wird. Warum wird darum so viel Aufhebens gemacht? Wen interessiert das? Wer profitiert davon? Es wird so getan, als würde ohne Sex etwas Wichtiges fehlen und ein Vakuum entstehen. Doch aus meinen Fundstücken, die sexy sind, aber den Sex ins Off verweisen, sprudelt mir statt gähnender Leere eine ganz eigene Fülle entgegen.
Überhaupt: Was ist eigentlich Sex? Ich meine es ernst, auch wenn es nach der Gretchenfrage klingt, die Kinder ihren Eltern stellen und dann speist man sie mit „wenn zwei Erwachsene sich sehr lieb haben…“ ab. Doch wie würdest du diese Frage hinreichend beantworten? Ich merke jedenfalls, wie viel Unschärfe bei diesem scharfen Thema herrscht. Wir reden meist so, als sei klar, was damit gemeint ist. Aber sind jetzt die Reibungen bestimmter Körperteile entscheidend oder das Auftauchen von Gefühlen wie Geilheit oder Scham? Wo fängt Sex an, wo hört er auf? Geht es beim Reden über Sex eher um Fortpflanzung oder um Erotik, um Obszönitäten oder Intimitäten? Wofür steht Sex und welche Bedürfnisse soll er stillen? Die Ungenauigkeit möchte ich nicht loswerden, im Gegenteil. Ich finde, sie gehört unbedingt dazu. Zumindest wird sie meinen Erfahrungen mit Sex gerechter als pseudo-exakte Definitionen.
Deswegen werde ich auch auf den nächsten Seiten den Weg des Herantastens und Umkreisens gehen, will das Thema nicht erobernd besteigen und penetrieren, keine Aussagen über die Wahrheit des Sex treffen. Wenn ich von Sex spreche, dann meine ich zudem nicht den Sex im Singular, sondern gehe vom Plural aus. Nicht unbedingt, um die vielen Homo-, Hetero-, Bi-, Pan- und weiteren Sexualitäten zu umfassen, sondern um auf verschiedene Einstellungen gegenüber Sex einzugehen. So wie der japanische Künstler Hokusai in seiner Holzschnittserie mit 36 Ansichten des Berges Fuji zeigt, dass Fuji anders erscheint, je nachdem, von wo aus man auf ihn blickt, möchte ich verschiedene Perspektiven auf Sex einnehmen und ihre Wirkungen befragen.
Meinen Blick lasse ich vor allem dort verweilen, wo an Sex Glücks- und Erlösungsversprechen geknüpft werden, die ihn ironischerweise ungenießbarer machen. Von dieser Warte aus betrachtet wird behauptet, er sei die schönste Nebensache der Welt. Wenn ich mich jedoch umschaue, leben wir noch nicht in einer Welt mit erotischem Grundeinkommen für alle. Eher macht die verbreitete fun morality aus der Möglichkeit sexuellen Vergnügens eine Pflichtübung, die im Allgemeinen zu mehr Stress als Spaß führt.1
Was tun? Es lohnt der Blick auf die vermeintlichen Rückseiten dessen, was als gewöhnliches, gesundes und gelungenes Sexualleben gilt:
•Asexualität als eigenständige sexuelle Orientierung, bei der kaum oder „keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen und/oder kein Verlangen nach sexueller Interaktion“2 empfunden wird;
•Freiwillig gewählte Lebensformen ohne normatives Streben nach sexuellen Handlungen, wie Abstinenz als asketische Enthaltsamkeit oder Zölibat als performativ abgelegtes Gelübde im Einklang mit persönlichen, spirituellen oder politischen Werten;
•Sexuelle Rezession als gesellschaftliches Gegenwartsphänomen, das auch als Entsexualisierung, Postsexualität oder Collective Turn-off bezeichnet wird und beschreibt, dass die neuen Generationen statistisch gesehen weniger Sex haben als zuvor und/oder dass die individuellen Symptome sexueller Lustlosigkeit zunehmen3;
•Sexuelle Probleme, verstanden als medizinische Diagnosen über „Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der sexuellen Funktion“, die bei lang anhaltender „Dauer, Symptomschwere und Leiden“ unterteilt werden in „Dysfunktion des sexuellen Verlangens und der sexuellen Erregung, Dysfunktion des Orgasmus, ejakulatorische Dysfunktion, sexuelle Schmerz-Penetrations-Störung“.4
Alle diese Aspekte gelten gemeinhin als Abweichungen von einer Norm, die sich dadurch auszeichnet, dass Menschen begehren, regelmäßig Sex haben und ihn funktionstüchtig performen können. Für alle diese Aspekte wird deswegen nach Ursachen und Lösungen gesucht oder sie gelten, wie die Enthaltsamkeit, als hochstilisierte oder beargwöhnte Besonderheit. Verglichen mit meinem Vorschlag, Sex zu betrachten wie Hokusai den Berg Fuji, ist das so, als gelte nur eine Perspektive auf Fuji als richtig, was aus den anderen Blickwinkeln bloß verzerrte, ungenügende oder missglückte macht. Doch machen sie alle den Berg respektive Sex aus, sind nicht von ihm wegzudenken. Was als normaler Sex gilt, ist nicht der eigentliche Sex, sondern die Ausrichtung auf das Ideal eines So-soll-es-sein-Sex. Sich für seine Andersheiten zu interessieren, ohne sie abzuwerten, ermöglicht einen umfassenderen Rundumblick, mit dem sexuelle Normalität ent-normalisiert und Andersheit bedingungsloser akzeptiert wird.
Das ist eine von vielen Taktiken für eine diskriminierungsfreiere Haltung, von denen auf den nächsten Seiten noch weitere ausfindig gemacht werden. Nicht normal funktionieren müssen. Den Anspruch der Fehlerfreiheit als Fehler enttarnen. Gesellschaftliche Vorgaben hinterfragen und entgiften. Ihr schimpft uns prüde? Dann gründen wir den Club der Proud Prudes, die wir uns leidenschaftlich für solidarisches Miteinander einsetzen und unsere Unabhängigkeit vom sexuellen Belohnungs- und Bestätigungssystem genauso genießen wie die Gemütlichkeit unserer leicht ausgeleierten, niemals wie Dessous zwickenden Baumwollunterhosen.5 Danke, nein, uns geht es hier im Abseits ganz gut.
Solch ein Zugang, mit dem die als Mängel bewerteten Unterschiedlichkeiten angeeignet werden „ohne den Anspruch, diese verbessern, fördern oder an ihnen rumdoktern zu müssen“, ist von „großer politischer Sprengkraft“, wie es die Inklusionsforscherin Mai-Anh Boger schreibt. „Er gibt einem Hoffnung, er flüstert einem zu: ‚Das andere Leben kann genauso wundervoll sein.‘“6
Für mich ist diese Perspektive wegweisend in Richtung eines utopischen Entwurfs sexueller Freiheit. In den vielen Aufbruchsbewegungen für größeren sexuellen Wohlstand fehlt mir die Aufmerksamkeit für die vermeintliche Kehrseite des Sexuellen. Wir halten zu sehr an den konventionellen Auffassungen eines guten Lebens fest, in denen Sex als ein Projekt behandelt wird, das sich so lange bearbeiten lässt, bis es endlich gelingt und erfüllt ist – und einem in dem Zuge das Gefühl gibt, auch selber gelingend und erfüllt zu sein.
Deswegen lautet die Hypothese meines Vorhabens: Das Leiden an Sex werden wir nicht los, indem wir Sex meistern, sondern indem wir lernen, an Sex zu scheitern. An dem Sex, der als unabdingbares Erfordernis gilt. An dem unser Wert gemessen und unsere Identität festgelegt wird. Der vor Bedeutung nur so trieft. Der unsere Aufmerksamkeitsressourcen zieht, uns mit anderen vergleichen und in einer Optimierungsschleife verfangen lässt. Kein großer Verlust, wenn da die Lust flöten geht. Und dann wage ich auch vorzuschlagen: Wenn es eh nicht klappt, kein Verlangen da ist oder der Penis zu schlaff – then that’s the way to go! Alles gut.
Klar, du kannst die blaue Pille nehmen, mit der „die Geschichte endet, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst“ – die Szene aus The Matrix drängt sich hier auf. Jedenfalls führt der lebendigere Weg heraus aus den Simulationen des ordnungsgemäßen Happy-End-Sex vielleicht eher mitten durch die Impotenz, durch das verminderte sexuelle Verlangen, durch die Orgasmusschwierigkeiten oder andere Probleme. Ich weiß, dass viele Menschen von diesen Umständen konkret betroffen sind und sich Abhilfe wünschen, gern auch mit einem möglichst einfachen Rezept. Niemandem möchte ich das absprechen. Nur frage ich mich, was den Leidensdruck überhaupt bereitet: Liegt das Problem am Sex und seinen Holprigkeiten oder eher an einer Gesellschaft, die nicht dazu befähigt, einen respektvollen und entspannten Umgang mit sexuellem Scheitern – was dann streng genommen keines mehr wäre – zu pflegen? Ich spreche vom Befähigen, Pflegen und Lernen, weil es ein Vermögen ist: Auch das Nicht-Können will gekonnt sein.
Im Gegensatz zur Bedeutung in der Sexualmedizin hat der Begriff Impotenz in der abendländischen Philosophie beispielsweise viel mit Potenz zu tun. Denn es gibt die Fähigkeit, etwas zu tun, aber auch die Fähigkeit, etwas zu unterlassen, auszuhalten oder über einen Mangel zu verfügen – ob man das nun freiwillig wählt oder ob es sich gegen die eigenen Wünsche so ereignet. „Potent ist das, was das Nichtsein empfängt und sein lässt“, beschreibt es Giorgio Agamben.7 Etwas darf geschehen, muss aber nicht. Darf sein und darf auch nicht sein.
Impotent im gängigen Sinne ist also viel eher, wer die Schlaffheit nicht aushält. Wer sich nicht erlaubt, keinen Sex zu haben. Wer seinen Möglichkeitsraum paradoxerweise gerade durch obligatorisches Enhancement verkleinert. Potent ist hingegen, wer sich auch einfach mal in Ruhe lassen kann. Körper und Sex machen nicht immer, was von ihnen verlangt wird. Was, wenn wir auf ihre Widerspenstigkeiten einen zwar nicht beschönigenden, aber schonenden Blick werfen? Vielleicht sind sie auf unserer Seite? Vielleicht wollen sie uns etwas mitteilen? Vielleicht lehnen sie sich für uns gegen etwas auf? Vielleicht geraten wir dank ihnen neben die erstrebte Spur und damit in interessante Gefilde?
Wer also auf den folgenden Seiten einen klassischen Ratgeber erwartet, der durch Symptombekämpfung verspricht, wieder Schwung in die Kiste zu bringen, sei vorgewarnt. Wer aber das Therapeutische nicht als eine „Wiederherstellung des kranken Körpers zur Normalität, sondern als eine Anbindung des Seins an das, was möglich ist“ versteht, wie es die Künstlerin Valentina Desideri in ihrer „Fake Therapy“ vorschlägt, dem*der hoffe ich, mit diesem Buch zu helfen.8 Und schließlich sei unbedingt angemerkt, dass nicht alle am Anderssein leiden. Für einige Menschen ist Sex einfach nicht der Rede wert. Und von ihnen ist viel zu lernen.
Eine große Rolle spielt Sex allerdings in meinem Engagement in der queer-feministisch-sexpositiven Szene. Sie ist der Nährboden für dieses Buch, gerade weil ich zu ihr in einem zwiespältigen Verhältnis stehe, das ich in Worte fassen und ordnen muss. Als schillerndes Wort ist Sexpositivität längst in der Mitte der Gesellschaft angelangt und sagt vieles, ohne dass immer klar ist, was es meint. Ursprünglich versteht sich Sexpositivität als progressive Graswurzelbewegung, die sich für einen toleranten Umgang mit sexueller Vielfalt in Bezug auf sexuelle Praktiken, Orientierungen und Identitäten einsetzt. Irgendwo zwischen Empowerment, Hedonismus und Aufklärung finden Fetischparties, Pornfilmfestivals, vaginale Selbstuntersuchungen, Prostatamassage-Workshops, Play- fighting, Lesungen erotischer Geständnisse, Dyke-Märsche, BDSM-Treffen, Sexarbeit-Stammtische, Gesprächsrunden über konsensuelle Nicht-Monogamie, Informationsangebote zu sexuell übertragbaren Krankheiten, Tempelnächte, Begegnungen in Swingerclubs, Darkrooms oder beim Cruising statt, um nur ein paar Steinchen eines riesigen Mosaiks zu nennen. Meist gelten bei diesen Veranstaltungen verbindliche Standards, die das Wohl der Teilnehmenden wahren sollen, wenn beispielsweise zum Gebrauch von Verhütungsmitteln oder dem Gestalten einer achtsamen und Grenzen wahrenden Atmosphäre gegenseitiger Einvernehmlichkeit angehalten wird.
Das Wort sexpositiv verrät eine dem Sex gegenüber aufgeschlossene, gastfreundschaftliche und enthusiastische Einstellung. Sex ist etwas Gutes. Diese Haltung muss als Gegenentwurf zu einer als sexnegativ betitelten, konservativen Gesellschaft verstanden werden, die Sex gegenüber feindlich eingestellt ist und ihn unterdrückt. Damit hätten wir es mit zwei Lagern zu tun: Pro-Sex vs. Anti-Sex. Aber ist Sex immer positiv? Was, wenn Sexnegativität sich gegen schlechten, gewaltsamen oder machtdurchtränkten Sex wendet? Wäre Sexnegativität dann nicht positiver als Sexpositivität? Schreckt das Feiern von sexuellem Ausdruck diejenigen ab, für die Sex eine schwierige Angelegenheit ist, aber die deswegen noch lange nicht in sexverteufelnden Kreisen gut aufgehoben wären? Baut es Druck auf, dass Sex stattfinden sollte – vom Verbotenen zum Gebotenen? Und wie nützlich ist noch die Kampfansage, Sex zu befreien, wenn doch allenthalben zu ihm ermuntert wird?
Man verliert den Überblick. Bezeichnungen verlieren im inflationären Gebrauch an Präzision. Mit meiner Sortierarbeit möchte ich Orientierung und Begriffsalternativen anbieten, damit sexpositiver Aktivismus nicht ins Einseitige kippt und in einem bösen Erwachen festgestellt werden muss, mit dem Feind im Bett gelandet zu sein, wenn die Aufrufe zum freien Sex gefährlich ähnlich klingen wie die neoliberalen Imperative zum Genießenmüssen, zur egozentrischen und entsolidarisierenden Selbstverwirklichung.
Um den Bogen zurück zu Ronnies Seilrutsche zu spannen: Die lustigste Erkenntnis aus den letzten Jahren, in denen ich nun Workshops zu sexuellen Spielformen gestalte, ist, dass Sex auch hier nicht der Star der Show ist. Er ist wie Tofu, ein super Geschmacksträger für das, was die sexpositiven Räume spicy macht: Läuternde Erkenntnisse in unbequemen Gruppenprozessen. Bei Rollenspielen dem Glück frönen, endlich nicht man selber sein zu müssen. Magische Momente der Schwarmintelligenz, wenn alle so aufeinander eingestimmt sind, dass das Miteinander wie eine einstudierte und gleichzeitig überraschende Choreografie wirkt. Wenn die Leute merkwürdiges Zeug miteinander anstellen: aus Langeweile gekoppelt mit überschüssiger Energie ein Kostüm aus Bettlaken zaubern, das fünf Menschen in eine Art Raupe verwandelt, die eine Runde durch den Playspace dreht. Alltagsobjekte in orgasmische Tools verwandeln: mit einem großen Malerpinsel den ganzen Körper abstreichen. Tränen kullern lassen, wenn einander lange genug in die Augen geschaut wird. Wenn man nur die Hände einander begegnen lässt, die wie kleine Tierchen mit Eigenleben anfangen, Tänze bis hin zu Orgien aufzuführen. Wenn einem jemand erlaubt, seine Glatze abschlecken zu dürfen. Ist das Sex?
Wer an solchen Workshops teilnimmt, will es nicht nur treiben, sondern ist von Sex umgetrieben. Vorbehalte klingen anfangs meist so: Was, wenn es mir zu sexuell wird? Was, wenn ich keinen hoch bekomme? Muss ich bei allem mitmachen? Ist es okay, sexuell unerfahren zu sein? Was, wenn ich mich schäme? Und nach den Workshops dreht sich das Feedback oft darum, wie unangebracht diese Sorgen waren. „Ich muss ja gar nix liefern!“ Sie haben sich neu zu Sex positioniert, also wirkt er auch anders. Leistungs- und Normsex tritt in den Hintergrund und lässt im Vordergrund ein spielendes Miteinander aufscheinen, bei dem weniger Auswendiggelerntes abgespult wird, um mehr zu verweilen im sinnoffenen Zwischenraum des „Was stellen wir jetzt miteinander an?“ Eine gewisse Aufregung, Verlegenheit und Ungewissheit gehört dazu. Mehr noch: Sich in sie hinein zu entspannen, lässt es knistern. Sie fordert uns auf, aus den gerade wirklich anwesenden Impulsen, Wünschen und Bedürfnissen gemeinsam zu basteln, was vielleicht noch nie zuvor jemand „Sex“ genannt hat. Nicht, um möglichst kreativ zu kopulieren, sondern um sich auf das einzulassen, was gerade möglich und stimmig ist.
Solche Lichtblicke des unerhört erfinderischen, sich selbst und den anderen gegenüber aufrichtig bleibenden Do-It-Yourself-Sex bleiben aufblitzende Momente, Polarsterne, nach denen ich mich ausrichte, gerade weil sie sich nicht immer einstellen. Zugegebenermaßen berichte ich zudem aus einer Nische, sogar einer verwinkelten Ecke innerhalb dieser Nische, weil es sexpositive Veranstaltungen gibt, deren Mehrwert gerade darin besteht, gleich zur Sache zu kommen. Wieder wird deutlich, wie unklar die Rolle des Sex nicht nur im Mainstream, sondern auch im Underground ist.
In meiner Arbeit kämpfe ich immer wieder damit, über die ungenaue und missverständliche Einsilbigkeit dieses Signalworts hinweg beschreiben zu müssen, worum es geht: nicht unbedingt um Sex, aber eben auch nicht nur um sein Gegenteil oder seine Abwesenheit, denn es braucht die Tofu-Grundlage, und es ist wichtig, das Kind beim Namen zu nennen. Nur hängen an dem, was gängiger Weise Sex genannt wird, vorschreibende und einschränkende Erwartungen, Ansprüche und ein schwieriges Erbe. Dagegen sind nicht einmal queer-feministische Szenen immun, sondern sie sind sogar ziemlich anfällig dafür. So sehr es mir ein Fest, ein Privileg und auch ein politisches Anliegen ist, mich in ihnen austoben zu dürfen, bezeichne ich mich und meine Vorhaben nicht als sexpositiv. Als einseitiges feministisches Emanzipationsprojekt bleibt Sexpositivität unbefriedigend. Wir müssen sie anreichern. Was das heißt, wie das geht, und warum das nicht nur eine kleine, hippe Bubble, sondern uns alle angeht, wird in den folgenden Kapiteln entfaltet.
1 Der soziologische Begriff der „fun morality“ bezeichnet nach Martha Wolfenstein eine in Wohlstandsgesellschaften verbreitete Einstellung, nach der „Spaß, der früher verdächtig oder gar tabu war, zur Pflicht wird. Anstatt sich schuldig zu fühlen, weil man zu viel Spaß hat, ist man geneigt, sich zu schämen, wenn man nicht genug hat.“ Vgl. Martha Wolfenstein: The Emergence of Fun Morality. In: Journal of Social Issues, Vol.7, Heft 4, 1951.
2 So lautet eine Definition auf der Informationsplattform Regenbogenportal: https://www.regenbogenportal.de/glossar?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5Bterm%5D=1&cHash=d7f6d4135801a35f58a78a4d17553b2f
3 Debby Herbenick, Molly Rosenberg, Lilian Golzarri-Arroyo, J Dennis Fortenberry, Tsung-Chieh Fu: Changes in Penile-Vaginal Intercourse Frequency and Sexual Repertoire from 2009 to 2018: Findings from the National Survey of Sexual Health and Behavior. In: Archives of Sexual Behavior, 51(3), 2022.
4 Peer Briken, Silja Matthiesen, Laura Pietras et. al.: Prävalenzschätzungen sexueller Dysfunktionen anhand der neuen ICD-11-Leitlinien. Ergebnisse der ersten repräsentativen Bevölkerungsstudie zu Gesundheit und Sexualität in Deutschland. In: Deutsches Ärzteblatt, Ausgabe 39, 2020. https://www.aerzteblatt.de/archiv/215853/Praevalenzschaetzungen-sexuellerDysfunktionen-anhand-der-neuen-ICD-11-Leitlinien
5 Die Idee zu diesem Club ist angelegt in Lisa Millbanks Blog-Artikel „The Ethical Prude – Imagining an authentic sex-negative feminism“, 2012 https://radtransfem.wordpress.com/2012/02/29/the-ethical-prude-imagining-an-authentic-sex-negative-feminism/
6 Mai-Anh Boger: Theorie der trilemmatischen Inklusion. In: Irmtraud Schnell (Hg.): Herausforderung Inklusion. Theorie und Praxis. Verlag Julius Klinkhardt, 2015, S. 58.
7 Giorgio Agamben: Über negative Potentialität. In: Emmanuel Alloa, Alice Lagaay (Hg.): Nicht(s) sagen. Strategien der Sprachabwendung im 20. Jahrhundert. Transcript, 2008, S. 293.
8 Valentina Desideri zitiert hier den Schriftsteller und Philosophen Franco Bifo Berardi: https://faketherapy.wordpress.com/ (Übersetzt von der Autorin)
Einladung zur Inventur
Unser Sex. Womit haben wir es da eigentlich zu tun? Los geht’s mit einer Bestandsaufnahme und einigen Grundsatzfragen. Wer möchte, greife zu Stift, Papier und Wecker und fühle sich eingeladen zu einer Runde Journaling, auch Automatisches Schreiben genannt. Wir wissen meist vieles, das aber noch nebulös im Kopf herumschwirrt. Das einmal ohne Filter aufzuschreiben macht es fassbarer. Und ich mag die Idee des Dialogs, wenn die weitere Lektüre mit dem eigenen Erleben verwoben wird, dem man sich zuerst widmet. Schließlich ist dieses Kapitel auch das Ergebnis vieler Gespräche, die ich im Anschluss an eine solche Schreibübung geführt habe.





























