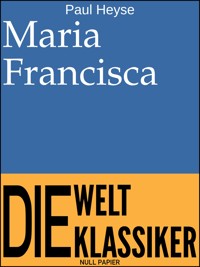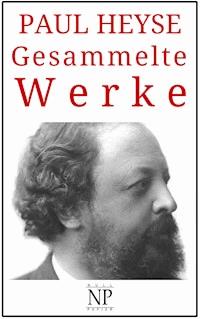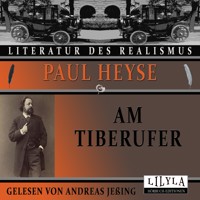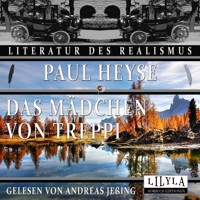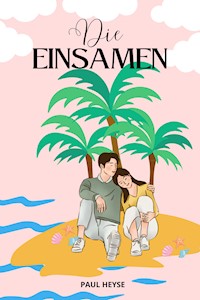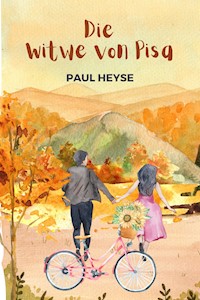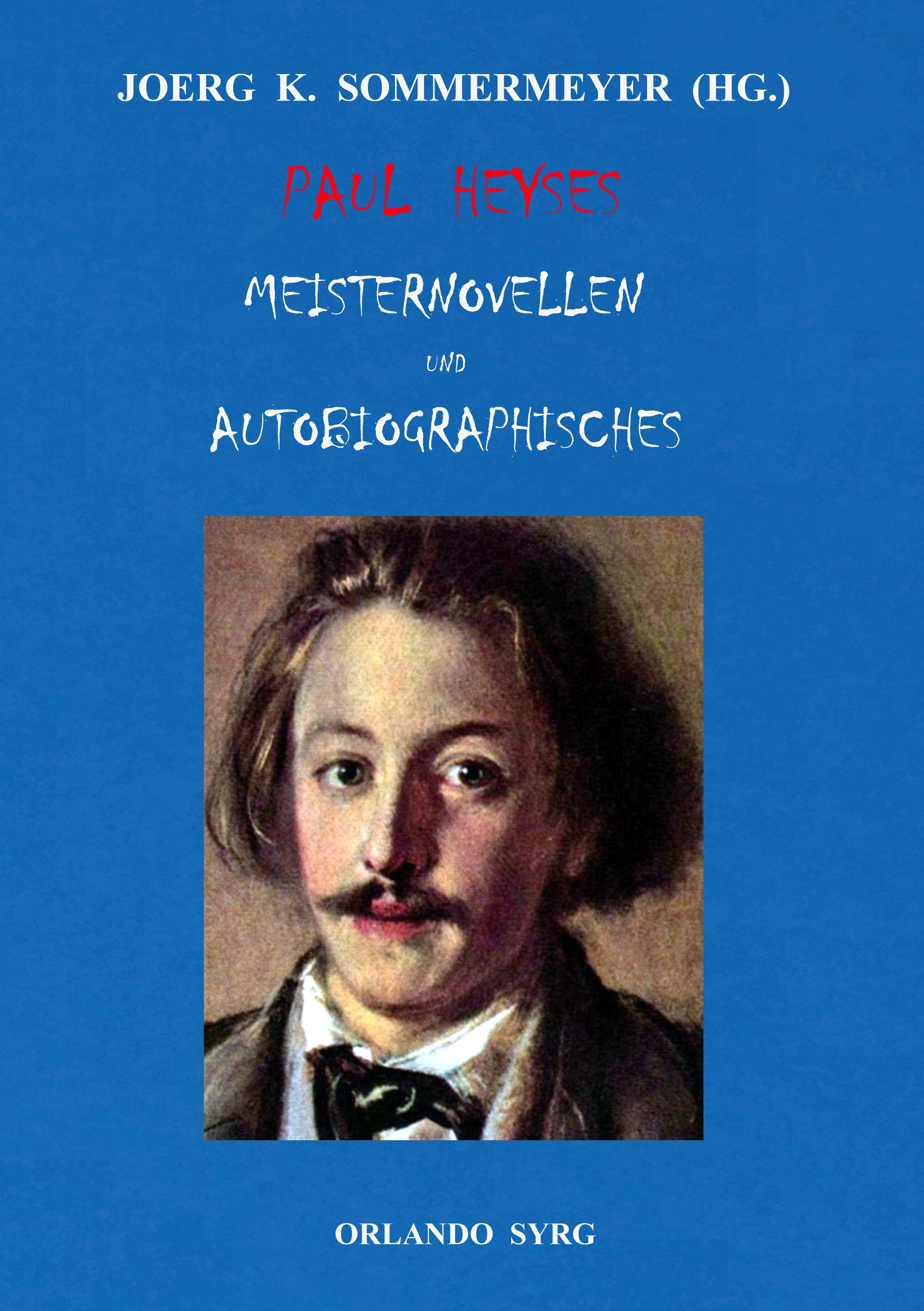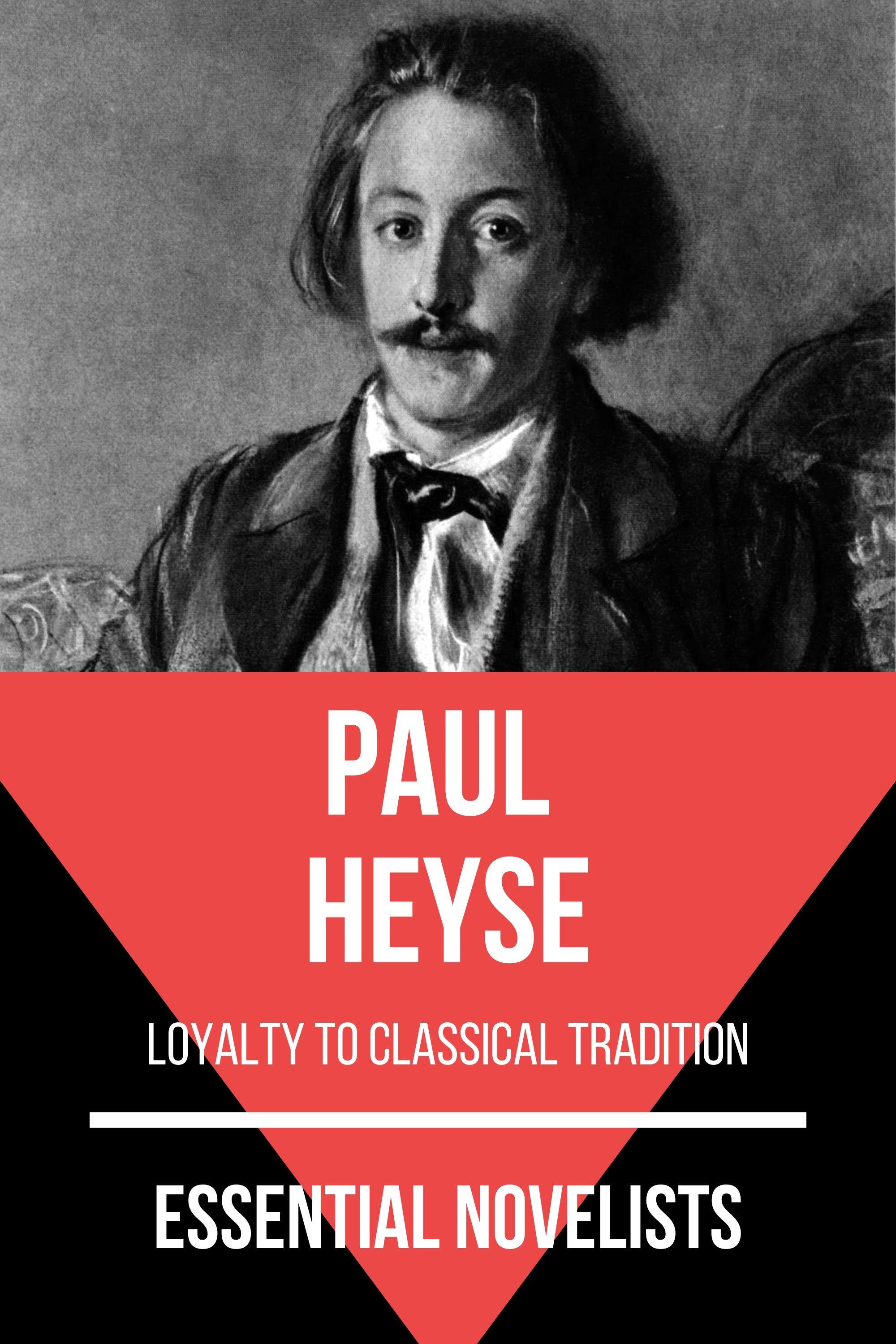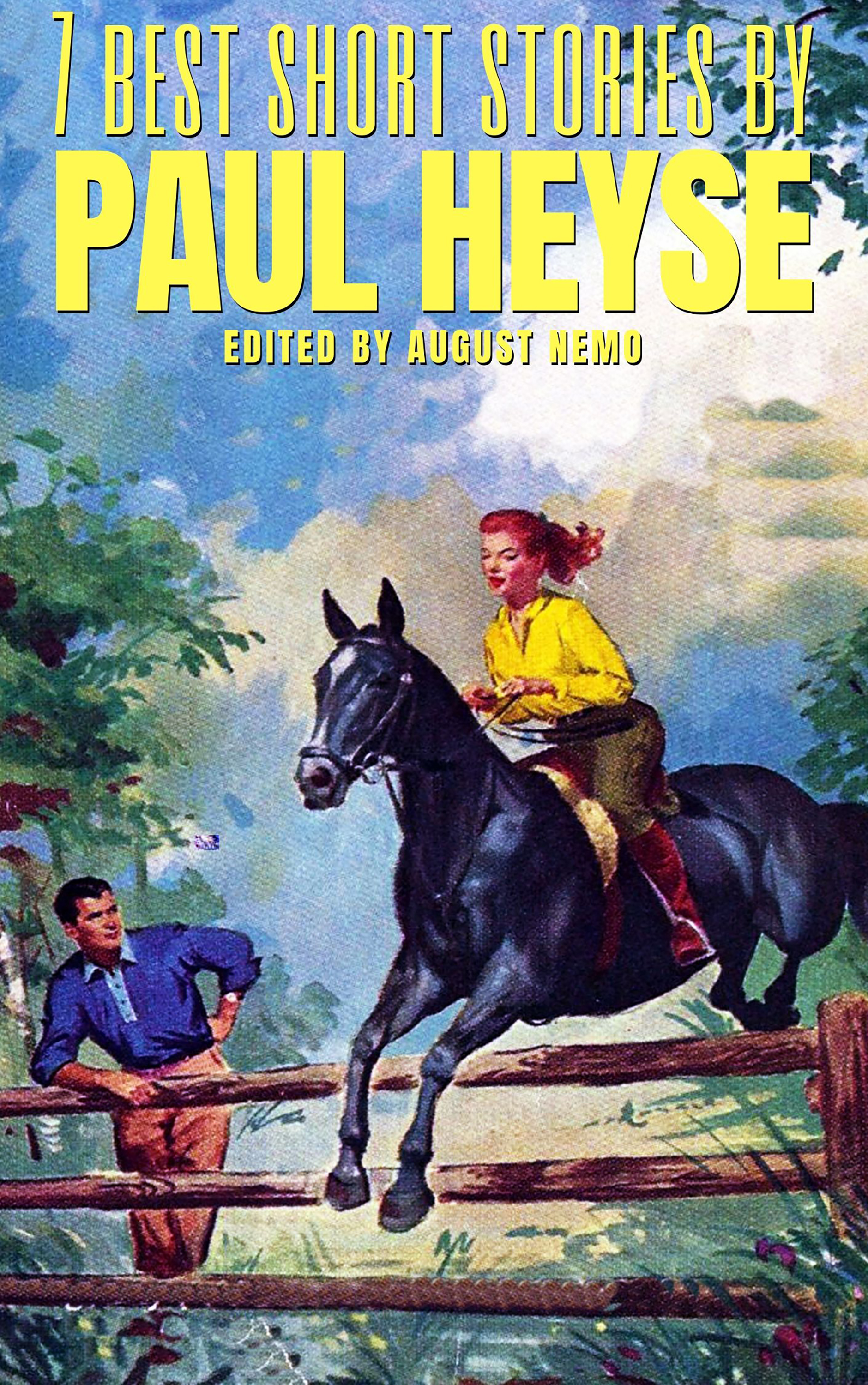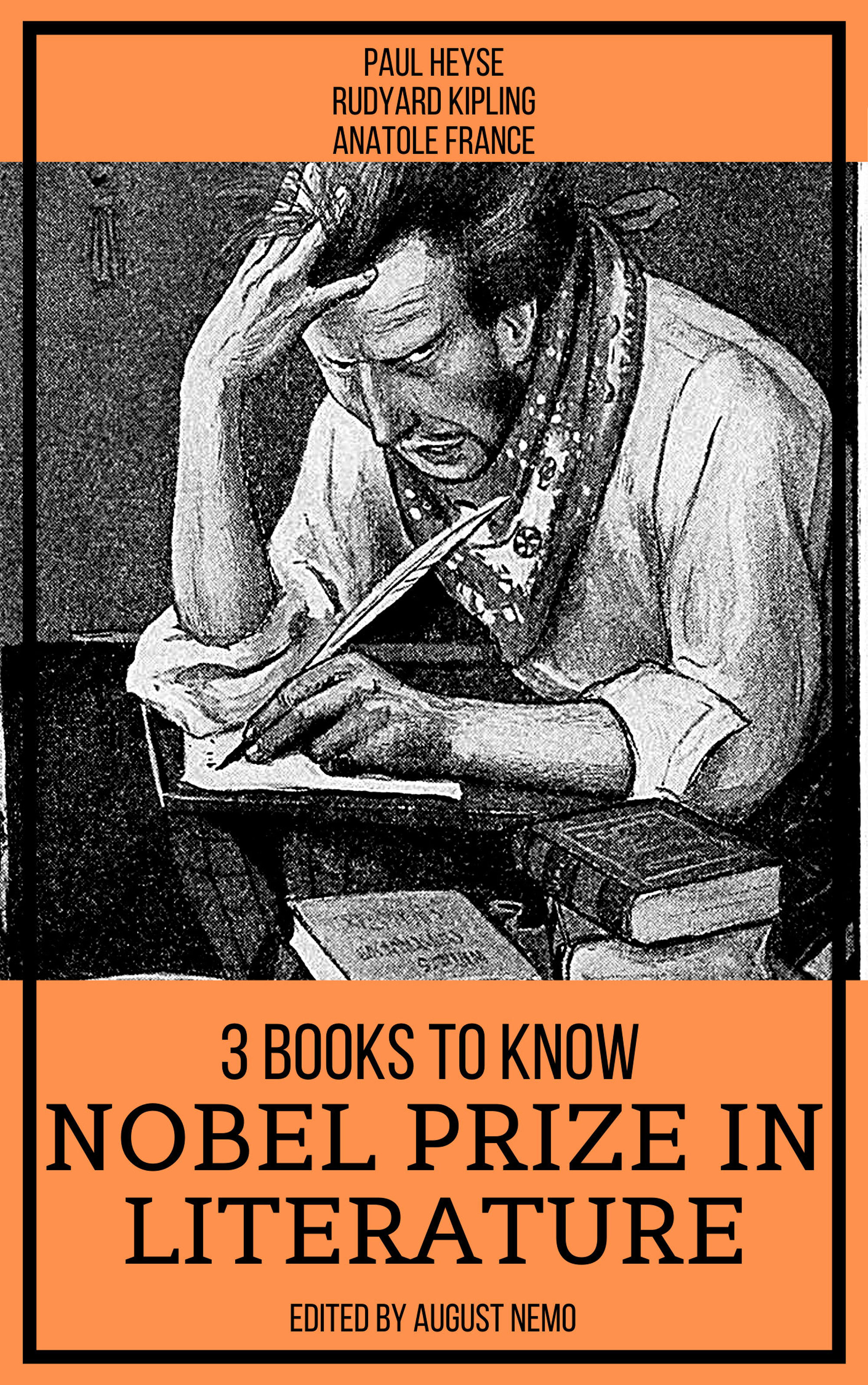Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Novellen vom Gardasee
Paul Heyse
Novellen vom Gardasee
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-88-4
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Gefangene Singvögel
Die Macht der Stunde
San Vigilio
Entsagende Liebe
Eine venezianische Nacht
Antiquarische Briefe
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Widmung
Meiner lieben Freundin Emma Kling zugeeignet.
Gefangene Singvögel
(1901)
Mutter, liebe Mutter, Hüter stellst du mir? Hüt’ ich mich nicht selber, Hilft kein Hüter dir,
(Spanisches Liedchen.)
Dass vor mehr als hundert Jahren, genauer gesagt am 11. September 1786, der Gardasee entdeckt worden ist, von keinem Geringeren als unserem größten Dichter, weiß Jeder, der Goethe’s »Italienische Reise« gelesen hat.
Freilich ging es mit dieser Entdeckung wie mit mancher anderen, die für den Kulturfortschritt der Menschheit noch wichtiger war: sie wurde bald wieder zugedeckt, noch ehe die Welt so recht von ihr erfahren hatte; wie eine Quelle, die frisch zu Tage dringt, ein Weilchen fortfließt, dann aber bald von lockerem Erdreich wieder aufgesogen wird. Denn obwohl Goethe den Gardasee »eine herrliche Naturwirkung«, »ein köstliches Schauspiel« genannt, und von dem, was jetzt Riviera heißt, der Strecke zwischen Gargnano und Salò, erklärt hatte, »keine Worte drücken die Anmut dieser so reich bewohnten Gegend aus«, war von dem Zauber des alten Benacus, von dem schon Virgil gerühmt hatte, dass »seine Brandung wie Meereswogen rauscht und braus’t«, das folgende Jahrhundert hindurch unseres Wissens kaum die Rede. Manzoni’s »Verlobte« und Torwaldsen’s »Alexanderzug« hatten den Comersee interessant gemacht, die Borromeischen Inseln lockten große Fremdenschwärme in ihre Gärten, und die Schlacht von San Martino war geschlagen worden, ohne dass Sieger und Besiegte für den zauberhaften Ausblick nach dem Monte Baldo hinauf Augen und Sinn gehabt hätten.
Da war es vor etwa einem Vierteljahrhundert einem Landschaftsmaler vorbehalten, den Gardasee von neuem zu entdecken.
Von verschiedenen Herbstausflügen kehrte mein Freund Bernhard Fries mit einer wohlgefüllten Mappe voller Skizzen und Ölstudien zurück, die er mit seinem heiteren Jupiterlächeln vor mir ausbreitete. Er war noch ein Künstler der alten Schule, die der Natur gegenüber den Begriff der Schönheit gegen den der Stimmung noch nicht vertauscht hatte. Damals war freilich die »Andacht zum Unbedeutenden«, die Armeleutmalerei, der hysterische Hang zur Dissonanz in Kunst und Literatur noch nicht aufgekommen. Impressionismus, schrankenloser Individualismus und wie die Stichworte der neuen Kunstanschauung sonst noch heißen, tönten noch nicht von den Lippen der nach Neuem begierigen jungen Welt, und der Kult der schönen Linie, der festgegliederten Form, der kräftigen Lokalfarbe wurde erst etwa zehn Jahre später als akademischer Zopf verhöhnt.
Bernhard Fries aber erlebte den Anbruch der neuen Zeit noch, und wenn er dann in Ausstellungen und Kunstvereinen dieser modernen Kunst begegnete, betrachtete er sie mit stillem Kopfschütteln, würdigte hie und da das Talent, wendete sich dann aber ruhig ab und sagte: Ich bin kein Konsument dafür.
Dann kehrte er in sein bescheidenes Atelier zurück, zu dem er ein Zimmer seiner Wohnung eingerichtet hatte, und fuhr fort, seine Bilder zu malen, wie es ihm ums Herz war, unbekümmert, ob sich, trotz der siegreichen neuen Richtung, »Konsumenten« dafür finden würden.
Dass einem so gearteten Künstler das Herz aufgehen musste gegenüber einer Natur, »deren Anmut keine Worte ausdrücken können«, begreift man leicht. Auch war es kein Wunder, dass er mit seiner Begeisterung mich ansteckte. Ich hatte auf früheren Italienfahrten einer eifrigen Landschaftspfuscherei gefrönt. Da ich kein eigentliches malerisches Talent besaß, auch einen Stimmungseindruck hervorzubringen mit meinem bescheidenen Zeichenstift nicht hoffen konnte, waren mir landschaftliche Motive die liebsten, in denen sich’s um reizvolle feste Linien des Terrains und, was die Vegetation betraf, um die geschlossenen Konturen der Pinien, Zypressen, Palmen und Olivenstämme handelte.
Das alles fand ich nun in den Gardastudien meines Freundes bis auf die hier kaum vorkommende Pinie aufs schönste beisammen. Und so widerstand ich der Versuchung nicht, auch meinerseits ein paar Herbstwochen als ein künstlerischer Freibeuter an diesem gesegneten Gestade herumzustreifen und dabei vielleicht in meiner dilettantischen Kunstübung einen kleinen Fortschritt zu machen.
Freund Fries hatte mir als das Standquartier, von dem aus er seine Streifzüge unternommen, Toscolano bezeichnet, und die einzige Herberge in dem kleinen Nest, das Cavallo bianco, wegen ihrer Reinlichkeit und Billigkeit gerühmt.
Das Lob dieser beiden Tugenden sollte ich bei näherer Bekanntschaft durchaus gerechtfertigt finden. Toscolano selbst aber schien mir den Vorzug vor den nachbarlichen Nestern Gargnano und Maderno nicht so recht zu verdienen.
Ich war mit dem Schiff von Desenzano hergekommen, in der reinen Herbstsonne des dritten Oktober, vorüber an Salò, dem damals noch unberühmten Gardone Riviera und dem heiteren Maderno. Zwar die Straße von hier aus durch die hohe Lorbeerallee entzückte mich. Als ich aber Toscolano erreichte, fühlte ich auf der Wanderung durch die einzige sonnenlose Gasse eine gewisse schaurige Beklemmung, die mich schon bereuen ließ, dass ich meinem ersten Eindruck nicht gefolgt und in Maderno geblieben war.
Doch der freundliche Empfang des Wirtes vom »Weißen Roß«, dessen biederes dickes Gesicht ein gemütvolles Lächeln überflog, als ich ihm den Gruß des alten Gastfreundes Sor Bernardo bestellte, söhnte mich bald mit dem Quartier, das er mir empfohlen, aus.
Freilich, das Haus selbst lag nicht sonniger als alle anderen. Es glich mehr dem, was wir in unsrem zivilisierten Vaterland einen Ausspann nennen, als einem richtigen Albergo, selbst nach italienischen Begriffen. Auch war das einzige Zimmer, das gelegentlich einen Fremden beherbergte und auch meinem Freunde zur Wohnung gedient hatte, nur ein großer, kahler, weiß getünchter Raum ohne anderes Mobiliar, als das breite, mit groben, blühweißen Leintüchern überzogene eiserne Bett, einen einzigen Strohstuhl, ein Waschbecken in einem eisernen Gestell und ein wackliges Tischchen. Statt des Schrankes und der Kommode dienten einige Haken und Nägel an der Tür. Und doch war’s, wie man in der Schweiz sagt, ein »frohmütiges Zimmer«. Denn von dem einzigen Fenster aus hatte man den Ausblick über einen kleinen Hof hinweg in das Gärtchen, das noch voller Georginen und spät blühenden Rosen war, hinten abgeschlossen durch eine lange »Serre«, aus der eine Überfülle gelber Limonen hervorleuchtete, und über dem Ganzen die schön gerundeten Berggipfel, die eben in der Abendglut brannten.
Übrigens war ich ja auch nicht hieher gekommen, um im Zimmer zu sitzen, sondern sollte in diesem nur die Stätte finden, wo ich nach der erquicklichen Tagesstreiferei mein Haupt niederlegte.
Mein Handköfferchen war bald ausgepackt – das Tischchen und die Türhaken reichten vollkommen zur Unterbringung meines leichten Gepäckes aus –, mit dem Wirt wurde ein allerdings sehr mäßiger Pensionspreis vereinbart, und ehe die Sonne noch ganz hinunter war, hatte ich das Skizzenbuch eingeweiht, indem ich darin vom Fenster aus die Umrisse des Gartens und der Berglandschaft entwarf.
Noch denselben Abend machte ich die Bekanntschaft der übrigen Wirtsfamilie, die heraufkam, als ich in dem zweiten, etwas größeren Zimmer, das bis auf den Tisch in der Mitte ganz ohne Möbel war, meine frugale Cena, mit Hilfe eines recht trinkbaren Weines einnahm.
Zuerst kam der Sohn des Hauses, Battista, ein treuherziger junger Mensch von etwa dreiundzwanzig Jahren, der sich als einen großen Kunstfreund zu erkennen gab, von den Studien des Sor Bernardo mit Bewunderung sprach und auch mir, nachdem er die angefangene Skizze betrachtet hatte, seine Hochachtung bezeigte. Als ich später einmal im Hof einen Esel zeichnete, der, an einen Pfahl gebunden, ein wenig Futter zu sich nahm, trat er respektvoll hinter mich und brach in die sachverständigen Worte aus: Ah! Pittura di carattere!
Die Mutter war eine einfache Frau, sehr schweigsam und überaus höflich, die mich neugierig betrachtete und die Leinwand meiner Leibwäsche zwischen zwei Fingern prüfte. Die Musterung schien sie befriedigt zu haben, sie war nun überzeugt, dass ich kein Landstreicher, sondern ein Signore und Galantuomo sei.
Einen Augenblick zeigte sich auch die Tochter des wackeren Paars, eine lange, dürre Figur, auf der ein sehr reizloses Gesicht saß, bekrönt von einem Berg blonder Flechten, eine Turmfrisur, mit der sich damals auch in Italien die hübschesten Rasseköpfe entstellten, während sie den Hässlichen den Anstrich lächerlicher Vogelscheuchen lieh.
Die Inhaberin dieses Haargebäudes schien aber über den Eindruck, den sie auf unbewachte Männerherzen machte, durchaus nicht in Zweifel zu sein. Sie ging nur einmal mit ihren imposanten Schritten durchs Zimmer, indem sie meinen Gruß mit einem leichten Kopfnicken von oben herab erwiderte, und warf mir von der Schwelle aus einen Blick zu, der deutlich sagte, dass sie überzeugt sei, ich würde in kurzem den Widerhaken des Brandpfeils, den sie mir zugeschleudert, in meiner Brust verspüren.
Diese nächste Nacht jedoch schlief ich ohne die geringste Beunruhigung und blieb auch während der ferneren Tage gegen die Gefahr gewappnet, selbst nachdem ich später einmal gutmütig genug gewesen war, das Porträt der Tochter für ihre Eltern zu zeichnen. Auch eine Schönere hätte mir’s nicht angetan; war ich doch der Landschaften, nicht der Staffage wegen, an den gepriesenen See gekommen, der nicht gerade durch einen besonders anmutigen Menschenschlag ausgezeichnet war.
Am anderen Morgen aber, als ich in aller Frühe an das Seeufer hinunterwanderte und mich in dem Ölwald erging, der hier an der Stätte aufgesprossen ist, wo vor Urzeiten das alte Benacus gestanden haben soll, ging mir das Herz auf, und ich rief in Gedanken dem Freunde, der mir diese Wege gewiesen, eine überströmende Dankeshymne zu. Es war in der Tat eine Szenerie von so überschwänglichem Glanz des Lichtes und der Farben, der Monte Baldo drüben ruhte so feierlich über dem fast unwahrscheinlich purpurblauen Seespiegel, den die Ora noch nicht kräuselte, die Wellchen, die am Strande verrauschten, blitzten wie flüssiges Gold in den ersten Morgenstrahlen und ein Traum schien die silbernen Wipfel der Olivenhalde zu wiegen, da sonst kein Lüftchen zu spüren war. Nur der Kummer befiel mich, dass all dem Zauber gegenüber mein grauer Bleistift noch ohnmächtiger als sonst sein musste, auch nur einen Hauch dieser »herrlichen Naturwirkung«, wie der Dichter es genannt, auf einem weißen Blatte festzuhalten. So verzichtete ich zunächst auf alles andere Studium, als durch die Augen, und genoss, der Küste entlang wandernd, unter den hohen Lorbeerwipfeln, welche die Straße übernickten, unvergessliche Stunden.
Als ich gegen Mittag zu meinem dunklen »Weißen Roß« zurückkehrte, trat der Wirt mir aus der Küche entgegen, auf jeder Hand ein rohes Stück Fleisch, mit der Frage, welches von beiden, das vom Rind oder vom Kalbe, ich zu verspeisen vorzöge. In dieser zwanglosen Art verhandelte er auch an den folgenden Tagen mit mir über das pranzo. Ich war aber so kunst- und schönheitshungrig, dass ich nur selten mich für meine leibliche Nahrung interessierte und noch heute nicht weiß, ob die Küche des Hauses höheren Ansprüchen genügt haben würde.
Nur dass auch die eingeborenen Toskaner von sehr genügsamer Art waren, konnte mir nicht entgehen, als ich am ersten Morgen nach meiner Ankunft in dem einzigen Café des Ortes zu frühstücken dachte.
Das Haus, über dessen Erdgeschoss auf einem schmalen Schilde zu lesen war: Luigi Caramella, Cafè e Liquori, lag meinem »Weißen Roß« schräg gegenüber. Aus dem Fenster des Vorderzimmers hatte ich am Abend ein kleines Häuflein Honoratioren vor dem offenen Eingang zu dem Kaffeelokal sitzen sehen, rauchend und aus schmalen Gläsern verschiedene Getränke, rote, gelbe und grüne schlürfend, dabei in eifrigem Disput, von dem ich, auch wenn ich in ihrer Mitte gewesen wäre, natürlich keine Silbe verstanden hätte, da sich alle im Ort, auch der Herr Pfarrer und der Schullehrer, des Dialekts bedienten, der an den schwer verständlichen Brescianer anklingt. Gegen Zehn hatten die Herren sich erhoben, der Wirt aber war noch aufgeblieben, hatte eine Mandoline geholt und darauf einige Volksliedchen begleitet, die er zu meiner Verwunderung in der reinsten neapolitanischen Mundart sang.
Als ich nun am anderen Morgen in das Café eintrat – ich kannte ja die italienische Sitte, das Frühstück nicht im Hotel einzunehmen –, stellte sich mir Herr Giggi Caramella sofort als einen echten Sohn der bella Napoli vor, mitten in Santa Lucia zur Welt gekommen, ein schlankes, schwarzbraunes Kerlchen, dessen kleine Feueraugen von Verschmitztheit und Spitzbüberei funkelten, sehr anders, als man es in lombardischen Gesichtern zu sehen gewohnt war.
Er erzählte mir in den ersten fünf Minuten seine Lebensgeschichte, wie er in Geschäften seines älteren Bruders, der am Posilip große Rebengärten besitze, nach Genua gekommen sei, um dort ihren Wein abzusetzen. Von da habe er an den Gardasee einen Ausflug gemacht und sei hier hängen geblieben, denn der Besitzer des Cafés sei gerade mit Tod abgegangen, und er habe gedacht, sich als sein Nachfolger aufzutun, nicht sowohl der Cafégäste wegen, an denen nicht viel zu verdienen sei, als um hier oben eine Filiale für das brüderliche Weingeschäft zu gründen. Damit sei er denn auch gut gefahren; sein vino del Vesuvio sei rasch beliebt geworden; ob ich ihn nicht auch versuchen wolle, da man im Cavallo bianco gegen ihn feindlich gesinnt sei und den Gästen dort nur das eigene säuerliche Gewächs vorsetze.
Ich dankte zunächst für diesen zu so früher Stunde ungewohnten Genuss und bat um Kaffee. Dazu zu gelangen, schien seine Schwierigkeiten zu haben. Erst nach langem Warten brachte mir der geschwätzige junge Mann das Gewünschte in einem verbogenen Zinnkännchen, ein trübes, dickes Gebräu, auf einem Schüsselchen verstaubte Zuckerstückchen, ein altbackenes Brötchen neben der etwas defekten Tasse. Wenn ich Milch wünsche, müsse er erst danach fortschicken. Seine Kunden tränken den Kaffee nur schwarz, zögen überhaupt mehr die übrigen bibite, liquori, aqua gazosa vor, von denen er mir eine lange Liste zur Auswahl vorhielt.
Hienach verzichtete ich darauf, mein Frühstück wieder im Café einzunehmen, und ließ mir etwas, was einem Milchkaffee ähnlich sah, von meinen Hauswirten bereiten.
Die frühen Morgenstunden waren aber so einzig schön, dass ich mich nicht lange mit Frühstücken aufhielt, sondern ungeduldig ins Freie strebte. Es war kein Hügel, keine Halde oder einsames Gehöft im Umkreis zwischen Monte Maderno und dem weißen Kirchlein von Gaino hoch oben zwischen seinen jungen Zypressen, die ich nicht mit spähenden Augen nach malerischen »Motiven« durchforscht hätte. Auf’s Papier kam das Wenigste. Ich war einsichtig genug, mich davor zu hüten, diesen Wundern Gottes mit unbeholfener Pfuscherei Gewalt anzutun.
Dagegen kam statt der dilettantischen Landschafterei meine eigentliche Musenkunst besser zu Ehren. In jenen unvergleichlich schönen Tagen füllte sich mein Skizzenbuch mit allerlei lyrischen »Landschäftchen mit Staffage«, zu denen mir die »Motive« von allen Seiten, aus Luft und See und den Wipfeln der Lorbeeren zuströmten. Ich hatte einen glücklichen Anfall akuter Lyrik, die wie ein der Liebe ähnliches Fieber mir in den Adern glühte. Und vollends, wenn der Tag in reinem Golde hinter dem fernen Salò zur Rüste ging, sang und klang es in mir wie in der jugendlichsten Zeit des »fahrenden Schülers«.
Lautlos faltet nun zusammen Der Gebirgswind feine Flügel. Der Zypressen dunkle Flammen Lodern still empor am Hügel.
Diese innere Musik erfüllte mich so ganz, dass ich es wie eine misstönige Störung empfand, wenn vorm Schlafengehen die Gassenhauer Giggi Caramella’s, so rein er die Melodien sang, in das offene Fenster meines Zimmers herüberklangen.
Andere musikalische Talente ließen sich nicht vernehmen.
Was an Vogelgesang etwa im Frühling zu hören gewesen war, trotz der Jagdflinten, Schlingen und Leimruten, mit denen man den armen kleinen Sängern nach landesüblicher italienischer Sitte nachstellte, war jetzt im Herbst hier wie überall verstummt. In den Häusern des Ortes, beim Spinnrocken und Webstuhl, erklang keines der Ritornelle, die im südlicheren Italien die Arbeit der Weiber begleiten. Auch in den Rebengärten und Olivetten sah ich die Männer ohne Sang und Klang ihre Geschäfte verrichten, und die Fuhrleute, die oben auf ihren schwer beladenen Karren ausgestreckt lagen, gaben keinen anderen Laut von sich, als den Knall ihrer Peitsche, mit der sie die keuchenden Esel und Maultiere antrieben.
Es ging überhaupt nicht lustig zu in dem alten sonnenlosen Neste, und außer dem grinsenden Lachen Giggi Caramella’s sah ich nur ernste, grämliche Mienen, selbst unter den Mädchen und Kindern.
Von meinem Wirt erfuhr ich den Grund dieser allgemeinen gedrückten und gedämpften Stimmung. Die letzten drei Jahre waren schlechte Weinjahre gewesen, und auch die Oliven hatten nur einen geringen Ertrag gegeben. Das hatte Manchen, der früher auf der faulen Haut gelegen, dazu gebracht, in der Papierfabrik drüben in der Schlucht von Toscolano für sich oder seine Kinder Arbeit zu suchen, die schlecht bezahlt wurde und den Menschen, das Ebenbild Gottes, zu einer Maschine machte. Die Fabrik sei überhaupt ein wahrer Landschaden. Wie viele gingen an Leib und Seele dadurch zu Grunde, bloß damit die Eigentümer sich bereicherten. Und wozu brauche man überhaupt so viel Papier? Bücher gebe es schon genug in der Welt, in den Zeitungen werde doch nur gelogen, und anständige Mädchen, wie seine Marietta, schrieben keine Liebesbriefe. Wenn es kein Papier gäbe, könnte der friedliche Bürger nicht durch Steuerzettel beunruhigt oder ein Kontrakt ihm präsentiert werden, den er in einer schwachen Stunde zu seinem Nachteil unterzeichnet hatte. Papier sei daher eine Erfindung des Teufels, die der Heilige Vater in Rom allen guten Christen verbieten sollte.
Ich hütete mich wohl, dem wackeren Manne zu verraten, dass ich selbst von dieser Erfindung einen ausgiebigen Gebrauch machte und schon von Berufswegen auch an den Fabriken, wo sie hergestellt wurde, ein Interesse hätte. Ich nahm mir also heimlich vor, am nächsten Tage die in der Toskaner Schlucht zu besuchen. Da ich aber, von Gaino herabsteigend, den Weg verloren und, hin und her kletternd, erst spät die Schlucht erreicht hatte, war schon Feierabend angebrochen, als ich die alten, unansehnlichen Fabrikgebäude vor mir liegen sah. Für diesmal musste ich darauf verzichten, den Teufel am Werk zu sehen, und schlenderte langsam die gewundene Straße an der steilen Felswand dahin, zu meiner Rechten tief im Grunde den Gebirgsbach, der zu dieser Jahreszeit nur als ein dünner Wasserfaden zwischen dem Steingeröll hinschlich.
Trotzdem war eine feuchte Luft in dieser Tiefe, und ich beschleunigte meine Schritte, um wieder ins Offene zu kommen. Als ich endlich aus der Schlucht heraustrat, auf die Landstraße, die links in den Ort, rechts nach Maderno führt, wehte mir ein warmer Hauch von der Abendsonne entgegen, die eben niedergegangen war. Ich blieb an der breiten Brücke stehen, unter welcher der Bach hinläuft. Es war hier noch ein wenig Leben. Männer in Hemdärmeln, die viel geflickten Jacken über die eine Schulter gehängt, offenbar Fabrikarbeiter, standen schwatzend und rauchend beisammen, junge Weiber schlenderten hin und her, zu dreien und vieren untergefasst, nach dem eintönigen Tagewerk in den stickigen Fabrikräumen sich in der reinen Abendluft ergehend. Doch durch das gedämpfte Geschwirr der Stimmen klang ein heller Gesang aus einem Häuschen, das ganz einsam drüben an der Straße neben dem tiefen Bett des Baches lag. Und seltsam, ich hörte deutlich die Melodie des Liedes, das auch der junge Kaffeewirt aus Neapel sang, mit dem schwermütigen Refrain:
Te voglio bene assaje, E tu non pienz’ a me.
Welches Mädchen mochte bei Giggi Caramella in die Schule gegangen sein?
Ich schritt über die Straße auf das Haus zu, ein alter, einstöckiger Kasten, von dessen Wand der ehemals rosa gefärbte Bewurf in großen Flecken abgebröckelt war. Neben der breiten Tür unten nur ein einziges Fenster, in dem niedrigen oberen Stockwerk zwei viereckige Löcher, mit festen Läden geschlossen. Zur Seite, an die Mauer gedrückt, die von der Hinterwand aus noch eine Strecke weit fortlief, ein Gärtchen, vorn mit einem verwahrlos’ten Zaun gegen die Straße abgegrenzt. Es mochte ehemals hübsch gewesen sein, große Büsche von Laurustinus und Granaten umgaben einen kleinen Grasfleck, in dessen Mitte ein Orangenbäumchen stand, noch mit Früchten behangen, diese aber, wie alle übrigen Pflanzen des Gartens, dick bestaubt und in der Sonnenhitze hingewelkt.
Ich sah das alles nur mit einem flüchtigen Blick, denn mein Interesse wurde von einer weiblichen Figur gefesselt, die vor dem breit offenen Eingang der Haustür auf zwei Steinstufen hockte, auf den Knien ein altes Kleidungsstück, mit dessen Ausbesserung sie beschäftigt war. Neben dem Türpfosten hingen vier hölzerne Vogelbauer, nicht viel größer als zwei Hand breit im Geviert. In dem vordersten saß eine schöne, ziemlich große Blauamsel – Leopardi’s Passero solitario –, im zweiten eine magere Nachtigall, im dritten eine kleine Meise, der vierte Käfig war leer. Von diesen drei Gefangenen schien sich nur die Meise ihrer früheren Freiheit zu erinnern. Sie allein sprang zwischen den engen Stäben, so gut es gehn wollte, hin und her und stieß verzweifelte kleine Töne aus. Die beiden anderen saßen regungslos und stumm auf der kurzen Querstange, ein Anblick, der mir ins Herz schnitt.
Ich war vor dem Hause stehen geblieben, während der Gesang drinnen nicht verstummte. Jetzt hörte ich auch das Lied Pare nun sogno, pare pazzia, – ebenfalls ein Repertoirestück Signor Caramella’s.
Wie könnt Ihr nur die armen Vögel so eng einsperren? fragte ich jetzt die Besitzerin des Hauses. Sie hören ja auch zu singen auf, wenn sie sich bei jedem Aufflattern den Kopf oder die Flügel zerstoßen. Gebt ihnen wenigstens größere Käfige, wenn Ihr sie gefangen haltet.
Die vor mir Sitzende sah mit einem feindseligen Blick zu mir auf, wie ein Haushund, der gegen einen unvorsichtig nahenden Fremden eine drohende Miene macht. Ich bemerkte nun, dass sie etwas verwachsen war, der Kopf steckte ihr zwischen den Schultern. Die Züge des Gesichts aber waren regelmäßig und noch nicht alt, sie mochte nicht über Vierzig sein, in ihrem dichten schwarzen Haar zeigte sich noch kein grauer Schimmer.
Erst nachdem sie mich scharf gemustert hatte, erwiderte sie: Größere Bauer habe ich nicht; sie »verlangen sie auch gar nicht« (so!), und die Nachtigall singt auch im Bauer, wenn es dunkel geworden ist. Die Blauamsel ist krank, die würde überhaupt nicht mehr singen, auch wenn ich ihr einen hausgroßen Käfig gäbe. Zitta, Adele! unterbrach sie sich plötzlich, indem sie sich halb umwendete. Drinnen brach plötzlich der Gesang ab. Ich sah jetzt, dass die Haustür gleich in die Küche führte, hinten am Herd hatte die Sängerin zu schaffen gehabt und dabei ihre helle, frische Stimme hören lassen. Etwas Weißes bewegte sich in dem düsteren Raum hin und her, ein paar aufzuckende Flämmchen auf dem Herde beleuchteten eine lose Jacke und zwei schlanke Arme, das Gesicht blieb im Schatten.
Hört, sagte ich wieder, mich dauern die armen Vögel. Die Nachtigall würde noch viel schöner singen, wenn sie dort in Eurem Gärtchen säße, und die Blauamsel könnte vielleicht in der Freiheit wieder gesund werden. Ich möchte Euch die Vögel abkaufen, um sie fliegen zu lassen. Am Ende sind sie doch auch Geschöpfe Gottes und haben ja auch nichts verbrochen, weswegen man sie ins Gefängnis setzen dürfte.
Die scharfen blauen Augen der Frau warfen mir einen argwöhnischen Blick zu; die ganze Sache, das Gespräch, das ich mit ihr angeknüpft, der Vogelhandel kam ihr verdächtig vor. Sie schien zu glauben, dass mir’s um einen anderen Singvogel zu tun sei, den großen drinnen im Hause.
Die Vögel verkaufe ich nicht, sagte sie mit rauer Stimme. Es würde ihnen auch nichts nützen, wenn man sie freiließe. Sie würden von Anderen wieder eingefangen oder totgeschossen werden. Im Käfig sind sie gut aufgehoben, und dass sie nicht mehr Raum drin haben, ist ganz gut, je mehr sie hätten, je mehr wollten sie. ’s ist wie mit den Menschen. Zu viel Freiheit schadet ihnen nur, dann gehen sie zu Grunde. Im Kloster ist gar keine Freiheit, und die drin sind, führen das gottseligste Leben und haben nichts zu bereuen.
Damit erhob sie sich hastig, raffte ihre Flickarbeit zusammen und trat über die Schwelle, die Tür hinter sich zuschlagend. Ich hatte gesehen, dass sie den einen Fuß nachzog. Vom Rücken betrachtet, wo man ihr feines, noch jugendliches Gesicht nicht sah, erschien sie wie ein buckliges altes Hexenweibchen.
Ich hatte schon darauf verzichtet, die Tochter dieses unholden Wesens näher kennen zu lernen, da begegnete mir gleich am nächsten Tage die Alte mit der Jungen mitten auf der Straße.
Man konnte kein ungleicheres Paar sehen. Neben der zusammengekrümmten hinkenden Gestalt, die ein dickes schwarzes Tuch um Kopf und Schultern geschlagen hatte, nahm sich das schlanke junge Geschöpf, das den Kopf frei auf dem Halse trug, doppelt reizend aus, wie ein Zypresschen neben einem knorrigen Weidenstumpf. Nur in den Gesichtszügen glichen sie sich auffallend. Der Kopf der Jungen hatte aber eine besondere Anmut durch kleine, natürlich geringelte schwarze Löckchen, die über die feine Stirn und die sanftgeschwungenen dunklen Augenbrauen fast bis an die Wimpern herabhingen und bei jedem Schritt leise zitterten. Auch waren die Augen zum Unterschiede von den blauen der Älteren dunkelbraun, von einem feuchten Glanz wie leuchtende Edelsteine.
Beide trugen, an kleinen Ketten vom Gürtel herabhängend, ziemlich große blanke Scheren, wie es hierzulande bei den Schneiderinnen, wenn sie auf Arbeit ausgehen, Sitte ist.
Ich grüßte höflich im Vorbeigehn, die Jüngere nickte ein wenig, die Ältere dankte mit einem grimmigen Blick und beschleunigte ihren Schritt, offenbar um nicht angeredet zu werden. Dann verschwanden beide in der Tür eines der ansehnlicheren Häuser.
Abends, als mir meine Wirtin im Cavallo bianco die frugale Cena herauftrug, fragte ich sie nach dem ungleichen Paar ein wenig aus. Ich erfuhr, dass die Ältere nicht die Mutter, sondern die Schwester der Schönen sei, die älteste von vier Töchtern eines Gärtners, dem die Frau gestorben war, nachdem sie lange mit ihm gelebt und ihm noch spät eine vierte Tochter geboren hatte. Da habe diese älteste, Giuditta, die drei jüngeren erzogen und nachdem auch der Vater bald hernach gestorben, das herabgekommene Hauswesen mit Mühe zusammengehalten. Die beiden mittleren Schwestern hätten in der Papierfabrik gearbeitet und seien dort auf schlimme Wege geraten, jetzt schon lange verdorben und gestorben. Nun habe die Giuditta nur die um zwanzig Jahre jüngere Adele übrig behalten und lasse an dieser Einen alles an Zucht und Strenge aus, was sie als unwirksam an ihren Schwestern mit Kummer und Schande habe erfahren müssen. Sie dürfe ihr kaum je von der Seite, und obwohl sie mit einer fast mütterlichen Liebe an ihr hänge, plage sie die Schwester doch ärger als eine böse Stiefmutter. Es sei schade um das arme Ding, das so hübsch und anständig sei; ihr eigener Sohn, der Battista, habe ein Auge auf sie geworfen, ihr selbst – der Padrona – wäre sie auch zur Schwiegertochter ganz recht trotz ihrer Armut, es gehe aber dennoch nicht, aus allerlei Gründen.
Über diese Gründe ließ die Frau sich nicht weiter aus. Ich sollte aber bald noch tiefer in diese Verhältnisse eingeweiht werden.
Denn am frühen nächsten Morgen, als ich von meinem Ölwalde unten am Strande wieder in den Ort hinaufstieg, mein Skizzenbuch unterm Arm, in das wieder neben einem fantastisch gekrümmten und durchlöcherten Olivenstamm ein paar Strophen hineingekommen waren, sah ich zu meinem freudigen Erstaunen sie selbst, die Adele, mir entgegenkommen, auf dem Kopf einen flachen Korb tragend, in dem ein Haufen Wäsche aufgestapelt lag. Wie die schlanke und doch volle junge Figur im Herabschreiten sich ausnahm, mit dem Arm den Korb im Gleichgewicht haltend, dazu die bräunlichen Wangen von der frischen Morgenluft sanft angeglüht, werde ich mich wohl hüten beschreiben zu wollen.
Ich sah, dass sie durchaus nicht darauf gefasst war, auf ihrem Gang zu dem Wäscherinnenplatz unten am See aufgehalten zu werden. Doch blieb ich ein paar Schritte vor ihr stehen, lüftete den Hut und sagte: Guten Tag, Fräulein Adele. Ihr wollt zum Waschen hinunter. Ich möchte Euch aber etwas fragen.
Sie heftete ihre glänzenden Augen schweigend auf mich, offenbar verlegen, wie sie sich zu benehmen hätte, ob sie ruhig weitergehen oder mich anhören sollte.
Seht, sagte ich, ich bin ein Maler und zeichne in mein Buch, was mir gefällt. Nun habe ich schon gestern, als ich Euch mit Eurer Schwester begegnete, gewünscht, von Euch ein Bildchen zu machen, damit meine Leute zu Hause sehen, dass es auch in Toscolano schöne Mädchen gibt. Ich hatte aber nicht gleich das Herz, Euch anzureden. Jetzt, da ich Euch hier so allein antreffe, möchte ich Euch fragen, ob Ihr mir nicht sitzen wollt, nur eine kleine Stunde. Ihr würdet mir einen großen, großen Gefallen tun.
Sie war dunkelrot geworden und hatte die Augen niedergeschlagen.
Warum wollt Ihr mich zeichnen, Herr? sagte sie endlich. Ich bin hässlich!
O Evastochter! dachte ich. Auch du verstehst dich schon auf das fishing for compliments.
Nein, Adele, fuhr ich fort, Ihr seid gar nicht hässlich. Eure Löckchen schon allein sind eine Schönheit. Seht – und ich öffnete das Buch und zeigte ihr darin einige Frauenporträts – alle diese Damen könnten froh sein, wenn sie aussähen wie Ihr. Die Sitzung dauert auch nur eine so kurze Zeit, und ich will Euch das Dreifache von dem geben für dieses Stündchen, was Ihr mit Eurer Schneiderei an einem ganzen Tage verdient. Morgen ist Sonntag, da arbeitet Ihr ja wohl nicht und könnt ganz gut zu mir in das Cavallo bianco kommen, meinetwegen mit Eurer Schwester, wenn Ihr allein Euch nicht zu mir getraut.
Sie hatte sich, während ich sprach, die Sache offenbar ernstlich überlegt, und auf einmal, da ich schon fürchtete, ein Nein zu hören, sagte sie mit großer Lebhaftigkeit: Meine Schwester darf nichts davon wissen, die würde es nicht erlauben, sie ist so streng. Aber wenn Euch wirklich so viel daran liegt – gut, ich will kommen, morgen, wenn ich allein zur Messe gehe, denn die Giuditta muss zu Hause bleiben, weil sie wieder ihre Gicht hat. Es darf’s aber kein Mensch wissen, und das Bild dürft Ihr Niemand zeigen, das müsst Ihr mir versprechen. Wollt Ihr?
Die Hand darauf, Adele! sagte ich. Ich danke Euch. Ihr braucht Euch nicht vor mir zu fürchten. Ich habe noch keinem braven jungen Kind was zu Leide getan. Addio, Adele! Auf Wiedersehen!
Sie nickte mir zu, jetzt schon ganz vertraulich, und schritt dann rasch an mir vorbei, sich umsehend, ob auch Niemand unser Geplauder belauscht habe. Es war aber gewöhnlich keine Menschenseele zu dieser Stunde auf dem Weg nach dem See zu finden.
Ich war sehr froh über diesen raschen Erfolg, den ich mir gestern nicht hätte träumen lassen, obwohl die schönen Mädchen in Italien sich durch ein solches Ansinnen eines »Malers« nie gekränkt fühlen und die hässlichen erst recht nicht, ganz wie in anderen Ländern. Aber nicht alle diese Schätzchen werden von einem argwöhnischen Drachen, wie Schwester Giuditta, bewacht.
Diese Adele – das war doch ein anderes Modell als meine knorrigen alten Ölbäume, das glatte, rötlich überhauchte »Fellchen« reizender als die graue, rissige Rinde so eines Olivenstammes, selbst in der Abendsonne. Freilich, hier erst recht hätte es der Farben bedurft. Aber auch die Linien waren schon eine entzückende Aufgabe, die zu lösen ein dilettantischer Bleistift alle Kunst und Kraft aufbieten musste.
In großer Ungeduld erwartete ich am anderen Morgen die festgesetzte Stunde. Ich wusste vom vorigen Sonntag, dass die ganze Familie meines »Weißen Rosses« in die Zehn-Uhr-Messe ging; nur der Piccolo, ein zwölfjähriges Bürschchen, blieb zur Bewachung des Hauses zurück und benutzte die Zeit, um den verkürzten Nachtschlaf nachzuholen. Um Elf kehrte dann der Wirt, gewöhnlich auch die Wirtin, aus der Kirche zurück, da sich dann Gäste zu einem Frühtrunk einfanden. Aber diese eine Stunde, hoffte ich, sollte mir und der Kunst gehören.
Es schien mir diesmal endlos zu dauern, bis sich die Familie in Bewegung setzte. Die Glocken hatten längst zu läuten aufgehört, die Straße war leer geworden, endlich sah ich Vater, Mutter und das Geschwisterpaar aus dem Hause kommen, Marietta in einem himmelblauen Kleide und weiter Krinoline, in dem blonden Lockenturm ihrer Frisur so etwas wie einen Paradiesvogel. Sie warf einen Blick nach dem Fenster hinauf, hinter dem ich vorsichtig zurückgelehnt hinauslugte, ob ich sie auch in ihrem Glanz bewunderte. Dann verschwanden sie um die Straßenecke.
Ich blickte scharf nach der anderen Seite, von wo mein Besuch kommen musste. Das Häuschen der Schwestern lag kaum zweihundert Schritt von meiner Herberge entfernt. Es war aber keine Menschenseele zu erspähen. Schon glaubte ich, auf die Sitzung verzichten zu müssen – wer wusste, ob die Schwester sie nicht aus irgend einem Grunde eingesperrt hatte – da hörte ich ein leises Klopfen an meiner Tür, und sie trat wirklich ein, blass vor Aufregung, aber ihre Augen leuchteten in dem dämmrigen Raum noch feuriger als gestern in der hellen Sonne.
Sie habe sich durch das Seitengässchen ins Haus geschlichen, sei auch Niemand begegnet, der Piccolo unten in der Küche liege auf einer Bank und schnarche. Nun aber solle ich rasch anfangen, denn sie habe nur drei Viertelstunden, dann müsse sie fort, ehe die Wirtsleute nach Hause kehrten.
Ich ergriff ihre Hand, sie nach dem Fenster zu führen – meinem Nordfenster –, wo ich schon einen Stuhl für sie, dem Zeichentischchen gegenüber, bereit gestellt hatte. Ich fühlte, wie ihre Hand kalt war und zitterte, und um sie völlig zu beruhigen, nahm ich eine väterliche Haltung an, nannte sie Du und und sagte ihr, eine meiner Töchter sehe ihr ein wenig ähnlich, was nicht der Fall war, bis auf den Schnitt und die Farbe der Augen, Ihre Aufregung ließ dann auch nach, der zarte junge Busen hob und senkte sich ruhiger, und sie setzte sich gehorsam, ganz wie ich es ihr angab. Ich weidete mich wieder an dem reinen, lieblichen Oval dieses Gesichtes, dem geraden, unten leicht abgestumpften Näschen, den feinen schwarzen Locken, die ihr über die Stirn fielen. Sie entschuldigte sich, dass sie sich nicht auch so schön frisiert habe wie die Marietta, aber erstens habe sie keinen falschen Zopf, und dann würde ihre Schwester Unrat gewittert haben, wenn sie sich zur Messe so aufgedonnert hätte.
Ich sagte ihr, dass ihre gewöhnliche Haartracht tausendmal hübscher sei als so ein künstlicher Aufbau, dann schwiegen wir beide eine Weile, da ich mich sehr zusammennahm, die ersten Striche ganz richtig zu machen. Das gute Kind hielt still wie ein gemaltes Madonnenbild. Auch als ich dann zu plaudern anfing, regte sie kein Glied und keine Miene.
Die Schwester hält dich wohl sehr streng? fragte ich.
Ja, Herr. Wir leben ganz still und zurückgezogen.
Aber an Festtagen gehst du doch wohl ein wenig zum Tanz?
Sie schüttelte langsam den Kopf. Niemals! Ich kann gar nicht tanzen. In Toscolano ist auch selten Tanzmusik. Und anderswohin komme ich nicht. Dreimal in meinem ganzen Leben bin ich in Maderno gewesen, ein einziges Mal in Gargnano. Was sollen wir auch da? Wir kennen Niemand, und wir sind arm, wir müssen arbeiten.
Ein tiefes Mitleid mit der schönen jungen Menschenblüte, die so im kalten Schatten verkümmerte, überkam mich.
Damit wird aber dein Liebster nicht einverstanden sein, Adele, fing ich wieder an. Der wird dich doch Sonntags auch einmal weiter spazieren führen wollen, als immer um Toscolano herum.
Sie wurde rot wie eine Granatblüte.
Ich habe keinen Liebsten, sagte sie sanft. Giuditta würde es nicht leiden. Wer sollte mich auch heiraten wollen? Ich habe nichts als ein halbes Dutzend Hemden und dies silberne Kettchen, das ich am Halse trage.
Nun, sagte ich, nicht alle Männer sehen auf Geld, wenn sie einem Mädchen gut sind. Da ist zum Beispiel gleich der Battista, der Sohn vom Cavallo bianco, von dem weiß ich, dass er sehr glücklich wäre, wenn er dich haben könnte.
Der! – sie rümpfte ein wenig die Unterlippe. Der hat keinen Willen. Ich weiß wohl, dass ich ihm gefalle. Aber weil seine Schwester mich hasst, wagt er nicht, die Hand nach mir auszustrecken. Poveretto!
Die Marietta hasst dich? Was hast du ihr zu Leide getan?
Sie zuckte die Achseln und schwieg. Draußen vor der Tür meines Zimmers raschelte etwas. Sie fuhr vom Stuhl auf, als ob sie fliehen wollte.
Es wird nur die Katze sein, sagt’ ich. Im Haus ist ja Niemand. Aber wenn du dich fürchtest, will ich die Tür verriegeln.
Nein, nein! bat sie hastig. Bitte, sehen Sie nur nach, dann aber lassen Sie die Tür offen.
Es war wirklich nur die Katze gewesen. Das Mädchen setzte sich wieder, und ich fuhr fort zu zeichnen. Um den Ausdruck ihres Gesichts lebendig zu erhalten, plauderte ich weiter.
Wie kommt es, dass du dieselben Lieder singst wie der Giggi Caramella? Hast du sie von ihm gelernt und siehst du ihn öfters?
Wieder überflog ihr Gesicht eine tiefe Röte.
Ich kenne ihn nicht, gewiss nicht. Giuditta spricht schlecht von ihm und sagt, er habe keinen guten Charakter. Das sagt sie aber von allen Männern, und von dem glaube ich es nicht, weil er immer lustig ist und so schöne Lieder weiß. Wir haben einmal eine Woche lang seinem Café gegenüber gearbeitet, der Doktor wohnt da, für dessen Frau hatten wir ein Kleid zu machen. Da hörte ich ihn immer singen und habe seine Lieder behalten. Unten bei Neapel, wo er her ist, muss es viel lustiger sein.
Ein Seufzer hob ihre Brust. Sie drückte die Augen halb ein und träumte vor sich hin. Um sie aus ihrer Schwermut herauszureißen, sagt’ ich: Wer weiß, Adele, du kommst auch noch einmal nach der Bella Napoli. Es braucht dich nur einmal ein Maler zu sehen, der nicht, wie ich, Frau und Kinder zu Hause hat, oder irgend ein anderer Fremder, der sich in dich verliebt, der heiratet dich dann, und ihr reis’t zusammen in die weite Welt, und du singst den ganzen Tag die lustigsten Lieder.
Sie schüttelte langsam den Kopf.
Das wird nie geschehen. Meine Schwester will, dass ich ins Kloster gehe. Wenn sie mich nicht im Hause und sonst zur Arbeit brauchte, hätte sie mich auch schon so weit gebracht. Denn im Kloster kann’s nicht viel trauriger sein als in dem Leben, das ich führe. Nun, wie Gott es haben will, so geschieht’s auf Erden.
Ich war eben im Begriff, ihr diese zahme Ergebung in ein freudloses Schicksal auszureden, als draußen die Glocken zu läuten anfingen. Sie stand erschrocken auf. Mein Gott! sagte sie, ich habe mich verspätet. Wenn ich jetzt nur noch unbemerkt fortkomme! Addio!
Sie lief nach der Tür. Ich hatte kaum Zeit, ihr das Geld, das ich ihr versprochen, in die Hand zu drücken, das sie auch in der Verwirrung, ohne darauf zu achten und ohne Dank zu sagen, annahm. Dann huschte sie aus der Tür.
Sie konnte das Haus kaum verlassen haben, da wurde wieder bei mir angeklopft. Zu meinem nicht geringen Erstaunen erschien Fräulein Marietta in meinem Zimmer, die sonst viel zu strenge Begriffe von Anstand hatte, um einem männlichen Gast ihrer Eltern einen Besuch zu machen.
Sie hatte einen roten Kopf, und ihre Züge waren von einer heftigen Aufregung verzerrt, wobei ihre kleinen blond bewimperten Augen unstet hin und her liefen.
Verzeihen Sie, Herr! sagte sie mit bebender Stimme, aber ich wollte nur fragen, ob Sie wirklich dieses – Mädchen (sie brauchte ein beschimpfendes Beiwort, das ich hier unterschlage) zu einer Sitzung eingeladen haben, wie sie eben vorgab. Sie wäre im Stande, sich fremden Herren auch ohne eine Aufforderung anzubieten, da sie so eitel und schamlos ist, dass sie glaubt, wie eine Prinzessin Jedem eine Gnade zu erweisen, dem sie nur erlaubt, sie anzugaffen. Und sie ist doch nicht einmal hübsch. Vor einem Jahr war ein französischer Maler hier, der sagte, ich hätte das schönste Gesicht von allen Mädchen und Frauen in Toscolano.
Ich bin wahrhaftig nicht eitel, Jede muss mit dem Gesicht zufrieden sein, das ihr Gott gegeben hat, aber dass nun dumme Leute dieser – (wieder ein ehrenrühriges Wort) Adele schmeicheln und ihr den Kopf verdrehen, o! – Sie ballte eine Faust und schüttelte sie in der Richtung, wo das Häuschen der Schwestern stand. Zeigen Sie mir doch das Bild, wenn es wahr ist, dass Sie sie gezeichnet haben.
Ich wollte nicht Öl ins Feuer gießen und erklärte, die Skizze sei erst angefangen, ich wisse auch nicht, ob ich dazu kommen würde, sie fertig zu machen.
Nun, sagte sie etwas beruhigter, wenn Sie ihr Gesicht länger studieren, werden Sie wohl dahinter kommen, dass nichts daran ist. Oder etwas doch: das Muttermal auf der Oberlippe. (In der Tat saß dort ein kleines schwarzes Fleckchen, das wie ein natürliches Schönheitspflästerchen den roten Mund nur anmutiger machte.) Sie sehen, Gott hat sie gezeichnet, wie er ihrer Schwester einen krummen Rücken und einen lahmen Fuß gegeben hat. Und mit solchen verworfenen Kreaturen haben wir uns, wenn es meinem Bruder nach gegangen wäre, verschwistern und verschwägern sollen? Per la Madonna, so lange ich noch da bin, die Ehre unseres Hauses zu verteidigen, sollen diese – (das dritte Schimpfwort) nicht über unsre Schwelle kommen!
Sie hob wie zum Schwur ihre magere Hand gegen die Zimmerdecke und rauschte aus dem Zimmer, in der Überzeugung, ein reuevolles Bewusstsein, wie unbesonnen ich mich mit einer so niedrigen Person eingelassen hatte, in mir erzeugt zu haben.
Ich konnte nicht so frei hinter dieser Furie drein lachen, wie sie verdient hatte. Das Mitleiden mit dem wehrlosen Gegenstande ihres Hasses machte mich traurig. Auch der arme verliebte Battista, den ich tief niedergeschlagen im Hause herumschleichen und die Sonntagsgäste bedienen sah, tat mir trotz seiner Schwachmütigkeit leid. Das Mädchen wäre als künftige Padrona des »Weißen Rosses« doch besser aufgehoben gewesen, als hinter kalten Klostermauern.
Indessen – »wie Gott es haben will, so geschieht’s auf Erden«, hatte sie selbst gesagt. Ich war egoistisch genug, mich zu freuen, dass ich wenigstens das liebliche Gesicht für mein Buch erobert hatte, und so saß ich auch am nächsten Morgen wieder an der Zeichnung, um sie noch ein wenig aus dem Kopf auszuführen – ich hatte die Züge ja auswendig gelernt – als es wieder bei mir anklopfte.
Ich rief in freudiger Erregung »Herein!«, da ich, so unwahrscheinlich es war, wirklich dachte, mein Modell von gestern habe wieder den Weg zu mir gefunden; doch in der Tür, die rasch aufgerissen wurde, erschien diesmal nicht das schlanke junge Wesen, sondern nur ihre missgestalte Schwester.
Sie schob sich, mühsam auf einen Stock gestützt, ins Zimmer hinein. Wie mich ihre scharfen grauen Augen, über die zwei Strähnen ihres schwarzen Haares herabhingen – nicht so reizend, wie die Löckchen ihrer Schwester – unter dem schwarzen Shawl hervor anblitzten, konnte einem in der Tat unheimlich zu Mute werden.
Ich ließ mir aber nichts merken, sondern nickte ihr freundlich zu.
Ah, die Signora Giuditta, sagte ich und stand auf. Was verschafft mir die Ehre? Kommt und nehmt Platz. (Ich bot ihr meinen eigenen Stuhl an.) Wie steht’s mit Eurer Gicht? Und was machen Eure Vögel?
Sie war mitten im Zimmer stehen geblieben und rührte sich nicht vom Fleck.
Meine Vögel? sagte sie mit ihrer rauen Stimme. Denen fehlt nichts. Die sind gut verwahrt. Wenn’s alle Menschen so gut hätten, könnten sie Gott danken.
Nun, Giuditta, Menschen brauchen doch keine Käfige, die haben ihre Vernunft und können sich selbst verwahren.
Sie zuckte die Achseln.
Menschen brauchen ihre Vernunft bloß, um unvernünftig zu sein. War’s etwa vernünftig, dass die Adele gestern, statt in die Messe zu gehen, zu Euch geschlichen ist, damit nun die ganze Stadt davon spricht? Denn natürlich, die Marietta – questa vipera di Marietta! – der ist sie begegnet, und die hat’s an die große Glocke gehängt. Nun zeigt man mit den Fingern auf sie.
Je nun, sagte ich, sie braucht sich nicht darum zu genieren, wenn sie nichts schlimmeres auf dem Gewissen hat. Es ist keine Todsünde, einem Maler zu sitzen. Die Madonna ist selbst zum heiligen Lukas herabgestiegen, damit er ihr Bildnis male.
Ja, die Madonna! Die mag tun, was ihr gefällt. Die Adele aber ist nur ein armes Ding, das nichts hat als seinen guten Ruf, und Ihr, Herr, seid kein Heiliger. Die Sitzung war gewiss nur ein Vorwand.
Ich nahm das Zeichenbuch vom Tisch und hielt ihr das Blatt mit dem Bilde ihrer Schwester vor die Augen. Da seht, sagte ich. Kaum länger als eine halbe Stunde ist Adele bei mir gewesen, da ist dies Bild zu Stande gekommen. Ihr begreift doch wohl auch, dass daneben keine Zeit war, per fare all’ amore, auch wenn ich ein leichtsinniger junger Fant wäre und nicht ein ehrsamer Familienvater.
Sie starrte unverwandt auf das Bild, ihre strengen Züge wurden milder, die Hand zitterte, mit der sie das Buch angefasst hatte.
Ja, sagte sie endlich, indem sie langsam vor sich hin nickte, sie ist es, bloß die Farben fehlen. Ihr findet sie also auch schön? Ihr hättet aber erst ihre beiden Schwestern sehen sollen, die waren noch weit schöner, und doch – und eben darum – denn es ist falsch, wenn man sagt:
Chi bella non è, Fortuna non ha!
Gerade den Schönen geht’s schlecht, alles stellt ihnen nach, und sie selbst rennen in ihr Verderben mit offenen Augen, weil ihre Schönheit, von der man ihnen immer die Ohren vollschwatzt, sie um die Vernunft bringt und ihr eigener Spiegel sie verblendet. Glaubt nicht, Herr, dass ich neidisch auf die armen Dinger gewesen wäre, weil ich selber so plump und garstig war von klein auf, wie eine Kröte. Ich sah früh ein, dass ich dadurch vor allen Versuchungen geschützt war, denn die Männer sind alle schlecht – bricconi, furfanti! – und mir gab keiner süße Worte, da behielt ich meinen klaren Verstand, und weil ich die Älteste war, nahm ich mir vor, meine Schwestern vor den Schlingen und Leimruten der Vogelsteller zu behüten. Sie sind ihnen doch ins Garn gegangen, ich habe sie nicht streng genug bewacht. Aber die Eine, die mir noch geblieben ist, die soll nicht dasselbe Schicksal haben, das habe ich der heiligen Madonna gelobt, und das will ich halten!
Adele hat mir erzählt, dass Ihr eine Nonne aus ihr machen wollt. Das wäre freilich der festeste Vogelbauer. Ich fürchte nur, sie wird ihre hübschen Federn an dem Klostergitter zerflattern und das Singen ganz verlernen, wie Eure Blauamsel. Dauert Euch denn nicht das junge Blut? Könntet Ihr nicht einen guten Mann für sie finden und selbst noch Freude erleben als Tante ihrer Kinder?
Sie antwortete nicht gleich. Nein, nein, sagte sie dann, es findet sich Keiner, der so ein armes Mädchen nimmt, wie es geht und steht. Nicht einmal in jedem Kloster fände sie Aufnahme ohne Mitgift. Aber unser Pfarrer hat mir versprochen, sich dafür zu verwenden. Zum Herbst soll sie eingekleidet werden. Ein guter Mann? Sogar der hätte sich gefunden, der Battista hier vom Cavallo bianco, freilich ein Tropf und zum Verlieben nicht eben geschaffen. Aber er hätte sie gut gehalten, und auch die Eltern hatten sich darein ergeben, bloß die Marietta – questa vipera di Marietta! – aus purer Eifersucht, weil sie keine Schwägerin wollte, die schöner wäre als sie – basta! Es ist so besser. Im Kloster ist sie vor allen Fallstricken der Eitelkeit sicher und geht endlich, nachdem sie selig gelebt hat, grad in den Himmel ein. Aber nun verzeiht, dass ich Euch so lange aufgehalten habe, und ich will ja nun glauben, dass Ihr keine schlimmen Absichten mit der Adele gehabt habt; aber wenn sie Euch versprochen hat, noch einmal zu Euch zu kommen, daraus kann nichts werden.
Auch nicht, wenn Ihr sie zu mir begleitet?
Sie schüttelte den Kopf. Sie soll nicht noch eitler werden, das taugt nicht für eine künftige Braut des Himmels. Und hier, Herr, nehmt das wieder –
Sie reichte mir den Fünf-Franken-Taler, den ich der Adele gestern in die Hand gedrückt hatte.
Seid Ihr toll? sagte ich. Das Geld ist so redlich verdient, wie wenn Eure Schwester dafür genäht hätte.
Es ist Sündengeld, und Ihr müsst’s zurücknehmen. Handgeld des Teufels, womit er Seelen fängt. Nehmt, nehmt!
Ich trat ein paar Schritte zurück. Als sie aber sah, dass ich mir’s nicht aufdringen ließ, warf sie’s auf das Tischchen, von wo es wieder herunter und in eine dunkle Ecke rollte. Dann winkte sie mir mit der Hand einen Abschiedsgruß zu und humpelte an ihrem Stock hastig aus dem Zimmer.
Meine Zeit in Toscolano war abgelaufen. Zwei Tage nach Giuditta’s Besuch sagte ich dem gastlichen Cavallo bianco Valet. Meine Wirtsleute beluden mich noch mit allerlei Gastgeschenken, Früchten und kleinen Kuchen, Battista ließ es sich nicht nehmen, mein Köfferchen selbst bis zur Dampferstation Maderno zu tragen, und so schritten wir am frühen Morgen die dunkle Gasse hinunter nach vielen ernst gemeinten »Auf Wiedersehen!«
Giggi Caramella räkelte sich, eine lange schwarze Cigarre rauchend, auf zwei Strohstühlen vor seiner Tür und würdigte mich kaum eines hochmütigen Kopfnickens, da ich seit jenem ersten Morgen nie mehr bei ihm gefrühstückt hatte. Als wir aber an die Brücke kamen, blieben wir Beide unwillkürlich stehen.
Aus dem Häuschen zur Linken klang eine helle, wohlbekannte Stimme, und deutlich hörten wir die Worte:
Te voglio bene assaje, E tu non pienz’ a me!
Battista war ganz blass geworden, obwohl ihn der Koffer, den er auf der Schulter trug, erhitzt hatte. Dann aber ermannte er sich, stieß einen schweren Seufzer aus und stapfte weiter, indem er damit meiner Überlegung ein Ende machte, ob ich nicht hingehen und den Schwestern zum Abschied die Hand drücken sollte.
Das arme, zur Himmelsbraut verurteilte schöne Kind noch einmal zu sehen, hätte mir freilich nur das Herz schwer gemacht.
Wir sprachen auf dem Wege kaum ein Wort miteinander, obwohl wir wahrscheinlich dieselben Gedanken hatten. Als wir dann den Landungsplatz erreicht und mein Begleiter seine Last abgeladen hatte, war ich in Verlegenheit, wie ich mich dem guten Menschen, der mich wie einen geehrten Gastfreund, nicht wie einen fremden Reisenden behandelte, dankbar erzeigen sollte. Ich griff aber doch in die Tasche, da sagte er: Ich bitte Sie, Herr, ich nehme nichts. Im Gegenteil: ich möchte, wenn Sie mir eine große Gunst erweisen wollten, die nicht umsonst von Ihnen annehmen. Könnten Sie mir wohl eine kleine Kopie von dem Porträt – Sie wissen schon – anfertigen, nur mit ein paar Strichen? Ich würde Ihnen dafür bezahlen, was Sie wollen, ich kenne die Preise für Kunstwerke nicht, aber Sie wissen, dass ich ein Kunstfreund bin, und zudem – ich hätte gern ein Andenken an Sie –
Das »Sie« klang zweideutig – es konnte so gut den Angeredeten wie eine gewisse junge Person bezeichnen. Wie es gemeint war, zeigte die Röte, die dem ehrlichen jungen Menschen jetzt bis in die Stirne geschossen war.
Ich versprach ihm, das Bildchen zu kopieren, sobald ich nach Hause gekommen sei, und hielt auch Wort. Es kam aber keine Erwiderung, überhaupt blieben die Bewohner Toscolano’s von dem Tage an gänzlich für mich verschollen.
Und blieben es fast ein volles Vierteljahrhundert.
Erst vor ein paar Jahren wurde es mir so gut, wieder einmal einige Wochen am Gardasee zuzubringen, diesmal im Frühling, in Salò und in Gesellschaft meiner Frau.
Am ersten schönen warmen Nachmittage aber nahmen wir ein Wägelchen und fuhren nach meinem Toscolano.
Ich war sehr gespannt, wie ich das alte Nest und meine Bekannten darin antreffen würde. Zu meinem Bedauern aber fand ich, dass die lange Zeit, die darüber hingegangen war, an den Häusern des Orts keine andere Veränderung vorgenommen, als dass sie alle mir befreundeten Menschen aus ihnen weggeholt hatte.
Doch nein, auch eines der Häuser war nicht mehr vorhanden, das Häuschen der beiden Schwestern gleich neben der Brücke und das Gärtchen daneben. Mein »Weißes Roß« dagegen – man nannte es jetzt Cavallino bianco – hatte allen Regen und Sonnenschein dieser dreiundzwanzig Jahre unverändert überdauert. Als ich mit meiner Frau die dunkle Treppe hinaufstieg zu der denkwürdigen Stätte, wo ich damals nach fleißigem Tagewerk den Schlaf des Gerechten geschlafen hatte, war noch alles wie damals, bis auf einen Fleck an der Wand, der inzwischen etwas weiter abgebröckelt war, und einen der Haken in der Tür, den eine derbe Hand verbogen hatte. Ich musste erleben, dass meine Frau über die Genügsamkeit ihres lieben Mannes, der aus diesem kahlen Raum begeisterte Briefe nach Hause geschrieben hatte, erschrak und fast auf den Gedanken kam, ein gewisses junges Gesicht mit schwarzen Löckchen habe einen Zauber ausgeübt, der diese Armseligkeit in einem anderen Lichte habe erscheinen lassen.
Als wir dann aber unten im Hof gegenüber dem frisch aufblühenden Gärtchen saßen und die Wirtin uns den süßen Moscato vorsetzte, den alle Fremden hier im Cavallino zu trinken pflegen, wurde uns Beiden wieder behaglicher. Es war nicht mehr meine Padrona von damals. Das Gasthaus war seitdem schon in die dritte Hand gekommen. Aber die jetzige Wirtin war aus Toscolano gebürtig und konnte all meine Fragen nach den früheren Inhabern beantworten.
Die Eltern hatten nur noch ein paar Jahr gelebt. Die Kinder waren dann fortgezogen, da eine Verwandte ihnen vorgespiegelt hatte, sie würden besser daran sein, wenn sie den Gasthof, den sie selbst am Idrosee besaß, übernähmen. Die Marietta hatte dazu geraten, in der Meinung, an einem anderen Ort würde man ihren Reizen und Tugenden mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen als hier, wo sie allgemein als eine böse Zunge und widerwärtige Närrin bekannt war.
Da droben sei es ihr aber auch nicht gelungen, einen Mann zu fangen, sodass sie immer galliger und giftiger geworden sei. Ihr gutmütiger Bruder, dem sie es verwehrt, eine Frau zu nehmen, habe sich mit der Flasche über sein ödes Leben zu trösten gesucht und sich endlich zu Tode getrunken.
Und was ist aus den beiden Schwestern geworden, die unten in dem Haus bei der Brücke gewohnt haben, der Giuditta und Adele? fragte ich.
Habt Ihr die auch gekannt? Nun, von denen ist auch nicht viel Gutes zu berichten.
Die Giuditta hat es gewiss gut mit ihrer Schwester gemeint, als sie eine Klosterfrau aus ihr machen wollte. Lieber Gott, an ihren anderen Schwestern, die ihr wie eigene Kinder waren, hat sie ja keine Freude und Ehre erlebt. Aber die Adele fühlte nun einmal nicht den Beruf zum heiligen Leben in sich. Und darum, als die Zeit heranrückte, wo sie als Novize eintreten sollte – es war ein ganz angesehenes Kloster, wo sonst nur wohlhabende Mädchen aufgenommen wurden, ihr aber erließ man die Mitgift von wegen ihrer schönen Stimme, die für den Gesang in der Kirche ein Schatz war – nun, da stahl sich das geängstete arme Ding in einer Nacht aus dem Hause und lief zu dem nichtsnutzigen Menschen, dem Cafetiere, der sie mit seinen Schelmenliedern betört hatte, und sie setzten sich in einen Kahn und fuhren in den See hinaus. Und da es eine schwüle Nacht war, im August, fühlten sie auch nicht das Bedürfnis, vor dem lichten Morgen wieder ans Land zu kommen.
Welch einen Lärm das Abenteuer machte, könnt Ihr Euch denken, Herr. Aber was war zu machen? Die Giuditta musste sich drein ergeben, dass ihr Augapfel die Frau dieses Briccone wurde. Sie verkehrte aber nicht mit dem jungen Paar, sie sprach den Namen ihrer Schwester nie aus. Nur als im nächsten Jahr ein Kindchen zur Welt kam und sie zur Patin gebeten wurde, da versöhnte sie sich mit dem, was einmal nicht zu ändern war, und nahm sich sofort der kleinen Adelina an, als ob sie ihre Großmutter wäre.
Das arme Würmchen konnte das auch gut brauchen. Denn sein Spitzbube von Papa hielt es nicht länger als ein halbes Jahr nach der Geburt des Kindes aus. Dann verduftete er. Er steckte bis über den Hals in Schulden, der Weinhandel war Schwindel gewesen, an seinem jungen Weibe hing der Taugenichts auch nicht sonderlich, und so war er eines Tages auf und davon. Das Café wurde versteigert, die arme Strohwitwe musste froh sein, wieder in dem Häuschen der Schwester mit ihrer Kleinen eine Zuflucht zu finden.
Sie war hier immer noch besser daran als in einer Klosterzelle. Sie hatte doch ihr Kind, und jetzt, da nichts mehr an ihr zu hüten war, sperrte auch die strenge Schwester sie nicht mehr ein. Jetzt aber schien ihr an ihrer Freiheit nichts mehr zu liegen. Sie ging nie aus dem Hause, außer zu ihren Kundschaften, wo sie still und schwermütig bei ihrer Schneiderarbeit saß. Singen hörte man sie nur selten, immer nur, wenn sie ihr Kleines auf dem Schoß hatte. Ihre Gesundheit hatte sichtlich gelitten in der kurzen Ehe mit dem schlechten Menschen, und auch mit ihrer Schönheit war’s bald vorbei. Als die kleine Adelina acht Jahre alt war, trug man ihre Mutter zu Grabe.
Die Kleine aber gedieh prächtig. Sie war auf und ab das Ebenbild der Mutter, wie ihr aus dem Spiegel gestohlen, nur um einen Kopf kleiner, und seltsamerweise blondhaarig. Aber ein herziges Engelchen – fatta a pennello (wie mit dem Pinsel gemalt) – und die gute Stunde selbst, das Mündchen immer zum Lachen aufgelegt, obwohl sie bei der Tante Giuditta nicht das lustigste Leben hatte. Denn die hielt sie kurz am Bändel, ließ sie nie allein auf die Straße, auch nur mit anderen Kindern zu spielen, und wenn sie selbst ausgehen musste, schloss sie das Kind in ihrem Häuschen ein.
Man konnte dann, wenn man vorbeiging, die Kleine drinnen singen hören wie ein Vögelchen im Bauer, dieselben Lieder, die ihre arme Mutter gesungen hatte. Es erbarmte einen ordentlich, zumal wenn man dachte, dass die Giuditta wieder keine andere Versorgung für das Kind im Sinn hatte als für die Mutter, und auch der Pfarrer ihr darin beistimmte.