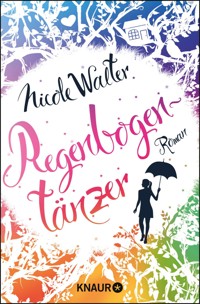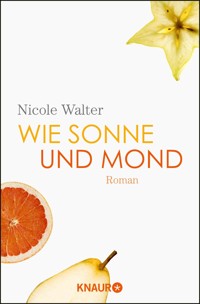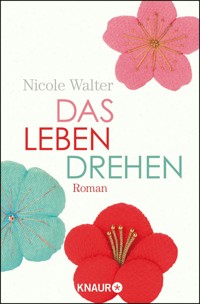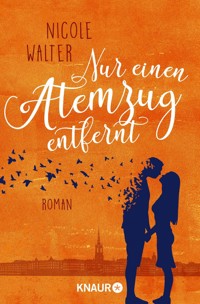
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weil Liebe mit dem Tod nicht endet: Dramatisch, anrührend und wunderschön erzählt Nicole Walter in ihrem Liebesroman »Nur einen Atemzug entfernt« die Geschichte einer ganz großen Liebe und einer schicksalhaften Reise nach Schweden. Mit dem Unfall-Tod ihres Ehemannes Tom hat das Leben auch für die 35-jährige Leonie aufgehört – zu groß war die Liebe zwischen ihnen, als dass ohne Tom noch irgendetwas Sinn ergeben könnte. Doch dann besucht Tom Leonie in ihren Träumen. Nacht für Nacht verlangt er Unmögliches von ihr: Sie soll endlich die Reise nach Schweden antreten, zu der sie beide am Tag nach dem Unfall hätten aufbrechen wollen. Widerstrebend macht Leonie sich schließlich auf den Weg ins Ungewisse: zu den Träumen ihrer Kindheit, zu einem Tom, der nur einen Atemzug entfernt scheint – und schließlich zurück ins Leben. Und zu einem neuen Glück? Nicole Walter ist Spezialistin für die ganz großen Gefühle und einfühlsam erzählten Romane über das, was im Leben wirklich wichtig ist. Neben dem Liebesroman »Nur einen Atemzug entfernt« sind von der erfahrenen Drehbuch-Autorin auch die folgenden warmherzig-gefühlvollen Romane erschienen: • »Das Leben drehen« • »Wie Sonne und Mond« • »Regenbogentänzer« • »Das Glück umarmen« • »Ein Blick in deine Augen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Nicole Walter
Nur einen Atemzug entfernt
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Mit dem Unfalltod ihres Ehemannes hat das Leben auch für die 35-jährige Leonie aufgehört – zu groß war die Liebe zwischen ihnen, als dass ohne Tom noch irgendetwas Sinn ergeben könnte. Doch dann besucht Tom Leonie in ihren Träumen. Nacht für Nacht verlangt er Unmögliches von ihr: Sie soll endlich die Reise nach Schweden antreten, zu der sie beide am Tag nach dem Unfall hätten aufbrechen wollen. Widerstrebend macht Leonie sich schließlich auf den Weg ins Ungewisse: zu den Träumen ihrer Kindheit, zu einem Tom, der nur einen Atemzug entfernt scheint – und schließlich zurück ins Leben. Und zu einem neuen Glück?
Inhaltsübersicht
Motto
Vorspann
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Epilog
Danke
Quellen
Nähme ich Flügel der Morgenröte und machte mir eine Wohnung zuäußerst am Meer
Astrid Lindgren
Ferien auf Saltkrokan
Gibt es ein Leben, das irgendwo auf uns wartet? Mit all den Antworten auf unsere Fragen? Muss zum Beispiel tatsächlich erst eine Tür ins Schloss fallen, ehe sich eine andere Tür öffnet? Warum können wir nicht beides gleichzeitig haben? Warum müssen wir immer wieder neu entscheiden? Zwischen dem alten Raum mit seinem Schicksal, eingedrungen in atmendes Mauerwerk, Liebe, Glück, Tränen, Schmerz, jede Facette gelebten Lebens unsichtbar und doch vorhanden. Wie das Knirschen im Gebälk, der stetig leise Dialog in die Jahre gekommener Häuser. Und diesem neuen Ort, vor dessen Tür wir noch unsicher, fast verängstigt stehen, weil sie ins Unbekannte führt. Wenn wir jedoch unseren ganzen Mut zusammennehmen und den ersten Schritt wagen, bringt es uns vielleicht wieder ein Stück näher zu unserem eigentlichen Ich, tief vergraben unter all dem Schönen und Schmerzvollen, das wir seit unserer Geburt erlebt haben. Enttäuschte Hoffnung. Angepasstes Sein. Erstickte Träume.
Vielleicht führt ja die neue Tür wie bei Leonie Singer – denn dies ist ihre und nicht unsere Geschichte – in ein gelbes Haus mit geschwungener Freitreppe und weißen Sprossenfenstern inmitten von dem hellen Grün endloser Wiesen und dem etwas dunkleren gesunder Wälder, eingebettet im Holzgeruch des schwedischen Sommers und in melancholischem Silberblau. Blau, die Farbe der Ruhe und der Ewigkeit, der Sehnsucht, des Vertrauens, aber auch der Lüge. Die Wahrheit suchen. Sie herauspicken aus alldem, was uns täglich erzählt wird und was wir anderen über uns erzählen, weil wir glauben, nur auf diese Weise geliebt zu werden.
Sein müssen, wer wir nicht sind.
Nicht sein dürfen, wer wir sind.
Wollen wir nicht alle hinaustreten aus dieser inneren Dunkelheit, mitten hinein ins Licht? Vielleicht sogar wie Leonie in das Land, in dem der Sonnenuntergang direkt in das Erwachen der Sonne hineinfließt und sich der Morgen sogleich in den Abend bettet, um Arm in Arm das magische Licht des Nordens an den Himmel zu zaubern. Über das Meer und die Seen, so klar, dass sie zum perfekten Tanzboden werden für Sonnenfunken und Sternefunkeln. Blick ohne Halt, weil in der Gegenwart schon die Ewigkeit zu spüren ist. Vielleicht am Hornborgasjö, wo die Kraniche, Symbol für ein langes Leben und Glück, rasten, ehe sie weiterziehen zu ihren Brutplätzen im Norden. Feuchte Gebirgssommerluft. Weißes Dunkel. Dunkles Weiß. Donnerndes Wasser. Donnerndes Eis. Landschaft, die sich aufzulösen scheint in einem Himmel, der von Sonne und Kälte flirrend vibriert.
Es ist der Polarkreis, an dem Leonie erkennt, dass sie sich nicht entscheiden, die Vergangenheit nicht aufgeben muss, um dem Leben die Hand zu reichen, das auf sie wartet. Ein Schritt genügt. Und Schweigen. Weil sie und wir im Schweigen und in der Stille uns nicht mehr belügen, sondern ganz die sind, die wir sind. Stets Suchende und Anbeter des Lichts.
1.
Der Flur war lang. Zu lang. Als würde er niemals enden. Abrupt blieb Leonie Singer stehen. Ratlos. Wieder hatte sie sich verlaufen in dem Labyrinth. Ein Versuch, sich an den Schildern zu orientieren. Erstaunte Blicke, die Leonie ignorierte, sie lief weiter wie blind. Wurde schneller. Erneute Blicke, das eine oder andere Lächeln folgten ihr.
Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie noch immer diese viel zu großen bunten Schuhe, von ihr liebevoll Breitmaulfrosch genannt, über ihren gelben Sneakers trug. Sie sorgten für den typischen Watschelgang des Clowns und waren gewiss ein Grund für die neugierigen Blicke. Leonie blieb stehen, schlüpfte aus den Schuhen, schleuderte sie von sich, lief weiter. Sie musste schneller sein, schneller laufen, auch wenn sie nicht ankommen wollte. Nicht sehen, was sie in wenigen Minuten sehen würde. Begreifen, was nicht zu begreifen war. Eine Frau hob die bunten Breitmaulfroschriesenschuhe auf und schaute verblüfft dem eigenartigen vor sich hin stolpernden und auf dem glatten Boden immer wieder wegrutschenden bunten Wesen hinterher. Dann glaubte sie zu verstehen und lächelte.
Leonie lächelte auch.
»Du willst wirklich mit mir bis rauf nach Lappland, Tom?« Noch vor wenigen Stunden hatten Leonie und ihr Mann Tom mit einem ganzen Stapel von schwedischen Reiseführern am Frühstückstisch gesessen, und Leonie hatte es noch immer nicht fassen können, dass Tom sie zwei Wochen zuvor damit überrascht hatte. »Ich träum schon so lange davon, Thommy. Ich freu mich so!«
Sein Gesichtsausdruck hatte sie daran erinnert, wie sehr Tom die Verniedlichung seines Namens verabscheute. Rasch hatte sie sich zu Tom verbessert und weitergesprochen, ohne auf sein zufriedenes Nicken zu warten. Ihr Ton wurde vorsichtig, tastend – wie so oft, seit Tom so explosiv geworden war. In den letzten Jahren reichte ein vermeintlich falsches Wort, und er ging in die Luft.
»Aber ist das nicht viel zu weit mit dem Auto?«, fuhr sie sich an ihn herantastend fort. »Vielleicht hätten wir doch eine organisierte Reise buchen sollen?«
Diesmal blieb er freundlich und ruhig. »Ich sitze am Steuer, wenn es übermorgen losgeht, Leonie, nicht du.« Er lächelte leicht, und sie atmete auf. »Sei nicht immer so ängstlich, Leo …«, kurze Pause, »…nie.«
Mit diesem Wortspiel betonte er gerne, dass sie vieles war, nur keine Löwin, und es nie sein würde. Leo? Nie! Dazu dieser Tonfall, leicht von oben herab. Sie hatte gehofft, er würde ihn sich abgewöhnen, nach allem, was in den vergangenen Monaten geschehen war. Doch sie rief sich zur Ordnung. Sie musste geduldig sein, ihm Zeit lassen. Zeit! Zum Glück würden sie jetzt erst einmal genug davon haben. Sie schluckte seinen Anflug von Überheblichkeit. Lächelte. »Ich bin nicht ängstlich, Tom. Ich frage.«
»Ich bin da, Leonie. Vertrau mir!« Seine Stimme nicht mehr unterschwellig aggressiv, überfordert, sondern warm und fürsorglich wie früher. Sie lernten gerade beide wieder dazu.
Als sie sich kennenlernten und viele Jahre, die folgten, war Tom stark, ihr Beschützer gewesen. Er war derjenige, der alles im Griff hatte. Privat. Beruflich. Bis er zu übertreiben begann. Er hatte zu viel von sich verlangt, und so waren unter dem ständigen Druck, den er sich selbst auferlegt hatte, die Rädchen aus seinem gut geölten Getriebe gesprungen. Nervenzusammenbruch. Burn-out.
»Vertraust du mir?« Er nahm ihre Hand, zart, behutsam, fast so wie früher. Keine Spur mehr von Unmut in ihm oder Ärger, die sie so oft auf Zehenspitzen um ihn herum hatten schleichen lassen.
»Natürlich vertrau ich dir, Tom. Ich hab einfach nur Reisefieber.« Geduld war der Weg. »Das habe ich immer.« Gleichzeitig war der Gedanke da, dass auch sie sich in den Jahren ihrer Ehe verändert hatte. Vermutlich gab es in ihr noch irgendwo die Löwin. Die Löwin, die brüllte und aus ihr herauswollte, ab in die freie Wildbahn. Dem Glück nachjagen und leben. Vor allem wieder leben. Doch über die Jahre war Leonie zur perfekten Dompteuse ihrer selbst geworden. Vorder- und Hinterpfoten parallel auf dem eisernen Rundhocker, mit viel zu wenig Platz für so eine gewaltige und stolze Wildkatze. Kein Fauchen, höchstens einmal das Lecken der Pfoten und den gewaltigen Schädel nach hinten gebogen, um vielleicht – und auch nur vielleicht – wieder einmal am Hals gekrault zu werden, da, wo Mensch und Tier besonders verletzlich sind.
Du bist wie deine Locken, hatte Tom am Anfang ihrer Liebe oft mit einer Zärtlichkeit gesagt, die über die Jahre verschwunden war. Einfach nicht zu zähmen wie Flummis. Der Vergleich mit den kleinen, bunten Springbällen hatte ihr gefallen. Vielleicht, weil sie sich nach ihrem Kennenlernen zum ersten Mal lebendig gefühlt hatte. So durch und durch sie selbst. Ebenso hatte es ihr gefallen, von ihm geneckt zu werden.
Warum willst du mich heiraten, Tom?
Wer außer mir sollte sich denn sonst opfern, mein lieber Schatz?
Jetzt sag schon, Tom, sag, dass du mich liebst.
Bis zu den Sternen, Leonie.
Ach, Thommy, ich brauch keine Sterne, mir genügt es, denselben Boden unter den Füßen zu spüren wie du. Egal, wo!
Vielleicht hätte sie genau das nicht sagen, nicht einmal denken, sondern mehr von ihm verlangen sollen. Achtsamkeit und Respekt. Aber sie hatte sich ihm zu sehr angepasst, damit er durch sie nicht auch noch unter Druck geriet. Dabei hatte sie zu viel von sich aufgegeben. Selbst als er mit der Zeit schwierig geworden war, auch immer wieder ungerecht gegen sie. Und das nur, das hatte sie in letzter Zeit erkannt, weil er mit sich selbst nicht klarkam. Emotional – nicht finanziell – war sie, durch und durch harmoniesüchtig, zu abhängig von ihm geworden. Nicht wie eine Löwin, nicht einmal wie ein Kätzchen. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn sie energischer gewesen, sie selbst geblieben wäre, mehr von ihm verlangt hätte … Hätte hätte Fahrradkette.
Leonie tastete sich weiter durch das Krankenhauslabyrinth. Tastete, stolperte, rannte, mit immer neuen Gedanken, die das andere, was sie nicht denken wollte, verdrängten. Dass seine Zärtlichkeit ganz allmählich verblasst war, wie ein Foto, das zu lange der Sonne ausgesetzt gewesen war. Der Mensch vertrug nicht zu viel Sonne. Vertrug er auch nicht zu viel Glück?
»Lass uns fliegen.« Auch das hatte Tom an diesem Morgen unvermittelt gesagt. Erst jetzt fiel ihr auf, wie seltsam die Szene am Frühstückstisch gewesen war und wie gründlich sie ihn missverstanden hatte.
»Du meinst, wir nehmen doch lieber das Flugzeug und nicht den Wagen?«, hatte sie nachgehakt.
»Ich meine nicht das Fliegen mit dem Flugzeug. Fliegen wie die Kraniche. Hast du sie schon mal beobachtet, die Kraniche?«
»Nein.«
»Nein? Dann musst du das unbedingt nachholen. Es ist etwas ganz Besonderes.«
»Warum hast du sie mir dann nicht längst gezeigt?«
»Kannst du nicht irgendwas mal alleine tun?« Seine Faust war so heftig auf dem Tisch gelandet, dass sie zusammengezuckt war. Tränen waren ihr in die Augen geschossen, und er hatte sie um Verzeihung bittend angesehen. »Tut mir leid, Leonie, tut mir leid. Natürlich machen wir das gemeinsam. Tut mir leid.«
»Schon gut.« Sie hatte sich wie immer zu einem Lächeln gezwungen. Tom hatte ebenfalls gelächelt, wobei, wenn sie sich jetzt in diesem verdammten Krankenhaus daran erinnerte, war es ein trauriges Lächeln gewesen. Verloren. Ein verlorenes Lächeln, das er danach nicht wiedergefunden hatte. Auch sich zu entschuldigen – und das gleich zweimal –, war sonst nicht seine Art.
»Früher«, war er fortgefahren, »habe ich die Kraniche oft beobachtet. Vor allem am Morgen, wenn sie sich versammelt haben, aber auch am Abend. Was für ein Schauspiel, wenn sie in perfekter Formation am Himmel auftauchen. Die kräftigen, erfahrenen Tiere an der Spitze, dann die Familien mit ihren Jungtieren. Die Luft ist erfüllt von ihrem lauten Trompeten.«
»Nur um diese Jahreszeit fliegen Kraniche nicht in den Norden«, widersprach Leonie automatisch, ganz die Lehrerin, die es gewohnt war, ihre Schüler zu verbessern. »Sie kommen aus dem Süden zurück zu uns.«
Im selben Moment noch biss sie sich auf die Lippen, war sicher, dass sie mit ihrer elenden Klugscheißerei kaputt gemacht hatte, was sich gerade wieder zwischen ihnen zu entwickeln begann. Nähe.
Doch Tom war nicht wütend geworden. Er hatte sie nur mit dieser Enttäuschung im Blick angesehen, die sie selbst von sich kannte. Als Kind, wenn ihr Vater sie aus der Welt der Astrid Lindgren zurück in die Realität holte. Sie hatte die Hand nach ihm ausgestreckt, doch er war zurückgewichen.
»Da ist sie ja, meine Lehrerin.« Und jetzt war auch er wieder zurück, dieser latent aggressive Spott, der jede gute Stimmung verdarb. Ihr das Gefühl gab, etwas falsch zu machen. Falsch zu sein.
Zum ersten Mal war ihr der Gedanke gekommen, ob es nicht nur die Arbeit gewesen war, sondern doch sie, wenn auch ungewollt, von der er sich überfordert fühlte. Grundschullehrerinnen hatten den Ruf, ihren Lieben gelegentlich mit ihrer »Besserwisserei« auf die Nerven zu gehen. Vielleicht war sie an all dem schuld, das die vergangenen Monate so besonders schwer gemacht hatte.
Er hatte schneller als sonst eingelenkt. »Ich bin ein guter Fahrer, Leonie, wir kommen gut an und verbringen eine großartige Zeit. Stockholm, Gotland – und am Ende springen wir über den Polarkreis, kehren um und fangen noch mal von vorne an.«
»Ach, Thommy«, sie hatte aufgeatmet, die Situation war offenbar wieder entspannt, »das Leben kann so schön sein.« Am liebsten hätte sie ihn spontan umarmt. Tat es nicht. Hatte noch immer Angst, dass er erneut zurückwich. Wie so oft. Und in diesem Augenblick veränderte sich seine Stimme zum dritten Mal. Wurde wehmütig.
»Vielleicht fängt das Schöne auch erst mit dem Tod an?«
Warum sagte er das? In dem Moment, in dem sie vom Leben sprach. Wollte er sie provozieren wie so oft, wenn er spürte, dass sie glücklich war? Warum hielt er es nicht aus, wenn sie glücklich war?
»Der Tod«, fuhr er jedoch nicht provokant, sondern nachdenklich fort, »der Anfang eines großen Abenteuers.«
»Wieso sagst du das? Gerade jetzt?« Sie hätte weinen können.
»Nur so, Leonie, einfach nur so dahergesagt.«
»Okay!« Sie hatte beschlossen, es dabei zu belassen, und mit einer schnellen Bewegung die Stubenfliege eingefangen, die ihnen schon während des ganzen Frühstücks um die Nase getanzt war, um etwas von der selbst gemachten Erdbeermarmelade zu stibitzen und sich dann auf dem Schinken niederzulassen.
»Versprich mir, dass wir gesund zurückkommen.« Der Flügelschlag der Fliege in der geschlossenen Hand – ich will hier raus – hatte sich bei diesen Worten mit ihrem Herzschlag vermischt. Warum sie das gesagt hatte? Sie hätte es zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten können, jetzt aber, da sie wusste, was geschehen war, erschien ihr diese Aussage wie eine Vorahnung.
»Wir holen die Hochzeitsreise nach, die ich dir schon vor zehn Jahren versprochen habe«, hatte er sie beruhigt. »Wir fangen ganz neu an.«
Ohne weiter nachzudenken, hatte sie die Fliege freigelassen, ihren Tom dann doch umarmt, und er hatte sie gehalten. Ganz fest, als wollte er sie nie wieder loslassen.
Die Fliege dagegen hatte sich wieder auf die Wurst gesetzt, als hätte sie in den letzten Minuten nichts, aber auch gar nichts gelernt.
2.
Während Leonie weiter durch den Endlosschlauch des Krankenhausgebäudes hastete, hatte sie Toms Gesicht vor Augen. Er war ein schöner Mann. Und sie liebte ihn sehr. Dabei war ihre Ehe nicht immer einfach gewesen. Nach dem frühen Tod seines Vaters hatte er mit Ende zwanzig das Familienunternehmen, eine Porzellanmanufaktur, übernommen. Pflicht, Härte und Entschlossenheit hatte er sich abverlangt. Eigenschaften, die nach zehn Stunden im Job privat nicht wie auf Knopfdruck abzustellen waren.Dabei wäre er so gern einfach nur Porzellanmaler geworden. Doch dafür brauchte man eine ruhige Hand, und Toms Hand zitterte manchmal. Das Zittern kam völlig unerwartet, und kein Arzt hatte bisher eine Erklärung dafür gefunden.
Leonie hatte ihm geraten, es mit Kalligrafie zu versuchen, damit er die Hand wieder unter Kontrolle bekam. Doch sobald er mit seinem wunderbaren Schriftbild fast fertig war, folgte ein Zittern, ein falscher Strich, und alles war verdorben. Sinnbildlich für all die Jahre, die Leonie ihren Mann nun schon kannte.
Manchmal hatte sie sogar den Eindruck, als täte er es mit Absicht. Fast am Ziel, stellte er sich selbst ein Bein und blieb erst einmal am Boden liegen. Hatte er Angst, er selbst zu sein? Und wenn es so war, wer war der Mann neben ihr? Was waren seine Wünsche, Träume und Sehnsüchte?
»Solange du nicht du selbst bist«, hatte ihr Vater oft zu ihr gesagt, »sondern tust, was andere von dir wollen, kannst du immer anderen die Schuld geben, wenn du scheiterst. Das ist feige. Mutig ist, so zu sein, wie du von Gott oder einer höheren Macht erdacht worden bist. Sonst endet dein Blick in den Spiegel irgendwann in Scherben, weil du einen Gegenstand voller Verzweiflung über dein nicht gelebtes Leben hineinpfefferst. Und wenn es ganz dumm läuft, mein Kind, trittst du auch noch in die Scherben, bleibst mit blutigen Füßen zurück, unfähig, deinen Weg fortzusetzen.«
Irgendwann hatten beide, Leonie und Tom, Toms gelegentliches Zittern akzeptiert. Es kam und ging, und dass er seinen Traumberuf nicht ausüben konnte, so what, immerhin hatte er mit Porzellan zu tun, hatte sogar die Nachttopfsammlung seines verstorbenen Vaters übernommen.
»Auf dem zum Beispiel haben schon königliche Hintern gesessen, Leo-Nie …« Mit diesen Worten hatte er die Spieluhr aufgezogen, die unter dem Nachttopf angebracht war, und sich in seiner Anzugshose auf den Topf gesetzt. »Nobles Kacken zu Händel oder Schubert …«
Tom hatte gelacht, dieses freie Lachen, das sie so an ihm liebte. Sie hatte ihn mit beiden Händen in die Höhe gezogen.
Nach dem Urlaub fangen wir neu an. Bei diesen Worten hatte das Grün in Toms dunklen Augen wie phosphoreszierende Farbtupfer geschimmert. Lange, schwarze Wimpern, die sie selbst nur mit viel Tuschen und künstlicher Verlängerung zustande brachte. Sein Haar war blond, hatte aber schon viele Silberfäden, die ihm eine eigene Dynamik verliehen. Und obwohl er selten in die Sonne kam, hatte seine Haut einen ebenmäßigen Bronzeton, um den sie ihn fast beneidete. Wenn sie sich in die Sonne legte, wurde sie erst rot und dann wieder blass. Deshalb mied sie die Sonne, und es hieß, sie habe einen wunderbaren Teint. Leonie glaubte das jedoch nur begrenzt.
Auch nicht, als sie sich nach dem gemeinsamen Frühstück an diesem Tag, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, sorgfältig zu schminken begann und Tom etwas tat, was er schon so lange nicht mehr getan hatte. Er setzte sich auf den Rand der Badewanne und beobachtete sie mit diesem Blick, den sie noch aus den ersten Jahren ihrer Liebe kannte. So, als könne er nicht genug von ihr bekommen.
Dabei wiederholte er die Worte, die sie ihm mühsam eingetrichtert hatte und die er heute an seinen jüngeren Bruder Andreas richten wollte. »Es wird Zeit, dass du Verantwortung übernimmst, Andi. Du schaffst das auch mal allein.«
Leonie nickte. »Außerdem bist du telefonisch erreichbar.«
»Aber nur im Notfall!«
Leonie lächelte und wählte das weiße, cremige Make-up, das für diese Gelegenheit besonders geeignet war, begann es mit einem Schwämmchen sanft über das Gesicht zu verteilen.
»Der ständige Kampf um die Manufaktur …«, fuhr er mit entschlossener Stimme fort. »Ich brauch eine Auszeit, und wenn wir zurückkommen, überlegen wir gemeinsam, wie’s weitergeht.« Leonie nickte erneut und dachte bei sich, ob Tom seinen Traum von der Porzellanmalerei womöglich doch noch nicht aufgegeben hatte und das seinem Bruder vermitteln wollte. Sie nahm den Schminkstift und zeichnete damit einen großen Bogen um Mund und Augen, die sie nun mit bunten Regenbogenfarben auszufüllen begann. Tom fuhr indessen fort: »Work-Life-Balance. Ich hab keinen Bock mehr, mich halb totzuschuften.«
»Und wenn Mr. Sunnyboy doch nicht mitmacht?« Leonie sah ihren Mann nun doch besorgt an. »Wenn er wieder mal abhaut und auf irgendwelche Berge steigt, während wir weg sind?«
»Das ändert nichts. Außerdem ist Mutter auch noch da. Allerdings glaube ich nicht, dass Andreas sie mit der Manufaktur allein lässt. Das wagt er nicht.«
»Bravo!« Sie klatschte vor Freude in die Hände. »Ich bin so froh.«
Sie war glücklich gewesen. In diesem Augenblick, nach langer Zeit, wieder glücklich.
Jetzt kam noch das Rouge, knallrot, und die schwarze Träne. Der Clown war fertig.
Doch gerade, als sie mit dem Stift ansetzen wollte, nahm Tom ihn ihr aus der Hand. »Denk dran, Leonie, diesmal keine Tränen, versuch’s zumindest mal …«
»Du meinst, ich soll nicht wieder heulen, wenn ich mich von meinen Kindern verabschiede, weil ich nächstes Jahr eine neue Klasse bekomme?«
Er hob das Kinn, ganz leicht nur, und sah sie mit einem Blick an, der wie aus sich selbst heraus leuchtete. »Man soll sich an das Lächeln eines Menschen erinnern, nicht an seine Tränen.«
»Ich bin schon froh, wenn sich die Kinder überhaupt an mich erinnern, und vor allem an das, was ich ihnen beibringe.«
»Klar erinnern die sich, du bist eine der wenigen, die verstehen, weshalb ein Kind nicht immer still sitzen kann.« Er ließ sie abrupt los und lachte so laut und unwillkürlich auf, dass sie ihn am liebsten in den Arm genommen hätte, aber da fuhr er schon fort. »Und wenn sich dann die Eltern über ihren Zappelphilipp aufregen, stellst du dich noch hin und hältst ihnen einen Vortrag. Dass gerade ihr Kind ein natürliches Verhalten zeige, weil der Mensch nun mal nicht dafür geschaffen sei, sich stundenlang in einem geschlossenen Raum hinter eine Bank zu zwängen, wenn draußen die Sonne scheint. Kinder, die auf Bäume klettern, rennen, spielen, das ist nur natürlich. Das ist es, worauf Eltern achten sollen.«
»Du hast mir zugehört, als ich das erzählt habe?« Verwundert sah sie ihn an.
Und Tom schien ebenso verwundert, als er ihr antwortete: »Ich hör dir immer zu, du merkst es nur nicht. Manchmal«, wieder war seine Stimme einen Moment verloren gegangen, »manchmal verlangst du einfach zu viel.«
Warum sagte er das. Warum? Leonie schluckte, und gleichzeitig war da erneut dieses Gefühl gewesen, das in ihr schon den ganzen Morgen immer wieder aufgeblitzt war. So als ob nichts davon wahr werden würde, was sie so sorgfältig geplant hatten.
»Nur, dass ich dein Lächeln liebe«, war er fortgefahren, als habe er das, was sie beunruhigte, nicht gesagt. »Hör bitte nie auf damit, versprich es mir.«
»Natürlich, Tom. Warum sollte ich?«
»Nicht nur dein Lächeln.« Er schien noch zärtlicher, sanfter zu werden. »Dich Leonie, ich meine die Leonie von Kopf bis Fuß, meine Löwin, dich liebe ich auch.« Er hatte sie angesehen, als suchte er hinter ihrer Clownsmaske nach etwas, das er für immer bei sich behalten wollte.
Wie lange hatte er diesen Blick nicht mehr für sie gehabt. Solche Dinge nicht mehr zu ihr gesagt. Zieh dich warm an, dein Schnürsenkel ist offen, stolpere nicht drüber … Manchmal brachte er ihr Elly-Seidl-Pralinen mit, ihre Lieblingspralinen, oder er stellte ihr den Kaffee ans Bett, wenn sie die Nacht durchkorrigiert hatte. Das war seine Art, ihr seine Liebe zu zeigen, aber diese drei Worte …
Schnell hatte sie weggewischt, was sie beunruhigte. »Ich liebe dich auch, Thommy. So sehr.« Alles war gut. So gut.
Ein Kuss. Weich, schön, zart wie seine Gesichtszüge, trotz der Härte, die er sich angeeignet hatte.
Sie hatte den Kuss in sich nachklingen lassen, und als sie die Augen geöffnet hatte, war Tom nicht mehr da gewesen. Gegangen, ohne dass sie ihn hatte gehen hören. Sie hatte nicht gehört, wie die Haustür ins Schloss fiel, und auch nicht, wie er den Motor seines SUV anließ. Kein Problem. Gegen Mittag würden sie sich wiedersehen und zusammen voller Vorfreude auf den gemeinsamen Urlaub zum »Schweden« gehen und das schwedische Nationalgericht Kötbullar mit Kartoffelbrei bestellen.
Hatte sie gedacht.
Davon war sie wirklich überzeugt gewesen.
Im Nachhinein allerdings war es seltsam, wie leise er das Haus verlassen hatte, als habe er sie vorbereiten wollen, darauf, dass er vielleicht nie wieder zurückkommen und dass es von nun an still in ihrem Leben sein würde. So still.
3.
Gedanklich wieder zurück im Klinikgebäude, drosselte Leonie das Tempo. Solange sie nicht ankam, war alles gut. Solange sie Tom nicht mit eigenen Augen sah, gefesselt an unzählige Schläuche, konnte sie verdrängen. Solange sie nicht gezwungen war, seinen Herzschlag am Monitor zu verfolgen, anstatt tastend mit der Hand, nachts, wenn sie neben ihm lag, musste sie sich keine Sorgen machen. In der vergangenen Nacht hatte er ganz ruhig geatmet, war nicht schweißgebadet aufgewacht, geplagt von einem immer wiederkehrenden Albtraum, von dem sie nur vermuten konnte, dass es um die Manufaktur ging, da er nie darüber sprach. Wie ein Baby hatte er leise vor sich hin geschmatzt, hatte sogar einmal gelächelt, und sie hatte ihn behutsam auf die Stirn geküsst, um ihn ja nicht zu wecken.
Wenn sie niemals ankam, war das alles vielleicht auch nicht wahr. Die Stimme am Telefon. Nicht wahr. Was die Stimme gesagt hatte. Nicht wahr. Sie musste nur umdrehen, das Krankenhaus wieder verlassen – und den Albtraum, in dem diesmal sie gefangen war. Dann war wieder alles gut. Alles gut!
Sei verdammt noch mal nicht so feige.
Sei ein Mal stark.
Streichle ihn, halte ihn, erinnere ihn an eure Pläne. Dann beginnt er vielleicht zu kämpfen. Wunder geschehen, Leonie, Wunder geschehen.
Leonie legte an Tempo zu.
Schon wieder eine Uhr, die wie ein seelenloses Ungeheuer leuchtend von der Klinikdecke hing. Zehn Uhr zweiunddreißig vormittags. Lief weiter. Bemerkte nicht, dass sie jetzt ganz zu atmen aufhörte. Bemerkte nicht die Aufmerksamkeit, die sie erregte. Die ratlosen, amüsierten und auch überraschten Blicke, die ihr folgten. Blaue Latzhose, rot-weiß geringeltes T-Shirt, blonde, wie außer Kontrolle geratene Locken, spritzig, verspielt und sprunghaft wie auch ihr Wesen gelegentlich, nur mühsam gebändigt von unzähligen roten, blauen, gelben, grünen Schleifen und Bändern. Die knallrote Clownsnase schmückte nicht mehr ihr Gesicht, sondern baumelte bei jedem Schritt um ihren Hals.
Das eine oder andere Lächeln folgte ihr. Ein weiblicher Krankenhausclown. So hoffnungsvoll, so bunt in der Tristesse des Krankenhausalltags, geprägt von Angst, Sorge und Hoffnungslosigkeit.
Eine Frau streckte die Hand nach ihr aus. »Kommen Sie … Mein Sohn. Er ist fünf Jahre alt, er lacht so gern … Kommen Sie bitte … Er liebt Clowns, es wird ihm guttun.«
Leonie ignorierte die Frau, aber die Hände wurden mehr, kamen jetzt von allen Seiten. »Bitte, meine Großmutter, mein Mann, meine Frau, mein Vater, meine Mutter … Sie sollen lachen. Lachen ist gesund! Macht gesund.«
Leonie blieb stehen. Wollte etwas sagen. Erklären, dass sie Lehrerin war, mit ihren Schülern gerade noch als Abschluss des Schuljahres vor den Eltern, Geschwistern und dem Kollegium ein gemeinsam entwickeltes Theaterstück hatte aufführen wollen, in dem sie als Clown die Zuschauer durch die Welt von Astrid Lindgren führte.
Sie, die schon als Kind lieber im Schlund der alten Weide mit hohlem Stamm und knorrigen Wurzeln vor ihrem Elternhaus gesessen hatte, über dem Kopf die atmende, blühende und lebendige Krone, in der Hand ein Buch. Die anderen Kinder hatten gespielt. Sie hatte immer nur gelesen und dadurch kaum Freunde gehabt. Aber welches Wesen aus Fleisch und Blut reichte schon an Pippi Langstrumpf, die Widerspenstige, heran, an die Kinder von Bullerbü mit ihrer traumhaften Kindheit oder an die Abenteuer von Tjorven, Pelle, Stina und Bootsmann auf Saltkrokan. Nähme ich Flügel der Morgenröte und machte mir eine Wohnung zuäußerst am Meer …
Mit Astrid Lindgren hatte sich Leonie über die Strenge ihres Vaters hinweggelesen. Als Leiter der Grundschule wollte er nicht, dass sie träumte. Sie sollte die Klassenbeste sein. So viel zu seinen klugen Worten, sie solle den Mut haben, sie selbst zu sein. Theorie und Praxis.
Dass ihr Vater der Rektor war, hatte sie unter den Kindern auch nicht gerade beliebter gemacht. Nicht selten waren sie um ihren Baum herumgetanzt, wenn sie ihre Ruhe haben wollte, und hatten gesungen: Sitzt die Leo auf dem Ast, ei, da liest sie, ei, da kracht sie, plumps, da liegt sie unten …
Das Theaterstück für ihre Klasse hatte Leonie selbst geschrieben, und allein die Proben hatten großen Spaß gemacht. Doch kaum hatte die Aufführung begonnen, war Gisela, die Schulsekretärin, in die Aula gestürzt. Leonie hatte sie noch mit Humor begrüßt, sie mit ins Stück einbinden wollen, doch dann hatte sie Giselas Gesichtsausdruck gesehen. Leonie hatte sich in dem dicht besetzten Raum mit der hohen Decke umgeschaut, sich gefragt, für wen wohl Giselas so völlig aufgelöster Blick bestimmt war. Für welche Mutter, für welchen Vater, galt es einem Mitglied des Lehrerkollegiums oder vielleicht einem Schüler, der vergeblich auf ein Elternteil oder einen seiner Großeltern wartete, dann erst hatte sie begriffen – sie war gemeint.
»Ein Anruf … Frau Singer … Ich hab’s aus Ihrem Fach genommen, das Handy, weil es gar nicht mehr aufgehört hat zu klingeln.«
»Und?«
»Das Krankenhaus … Ihr Mann …«
Wenn Tom noch in der Lage gewesen war, dem Arzt oder dem Sanitäter ihre Handynummer zu geben, dann war er bei Bewusstsein, dann konnte es nicht so schlimm sein. Konnte es nicht so schlimm sein …
Doch um all das loszuwerden, was in ihr vorging, den Menschen um sie herum zu erklären, dass sie kein Krankenhausclown war, hätte sie Sauerstoff benötigt. Das Atmen, sie hatte es wieder vergessen.
So viele Menschen sahen sie erwartungsfroh an.
»Geht es Ihnen nicht gut?« Die Augen der Frau, die sie als Erste ihres Kindes wegen angesprochen hatte, wurden mitfühlend. »Es ist nicht einfach, jeden Tag all das Leid hier zu sehen. Aber Sie machen einen wichtigen Job.«
»Doch, natürlich! Alles gut.« Solange man es nicht aussprach, war es nicht Realität, nicht Realität, nicht … Sie zwang sich zu einem Lächeln, und diesmal gelang es ihr: »Ich bin nur kein Clown! Zumindest nicht im Krankenhaus. Im Leben vielleicht.«
Sie wusste nicht, weshalb sie das jetzt gerade sagte, als sei Selbstironie in dieser Situation angebracht. Sie wusste nicht weiter. Ließ die Frau stehen, erreichte die Intensivstation, läutete, nannte ihren Namen und zu wem sie wollte. Ein Surren, die Tür ging auf. Jemand reichte ihr einen grünen Kittel. Sie dachte noch, dass sie jetzt zumindest passend angezogen war.
4.
Passend angezogen – wofür?
Für das immer wiederkehrende Geräusch des Beatmungsgeräts, der Überwachungsmonitore. Alarmsignale. Von irgendwoher. Der Geräuschpegel auf einer Intensivstation, das zumindest war Leonies Gedanke, hatte etwas vom Wohnen an einer verkehrsreichen Straße.
Leonie fühlte Verärgerung in sich aufsteigen, Wut, wandte sich an die Ärztin, die sich ihr als Dr. Schyra vorstellte. Dr. Marlene Schyra. »Wie soll man bei dem Krach wieder gesund werden.« Sie fuhr die Frau förmlich an. Kannte den Ton so gar nicht von sich. Sie hätte in diesem Moment um sich schlagen, auf die ganzen Apparaturen einschlagen können. Sie wollte, dass sie still waren. Sie sehnte sich danach, nichts als Toms Atem zu hören. So wie in den Nächten, in denen er sie einfach nur im Arm gehalten hatte. Nächte voll von Liebe.
»Ihr Mann wird nicht mehr gesund!« Die Augen der Ärztin, deren Farbe so war, dass Leonie sie später nicht mehr hätte beschreiben können, wurden mitfühlend. »Wie ich Ihnen schon am Telefon gesagt hatte. Wir lassen Ihren Mann gehen!«
»Mein Mann darf wieder nach Hause? So schnell!« Leonies Herz hüpfte. Alles war gut. Vielleicht sogar ein Missverständnis. Zwei Männer mit gleichem Namen. Er würde sich erholen, und sie würden eben etwas später nach Schweden fahren – oder besser fliegen, so wie die Kraniche. Egal, wann und ob sie in den Norden flogen. Sie pfiff auf die ökologische Realität. Hauptsache, Tom wurde wieder gesund.
»Ich bin so erleichtert.« Am liebsten wäre sie der Ärztin um den Hals gefallen. »Wir wollten übermorgen nach Schweden fahren. Unsere Hochzeitsreise. Hat lang genug gedauert.« Sie lachte kurz auf. »Acht Jahre! Jetzt können wir, wenn nötig, auch noch etwas warten. Mein Mann ist im Moment unabhängig. Sein Bruder macht den Job …« Diese Stille. Leonie brach ab.
Dann die Worte der Ärztin. »Wir haben zweimal versucht, Ihren Mann wiederzubeleben. Zehn Minuten war das Gehirn ohne Sauerstoff. Selbst, wenn wir alles täten … er wäre nicht mehr derselbe …«
»Dann ist er eben ein anderer.« Leonie kämpfte. Kämpfte, wie sie noch nie gekämpft hatte. Leo. Endlich ließ sie die Löwin in sich zu. Leo-Nie. Leo-von-jetzt-an-Immer. »Er war auch vor zehn Jahren ein anderer … Einer, mit dem ich lachen konnte. Heute ist er nur noch ständig überfordert und ernst, viel zu ernst. Oft ist er auch traurig, will es nur nicht zugeben. Deshalb ist er ruppig, gelegentlich dominant. Aber ich kenne ihn, wie er wirklich ist. Ich kann es fühlen. Er ist knapp am Burn-out vorbeigeschrammt. Vielleicht war er schon mittendrin. Wer weiß das schon. Wie auch immer, noch ist es nicht ganz vorbei. Das macht ihn manchmal aggressiv, aber nicht gegen mich, gegen sich selbst. Doch das heute Morgen, das war ein Anfang … Wir fangen neu an. Verstehen Sie, was das bedeutet? Ein Neuanfang?«
»Die Sauerstoffsättigung liegt bei fünfzehn Prozent. Wir kriegen sie nicht mehr hin. Die Sättigung.«
»Heute Morgen hat er mir endlich wieder gesagt, dass er mich liebt. Dabei dachte ich schon … Er war nicht immer fair zu mir in letzter Zeit.« Ein Blick auf das Gesicht der Ärztin. »Das sagte ich wohl schon!« Aber egal. Sie konnte nicht aufhören. Sie musste reden und reden, redete um sein Leben. Dr. Schyra sollte, sie musste verstehen, dass es noch nicht vorbei sein konnte. »Es war nur die viele Arbeit. Er hatte fast ein Burn-out, wissen Sie, aber das sagte ich auch schon … Und ich hab es lange nicht bemerkt … Er hat immer gesagt, ich sei noch wie ein Kind.«
»Wir haben alles versucht.« Dr. Schyras Stimme war warm und weich. »Die Verletzungen sind zu schwer.« Sie legte die Hand leicht auf Leonies Arm. »Wir haben Ihren Mann ins künstliche Koma gelegt.«
Leonie schüttelte die Hand unwillig ab. »Warum? Er war doch bei Bewusstsein. Warum haben Sie das getan?«
»Er war nicht bei Bewusstsein, Frau Singer.«
»Aber Sie haben angerufen, ich meine, das Krankenhaus. Er muss Ihnen meine Handynummer gegeben haben.«
»Ihr Mann hat eine Notfall-App. Darin stand Ihre Nummer.«
Stille. In ihrem Kopf. Der Versuch, zu begreifen. Sie begriff nichts. Nur eins: »Er darf nicht sterben, Frau Dr. Schyra. Nicht jetzt. Wo alles wieder gut wird. Mit uns. Gut, verstehen Sie, richtig gut.«
»Es geht Ihrem Mann gut, Frau Singer. Er hat keine Schmerzen. Kann ich etwas für Sie tun? Einen Kaffee vielleicht?«
Leonie schüttelte den Kopf. Suchte Thommys Gesicht. Es war wie immer. Schön. Friedlich. Fast ein wenig feminin, jetzt, da die Angst weg war, das Zittern jeden Morgen. Das Zittern, das ihm seinen Traumberuf verwehrt hatte. Porzellanmaler. Die Sorge, den Tag nicht zu schaffen. Fehler zu machen. Den Eine-Million-Dollar-Fehler, der das Unternehmen pleitegehen ließ. Er trug Verantwortung. Für seine Mitarbeiter. Für deren Familien. Vor allem für die Manufaktur, schon seit zwei Jahrhunderten in der Familie Singer. Vielleicht, wenn doch noch alles gut wurde, vielleicht konnte man ihn untersuchen, herausfinden, ob das Zittern nicht eine körperliche Ursache hatte, ihn medikamentös einstellen oder gar heilen … Es war nicht zu spät. Du kannst auch jetzt noch Porzellanmaler werden, Thommy. Die Welt steht dir offen, du darfst jetzt nur nicht aufgeben. Kämpfe verdammt noch mal, kämpfe!!!
Er war so unversehrt. Fast kindlich. Ja, jetzt war er das Kind. Das Kind, das er irgendwann hinausgeworfen hatte aus sich selbst. Immer erwachsen zu sein war wie diese Krankheit, von der sie einmal gelesen hatte. Sklerodermie. Die Haut wurde dicker und dicker, verhärtete, bis man sich kaum noch bewegen konnte. Erwachsensein war dicke Haut und Sich-nicht-mehr-bewegen-Können. Sie dagegen war dünnhäutig geblieben.
Sie zu sehr Kind. Er zu sehr erwachsen. Vielleicht hatten sie sich darüber nach und nach verloren. Auf Gotland hatte Tom sich endgültig, hatten sie einander wiederfinden wollen. Vielleicht wäre dann auch dieses verdammte Zittern endgültig vorbei gewesen … Es darf nicht vorbei sein, Thommy. Nicht ausgerechnet jetzt!
Von irgendwoher klang Gabriellas Song aus dem schwedischen Film Wie im Himmel zu ihr.Urinflaschen schepperten. Ein Sekretabsauger lärmte, untermalt von dem ständigen Piepen der Monitore und dem Geräusch der Dosierpumpe, aus der kontinuierlich Infusion abgegeben wurde. Und dennoch hörte irgendjemand an diesem Ort zwischen Leben und Tod dieses so besondere Lied. Det är nu som livet är mitt … Leonie wandte sich an die Ärztin. »Woher kommt die Musik?«
Marlene Schyra warf Leonie einen überraschten Blick zu. »Hier ist keine Musik, Frau Singer!«
Aber die Melodie war nicht nur in ihrem Kopf, da war Leonie sicher. Sie war ebenso real wie die wunderbaren Stimmen, die das Lied sangen. Auf Schwedisch. Sie konnte kein Schwedisch. Kein einziges Wort. Und dennoch war es, als tanzten die Worte und Noten aus Thommy heraus, um in sie einzudringen, Herz, Kopf und Seele, ihr etwas zu sagen. Jag har fått en stund här på jorden …
Leonie kannte nur den deutschen Text. Leonie hatte Wie im Himmel gemeinsam mit Thommy im Kino gesehen. Gesehen, wie auch er bei dem Lied, ihrem Lieblingslied, die Tränen aus den Augen gewischt hatte. Verstohlen, aber sie waren da gewesen. Meine Sehnsucht bringt mich hierher … denn dies ist der Weg, den ich wählte. Und ich ahne, weil ich spür. Jetzt gehört dieses Leben mir.
Wieso gehört jetzt dieses Leben dir? Jetzt, wo du vorhast zu gehen? Und wem hat es vorher gehört? Mir? Warum schickst du mir dieses Lied? Warum, Thommy, warum?
Es gibt diesen Moment, in dem man begreift, dass da noch etwas ist, hinter dem Himmel. Vielleicht das, was allgemein als die Ewigkeit bezeichnet wird. Und dass der, den man liebt, nur einen Atemzug entfernt bleibt, egal, wo er gerade ist.
Leonie glaubte an vieles, jedoch nicht an ein Leben nach dem Tod. Fast wütend wischte sie das Begreifen weg.
Saß wieder da.
Mit der Tasse heißen Kaffees in der Hand, um den sie nun doch gebeten hatte.
Trank nicht.
Es gab kein Durchkommen in ihrer Kehle. Hätte sie auch nur genippt, sie wäre noch vor Thommy gestorben, an ihrer absoluten Fassungslosigkeit erstickt. Sie stellte die Tasse weg, versuchte zu reden. Diese Frage in ihrem Kopf. Sie musste beantwortet werden. Jetzt.
»Heute Morgen hat Tom gesagt, das Ende sei erst der Anfang. Nach dem Tod beginne erst unser Abenteuer, nicht ganz genau, aber so ähnlich hat er es gesagt. Sie haben doch ständig mit dem Tod zu tun. Was, Frau Dr. Schyra, kommt danach?«
Die Ärztin antwortete nicht sofort. Stattdessen schien sie gedanklich an einen anderen Ort zu wandern, und es dauerte einen zusätzlichen, so zumindest kam es Leonie vor, langen Moment, ehe sie antwortete. »Wir sehen nur, was wir wissen, und was wir nicht wissen, sehen wir auch nicht.«
Leonie verstand nicht, wollte nachhaken, doch da glitten Dr. Schyras schöne Augen, in denen etwas stand, das Leonie noch nie in einem Blick gelesen hatten – Wehmut wäre das falsche Wort gewesen –, erneut zum Überwachungsmonitor, der selbst die kleinste Abweichung und Veränderung in den Funktionsabläufen des Körpers wahrnahm. Geschah etwas Beunruhigendes, gab der Apparat Alarm. Bei Tom hatten sie den Alarm abgestellt.
Zumindest gab er kein zusätzliches Geräusch von sich, als Dr. Schyra sagte. »Es dauert nicht mehr lang! Gehen Sie nicht mehr weg. Bleiben Sie bei Ihrem Mann.«
Dr. Schyra wollte den Raum verlassen, doch Leonie hielt sie fest, klammerte sich mit beiden Händen an ihren Arm. »Bitte, Frau Dr. Schyra, sagen Sie mir irgendetwas, damit ich das hier durchstehen kann. Lügen Sie, aber sagen Sie irgendetwas …«
Dr. Schyra blieb stehen, schien zu überlegen, drehte sich zu Leonie um. »Sie kommen zu uns. In unseren Träumen. Zeigen uns dort den richtigen Weg.«
»Träume? Das ist alles?«
»Es ist die Wahrheit!«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Amelie hat es mich gelehrt.«
5.
Leonie war enttäuscht. Träume waren Schäume. Dienten der Verarbeitung. Waren sinnlich-lebendiges, halluzinatorisches Geschehen. Pure Fantasie. Hatten nichts damit zu tun, was sie und Tom waren, sind und nicht mehr sein würden. Nie wieder. Was für Worte, was für furchtbare, das Leben unentwegt begleitende Worte.
Offenbar ahnte Dr. Schyra, was in Leonie vorging. Sie lächelte leicht. »Amelie besucht mich sehr oft, wenn sie nicht gerade etwas Wichtigeres zu tun hat.«
»Amelie? Ihre Schwester?«
»Die Geliebte meines Mannes. Meine Freundin.«
Leonie verstand immer weniger, ging auf das Unglaubliche nicht ein, dass die Geliebte des Ehemanns gleichzeitig Freundin der Ehefrau sein konnte. Niemals. Nicht mit ihr. Hätte Tom sie betrogen, sie hätte getötet. Töten, Tod, Tom starb, und sie konnte nichts, aber auch gar nichts dagegen tun. Wie machtlos sie sich fühlte. Klein. Hilflos. Nicht mehr vorhanden.
Es dauerte, bis sie ihre Gedanken in Worte fassen konnte: »Sie sprechen in der Gegenwart von ihr, Frau Dr. Schyra. Dann lebt Amelie noch.«
»Sie ist vor neun Jahren gegangen.« Dr. Schyra lächelte erneut. »Ich war ihre Ärztin. Eines Tages, wir waren zusammen in der Toskana, ist es Amelie gelungen, mit einem Schritt das Meer anzuhalten, die Welle hat tatsächlich genau vor ihrem Fuß gestoppt, da dachte sie, sie hätte es geschafft … Aber diese verdammte Leukämie.« Marlene Schyras Stimme entglitt für einen Augenblick. »Ich hatte es gehofft …« Ihre Stimme wurde wieder fest. »Wir denken immer, die Beziehung zu einem geliebten Menschen ist vorbei. Sie ist nicht vorbei, sie setzt sich nur auf eine andere Art und Weise fort.«
»Wie denn?« Leonie nahm wahr, dass sie jetzt denselben, fast bissigen Unterton hatte wie Tom, wenn er glaubte, sie rede Blödsinn. Diese Amelie, was hatte sie mit einer Frau zu tun, die glaubt, das Meer anhalten zu können … Leukämie war scheiße, aber gerade nicht ihr Problem. Ihre Stimme wurde noch bissiger. »Tom und ich haben nichts Gemeinsames mehr, keine Zukunft, nicht mal die Gegenwart!«
»Sie haben Ihre gemeinsamen Jahre.«
»Aber wir erleben nichts mehr zusammen, außer meiner Fantasie im Traum, vielleicht.«
»Ihr Mann verlässt Sie nicht. Bleiben Sie für alles offen. Ich hab das auch erst lernen müssen.« Leonie fühlte, wie sich Marlene Schyra ganz sanft von dem Griff befreite, mit dem sie sich noch immer an sie klammerte, ohne es selbst zu bemerken. »Wenn Sie mich brauchen oder reden wollen, ich bin da.« Mit diesen Worten verließ sie die Intensivstation, und Leonie äffte sie in Gedanken nach. In meinen Albträumen …
Sie wusste nicht, warum sie so wütend war, am liebsten hätte sie dieser Ärztin noch wie Pippi Langstrumpf die ausgestreckte Zunge hinterhergeschickt. Sie nahm sich zusammen, zog sich an die Seite von Tom zurück, an das, was als Intensivarbeitsplatz mit allseitigem Zugang zum Patienten und deckengebundenen Versorgungseinheiten bezeichnet wurde. Sie hatte die Bezeichnung schon einmal gehört. Damals, als ihr Vater gestorben war, ebenfalls an diesem kalten Ort, abgeschirmt von einem Vorhang links und rechts des Patientenbetts. Zum Abschiednehmen ebenso wenig geeignet wie ein zugiger, schmuckloser Bahnhof in einer wintereisigen Nacht.
Sie würde Tom in dieser Kälte nicht allein lassen. Sie musste sich zusammennehmen, ihn begleiten auf dieser Reise, die er ganz bestimmt nicht hatte antreten wollen.
Leonie setzte sich. Nahm seine Hand. Sie fühlte sich warm an. War so ruhig, wie er es sich immer gewünscht hatte. Ruhig genug, um dem Porzellan der Manufaktur Singer seine Farben, Formen und Motive zu schenken, anstatt sich mit der trockenen Betriebswirtschaft auseinanderzusetzen, denn die Manufaktur kämpfte seit Jahren ums Überleben.
»Ästhetik, Tradition, Nachhaltigkeit und Qualität, das alles interessiert nicht mehr«, hatte Tom oft gesagt, »immer nur billig, billig.«
Leonie überlegte kurz, ob sie die Familie informieren solle, aber sie würden ohnehin nicht mehr rechtzeitig kommen, und sie war auch nicht gerade die Schwiegertochter, die sich Magda Singer für ihren Sohn gewünscht hätte.
»Du bringst dich nicht ein, Leonie. Tom braucht dich an seiner Seite, und du vertust deine Zeit als Grundschullehrerin. Wenn du wenigstens Kinder bekommen würdest, am besten einen Sohn. Wir brauchen Erben.«
Selten hatte Leonies Beruf aus einem Mund so abwertend geklungen. Der Beruf, der für sie mehr war als nur Unterrichten. Sie liebte ihn, sie liebte ihre Kinder.
Tom hatte sie darin unterstützt. »Leb dein Leben, Leonie. Denn dein Leben gehört nur einem – dir.« Er war so widersprüchlich gewesen. Ganz wunderbar und dann wieder kaum zu ertragen. Manchmal in den vergangenen Monaten hatte sie gefürchtet, Tom nicht mehr zu lieben. Irgendwann von ihm weggehen zu müssen. Jetzt ging er fort von ihr. Nein, sie würde niemanden aus der Familie verständigen, die hereinflattern würden wie eine Schar aufgeregt krächzende Krähen. Magda, klein, immer irgendwie zu schnell in ihrem Reden, in ihren Bewegungen, mit ihrer Vorliebe für schwarze Kleidung, immer nur das eigene Leid sehend. Leonie war sicher, dass sie, käme sie jetzt dazu, Tom vor allem vorwerfen würde, ihr, seiner Mutter, so etwas Schreckliches anzutun. Andreas dagegen würde sich hinter aufgesetzter Lockerheit verstecken, ohne fähig zu sein, die Realität zu akzeptieren. In seinem Leben gab es keinen Tod. Vermutlich würde er nur ein Thema haben: Wie verdammt noch mal sollte er ohne Tom zurechtkommen? Die Auszeit seines Bruders war ja schon kaum zu ertragen. Nein, keine Mutter, die so gern das Leben anderer bestimmte und noch lieber Aufregung verstreute wie Konfetti auf jedweder Geburtstagsfeier, ohne hinterher auch nur ans Aufräumen zu denken, weil sie Aufmerksamkeit wie die Luft zum Atmen brauchte. Und auch nicht den Bruder, der sich vor allem um sich selbst drehte. Diese letzten Minuten mit Tom gehörten allein ihr.
Die Wut nahm ab.
Die Hilflosigkeit war wieder da.
Die Ratlosigkeit.
Und das absolute Nichtverstehen, was gerade vor sich ging, als gehöre sie nicht dazu. Eine Fremde im eigenen Leben, das irgendwo stattfand, nur nicht hier.
Wenn Tom doch nicht im Koma liegen würde. Sie hatte ihm noch so viel zu sagen. Er sah friedlich aus. Atmete regelmäßiger als sie.
Leonie hielt sein Gesicht mit den Augen fest. Bei seinem ersten Atemzug hatte sie noch nicht existiert. Bei seinem letzten war sie an seiner Seite. Wieder diese Melodie in ihrem Ohr. Gabriellas Song. Thommy hatte es für sie gesungen. Am Nordseestrand auf Sylt. Er hatte gesungen, und ein anderer hatte dazu Gitarre gespielt.
Ich will spüren, dass ich lebe. Jeden Tag ganz neu. Offen, mutig, stark und frei …
Das Meer ruhig und endlos, die weißen Wolken, als würden sie Hand in Hand über den tiefblauen Himmel ziehen. Sie hatten mit einer Gruppe von jungen Leuten in den Dünen gesessen, der Wind hatte mit dem Dünengras gespielt wie auf einem Instrument, und Leonie war in Tom verliebt gewesen. So unglaublich verliebt, dass sie allein schon am ganzen Körper zitterte, wenn sie ihn ansah, und innen drin auch. Ich will leben und will sagen. Ich bin gut so, wie ich bin. Die Worte wechselten wieder ins Schwedische. Waren in ihrem Ohr. Verdammt noch mal, sie konnte kein Schwedisch, wieso waren auf einmal die Worte da, warum verstand sie, was sie bedeuteten? Som har visat en liten bit Av den himmel jag aldrig nått …
Und jetzt sah sie es auch, sah es in seinem Gesicht, als habe jemand einen Filmprojektor betätigt, sein schönes Gesicht zur Leinwand gemacht, auf der sich nun in schneller Bildabfolge das spiegelte, was sie gemeinsam hatten entdecken wollen. Sie sah nicht mehr die Dünen von Sylt, auch nicht ihr Zuhause, sie sah in seinem Gesicht das, was ihre nahe Zukunft, zumindest für ein paar Wochen, hätte sein sollen.
Sie sah ein von Flüssen durchzogenes waldiges Gebirgsland, fruchtbare Täler, gebettet in ein unfassbar sanft leuchtendes Rosa in allen Schattierungen des Abendlichts. Dann die fast dahinschmelzende Lieblichkeit Südschwedens mit ihren Rapsfeldern, sattem Grün und immer und immer wieder das Meer. Sie roch den Duft von Apfeltee und Zimtschnecken, atmete die frisch gewaschene Decke ein, die in ihrer Fantasie bereitlag, wenn die vor den Cafés aufgestellten Heizstrahler selbst im Frühsommer nicht ausreichten und man sich hineinkuscheln wollte in ihren Geruch von Zitrone, Bergamotte und Vanille. Meer und Salz. Schnee und Moos. Wald und grüne Wiesen, Zimt und Kakao, frisch gebackene Waffeln und Zimtschnecken.
Leonie sah sich um. Nichts von alledem. Dennoch überlagerte er den Krankenhausgeruch, dieser Duft, der sie auf ihrer Reise durch die geöffneten Seitenfenster ihres Wagens hatte begleiten sollen. Jetzt ging Thommy allein. Mit der Weite hinter seinen geschlossenen Augen, den Blick auf die Schären gerichtet, mit ihren winzigen Inseln mit oft nur einem Haus, auf das tiefe Blau des Wassers zahlloser Seen, umgeben von hohen, mit dem Wind tanzenden Gräsern bis wieder hin zu den sich in der Ewigkeit verspielenden Wellen des Meeres.
Ewigkeit!
Wer bist du?
Wie siehst du aus, wie fühlst du dich an, was machst du mit uns?
»Es ist wichtig, mit dem Wind zu fliegen, nicht gegen den Wind, vergiss das nie, Leonie.« Das war seine Stimme. Er sprach mit ihr.
»Gleich ist es vorbei.« Dr. Schyra war wieder da.
»Nein, sehen Sie doch, er spricht. Tom ist wieder bei Bewusstsein, Liebling …«, sie beugte sich über ihn, »ich hab gewusst, dass du mich nicht allein lässt.« Sie wollte ihn küssen, streicheln, doch Dr. Schyra zog sie sanft zurück.
»Ihr Mann ist schon fast auf der anderen Seite!«
Auf der anderen Seite wovon? Wo verdammt noch mal gehst du hin, Thommy? Ich bin nicht weg, dir nur wie immer einen Schritt voraus. Seine Stimme, sein Lachen, seine Art, sie zu necken. Alles in ihrem Kopf. Dazu diese Gefühle, gewaltig wie der Eissturm am Polarkreis, der unter die Haut fährt, bis man sich ihm hingibt, die Arme wie Flügel vom Körper löst und mit ihm einfach davonfliegt …
»Wir werden fliegen, Leonie, wie die Kraniche … frei sein!«
»So haben wir nicht gewettet, Thommy, so nicht!«
Bitte, Eissturm,wandle unsere Arme in Flügel, damit wir gemeinsam dem Tod davonfliegen können. Sie klammerte sich an Toms Hand. Lass uns gemeinsam weglaufen, Thommy. Dahin, wo wir glücklich sein wollten. Endlich wieder. Nach zu viel Staub auf dem Ja, das hätte für immer dauern sollen.
Nun waren es nur acht Jahre. Ihre Geschichte war geschrieben. Kein Wort, kein Kuss, keine Umarmung würden mehr hinzukommen. Kein Schweigen. Kein Streit. Kein gemeinsames Erlebnis, von denen sie viel zu wenig gehabt hatten. Was die Ärztin von dieser Amelie erzählte, war Quatsch.
»Er ist gegangen.« Dr. Schyras Stimme war sanft und grausam.
Leonie wollte erneut auf sie losgehen. Auf sie einschlagen. Menschenleben retten war ihr Job. Und Thommy war auch noch privat versichert. Diese Ärztin hatte versagt. Leonie ging nicht auf Marlene Schyra los, küsste und streichelte Tom stattdessen, flüchtete dann, so schnell sie nur konnte, verließ den fremd Gewordenen, den sie gerade an diesem Morgen wieder begonnen hatte kennenzulernen. Auch das war vorbei.
Und wieder waren Worte in ihrem Kopf, als hätten ihre Locken die Antennen ausgefahren und eingefangen, was noch zwischen Erde und Himmel war.
»Wer bist du, Thommy?«
»Einmal der und dann wieder der andere.«
»Du tust mir weh.«
»Ich weiß.«
»Warum tust du es dann?«
»Ich muss dir wehtun.«
»Warum, Thommy, warum?«
»Um mich endlich selbst zu spüren, Leonie.«
»Warum hast du damit aufgehört, Thommy, warum?«
»Meine Schuld, meine große, große Schuld!«
Leonie lief weiter. Unter dem seelenlosen Ungeheuer hindurch, das noch immer leuchtend von der Decke hing. Die Zeiger standen jetzt auf zwölf Uhr mittags. Eineinhalb Stunden hatte ihr Abschied von Tom gedauert. Sie hätte ihn von nun an auch ohne seinen Widerspruch »Thommy« nennen können. Doch im selben Moment, als sie das dachte, wusste sie, dass er den Rest ihres Lebens nicht mehr Thommy, sondern Tom sein würde.
»Gehören die nicht Ihnen?« Eine Frau stand vor ihr. Mit ihren riesigen, giftgrünen Breitmaulfroschschuhen in der Hand. Leonie wollte sie schon beiseiteschieben – Sehen Sie nicht, in welchem Zustand ich bin? –, doch da waren Toms Worte. Keine Tränen … man soll sich an dein Lächeln erinnern, nicht an deine Tränen.
Sie nahm die Schuhe, bedankte sich lächelnd, wollte weitergehen, bemerkte, dass sie vor der Kinderstation stand. Sie atmete tief durch, stieß die Glastür auf, betrat das erste Zimmer, und noch bevor sie etwas tat oder sagte, hörte sie schon das Kichern und Lachen der kleinen Patienten.
Und in demselben Augenblick, als Dr. Schyra das Fenster des Raumes öffnete, in dem Tom Singer aufgebahrt worden war, und Amelie in Gedanken zurief, sie solle sich da oben gut um Tom Singers Seele kümmern, die gleich zu ihr hinaufsteigen würde, setzte Leonie die rote Nase auf, die ihr noch immer um den Hals baumelte, und stolperte in die Mitte des Krankenzimmers:
»Ich hab eine Erkältung. Deshalb ist meine Nase rot, feuerrot. Darf ich mich setzen, Kinder?«
Die Kinder schrien begeistert: »Ja!« Leonie machte Anstalten, sich auf einen imaginären Stuhl zu setzen, die Kinder riefen noch »Nicht!«, doch da ließ sie sich schon bewusst zu Boden fallen.
Sie lachte.
Die Kinder lachten.
Die Tränen, die sich langsam in ihren schwarz ummalten Augen versammelten, sahen die Kinder nicht. Und Leonie? Sie drängte jede einzelne Träne zurück und überlegte sich den nächsten »Quatsch«, den sie für die Kinder anstellen konnte.
Sie verbrachte eine ganze Stunde damit.
Es rettete ihr vielleicht das Leben.
Denn danach fühlte sie – irgendwann und irgendwie würde es weitergehen.
6.
Es gibt für jeden diesen Moment, von dem man hofft, er werde nie eintreten, und von dem man weiß, dass er irgendwann kommen wird. Irgendwann wird man von einem geliebten Menschen verlassen werden. Aber doch nicht mit fünfunddreißig. Da hatte man Eheprobleme, einen unerfüllten Kinderwunsch, möglicherweise Ärger im Job, aber man wurde nicht Witwe.
Da kam man doch nicht nach einem normalen Frühstück voller Urlaubspläne in ein Haus zurück, in dem noch alles genauso war wie in dem Augenblick, als man es überstürzt verlassen hatte, weil man sich wieder einmal etwas in der Zeit verschätzt hatte.