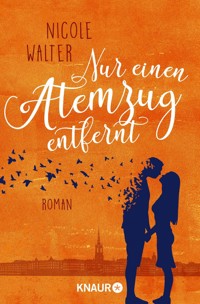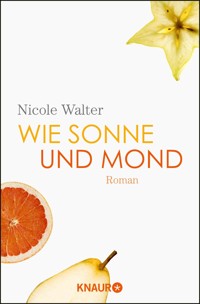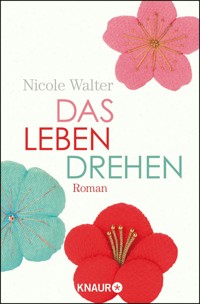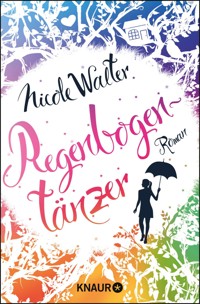
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist es, das das Leben lebenswert macht? Für den alten Alfons sind es seine Saalflugzeuge, so zart und zerbrechlich, dass sie eigentlich nur in geschlossenen Räumen fliegen können. Milena kann ihn gerade noch daran hindern, sich von einer Brücke in die Isar zu stürzen, als sein Flugzeug eine Bruchlandung erleidet und im Fluss unterzugehen droht. Dabei würde sie selbst gern springen, jetzt, wo ihre Karriere als Tänzerin vorbei ist. Stattdessen bringt sie Alfons zurück in das Regenbogenhaus. Und lernt dort wundervolle Menschen kennen: Menschen, die allein nicht in der Welt zurechtkommen und die doch wissen, was das Leben lebenswert macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Nicole Walter
Regenbogentänzer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was ist es, das das Leben lebenswert macht?
Für den alten Alfons sind es seine Saalflugzeuge, so zart und zerbrechlich, dass sie eigentlich nur in geschlossenen Räumen fliegen können. Milena kann ihn gerade noch daran hindern, sich von einer Brücke in die Isar zu stürzen, als sein Flugzeug eine Bruchlandung erleidet und im Fluss unterzugehen droht. Dabei würde sie selbst gern springen, jetzt, wo ihre Karriere als Tänzerin vorbei ist. Stattdessen bringt sie Alfons zurück in das Regenbogenhaus. Und lernt dort wundervolle Menschen kennen: Menschen, die allein nicht in der Welt zurechtkommen und die doch wissen, was das Leben lebenswert macht.
Inhaltsübersicht
Motto 1
Motto 2
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog
Ich lobe den Tanz (…)
O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.
Augustinus Aurelius (354–430), Bischof von Hippo, Philosoph, Kirchenvater und Heiliger
Gibt es etwas, wofür es sich zu träumen lohnt?
Prolog
Sie legte ihn frei. Den Mann mit dem Kaktus, den niemand anfassen durfte. Ein Mal nur hatte sie ihn berührt, und er hatte nicht mehr damit aufgehört … dieses Schreien … diese Angst, diese tiefe, tiefe Verzweiflung.
Jetzt stand sie vor ihm, und er bat ausgerechnet sie, ihm das Haar zu schneiden und den Bart abzunehmen. Mit beidem hatte er sich zuwachsen lassen, bis nichts mehr von ihm übrig geblieben war – außer Augen. Diese Augen. Zunächst dumpf und ausdruckslos, waren sie über die Wochen, die sie ihn inzwischen kannte, lebendig geworden. Ganz allmählich. So wie der Kaktus, den er stets bei sich trug. Die Königin der Nacht. Nur ein Mal würde sie erblühen und dann für immer vergehen.
Nicht Freude, Liebe, Lachen oder irgendeine andere Form von guter Energie, sondern Medikamente hatten seine Augen zum Leuchten gebracht. Normalität gab es für ihn nur auf Rezept. Doch anfassen durfte man ihn noch immer nicht.
»Nur die da«, er hatte mit dem Finger auf sie gezeigt, »die Tänzerin darf mir die Haare und den Bart wegmachen.«
»Warum?«, wollte Phil Friedmann wissen. Er war Arzt und für ihn zuständig.
»Sie kann mit den Ohren sehen und mit den Augen hören … und ihr Körper ist Musik, auch wenn es ganz still ist.«
Friedmann nickte Milena zu. Milena zögerte, nahm aber doch die Schere. Sie wusste inzwischen, was der Kaktusmann getan hatte, ehe er an diesen Ort gekommen war. In das Regenbogenhaus mit seinen Regenbogenmenschen. Und das ängstigte sie. Ängstigte sie noch immer. Obwohl sie schon so viel mehr über ihn und alle anderen wusste. Friedmann nickte erneut. Sie atmete tief ein, setzte mit dem Rasiermesser an, peinlich darauf bedacht, ihn nicht mit der Hand zu berühren. So begann sie, ihn freizulegen. Millimeter um Millimeter. Sie tauschte mit Friedmann einen Blick. Und für den Bruchteil einer Sekunde waren sie verbunden in dem Erstaunen über das, was sie sahen und – beide – nicht erwartet hatten. Diese feinen Züge, so sensibel, sie stürmten auf Milena ein. Alles andere um sie herum verblasste, auch Phil. Sie starrte Christopher an und ahnte, nein, sie wusste noch im selben Augenblick, dass sie diesem Mann nicht mehr würde entkommen können. Auf eine ihr noch unbekannte Art und Weise würde er zu ihrem Schicksal werden. Vielleicht ihrem Leben sogar wieder einen Sinn geben. Endlich. Wieder. Einen Sinn.
»Wie konnte es nur so weit mit dir kommen, Christopher?« Sie musste es wissen.
»Weil ihnen jemand gesagt hat, dass ich mich für Gott halte.« Er lächelte, und der Sommerhimmel draußen vor dem Regenbogenhaus wurde weit. »Sie mögen es nicht, wenn sich jemand für Gott hält, weil sie sich selbst für Gott halten.«
Während er das sagte, sah er Phil Friedmann an.
Phil Friedmann hielt seinem Blick stand. Er wusste – auch er war gemeint.
1
Milena, hast du die Hausaufgaben fertig?«
»Milena, Tisch abräumen!«
»Milena, hör auf, durch die Wohnung zu tanzen, tu endlich was! Was Vernünftiges!«
»Milena … !!!!«
Sie lief so schnell sich ihre Beine bewegen konnten. Fort vom öden Alltag hin zu ihrem Traum. Sie fühlte sich geborgen in ihm, sicher. Wie in dem alten Fahrstuhl des Mietshauses, in dem sie mit ihrer Familie wohnte. Manchmal, wenn sie einen Ort ganz für sich haben wollte, stellte Milena den Schalter auf Stopp, hockte sich auf den Boden des Fahrstuhls und redete mit ihm wie mit einem guten Freund. Der Fahrstuhl hörte zu. Er war der Einzige, der ihr wirklich zuhörte und sie verstand. Wenn sie dann genug erzählt und er ihr lang genug zugehört hatte, stellte sie den Schalter wieder auf Go, und er fuhr sie hinauf an den Ort, an dem sie ihrem Traum ganz nahe kam. War der Fahrstuhl allerdings kaputt, musste sie die Treppe nehmen. Lief Stufe um Stufe bis hinauf in den achten Stock und blieb vor der schweren Eisentür stehen.
Die Eisentür. Ihr Tor zur Freiheit. Milena stemmte sich gegen die Tür, sie hatte noch wenig Kraft und die Tür ließ sich nur schwer öffnen, und dann war er da – ihr Traum. Und der Himmel.
Milenas Herz klopfte bis zum Hals. Sie wollte hineinspringen in das endlose Blau. Sich tragen lassen und dann die Arme ausbreiten und – fliegen.
Weit über die Dächer der grauen Hochhaussiedlung, diesem Ring aus Beton, in dem nicht nur Blätter, sondern gelegentlich auch Müllbeutel in den wenigen Bäumen hingen. Sie wollte raus, raus aus der Wohnung, die sie mit dem Vater, der Mutter und dem jüngeren Bruder Maxi teilte. Aus ihrer Wohnung, in der nie etwas Neues gekauft wurde, solange das Alte nicht kaputt war, raus aus diesem Leben, das so kleinkariert war wie ihr Mathematikheft, in dem nur selten eine Rechnung aufging.
Wozu brauchte sie Noten? Sie hatte die Klangbilder im Kopf. Immer. Auch wenn es um sie herum vollkommen still war.
»Milena aufräumen, hast du die Hausaufgaben fertig? Deck den Tisch!« Nein! Nicht jetzt. Nicht in diesem Augenblick.
Ihr Puls schlug den Takt. Ihr Körper begann zu musizieren. Sehnen, Muskeln, Gelenke wurden zum inneren Orchester. Zuerst die Streicher, zart. Die Füße begannen zu wippen. Die Fenster der Hochhauswaben gegenüber nahmen ihre Logenplätze ein. Jetzt der Paukenschlag. Mit Schwung hob sie das rechte Bein, die auf den winzigen Balkons zum Trocknen aufgehängten Wäschereihen flatterten ihr begeistert entgegen. Die vielen Parabolantennen verneigten sich. Brava, Milena Müller, brava! Sie schwang das Bein über den rostigen Rahmen eines achtlos dahingeworfenen Liegestuhls mit voller Kraft senkrecht nach oben. Drehte eine Pirouette, hielt sich an der Lehne eines alten Holzstuhls fest, verfing sich fast in dem Schlabberpulli, in dem ihr magerer Körper unterzugehen drohte. Drehte noch eine Pirouette, noch eine, immer weiter auf den Rand des Daches zu. Doch das war ihr gleichgültig. Sie war elf und wollte tanzen. Mit und über den Wolken. Tanzen. Nichts als tanzen. Immer nur tanzen …
»Frau Müller?«
»Ja?«
»Ich habe Sie gerade nach Ihrer Ausbildung gefragt.«
»Stage School Hamburg.«
Ihr seid Puppen. Die Fäden gehen durch die Wirbelsäule und sind an Ellbogen und Knien befestigt. Das hatte ihnen Tom, Lehrer für Jazzdance, schon am ersten Tag mit auf den Weg gegeben.
»Stage School Hamburg.« Die Frau von der Arbeitsagentur sah sie an. Ihre Augen verrieten die Resignation, ihre ganze Haltung strahlte das aus. »Ich meine, haben Sie noch etwas anderes gelernt, Frau Müller, außer … nur … tanzen und singen?«
Nur tanzen und singen.
Starlight Express, Grease, Westside Story, Phantom of the Opera – sie hatte alles getanzt, was es im Musicalsektor zu tanzen gab. Und jetzt saß sie da, an diesem Ort, an dem Milena nie hatte sein, vor einem Menschen, mit dem sie nie etwas hatte zu tun haben wollen, fand sich in einer Rolle, die sie nie hatte spielen wollen. Frustrierte Arbeitssuchende im Jobcenter. Sie fühlte sich fremd. War herausgerutscht, nicht nur aus dem ihr so vertrauten Leben, sondern auch aus sich selbst. So saß sie da, neben sich, die Tänzerin und ihr Schatten. Ihr seid Puppen. Die Fäden gehen durch die Wirbelsäule und sind an Ellbogen und Knien befestigt. Die Puppe und die Puppenspielerin; sie zog an den Fäden und sorgte dafür, dass Milena reagierte und antwortete: »Nein, ich habe nichts anderes gelernt. Nichts …«
»Um Himmels willen, mach was Richtiges, Kind!« Mit aller Kraft hatten sich die Eltern gegen ihren großen Traum gestemmt. »Eine Ausbildung. Etwas Sicheres.«
»Mama, Papa, ich will, ich muss tanzen!«
»Es gibt Tänzer, die sitzen mit dreißig im Rollstuhl.«
»Bitte, Mama, ich muss …«
Milena liebte ihre Mutter. Die feinen Bewegungen, mit denen sie immer alles exakt zurechtrückte, weil alles seinen Platz hatte. Jedes Ding und jeder Mensch. Fand der Mensch seinen Platz nicht, wurde er unglücklich, davon war ihre Mutter zutiefst überzeugt.
Sie hatte ihren Platz gefunden, neben dem Vater, einem Fachangestellten im Öffentlichen Dienst. Sie war etwas größer als er und trug deshalb nie hohe Absätze, obwohl sie mit glänzenden Augen vor jedem Schuhladen stehen blieb.
»Kauf sie dir doch, Mama!«
»Dein Vater mag nicht, wenn ich größer bin als er.«
»Du liebst Schuhe mit hohen Absätzen.«
»Ich liebe deinen Vater.«
Milena hatte nie verstanden, dass man für einen anderen auf etwas verzichtete, das man haben wollte. Ihre Mutter aber ging weiter. Aufrecht. Wie eine Königin. Sie musste sich ihre Haltung nicht hart an der Stange erarbeiten, ihre Haltung war angeboren. Sie arbeitete für einen ambulanten Pflegedienst, blieb meist länger bei ihren Patienten, als es der Minutentakt vorschrieb. Den Ärger, den sie deshalb mit der Pflegedienstleitung bekam, nahm sie in Kauf.
Von dem, was ihre Tochter wollte, hatte sie allerdings wenig Ahnung. Davon war Milena überzeugt – bis zu jenem Abend Ende November, an dem das Dach endlich den Teppich vor ihr ausrollte, der ihr gebührte; nicht rot, sondern weiß.
Der erste Schnee. Milena betrat das Dach und sank ein. Andere wären entsetzt vor der Nässe zurückgewichen, die durch das Tuch ihrer Ballerinas kroch und jeden Millimeter ihrer Haut bis zu den Knöcheln benetzte. In Milena jedoch löste sie wohliges Schaudern aus. Der Verkehrslärm drang gedämpft zu ihr herauf, die Lichter hinter den Fenstern wurden zu Scheinwerfern, hundertfach, das Grau der Hochhäuser in ein dunkles Nichts zurückdrängend. Es war kalt, es schneite, an den Dachrinnen hingen Stalaktiten aus Eis, und all das formte sich in Milena zu einer einzigartigen Melodie, wie alles zur Melodie wurde, was sie sah, hörte, empfand.
»Milena, mach die Musik leiser. Milena, musst du immer tanzen, kannst du nicht gehen wie ein normaler Mensch?«
Sie fühlte den Rhythmus, wurde zur Solistin inmitten einer Schar von Gruppentänzern im Flockenkostüm. Sie spürte weder ihre nassen Füße noch den Schweiß auf ihrer mittlerweile klamm gewordenen Haut. Der Atem mit seinen Sprechblasen war ein weiterer Teil der Inszenierung, und der Schnee zeichnete die Choreographie ihrer neu erdachten Schrittfolgen auf. Und dann sah sie ihre Mutter. Sie stand einfach da, ohne Jacke, ohne Mantel in einem viel zu dünnen Kleid, Gänsehaut, und die Arme trotzdem nicht wärmend um den Leib geschlungen. Sie hingen einfach so da, fast hilflos von ihren Schultern. Viel später hatte Milena ihre Mutter gefragt, was sie in diesem Moment empfunden hatte, und ihre Mutter hatte geantwortet: »Ich hab einfach nur gewusst, wer du wirklich bist und wohin du gehörst.«
Warum ihre Mutter ihr ausgerechnet an diesem Tag aufs Dach gefolgt war, Milena hatte sie nie danach gefragt. Vielleicht hatte sie angenommen, ihre Tochter treffe sich dort mit Jungs, rauche heimlich oder treibe sonst etwas, das man mit elf möglicherweise so trieb. Aber sie sah Milena tanzen.
Ihre Eltern redeten die ganze Nacht. Am Morgen, als Wind und noch mehr Schnee längst alle Tanzschritte bedeckt und verweht hatten, erlaubte ihr der Vater, die Ballettschule zu besuchen. Die Mutter ging putzen, um das nötige Geld dafür aufzutreiben, ihr Bruder Maxi war sauer, weil er kein neues Fahrrad bekam, und der Vater saß bei ihrem ersten Auftritt sogar in der ersten Reihe. Nur – mit elf Jahren war es für das klassische Ballett trotz Milenas Talent zu spät. Nicht aber für das Musical.
Nur tanzen und singen?
Egal, was ihr später mal macht, bei uns lernt ihr fürs Leben. Zum Beispiel, wie man Stimme und Körper einsetzt, um vor anderen entschlossen aufzutreten und sein Ziel zu erreichen.
Nicht aufgeben. Sie konnten ihr alles nehmen. Den Auftritt, den Applaus, die Orientierung, aber nicht, was sie war und wer sie für immer sein würde. Eine Tänzerin.
Milena straffte sich. Die Musik in ihr war wieder da. Stimme und Körper nahmen Haltung an.
»Wann waren Sie …« Sie versuchte, sich an den Namen der Arbeitsvermittlerin zu erinnern. Er stand an der Tür, vor der Milena so endlos lange gewartet hatte. Mit all den anderen Namenlosen, die nach dem Ziehen einer Nummer selbst zur Nummer geworden waren. Sie war Nummer siebenundzwanzig in dieser neuen Welt. Nur wenige Schritte über das Kopfsteinpflaster. Noch einmal an der Zigarette ziehen, als wäre es der letzte Zug. Alle Tänzer rauchten, die Kippe in die Ritze treten, Bibliothek links, Glasfront geradeaus, und dann wieder hinein in das riesige Gebäude mit seinem Flurlabyrinth. Jetzt erinnerte sich Milena: Adamczik. Die Frau hieß Adamczik.
»Wann waren Sie das letzte Mal in einem Musical oder im Ballett, Frau Adamczik?«
Ein Augenblick der Überraschung, dann war die Resignation wie weggeblasen. Die Augen von Frau Adamczik begannen zu tanzen. Sogar in die durch viel Haarspray erstarrte Von-der-Leyen-Frisur geriet ein Hauch von Bewegung. »Mamma mia. Ich liebe Abba. Ein wunderschöner Abend. Nur viel zu lange her.«
Milena beugte sich leicht vor. »Warum, Frau Adamczik, hätte ich dann jemals etwas anderes lernen sollen?«
Für einen ganz kurzen Moment waren sie nicht mehr die auf der einen und die auf der anderen Seite des Schreibtischs. Sie waren wie durch unsichtbare Fäden miteinander verbunden – Tänzerin und Publikum.
Frau Adamcziks Stimme klang milder, als sie fortfuhr: »Und weshalb haben Sie aufgehört? Ich denke, gerade beim Musical, Sie sind doch erst …«, kurzer Blick auf Milenas Unterlagen, »… doch schon … fünfunddreißig?«
»Dazu Rücken- und Gelenkprobleme.«
Bei einer Hebung war Milena so unglücklich gestürzt, dass sie sich einen Rückenwirbel verletzt hatte. Operation. Reha und danach – das endgültige Aus.
»Oh.« Pause. Die Augen tanzten nicht, und auch der Mund lächelte nicht mehr. Frau Adamczik fiel zurück in die Resignation. »Es wird nicht leicht werden, Frau Müller, Ihnen etwas zu vermitteln. Alles andere als leicht. Wirklich nicht einfach.«
Vorsorge treffen. Das Plakat des Diakonischen Hilfswerks, das gegenüber der Arbeitsagentur an einer Mauer klebte, zeigte zwei Frauen mit Kopftuch, die irgendwo, Afghanistan oder Türkei, im gleißenden Sonnenlicht ein Feld bepflanzten.
Vorsorge treffen und sich damit schon Sorgen machen, wenn alles noch gut ist. Sich Sorgen machen auch in jenen kostbaren Augenblicken, in denen das, was man sich ersehnt, eins wird mit dem, was man tut, kein Lärm von außen die innere Stimme überdeckt. Man ist ganz bei sich. Warum, zum Teufel, also an später denken und sich damit alles verderben?
Milena hatte nicht einmal daran gedacht, Vorsorge zu treffen, auch wenn sie hätte wissen müssen, wie schnell alles vorbeiging. Wie der Frühling. Gerade noch hatte er im pastellfarbenen Kostüm vor einem tiefblauen Himmel sehnsucht- und traumverloren Spitze getanzt. Bis sein angenehm warmes Licht erlosch, seine Melodie verklang, der Frühling trat leise ab, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Er hatte sich die Nacht ausgesucht, die Zeit, in der alles schlief. Dann, noch im Morgengrauen, das Solo kleiner Trommeln und Flöten, dann das Einsetzen des gesamten Orchesters, dieser gewaltige Sprung. Der Sommer war da. Prall, elektrisierend, leidenschaftlich, und es würde Monate dauern, bis er sich vom vielen Leben erschöpft zurückzog und die Bühne nach dem sich vornehm zurückhaltenden Herbst dem kalten Winter überließ.
Vorsorge treffen. Sie hatte sich nicht gesorgt und damit Zeit verschwendet. Sie hatte getanzt, bis ihr Körper durch und durch erhitzt war von Rausch, Glücksgefühl und Applaus. Brava, Milena Müller, brava! So weit hatte sie es nie geschafft, aber sie hatte vergessen, wie kalt Kälte sein konnte. Jetzt war es Sommer, und sie fror.
Der letzte Auftritt. Die letzte Verneigung. Der letzte Applaus. Der Vorhang fiel, und es war, als habe es sie nie gegeben, als habe nie auch nur ein Fuß den Boden einer Bühne berührt. Vorhang zu. Scheinwerfer aus. Und dann war man einfach für immer – weg. Vorsorge treffen. Sie hätte zumindest irgendwann dazwischen an das Später denken sollen. Wie das Kind, das gebeten worden war, nach dem Stern zu greifen, und den Boden berührt hatte. Sie hatte den Boden ignoriert. Damit war sie jedoch nicht allein.
»Hast du wieder mal was von Carmen gehört, von Christine oder Oskar?« Oder von all den anderen, die irgendwann von der Bühne verschwunden waren, wie aufgesogen vom Erdensumpf. »Keine Ahnung, was sie jetzt machen.« Es zu wissen – oder sich auch nur nach ihnen zu erkundigen – hätte bedeutet, ein Danach zu akzeptieren. Doch sie wollte an das Danach nicht einmal denken. Kein Tänzer dachte daran. Er tanzte. Vorsorge treffen? Nicht einmal dann, wenn die Schmerzen im Rücken unerträglich wurden. »Dreh dich, weiter und weiter, steh niemals still, sonst verlierst du den Tanz.«
Sie hatte nicht nur den Tanz verloren. Ohne ihn hatte sie auch keine Identität. Sie war nichts mehr. Hatte keinen Status, keine Aufenthaltsgenehmigung für das normale Leben. Sie hatte noch weniger als all die Namenlosen vor dem Zimmer von Frau Adamczik, die zumindest hofften, in den Beruf zurückkehren zu können, den sie erlernt hatten.
»Irgendwas werde ich schon finden.«
»Wer arbeiten will, kriegt Arbeit.«
»Es geht immer irgendwie weiter.«
Milena entschied sich für ein anderes Mantra. »Ich bin ein Geldmagnet!« Sie überquerte die Straße. »Geld fließt mir aus unsichtbaren Kanälen zu.« Reifen quietschten. Wildes Hupen. Der Mercedesfahrer stoppte so knapp vor ihr, dass sie erschrocken einen Schritt zurücktrat und dann wie angewurzelt stehen blieb. Das Hupen hörte auf, das Seitenfenster wurde heruntergekurbelt. Der Fahrer, ein durchaus ansehnlicher Mann mittleren Alters, steckte den Kopf heraus und fluchte: »Kreuzkruzefix … dumme Henna, saudumme.« Das in München selten gewordene Exemplar eines Bayern, nicht in Lederhosen, sondern im geschäftlichen Tarnanzug mit Krawatte, spöttelte Milenas innere Stimme. Gleichzeitig gab sie das Kommando: Herzschlag runterfahren. Im Schritttempo weitermachen.
Milena trat an das geöffnete Seitenfenster und hauchte dem Mercedesfahrer entgegen: »Tut mir leid.« Sein hochroter Kopf verlor etwas an Farbe, der Augenausdruck wurde milder: »Na, geht doch!« Da fuhr sie jedoch schon fort: »Dass Sie noch immer keine Frau von einem Huhn unterscheiden können.«
Hatte er bisher noch im Stand-by-Modus gewütet, so legte er jetzt richtig los. »Du gwambada Uhu du!Oide Scheißhausfliagn« waren noch die harmloseren Varianten der bayerischen Schimpfkanonade. Nun hätte Milena sich einfach umdrehen und gehen können, aber da blitzte erneut der innere Kobold auf, der sich in den letzten Monaten gekränkt und verunsichert in eine Ecke gekauert hatte. Der Autofahrer fluchte und schimpfte, Milena lupfte mit zauberhaftem Lächeln den bunten Rock, den sie auf dem Tollwood, einem großen, farbenfrohen Basar, erstanden hatte, wirbelte die Endlosbeine zum Cancan, zwei-, dreimal, drehte sich blitzschnell um, gab auch noch die Rückseite ihres Höschens zum Besten, Applaus, Applaus, nicht vom Autofahrer, sondern von einigen Passanten, ging mit einer tiefen Verbeugung in die Knie und gab die Straße wieder frei. Einen Moment der Verblüffung, dann preschte der Autofahrer mit Kavaliersstart davon.
Milena sah ihm nach, überquerte die Straße und setzte dabei das Mantra fort, mit dem sie das Universum sanft darauf hinweisen wollte, dass sie seine Unterstützung diesmal wirklich nötig hatte.
Normalerweise glaubte Milena im Gegensatz zu Betty, einer Ex-Kollegin, weder an die Kraft des Universums noch an Mantras. Doch wenn man nicht mehr an sich selbst glaubte, konnte man genauso gut an alles glauben. Auch daran, dass die Bank es zur Abwechslung einmal gut mit ihr meinte.
»Ich bin ein Geldmagnet, Geld fließt mir aus unsichtbaren Kanälen zu.« Sie bebte dem Sachbearbeiter förmlich entgegen, der jetzt das Büro betrat. Seit zehn Minuten wartete sie schon auf ihn. Er reichte ihr die Hand und setzte sich ihr gegenüber auf die andere Seite des Schreibtisches.
»Ich habe mich in der Zwischenzeit schon einmal informiert, Frau Müller.«
Milena lächelte vorsichtig. Ihr Lächeln blieb allein.
Der Bankbeamte fuhr fort: »Bei Ihrem Scoring ist die Erhöhung Ihres Überziehungskredits …« Fouetté. Seine Stimme erinnerte sie an die rasche, peitschenhiebartige Bewegung eines Beins innerhalb einer Drehung. »Tut mir leid, da haben wir ein Problem.«
»Scoring?«
»Das Scoring ist ein Zahlenwert auf der Basis einer statistischen Analyse, das die Kreditwürdigkeit einer Person aufgrund kreditrelevanter Merkmale repräsentiert.«
»Kreditrelevante Merkmale …« Dafür, was sie gerade empfand, gab es keinen beim Tanz spezifischen Ausdruck. Höchstens das Tendu. Das langsame Herausschleifen der Fußspitze aus einer Grundposition. Sie veränderte ihre Stellung. Saß wieder gerade, die Knie aneinandergepresst.
»Sie haben Ihren Überziehungskredit schon mehrmals bis zum Äußersten in Anspruch genommen.«
»Dafür ist so ein Überziehungskredit doch da? Und die Bank verdient an meinen Zinsen?« Sie versuchte zu verstehen. Zumindest irgendetwas in dieser ihr so fremden Welt.
»Schon, aber für Ihre Rating-Stufe ist das nicht gut.«
»Rating-Stufe?«
»So eine Art Note. Die Beurteilung Ihrer Bonität.«
»Also Sie gewähren mir einen Überziehungskredit, an dem Sie gut verdienen, und wenn ich ihn nütze, dann krieg ich eine Sechs?«
»Sechs wäre gut.« Zum ersten Mal zeigte sein Gesichtsausdruck Bedauern. »Sie haben im Moment eine Dreizehn. Ganz schlecht. Und jetzt sind Sie auch noch arbeitslos.«
Es wurde Zeit für den Contretemps, Verbindungsschritt mit Richtungswechsel. »Der Leistungsantrag ist gestellt, und der Antrag auf einen Vorschuss …« Dieser Hauch von Langeweile im Gesicht des Bankbeamten. Sie atmete tief durch. »Was kann ich tun?«
Endlich waren sie am Punkt. Auch er atmete auf. »Bis zum nächsten Ersten Ihre Überziehung zurückzahlen.«
Tour en l’air. Sprung mit Drehung um die eigene Achse in der Luft und nie wieder auf den Boden zurückkommen …
Milena überlegte nicht. Zog ihr Portemonnaie aus der Handtasche, öffnete es und stülpte es blitzschnell um. Alles, was sie noch an Münzen und Scheinen hatte, rollte und flatterte auf den Schreibtisch des Bankbeamten.
»Der Rest kommt dann irgendwann.«
Er war verblüfft.
Sie triumphierte.
Setzte ihr Mantra fort.
Ich bin ein Magnet.
Ich zieh die Scheiße an.
Milena verließ die Schalterhalle. Ihr war übel. Wo um Himmels willen sollte sie die dreitausend Euro auftreiben, die sie von ihr haben wollten. Womit Miete, Essen und überhaupt alles bezahlen? Zu ihren Eltern konnte sie nicht gehen. Auch nicht zu ihrem Bruder. Ihr kleiner Bruder Max. Sie hatte ihn gewickelt. Er hatte sie zur Weißglut gebracht. Indianer auf Kriegspfad, Indianer, die gemeinsam die Friedenspfeife rauchten. Als Kinder waren sie beides gewesen, und jetzt hatten sie einander schon so viele Jahre nicht mehr gesehen.
Das letzte Mal an jenem Abend in Paris vor fast sechzehn Jahren.
Sie hatte das Phantom der Oper getanzt. Das Musical um den geheimnisvollen Mann im schwarzen Cape mit der weißen Maske, der in den alten Gemäuern der Oper auftaucht. Nachts. Leise, innig wird Musik erklingen. Hör sie, fühl sie, lass sie dich durchdringen. Lös dich von der Welt, die dein Herz gefangen hält. Widerstrebe nicht der unbekannten Macht, der Dunkelheit und der Musik der Nacht. Die Melodie war noch in ihrem Kopf gewesen, ebenso wie die Worte. Der tosende Applaus – und danach Stille. Absolute Stille. Diese hatte sie gesucht, nachdem die anderen gegangen waren. In dem Sessel aus rotem Samt hatte sie vor dem wandbreiten Spiegel gesessen. Schminkte sich ab. Entfernte nach und nach das Make-up, das sie auf der Bühne zur Diva gemacht hatte. Die großen ausdrucksstarken, braunen Augen mit ihrem goldgrünen Funkenspiel schrumpften zur Normalgröße. Der Mund, gerade noch durch die tiefrote Farbe hocherotisch, war jetzt blass, und man sah ihm an, wie gut sich Milena mit dem Unglücklichsein auskannte. Es gab Zeiten, da hatte das Unglücklichsein ebenso zu ihr gehört wie ihre langen Beine. Lange Beine, ewiges Unglücklichsein, selten Affären, und bahnte sich zwischendurch so etwas wie eine Beziehung an, kam sie sich darin vor wie ein ungebetener Gast. Sie bürstete ihr dichtes, braunes Haar – ihre Mutter hatte es Rosshaar genannt – energisch gegen den Strich, ohne Rücksicht auf die winzigen Knoten, verursacht von zu viel Haarspray, es ziepte, sie presste die Lippen noch fester zusammen.
Sich lösen von der Welt, die ihr Herz gefangen hält … Dafür brauchte sie nach jeder Vorstellung ihre Zeit.
Ein Spaziergang durch Paris im Licht der aufgehenden Sonne. Café au lait in ihrem kleinen Café an der Seine. Erst dann war sie bereit gewesen, in das winzige Zimmer zurückzukehren, in dem sie mit einer anderen Tänzerin untergebracht worden war.
Max hatte schon auf sie gewartet. Kein Kuss wie sonst. Keine Umarmung wie sonst. Nur ein knappes »Sie lassen sich scheiden«.
»Wer … wer lässt sich scheiden?« Wenn er sie schon nicht umarmte, dann wollte wenigstens sie ihn umarmen. »Wie geht es dir?«
Er wich aus. »Deinetwegen. Sie lassen sich deinetwegen scheiden.«
»Unsere Eltern?« Niemals. Nicht ihre Eltern. Sie kauften nichts Neues, solange das Alte noch funktionierte. Und sie hatten immer funktioniert. Immer! »Du spinnst.«
»Ich spinne? Du bist es doch mit deinem verdammten Tunnelblick.« Sie hatte Max noch nie so wütend, so hilflos gesehen, bis auf das eine Mal, als er grundlos auf dem Schulhof verprügelt worden war. »Deinem komplett durchgeknallten Rumhopsgehirn. Kapierst du es nicht? Du bist schuld, dass sich unsere Eltern getrennt haben! Du! Sie werden einfach nicht damit fertig, dass du … Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.«
Kleine Fingerchen, die sich an ihrem Blusenkragen festklammern. Weg damit, weg, geh auf Reisen in eine andere Wirklichkeit … geh, geh, geh … tanz!
Das falsche Bild. Die falsche Erinnerung. Nicht jetzt nach dem unerfreulichen Gespräch mit der Bank. Sie brauchte ihre Kraft. Irgendwie musste es ja weitergehen.
Vorsicht Rutschgefahr. Das Putzteam hatte den Aufsteller vermutlich vergessen. Aus dem Schlund des Geldautomaten schoben sich Scheine in die offene Hand einer Frau. Mit welcher Selbstverständlichkeit die Frau das Geld entgegennahm und in ihr Portemonnaie steckte, fast empfand Milena so etwas wie Neid. Dabei war sie nie ein neidischer Mensch gewesen. Die Glastür fiel hinter ihr zu. Und es war, als sei auch das vorbei – für immer. Würde ihr Leben von nun an wie ein Haus sein mit vor ihr verschlossenen Türen?
Nein, eine Tür gab es noch. Eine Tür, die sich sogar aufsperren ließ, weil sie den Schlüssel hatte. Nur, wie lange noch, wenn sie schon bald die Miete nicht mehr zahlen konnte? Das andere ließ sich verdrängen. Das hatte sie auch schon lang genug geübt. Die Realität, so, wie sie jetzt war, leider nicht.
Ihre Wohnung. Fünfunddreißig Quadratmeter mit Kochnische und Blick auf eine Garage.
»Wir haben sie mit Efeu bepflanzt«, hatte ihr die alte, stets ganz in Schwarz gekleidete Vermieterin Frau Lipowsky erklärt, wie immer etwas außer Atem und auf ihren Gehstock gestützt. »Damit es etwas freundlicher ist.«
Das farbige Wechselspiel der Jahreszeiten auf einer Garagenwand – würde das alles sein, was die Zukunft noch für sie bereithielt? Vom Bett aus, in dem sie sich verkriechen würde, vielleicht für immer, und in einem Körper, der allmählich schrumpfte – auch innere Lähmung baut Muskeln ab. Der Kopf würde dann den Rest besorgen, schwer geworden mit all den Gedanken und Erinnerungen. Irgendwann würde der Hals ihn nicht mehr tragen können, Kopf hoch, en face, hoch, hoch, der Kopf würde abfallen und vielleicht unters Bett rollen. Die alte Vermieterin würde auf sie aufmerksam werden, weil der Briefkasten irgendwann überquoll. Keine Briefe. Nur Werbung. Und weil auf ihrem Konto keine Miete mehr eingehen würde. »Irgendwas stimmt da nicht.«
Man würde die einzige Tür öffnen, zu der Milena noch den Schlüssel hatte, das wenige entrümpeln, das sich in der Wohnung befand, bisher Durchgangsstation zwischen zwei Engagements, zwei Umzugskisten waren noch nicht einmal ausgepackt, man würde den Kopf unter dem Bett finden – »So eine Sauerei!« – und nicht wissen, was man mit ihm anfangen sollte, ebenso wenig wie mit dem Rest. Dem Rest, der von einem großen Traum geblieben war.
2
Du saublöde Kuh, du!« Eine Amsel flatterte erschrocken auf. Zentimeterknapp preschte der Radfahrer an Milena vorbei, als handle es sich nicht um einen Spazierweg, sondern um eine Formel-1-Strecke. Er trug Anzug, Fahrradhelm, und die Aktenmappe hing schief im Gepäckträger. Stressabbau nach dem Büro.
»Und Sie«, schrie Milena ihm hinterher, »können Sie nicht aufpassen? Sie unterbelichteter Drahteselschumi!«
Statt einer Antwort drehte sich Drahteselschumi nach ihr um und drohte ihr mit der Faust. Geballte Aggression. Milenas Herz schlug bis zum Hals und beruhigte sich erst, als sie die Großhesseloher Brücke erreicht hatte. Majestätisch spannte sich die Brücke zwischen Fachwerkrahmen doppelstöckig über die auf Kies gebettete Isar. Im ersten Stock ein Rad- und Fußgängerweg, über die Gleise im zweiten Stock donnerten die Züge der Oberland- und der S-Bahn.
Vorhängeschlösser als ein Zeichen für immerwährende Liebe hingen vor sich hin. Nicht tausendfach wie an der einen römischen Laterne, die unter der Liebeslast eingeknickt war, sie hingen vereinzelt, klein, bunt, im Sonnenlicht blinkend an den Gittern, die angebracht worden waren, um Lebensmüde vom Springen abzuhalten. Doch Lebensmüde waren einfallsreich. Sie kamen dahin, wohin sie wollten, wenn sie es wirklich wollten. Ein Grablicht jedenfalls lag im Gras, vermutlich umgeworfen von spielenden Hunden. Sein Feuer erloschen, dafür setzte die Sonne dem roten Glas Lichtpunkte auf.
»Bis zum Mond und zurück …« Eine kleine grauhaarige Frau mit Rucksack stand vor den Liebesschlössern und las ihrem Begleiter vor, was in die Schlösser eingraviert worden war. »Alles vergeht, nur die Liebe besteht.«
»So ein Schmarrn, den Schlüssel in die Isar zu schmeißen!«
»Typisch Mannsbild. Schwören einem ewige Treue und denken schon an eine andere.«
»Reg dich nicht auf, ich bin jetzt schon fast fünfzig Jahre freiwillig bei dir.«
»Weil ich für dich putz und koch …«
Sie entfernten sich streitend, im Gleichschritt marsch!
Irgendwann wurden sie langsamer, noch immer im Gleichschritt: Der Mann nahm die Hand seiner Frau, die Frau lehnte den Kopf kurz an seine Schulter. Sie brauchten keine Liebesschwüre, nur diese kleinen Gesten.
Alles war gut. Für sie beide war alles gut.
Pas de bourrée. Milena machte einige kleine Schritte aus der Grundstellung heraus. Sie hatte Musical getanzt, das Ballett jedoch nie verloren. Wie gern würde sie sich jetzt hineintanzen in den Wind, diesen streunenden Gesellen, hinein in die Anmut der Luft, mit dem Flammenfluss Isar, tief unter der Brücke, dem ewig goldenen Strom Abendlicht, aus dem sich jetzt etwas löste. Milena wusste nicht sofort, was es war. Ein tänzelndes, silbriges Etwas mit festem Körper, die Flügel nur ein Hauch. Wie ein feinstoffliches Wesen aus einer anderen Dimension. Das Wesen segelte vorwärts, kehrte exakt am Scheitelpunkt um, schwang sich einen Herzschlag lang in einer Rückwärtsbewegung, leicht, elegant grazil, und dann – Milena hielt den Atem an – stürzte es kopfüber in die Isar, die sofort nach ihm schnappte wie ein Krokodil nach seiner Beute und es davontrug, vielleicht an den geheimen Ort, an dem die Isar all die Schlüssel aufbewahrte, damit man sie irgendwann vielleicht doch wieder aufsperren konnte, die Vorhängeschlösser und die Herzen.
Milena träumte sich einen Moment hinein in den Fluss, so, wie sie sich als Kind vor dem Einschlafen in den Tanz geträumt hatte. Der Fluss, der immer in eine Richtung fließt. Bis hin zum Meer, wo er ein Teil der unendlichen Weite wird.
»Auch unser Leben ist wie ein Fluss«, hatte die Mutter zu ihr gesagt. »Natürlich kannst du gegen die Strömung ankämpfen, und vielleicht hast du damit auch Erfolg, für einen Augenblick, aber dann wirst du an Kraft verlieren, müde werden, und der Fluss wird dich dahin tragen, wohin du gehörst.« Die Mutter hatte gelächelt: »Lass das Leben fließen, Milena. Lass es einfach zu.«
»Sie fliegen nur in geschlossenen Räumen.« Die Stimme holte sie aus ihren Gedanken zurück. Aber es war nicht nur die Stimme, es war der kleine Mann, der sie auf Anhieb faszinierte. Im schwarzen Gehrock stand er sehr aufrecht vor ihr. Blütenweißes Hemd, schwarze Fliege, und er wirkte fast wie das abgestürzte und in der Isar versunkene Lichtwesen, herbeigesegelt aus einer anderen Welt. »Nur ein Luftzug, und sie stürzen ab.«
»Aber wenn Sie das vorher schon wussten, Herr …«
»Alphonse.« Der kleine Mann verneigte sich so tief, dass es den Anschein hatte, sein Kopf berühre den Boden. »Alphonse Pénaud. Erfinder des Saal…« Was er dann sagte, schien ihm äußerst wichtig zu sein. Seine Augenlider flatterten vor Aufregung. »Nicht Sal wie die kleinere der Kapverdischen Inseln am nordöstlichen Rand des Archipels, und auch nicht Sall wie der zwanzig Kilometer lange Fluss in Baden Württemberg, sondern …«
»Saal wie der Saal …«
Die Lider senkten sich sanft wie ein Schmetterling, der seine Flügel ablegt, hoben sich wieder, und Alphonse’ tiefblaue Augen blickten sie erleichtert an. »Genau … wie der Saal … Ich habe das Saaaalflugzeug erfunden.«
»Und jetzt ist es abgestürzt.« Ein leises Bedauern lag nun auch in Milenas Stimme.
»Weil es nur in geschlossenen Räumen fliegen kann, draußen stürzen sie immer ab. Immer …«
Milena hätte den seltsamen kleinen Mann mit der Fliege gern gefragt, weshalb er sein Saaaalflugzeug von der Isarbrücke abheben ließ, wenn er schon vorher wusste, dass es nicht gutgehen würde. Doch er hatte jetzt etwas von der fast körperlosen Gestalt aus der Geschichte von der traurigen Traurigkeit. Auch er war durch und durch traurige Traurigkeit, verloren am staubigen Wegrand, gemieden von den Menschen, die sie mit Sätzen aus ihrem Leben verbannen wollten wie: »Das Leben ist heiter. Nur Schwächlinge weinen.« Die Traurigkeit hatte keinen Platz in einer Welt, in der nur Schwächlinge weinten und die aufgestauten Tränen fast die Köpfe sprengten. »Nur wer die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine Wunden wirklich heilen.« Auch das hatte die Mutter immer wieder zu ihr gesagt.
Der kleine Fliegefliegermann, Milena gab Menschen gern Namen, die zu ihnen passten, stand noch immer vor ihr. Bewegungslos. Über die plötzlich so starke Sehnsucht nach ihrer Mutter hatte sie ihn beinahe vergessen.
»Sie sehen traurig aus.« Er sprach aus, was sie zu ihm hatte sagen wollen.
»Das bin ich auch. Traurig und …«, sie wusste nicht, weshalb sie es ihm anvertraute, »… leer.«
»So als wäre alles aus Ihnen herausgesickert, wie Benzin aus einem lecken Flugzeugtank?« Zum ersten Mal kam Bewegung in ihn. Aber es war nur der Kopf, der sich leicht nach rechts neigte wie ein Vögelchen, das zwitschernd auf sich aufmerksam machte.
Milena nickte. »Ich habe das Gefühl, irgendwann stürze ich auch ab.«
»Was leer ist, muss man wieder füllen. Aber nicht mit Stroh.« Alphonse neigte den Kopf jetzt nach links, ließ sie nicht aus den Augen. Es war, als musterte er sie nicht nur von vorn, sondern von allen Seiten. Wie etwas, das er kaufen wollte, allerdings unbeschädigt und nicht zum halben Preis. Sie fühlte sich von ihm durchschaut.
»Natürlich nicht mit Stroh«, antwortete Milena. Merkwürdiger kleiner Mann. Er redete Unsinn, und er durchschaute sie auch nicht.
Sie wollte sich von ihm abwenden, doch da war etwas in seiner Stimme, die so freundlich war, die Stimme eines Freundes, was sie innehalten ließ. »Sie müssen halt suchen.«
Jetzt war er es, der sich von ihr abwandte.
Ihre Stimme klang jedoch nicht freundlich, sie war viel zu kühl. »Was soll ich suchen?«
Alphonse sah sie ratlos an: »Wieso reden Sie so mit mir?«
»Ich rede ganz normal mit Ihnen.«
»Nein, Sie reden wie viel zu lange eingefroren. Wenn Sie nicht aufpassen, tauen Sie nicht mehr auf.«
Wieder dieser Vögelchenblick. So harmlos. Er war nicht harmlos. Er konnte, wenn er wollte, ganz schön kräftig zupicken. Wie Jockl, der Wellensittich, den sie als Kind gehabt hatte. Einmal hatte sie sogar geblutet. Sie wollte nicht bluten. Außerdem war dieser Mann verrückt. Sie wandte sich erneut ab.
»Suchen Sie nach Gedanken! Überall, wo Sie nur können. Kennen Sie den Gedankenflohmarkt?«
Er hatte es erneut geschafft. Sie ging nicht, fühlte etwas in sich, das sie seit Wochen nicht mehr gefühlt hatte. Etwas, das stärker war als das Unbehagen, das verrückte Menschen in ihr auslösten. Zum ersten Mal interessierte sie etwas anderes als der Unmut darüber, dass das Tanzen vorbei und sie der unglücklichste Mensch der Welt war. »Gedankenflohmarkt?«
»Da sind die Gedanken noch ganz billig.« Alphonse’ Lider flatterten wieder. »Sie kosten wirklich nicht viel. Weil ein anderer sie schon mal gedacht hat und benutzt.«
»Benutzt.«
Alphonse nickte. »Neue Gedanken sind heute kaum noch zu kriegen, und sie sind teuer. Aber das macht nichts. Gedanken, die schon einmal gedacht worden sind, stürzen nicht ab.«
»Weil man schon ausprobiert hat, ob sie nur in geschlossenen Räumen fliegen können oder auch draußen.«
»Sehen Sie …« Alphonse strahlte, sogar seine exakt sitzende Fliege lachte sie an. »Sie denken meine Gedanken, und ich gebe sie Ihnen sogar umsonst.«
Was für eine eigenartige Situation. Nachdem sie sowohl beim Arbeitsamt als auch bei der Bank abgeblitzt war, stand sie auf Münchens sogenannter Selbstmordbrücke. Hinter ihr rasende Fahrradfahrer, neben ihr dahinschlendernde Fußgänger, über ihr donnernde Züge, unter ihr die gemächlich dahinfließende Isar und vor ihr Alphonse Pénaud, wobei sie bezweifelte, dass der jemals auch nur irgendetwas erfunden hatte. Der kleine Mann tickte nicht richtig, und allmählich steckte er sie damit an. Sie fühlte wieder etwas außer Angst und Hilflosigkeit. Das innere Vergnügen taute im Licht der Abendsonne auf. Gedankenflohmarkt! Sie fing tatsächlich schon an zu denken wie er. Egal. Denn endlich empfand sie wieder einen Hauch von Lebensfreude.
»Die Gefühle allerdings können Sie nicht auf dem Gedankenflohmarkt kaufen.« Natürlich, sie hatte seine Gedanken benutzt, deshalb konnte er sie auch lesen. »Ihre Gefühle müssen Sie schon selbst fühlen. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen.« Für den Bruchteil einer Sekunde hatte Milena den Eindruck, dass sich die Fliege mit seinen Mundwinkeln an beiden Enden nach unten neigte.
»Das müssen Sie auch nicht.«
»Gut.« Alphonse schien erleichtert. »Sehr gut. Und wenn Sie noch ganz viel Neues erleben, dann sind Sie innen drin wieder voll.«
Jetzt wollte sie es wissen. »Ich soll also die Gedanken von anderen Menschen denken, nach neuen Gefühlen und nach neuen Erlebnissen suchen, aber dann, lieber Alphonse, bin ich doch nicht mehr ich?«
»Sie sind ein neues Ich.« Er lächelte nachsichtig. »Das nennt man Veränderung.«
»Und alles, was vorher war?«
»Das ist«, er klopfte sich leicht auf den Hinterkopf, »die Erinnerung.«
»Danke, Alphonse.« Es wurde allmählich dunkel. »Ich muss nach Hause.«
»Ich habe kein Zuhause.« Er war wieder ganz traurige Traurigkeit.
»Wieso haben Sie kein Zuhause?«
»Sie schmeißen mich raus.« Tränen standen jetzt in seinen Augen. »Ich hab’s ja versucht. Ich hab gedacht, wenn es mein Flugzeug schafft, draußen zu fliegen, dann schaffe ich es auch.«
Das umgeworfene Grablicht, erloschen, die Gitter, die niemanden davon abhalten konnten, der wirklich springen wollte. Besonderer Augenblick an den Gittern, für immer eingraviert in einem einfachen Vorhängeschloss. Liebe unter Verschluss. Zusperren, absperren, das Glück einsperren, damit es einem nie wieder entkommt, und den Schlüssel in die Tiefe werfen, fort mit ihm in die Isar. Die Isar, die ihn mitnimmt an diesen güldenen Ort der weggeworfenen Schlüssel und eingesperrten Herzen.
Eingesperrtes Herz. Sie wollte gehen, aber sie durfte Alphonse nicht allein lassen. Das fühlte Milena in diesem Moment sehr deutlich. Vielleicht, weil sie tatsächlich seine Gedanken dachte und ahnte, dass er nicht nur des Flugversuchs wegen auf der Brücke stand. »Warum wollen sie Sie rauswerfen, Alphonse?«
»Die sagen, ich bin jetzt so weit.«
»Wer sagt das?«
»Die Leute aus dem Regenbogenhaus.«
»Regenbogenhaus?«
Offenbar sah sie gerade ein bisschen dämlich aus, denn Alphonse lächelte milde. »Ist nicht das, was Sie denken.« Er setzte sich in Bewegung. Er lief die Brücke entlang wie ein Walker, der unbedingt das Münchner Marathon-Walking gewinnen wollte. Milena beeilte sich, ihn einzuholen. Er war verdammt schnell. Sie legte zwischen dem Gehen ein paar Joggingschritte ein.
»Was denke ich denn?« Sie blieb stehen.
Alphonse jedoch ging weiter, und seine Stimme nahm einen leicht überheblichen Ton an: »Das Regenbogenhaus ist kein Haus im Regenbogen, natürlich nicht … Weil’s so was gar nicht gibt.«
Milena setzte sich wieder in Gang. Die Isarbrücke hatten sie längst hinter sich gelassen, tauchten jetzt, umgeben von Abendlicht, in den von hohen Bäumen beschatteten Fußgängerweg ein. Obwohl es ihr eigentlich gleichgültig sein konnte, was Alphonse über sie dachte, war Milena erleichtert, dass er nicht einmal ahnte, was tatsächlich in ihr vorging. Ihr Leben gehörte von nun an dem Schicksal. Ihre Gedanken aber sollten gefälligst bei ihr bleiben.
»Man kann in einem Regenbogen kein Haus bauen«, fuhr Alphonse fort, wobei seine Stimme denselben Tonfall annahm wie die ihres Physiklehrers vor wer weiß wie vielen Jahren. Wie im Halbschlaf ratterte er herunter: »Der Regenbogen ist ein atmosphärisch-optisches Phänomen, das als kreisbogenförmiges, farbiges Lichtband in einer von der Sonne beschienenen Regenwand oder Regenwolke wahrgenommen wird. Sein radialer Farbverlauf zeigt Ähnlichkeiten mit den Spektralfarben. Jeder der annähernd kugelförmigen Regentropfen bricht das Sonnenlicht beim Ein- und beim Austritt und reflektiert es innen an seiner Rückwand …«
Milena ließ Alphonse dozieren und lief weiter, immer exakt einen Schritt hinter ihm her. Sie hatten die Menterschwaige erreicht. Münchens Liebling am Isarhochufer. Der Geruch von Hendl, Steckerlfisch und Grillfleisch. Ein zweites Wohnzimmer unter riesigen Kastanien. Bierbank-Feeling und ein fröhliches Prost vom und zum Nachbarn. Kindergeschrei und Erwachsenenlachen. Milena wäre gern dabei gewesen, doch sie war völlig mittellos und offenbar dazu bestimmt, einem heimatlosen Saalflugzeugerfinder, der Wikipedia auswendig aufsagen konnte, hinterherzudackeln.
Bisher hatte Alphonse kaum Luft geholt. Jetzt atmete er tief durch. »Nun ist Ihnen hoffentlich klar, warum man im Regenbogen kein Haus bauen kann.«
Milenas Blick ging hilfesuchend zum Himmel. »Für mich war der Regenbogen immer ein Band aus Licht und Farben«, antwortete sie schließlich, »mit dem der liebe Gott den Himmel schön eingepackt hat wie ein Geschenk …«
Alphonse lachte. Noch nie hatte Milena einen Menschen so herzlich lachen hören. »Der Himmel ein Geschenk, verpackt in den Regenbogen. So ein Blödsinn.«
War Milena knapp davor gewesen, mitzulachen, wurde sie jetzt wütend. Alphonse war derjenige, der Unsinn redete, und dennoch hatte sie nicht über ihn gelacht. Sie hatte Respekt vor Menschen. »Andererseits«, er wurde wieder ernst, »ist der Himmel ein Geschenk. Denn ohne Himmel … Das wäre wie ohne Dach über dem Kopf und wie …« Er brach ab, sah zum Himmel und verlor sich offenbar für einen Augenblick in die Vorstellung, wie die Welt ohne Himmel aussehen würde. Er kam zu einem Entschluss. »… wie ohne Ende in Sicht.«
Den Eindruck hatte Milena auch. Wenn sie und Alphonse so weitermachten, war auch kein Ende in Sicht. Sie sah sich schon unter der Isarbrücke schlafen, was in naher Zukunft ja durchaus der Fall sein konnte.
»Gehen wir?«, forderte sie Alphonse sanft auf.
»Wohin?«
»Nach Hause.«
»Das Regenbogenhaus ist doch kein Zuhause!« Er sah sie empört an.
Milena war ratlos, wollte ihn aber verstehen. Auch um ihn nicht bei der Polizei abliefern zu müssen. »Was ist es dann? Eine Illusion?«
Alphonse sah sie an, und seine Augen waren mit einem Mal seltsam klar. »Genau, das ist es. Eine Illusion, in der man drin wohnen kann, bis man rausgeschmissen wird.«
Mit diesen Worten waren sie wieder am Anfang.
Gingen aber Schritt für Schritt weiter.
Alphonse im Walking-Wackelgang.
Milena im gelegentlichen Joggingschritt.
3
Das Regenbogenhaus. Es war kein Haus, errichtet in den sanften Farben des Regenbogens, entstanden aus Träumen, wie ein Gedicht behauptete. Natürlich war es das nicht, aber es war auch keine Illusion, keine Fata Morgana im Niemandsland. Es stand aufrecht und durchaus beeindruckend am Rand eines Parks, der in der Dunkelheit aussah wie ein schwarzes, zufällig vom Himmel gefallenes Tuch. Die Wirkung, die das Haus auf Milena hatte, war das Besondere an ihm.
Vielleicht lag es an den wie zufällig dahingestreuten Laternen, die den Weg zum Regenbogenhaus säumten, an den vielen hell erleuchteten Fenstern, wie Wegweiser durch die Nacht, oder nur an diesem klaren, aus sich heraus strahlenden, so vollkommen gerundeten Mond. Es war Vollmond. Und Milena wäre nicht erstaunt gewesen, hätte sich jetzt die Silhouette eines heulenden Wolfes vor den Mond geschoben.
»Das Haus ist wie das Glaskugelhaus. Kennen Sie das Glaskugelhaus?«
Milena zögerte. Viel wusste sie noch nicht von Alphonse, außer, dass er eine Frage nie einfach so stellte. Im Gegensatz zu anderen schien er sich etwas dabei zu denken. »Nein, tut mir leid …«
»Sie wissen nicht, was das ist?« Alphonse sah sie mitfühlend an. »Dieses kleine Haus in einer Glaskugel? Dreht man sie um, dann schneit es?«
»Das kenne ich schon. Natürlich. Ich hab so was mal zu Weihnachten gekriegt. Kein Haus, aber einen kleinen Engel.«
Tiefe Erleichterung. Alphonse atmete durch. Offensichtlich gehörte Milena doch nicht zu den verlorenen Wesen, die ohne das Wissen um Glaskugelhäuser und Glaskugelengel durchs Leben gehen mussten. Was allerdings grundsätzlich hinter seiner Frage steckte, war Milena nicht klar. »Und was hat das Regenbogenhaus mit dem Glaskugelhaus zu tun?«
»Man kann es nicht umdrehen. Wir sind nicht stark genug dafür.« Alphonse warf Milena einen Blick zu, als sei sie allein für zumindest diese menschliche Schwäche verantwortlich.
»Und wenn man es umdrehen könnte?«
»Dann wären alle, die darin wohnen, nicht falsch, sondern richtig herum.«
Milena verstand Alphonse immer weniger, beließ es aber dabei. Sie war müde, wollte in ihre Wohnung und nur sichergehen, dass Alphonse in dieser Nacht keine Dummheiten mehr machte. Damit allerdings war die Sache für sie erledigt. Sie hatte andere Sorgen.
»Komm!« Während Milena noch darüber grübelte, wann und vor allem wie sie sich dieser seltsamen Situation entziehen konnte, nahm Alphonse sie einfach an die Hand. Alphonse, der Saalflugzeugerbauer, Fliegenträger, Wikipediaauswendiglerner, Gedankenleser und verhinderter Weltumdreher. Milena ließ es zu. Hand in Hand näherten sie sich dem Regenbogenhaus, dessen Wirkung mit jedem Schritt stärker wurde. Es zog sie in seinen Bann.
Am Ende des Regenbogens liegt das Niemandsland. Das alte Kindergedicht fiel ihr wieder ein. Ein Land, in dem niemals Krieg stattfand. Ein Land, in dem sich alle lieben. Das ist seit Millionen Jahren so geblieben. Dorthin wandern alle Seelen, die sich auf der Erde quälen. Dort finden alle Seelen Ruh. An der Stelle wusste sie nicht mehr weiter. Erst wieder: Lächelnde Paare, die im Gras liegen. Alte Frauen, die Babys im Arm wiegen. Babys im Arm. Wiegen … Das Bild fraß sich in ihr fest … wiegen … wiegen … Keiner ist hier mehr allein … Nicht mehr allein. Nie mehr allein … Kleine Fingerchen, die sich an ihrem Blusenkragen festklammern. Weg damit, weg, geh auf Reisen in eine andere Wirklichkeit … geh, geh, geh … tanz!
Ihre Kehle wurde eng. Atemnot. Was war heute nur mit ihr los? Sie zerrte an Alphonse’ Hand. Das hier war falsch. Sie musste sich umdrehen, damit es wieder richtig war. Sie wollte weg. Alphonse’ Hand aber entwickelte eine enorme Kraft. Sie kam nicht los. »Sie sind auf einmal so weiß!« Alphonse sah sie besorgt an. »Wie der Schnee … nicht so schmutzig wie in der Stadt, sondern weiß wie frisch gefallen im Wald.«
Sein warmer Blick, seine Hand, so fest und seltsam vertraut, Milena wusste nicht, was sie beruhigte. Doch ihr Herzschlag wurde ruhig. In diesem Moment hätte sie sich hineinschmiegen können in diesen eigenartigen kleinen Mann.
Sie gingen weiter. Hand in Hand kamen sie vor dem Regenbogenhaus an. Im Grunde war es eine Villa im Jugendstil, mit Pippi-Langstrumpf-Veranda, nur der »kleine Onkel« fehlte, Pippis Pferd, nicht aber der Schaukelstuhl, in dem eine grauhaarige Frau saß und mit flinken, sehr flinken Fingern und vielen Stricknadeln strickte.
»Hallo, Alphonse.« Sie lächelte Alphonse an, wobei Milena bemerkte, dass ihr oben rechts ein Zahn fehlte.
»Lisa, hallo.« Alphonse lächelte nicht. Schob Milena an der grauhaarigen Frau vorbei.
»Ich war heute mit meiner Tochter und meinen Enkeln spazieren, Alphonse.« Lisa lächelte weiter.
»Schön!« Sie hatten die Terrassentür fast erreicht. Milena warf einen Blick in den großen Raum hinter der Tür. Er hatte etwas von einem Speisesaal. Ein großer schwerer Lüster an der Decke, fünf Tische, ein Regal mit unzähligen Fächern.
»Ich glaube, wir wurden beschattet«, fuhr Lisa lächelnd, mit den klappernden Stricknadeln vor sich hin strickend, fort.
Alphonse verdrehte die Augen. »Von einem Sonnenschirm, unter dem ihr dann Kaffee getrunken habt?«
»Natürlich nicht.« Die Frau lächelte wieder und strickte weiter. »Von einem Mann. Er hat jedes Mal anders ausgesehen.«
Milena sah Alphonse verblüfft an. Alphonse winkte ab, das alles kannte er offenbar schon, hielt Milena die Tür auf, und – Milena stand vor einem Kaktus, der sich mitten im Speisesaal vor ihr aufbaute. Allerdings war es ein Kaktus auf zwei Beinen. Jetzt schob sich der Kaktus ein wenig zur Seite, und ein Männergesicht kam zum Vorschein. Eine sehr gerade römische Nase, dunkle Augen unter schön geschwungenen Brauen. Das restliche Gesicht war überwuchert von etwas, das sich zurechtgestutzt wohl Bart genannt hätte. Der Mann drückte den Kaktus fest an sich, sah Milena an, wobei die Augen völlig ausdruckslos blieben.
»Dass ich nicht abkratze«, begann er, ohne Milena aus den Augen zu lassen. »Offiziell halt, daraus habe ich Unterstellungen entwickelt, dass ich einfach … so viel, ja, das ist so Ballast, dass ich … also keinen freien Schritt habe …«
Milena klammerte sich unwillkürlich an Alphonse’ Hand. Alphonse drückte sie kurz und lächelte: »Christopher nimmt wieder mal seine Medikamente nicht.«
Er schob Milena wie selbstverständlich weiter, und Christopher sah ihnen nach. Mit Kaktus, alter Jogginghose, die zu tief in seinen Hüften hing, und Christuslatschen. Milena hatte sich noch nicht erholt – von der strickenden Lisa, die beschattet wurde, jedes Mal von einem anderen Mann, gelegentlich auch einer Frau, und Christopher, der keinen freien Schritt hatte –, als noch ein Mann vor ihr stand.
Er trug Jeans, ein Sweatshirt, das dunkle, leicht krause und mit grauen Strähnen durchzogene Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Am auffälligsten waren seine Augen. Ganz klare, tiefblaue Augen, die sich unverwandt auf sie richteten, während er mit Alphonse sprach.
»Du kannst nicht einfach Leute mit herschleppen, die eine Bleibe brauchen, Alphonse.« Milena mochte Männer mit tiefen Stimmen und blauen Augen. »Du weißt, das muss übers Amt gehen, und wir sind voll.«
»Ich brauche keine Bleibe«, versicherte Milena ihm hastig.
»Dann sind Sie gut untergebracht?«
»Wie kommen Sie darauf, dass ich untergebracht werden muss?«
»Ich habe Sie heute vor der Arbeitsagentur Cancan tanzen sehen.«
Milena saß im Bus und fuhr durch die Münchner Nacht. Sie fuhr selten Bus. Liebte aber diesen Moment, wenn sie im Licht saß und um sie herum alles dunkel war. Sie war gern im Licht. Ein Bühnenmensch. Der sich alles vom Leben nahm, auch auf Kosten anderer, es sich nehmen musste, um dahin zu kommen, wohin er wollte. Allerdings nicht ungestraft. Denn offenbar holte sich das Leben irgendwann alles wieder zurück.
Was für ein Tag. Keine Arbeit. Kein Geld. Und als Krönung – eine therapeutische Wohngemeinschaft für psychisch erkrankte Menschen.
»Wenn wir stark genug wären, könnten wir das Haus auf den Kopf stellen, und alles, was darin falsch ist, wäre richtig herum.« Milena hatte verstanden, was Alphonse ihr damit hatte sagen wollen.