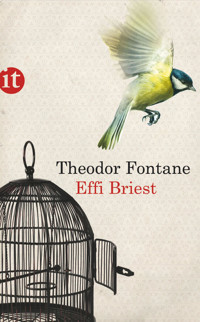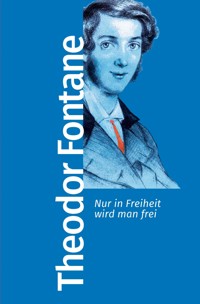
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiwi Bibliothek
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten
- Sprache: Deutsch
Vor der »Weltliteratur« kam die Revolution - Theodor Fontanes frühe politische Texte Dass Theodor Fontane heute den bekanntesten Schriftsteller*innen zuzuordnen ist, war zu seinen Lebzeiten lange nicht absehbar. Seine Hauptwerke, etwa »Irrungen und Wirrungen«, »Effi Briest« oder »Der Stechlin«, die ihn zu einem der bedeutendsten Vertreter des literarischen, poetischen "Realismus« machen, sind allesamt erst in späteren Lebensjahren entstanden. Viel weniger bekannt ist der junge, der »politische« Fontane, dessen frühe Texte hier erstmals versammelt werden. Im Revolutionsjahr 1848 ist er ein glühender Vertreter der durch die Februar-Revolution in Paris auch in Deutschland enorm an Auftrieb gewinnenden demokratischen Kräfte. Überall in den deutschen Ländern gärt es, natürlich auch in Berlin, wo der 29-jährige inzwischen als Angestellter in der Apotheke »Zum schwarzen Adler« am Georgenkirchplatz arbeitet. Mehr taumelnd als zielgerichtet gerät er in die am 18. März des Jahres ausbrechenden Gefechte und Barrikadenkämpfe. Im autobiografischen Eingangstext des zweiten Bandes der »Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten« schildert Fontane seine Erlebnisse der Revolution. Erstmals sind hier auch seine radikaldemokratischen Artikel aus den Jahren 1848 bis 1850, die er für die »Berliner Zeitungshalle« und als »Berlinkorrespondent« für die »Dresdner Zeitung« schrieb, sowie seine politische Korrespondenz versammelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Edition PaulskircheTheodor Fontane
Nur in Freiheit wird man freiMit einem Vorwort von Iwan-Michelangelo D’AprileHerausgegeben von: Jörg Bong, Ina Hartwig, Helge Malchow, Nils Minkmar, Walid Nakschbandi und Marina Weisband
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Edition Paulskirche
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Edition Paulskirche
Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten
Herausgegeben von: Jörg Bong, Ina Hartwig,Helge Malchow, Nils Minkmar, Walid Nakschbandi und Marina Weisband
Idee und Konzeption: Jörg Bong
Projektleitung und Redaktion: Rüdiger Dammann
Gestaltung: Kurt Blank-Markard
In Kooperation mit:
In der Buchreihe »Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten« werden erstmals die Schriften, Biografien, Gedanken und Geschichten der frühen Demokrat*innen versammelt und gewürdigt. Im Zentrum stehen die beiden Revolutionsjahre 1848/1849. Die ersten 5 von 16 Bänden erscheinen im Frühjahr 2023. Die einzigartige Bibliothek ist eine offizielle Kooperation mit der Paulskirchen-Stadt Frankfurt am Main.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Dass Theodor Fontane heute den bekanntesten Schriftsteller*innen zuzuordnen ist, war zu seinen Lebzeiten lange nicht absehbar. Seine Hauptwerke, etwa »Irrungen und Wirrungen«, »Effi Briest« oder »Der Stechlin«, die ihn zu einem der bedeutendsten Vertreter des literarischen, poetischen „Realismus« machen, sind allesamt erst in späteren Lebensjahren entstanden.
Viel weniger bekannt ist der junge, der »politische« Fontane, dessen frühe Texte hier erstmals versammelt werden. Im Revolutionsjahr 1848 ist er ein glühender Vertreter der durch die Februar-Revolution in Paris auch in Deutschland enorm an Auftrieb gewinnenden demokratischen Kräfte. Überall in den deutschen Ländern gärt es, natürlich auch in Berlin, wo der 29-jährige inzwischen als Angestellter in der Apotheke »Zum schwarzen Adler« am Georgenkirchplatz arbeitet.
Mehr taumelnd als zielgerichtet gerät er in die am 18. März des Jahres ausbrechenden Gefechte und Barrikadenkämpfe. Im autobiografischen Eingangstext des zweiten Bandes der »Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten« schildert Fontane seine Erlebnisse der Revolution. Erstmals sind hier auch seine radikaldemokratischen Artikel aus den Jahren 1848 bis 1850, die er für die »Berliner Zeitungshalle« und als »Berlinkorrespondent« für die »Dresdner Zeitung« schrieb, sowie seine politische Korrespondenz versammelt.
Theodor Fontane (1819–1898) schrieb mit »Irrungen und Wirrungen«, »Effi Briest« oder »Der Stechlin« einst Werke, die zur Weltliteratur geworden sind, und gilt als bedeutendster Vertreter des literarischen »Realismus«. In jungen Jahren war er Teil der Märzrevolution 1848 in Berlin und publizierte radikaldemokratische Artikel.
Iwan-Michelangelo D'Aprile, geboren 1968, ist ein deutscher Historiker und Literaturwissenschaftler. Seit 2015 hat er an der Universität Potsdam die Professur für Kulturen der Aufklärung.
Inhaltsverzeichnis
»Bäcker Roesike statt Humboldt« Theodor Fontane, die Revolution und die Demokratie
Freiheitserwachen
Der achtzehnte März
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel (leicht gekürzt)
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Artikel in der »Berliner Zeitungshalle« (1848)
Artikel in der »Dresdner Zeitung« (1848–1850)
Briefe
Anhang
Biografische Notiz
Editorische Notiz
Quellen
»Bäcker Roesike statt Humboldt« Theodor Fontane, die Revolution und die Demokratie
Vorwort von Iwan Michelangelo D’Aprile
Als im Oktober 1896 in der internationalen Literaturzeitschrift Cosmopolis die Erinnerungen des 76-jährigen Theodor Fontane an die 1848er Revolution erschienen, die dann auch in seine Autobiografie Von Zwanzig bis Dreißig eingegangen sind, fanden sich im selben Jahrgang der Zeitschrift auch die Revolutionserinnerungen eines seiner alten Freunde aus der vormärzlichen Jugend. Mit dem inzwischen weltweit bekannten und hoch angesehenen Oxforder Orientalistik-Professor Max Müller war Fontane in den frühen 1840er Jahren im demokratischen Leipziger Literaturverein »Herwegh Klub« aktiv gewesen, bevor sich mit der Revolution ihre Wege trennten und Müller wie so viele andere ins englische Exil gegangen war. In seinem Beitrag für Cosmopolis kommt Müller auch auf den alten Leipziger Freund Fontane zu sprechen. Er erinnert sich an ihn als einen humorvollen und vielversprechenden jungen Autor (»He was a charming character, a man of great gifts, full of high spirits and inexhaustible good humour«). Allerdings hätte der seinerzeitige Apothekergehilfe in seinem Leben zu viele Existenzkämpfe um das tägliche Einkommen austragen müssen, sonst hätte aus ihm ein zweiter Heine werden können (»He might have been another Heine«).[1]
Anders als Heinrich Heine, Georg Herwegh, Ferdinand Freiligrath, Louise Otto Peters, Mathilde Anneke, Louise Aston, Fanny Lewald und viele andere wird Theodor Fontane heute in der Regel nicht zu den literarischen Revolutionsheld:innen gezählt. Zu gebrochen erscheint sein Verhältnis zur Revolution, zu widersprüchlich seine politische Position, zu wechselhaft seine Autorenbiografie. Revolutionäres Engagement und gesellschaftskritische Romane stehen neben dem jahrzehntelangen Pressedienst für regierungsnahe und gegenrevolutionäre Zeitungen sowie dem entsprechenden Preußen-Schrifttum. Hinzu kam ein, auch familiär bedingtes strukturkonservatives und staatsfrommes Umfeld (hugenottische Kirche, Adelskreise), das als Auffangnetz bei der Stellen- und Wohnungssuche sowie als Infrastruktur für literarische Großprojekte wie die Wanderungen durch die Mark Brandenburg zum Tragen kam. Was Fontane selbst als ständigen »Eiertanz zwischen allen Stühlen« beschrieben hat, wurde ihm in der Folge als fehlende politische Zuverlässigkeit ausgelegt – ein Vorwurf, der im Übrigen interessanterweise zuerst in den 1850er Jahren von seinen Vorgesetzten bei der preußischen Pressestelle gegen ihn erhoben wurde. Thomas Manns »unsicherer Kantonist« ist ebenso fest ins gängige Fontane-Bild eingegangen, wie das notorische »Einerseits und Andererseits«, das dessen Habitus kennzeichne. Die einen monieren seine mangelnde theoretische Durchdringung (er »hätte nur in eine Buchhandlung gehen und sich die Schriften von Marx und Engels kaufen müssen«, beklagte etwa Georg Lukács[2]). Die anderen tun sein revolutionäres Engagement als bloße Jugendverirrung ab (Fontane war 1848 immerhin knapp 30 Jahre alt), bevor er schnell auf die richtige – d.h. in dieser Sicht, konservativ-preußische – Bahn gekommen sei. Die ironisch-humoristische Darstellung der Revolution in Fontanes Autobiografie deuten sie zur sozusagen letztgültigen Absage des Autors an die eigenen jugendlichen Verfehlungen um.
Weit weniger präsent ist, in welchem Ausmaß Fontane in bedeutenden frühdemokratischen Vereinen, Gruppierungen und Periodika aktiv war, wie sehr er sich während der Revolution engagierte und wie zentral das Revolutionsthema für sein literarisches Werk noch über 1848 hinaus blieb. Dies manifestiert sich in einem umfassenden – hier nur in Auszügen abgedruckten – Textkorpus, das von Gedichten, Dramenentwürfen, Übersetzungen und literaturhistorischen Abhandlungen bis hin zu Leitartikeln, Zeitungskorrespondenzen und zahlreichen Briefen reicht. Das Meiste davon wurde zu Fontanes Lebzeiten nicht publiziert (zumeist wegen Absagen der Verleger an den seinerzeit noch unbekannten Autor), vieles blieb Entwurf oder findet sich nur im nicht-öffentlichen Medium der Privatkorrespondenz.
Fontanes literarische Laufbahn begann während seiner Apothekengehilfen-Jahre in Leipzig in den Kreisen um die wichtigste deutsche radikaldemokratische Burschenschaft »Kochei« von Robert Blum und Hermann Kriege. Im zugehörigen »Herwegh-Klub« sowie der von Robert Binder und Robert Blums Schwager und späteren Paulskirchenabgeordneten Georg Günther herausgegebenen Literaturzeitung Die Eisenbahn schrieb und veröffentlichte Fontane seine ersten Gedichte, aber auch zahlreiche Übersetzungen frühsozialistischer britischer Arbeiterdichtung.
Darunter finden sich Anklagen gegen die als versteinert dargestellten politischen Verhältnisse der Restaurationszeit (Mönch und Ritter, 1841) ebenso wie gegen den preußischen Militarismus. In den Zwei Liedern vom Lederriem (1841/42, unveröff.) wird etwa das spätere Niederschießen der eigenen Bevölkerung durch die preußische Armee während der Revolution schon literarisch vorweggenommen. Aus der Sicht der preußischen Soldaten heißt es hier: »Und wenn einst der Pöbel die Kette zerbricht, / Ob Vater, ob Bruder, das kümmert uns nicht, / Wir stürmen hinein in die feindlichen Glieder / Und stoßen und schlagen und schießen sie nieder.«[3]
Als komplementäre Kehrseite dieser militaristischen Gewaltverhältnisse wird von Fontane im Gedichtduett Zwei Liberale (1842) mindestens ebenso scharf ein bourgeoiser Liberalismus kritisiert, der sich mit diesen Verhältnissen arrangiert – sei es aus Furcht vor der Polizei (Die Faust in der Tasche), sei es aus Dünkel gegenüber den ebenfalls Freiheitsrechte einfordernden kleinbürgerlichen und proletarischen Klassen wie in Der Befriedigte. Hier wird ein bequemer Bourgeois vorgeführt, der seine Freiheit schon realisiert sieht, wenn er seine Leipziger Zeitung lesen, die Marseillaise pfeifen und sich Karl Rottecks Staatslexikon anschaffen kann, während er sich über weitergehende Forderungen des vermeintlichen Mobs mokiert: »Freiheitseifer, voller Geifer, / Tobt jetzt wie ein Marodeur, / Freiheit will der Scherenschleifer / Wie der Schneider und Friseur.«[4]
In den Frühlingsliedern (1842, unter »Freiheitserwachen« als Auszug in diesem Band) schließlich wird ausgehend von der in Herwegh’schen und Heine’schen Motiven gezeichneten Eiszeit der Restauration (»Und sieht die Fürsten weiter spinnen / An unsrer Freiheit Leichentuch«) die Hoffnung auf revolutionären Widerstand unmittelbar zum Ausdruck gebracht: »Und einmal nur das Schwert genommen, / Das gute Schwert in unsre Hand, / Dann muss der Lenz der Freiheit kommen / Und segnen unser Vaterland.«
An der 1848er Revolution war Fontane dann von den ersten Unruhen in Berlin im Frühjahr 1848 bis zu den letzten Freischärler-Aufgeboten auf längst verlorenem Posten in Schleswig-Holstein im Sommer 1850 in allen Phasen aktiv beteiligt: als Barrikadenkämpfer des 18. März, als Wahlmann für das erste deutsche Parlament der Frankfurter Paulskirche und als Journalist bei zwei der prominentesten frühdemokratischen Zeitungen.
Die Leipziger Herwegh-Klub-Gefährten Hermann Kriege und Georg Günther druckten von August bis November 1848 in der von ihnen im Auftrag des »Zentralausschusses der Demokraten Deutschlands« herausgegebenen Berliner Zeitungshalle politische Kommentare und Leitartikel Fontanes ab (in diesem Band enthalten). Gleich mit seinem ersten in der Zeitungshalle veröffentlichten Artikel erzielte Fontane einen journalistischen Achtungserfolg, als er unter dem Titel Preußens Zukunft kurzerhand die Selbstauflösung Preußens als unabdingbare Voraussetzung für die Gründung eines deutschen Nationalstaats diagnostizierte. Da der preußische Staat seit seiner Gründung untrennbar mit der absolutistischen Staatsform der Hohenzollern-Monarchie verbandelt und auch seither ein Staat ohne Nation geblieben sei, sei er mit einer Republikanisierung Deutschlands nicht kompatibel: »Diese Auferstehung Deutschlands wird schwere Opfer kosten. Das schwerste unter allen bringt Preußen. Es stirbt. Jeder andere Staat kann und mag in Deutschland aufgehen; gerade Preußen muss darin untergehen. […] Preußen war eine Lüge, das Licht der Wahrheit bricht an und gibt der Lüge den Tod.« Die Alternative sei, wie Fontane in einem Folgeartikel – im historischen Rückblick hellsichtig – prognostizierte, lediglich eine Einheit ohne Freiheit.
Der bis dahin einer breiteren Öffentlichkeit noch völlig unbekannte Autor erlangte mit diesen Thesen nicht nur die Aufmerksamkeit von mehreren deutschen Zeitschriften außerhalb Berlins, die seinen Artikel nachdruckten, sondern erstmals auch von erfahrenen politischen Profis und Diplomaten wie Karl August Varnhagen von Ense. »Ein kleiner, trefflich geschriebener Aufsatz in der ›Zeitungshalle‹ hier, von Th. Fontane unterschrieben, sagt geradezu, Preußen stirbt, und muss sterben, es soll seinen Tod sogar eigenhändig vollziehen! Dies hat mich sehr ergriffen. Es ist viel Wahres darin«, notierte Varnhagen in seinen Tagebüchern.[5] In diese Zeit fällt auch der Plan des renommierten Schriftstellerinnen-Kritiker-Paars Fanny Lewald und Adolph Stahr, einen großen Revolutionsroman zu schreiben – mit Theodor Fontane in der Hauptrolle als republikanischer Held auf der Barrikade.
Im Herbst 1849, als in Preußen die Pressefreiheit längst wieder eingeschränkt worden war, vermittelte Fontanes ebenfalls seit Leipziger »Herwegh-Klub«-Tagen verbundener Jugendfreund Wilhelm Wolfsohn ihm einen Posten als Berlin-Korrespondent der Dresdener Zeitung, dem Organ der sächsischen demokratischen Fortschrittspartei. In seinen zwischen November 1849 und Mai 1850 erschienenen rund 40 Korrespondentenberichten bietet Fontane in einer Mischung aus Reportage, Analyse und Kommentar zeitnahe Informationen und Hintergründe zur gegenrevolutionären Reaktion in Berlin, die sich nun in Polizeiwillkür, Verleumdungskampagnen, politischen Prozessen und gezielten Provokationen manifestiert. »Das Polizeiregiment ist in Blüte. Auflösungen demokratischer Vereine und Ausweisungen missliebiger Persönlichkeiten sind Parole und Losung. […] Es ist eine Schande«, heißt es gleich in Fontanes erstem Korrespondentenbericht (in diesem Band enthalten).
Entgegen der offiziellen Propaganda, wonach man lediglich mit notwendigen Maßnahmen auf revolutionären Terror, Schrecken und Gewalt reagiere, gingen diese nach Fontane vor allem von der Regierung und interessierten Adels-Kreisen um die Kreuzzeitung aus. Als »Vogelscheuche des Kommunismus und der Anarchie« bezeichnet Fontane hingegen die Versuche der Regierung, im Bürgertum die Angst vor der Demokratisierung zu schüren. Während die Bevölkerung aus den 48er März-Ereignissen gelernt habe und sich trotz aller offenen Gewaltakte nicht zu den »von der Reaktion […] herbeigefleht[en]« Ausschreitungen provozieren ließ, erscheint die Rolle der von Otto von Manteuffel geleiteten, eigentlich für Ruhe und Ordnung zuständigen Polizei pervertiert: »Nicht die kleinste Ruhestörung ist den Anstrengungen der Polizei gestern gelungen«, stellt Fontane zum zweiten Jahrestag der Berliner März-Revolution fest. Ironisch verkehrt sind hier die Verhältnisse, nicht Fontanes Satz.
Abgleichen lassen sich Fontanes Korrespondentenberichte der Revolutionsjahre mit seinem privaten Briefwechsel dieser Zeit. Zunehmenden Spannungen war besonders die Freundschaft zu Bernhard von Lepel ausgesetzt. Auch bedingt durch seine Stellung als Gardeoffizier beharrte Lepel auf einem monarchistisch-legitimistischen Standpunkt und verteidigte den Einsatz der Armee zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. Sarkastisch rechnet ihm Fontane daraufhin die Verbrechen des preußischen Militärs bei der Niederschlagung der Revolutionen in Südwestdeutschland und in den März-Tagen in Berlin vor: »Denke an Mainz und die abgehackten Hände ertrinkender Knaben, […] denk an die Schüsse, die man gegen verwundete und geknebelte Gefangene [beim Transport nach Spandau] richtete, […] – an das herrliche Benehmen der Gardemänner gegen todesmutige Freischärler und sage mir dann noch ›Charakter und Bravheit stecken in der Armee wie nirgends‹. Ja, Charakter steckt drin, aber welcher!« Zugleich aber diskutiert Fontane mit Lepel auch sein zu dieser Zeit geplantes literarisches Hauptwerk: ein Drama über die englische Revolution von 1648/49 und die Rolle des damaligen Königs Karl Stuart, in dem Fontane unübersehbare Parallelen zur aktuellen Situation in Preußen zieht. Fontanes Revolutionsdrama blieb unvollendet und ist nur in den ersten Szenen überliefert. Es zeigt aber, wie sehr ihn das Revolutionsthema in dieser Zeit auch literarisch beschäftigt hat (vgl. Briefe 1–6).
Hintergrundinformationen zu Fontanes Korrespondententätigkeit für die Dresdener Zeitung lassen sich seinem Briefwechsel mit Wilhelm Wolfsohn ablesen. So wurde von der Redaktion im Dezember 1849 ein Artikel Fontanes abgelehnt, in dem dieser das Preußen der Aufklärung unter Friedrich II. zum Rechtsstaat stilisiert, um es der Polizei- und Willkürherrschaft seiner eigenen Gegenwart entgegenzustellen – für eine sächsische Zeitung und ihr Publikum, die alles andere als Aufklärung mit Friedrich II. verbanden, erschien dies nicht passend (vgl. Brief 8). Hier scheinen Spannungsverhältnisse zwischen den unterschiedlichen deutschen Partialnationalismen ebenso auf wie Fontanes ambivalente Haltung zu Preußen. Daraus eine Abkehr Fontanes von seinen demokratischen Prinzipien zu konstruieren, wäre aber verfehlt. Nicht nur war es unter deutschen Republikanern ein zeittypisches Argumentationsmuster, das Preußen der Aufklärung zum Gegenbild zur konservativen Reaktionspolitik unter Friedrich Wilhelm IV zu stilisieren: Karl Friedrich Köppen etwa widmete seine »Jubelschrift« Friedrich der Große und seine Widersacher auf dem Titelblatt seinem »Freunde Karl Heinrich Marx aus Trier«; Ferdinand Freiligrath dichtete in Balladen wie Im Himmel Friedrich den Großen zum Begründer des Republikanismus um. Vor allem aber hat Fontane für die Dresdener Zeitung nach diesem zwischenzeitlichen Konflikt weitaus mehr Korrespondenzberichte geschrieben als zuvor.
Nicht zuletzt verdeutlicht der Briefwechsel mit Lepel und Wolfsohn den quälenden Prozess, in dem Fontane sich angesichts der Niederschlagung der letzten revolutionären Bewegungen durch die preußische Obrigkeit beziehungsweise die von den alten Wiener Ordnungsmächten unterstützten dänischen Truppen in Schleswig-Holstein sowie der eigenen immer bedrückenderen materiellen Not im Spätsommer 1850 schließlich als Pressearbeiter im regierungsamtlichen »Literarischen Bureau« anwerben ließ. Vorangegangen waren dem vergebliche Bewerbungen des mittellosen Apothekers u.a. als Gartenbausekretär, Hilfsbibliothekar oder Eisenbahnschaffner. Um ein Haar wäre Fontane auch den Weg zehntausender anderer deutscher Achtundvierziger ins Exil gegangen. Lepel teilte er im Mai 1849 mit: »In spätestens 8 Wochen denk’ ich auf dem Weg nach New-York zu sein«, bevor er diese Pläne dann Ende 1849 doch noch verwarf (vgl. Brief 7). Fontanes nachrevolutionärer Eintritt in den Regierungsjournalismus, daran lassen die zeitgenössischen Zeugnisse keinen Zweifel, hatte viele Ursachen und war zuallererst durch materielle Not sowie die Abwägung von Berufs- und Subsistenzmöglichkeiten begründet – aber er war alles andere als eine politische Konversion, bei der Fontane mit fliegenden Fahnen und voller Überzeugung die Seiten gewechselt hätte.
Erst von den Zeugnissen der Revolutionszeit aus – und im Wissen um die historischen und biografischen Entwicklungen, die in den 50 Jahren zwischen Ereignis und Erinnerung liegen – lässt sich Fontanes autobiografischer Altersrückblick in Von Zwanzig bis Dreißig angemessen verstehen (das Kapitel »Der achtzehnte März« ist hier in leicht gekürzter Form abgedruckt): nicht als historische Tatsachendarstellung, sondern als vielfach stilisierte Literarisierung voller Auslassungen, Umdeutungen und Anspielungen. Zugleich aber werden so durchaus auch Kontinuitäten erkennbar, die den politischen Fontane jenseits aller Seitenwechsel, Widersprüche und Urteilsenthaltungen kennzeichnen. Nicht lässt sich Fontane im parteipolitischen Sinn auf eine Richtung festlegen – und dies schon gar nicht jenseits der sich während seines Lebens rasant wandelnden Kontexte. Wohl aber finden sich im Altersrückblick Argumentations- und Darstellungsmuster, die schon in Fontanes vormärzlichen Schriften angelegt sind.
Dazu gehört der Vorrang von Empirie und Beobachtung vor einer hochtrabenden Programmatik ebenso wie die sozusagen urdemokratische Intuition, die Bevölkerung mit ihren Bedürfnissen, ihrer Alltagsrationalität, aber auch ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut als Subjekt ernst zunehmen und zu Wort kommen zu lassen. So wurde die Revolution des 18. März nach Fontanes Alterserinnerung eben nicht von den »mehr als harmlosen« Angehörigen der Bourgeoisie durchgekämpft (für die zuallererst Fontane selbst steht, der hier nur als clownesker Taugenichts auftritt), sondern von Handwerkern und Maschinenarbeitern, aus deren Erfahrungsberichten Fontane ausgiebig zitiert. »Lauter ordentliche Leute«, wie Fontane ausdrücklich hinzufügt. Wie schon in seinen frühen Gedichten für die Eisenbahn der frühen 1840er Jahre konterkariert Fontane auch 1896 noch den Popanz eines Schreckgespenstes der Revolution und die Angst vor einem rasenden Mob, mit dem das Bürgertum bis weit ins Kaiserreich – und tatsächlich über Fontanes Lebzeiten hinaus – auf Linie gebracht wurde.
Die Kritik am letztlich affirmativen bürgerlichen Liberalismus scheint auch in Fontanes Schilderung der Urwählerversammlung zum ersten deutschen Parlament auf. Nachdem er stundenlang den rhetorisch geschraubten und ins Allgemeine ausschweifenden Reden von Professoren und Akademikern zugehört hatte (»ödes wichtigtuerisches Papelwerk«), meldet sich der Wahlmann Fontane und stellt fest, dass er anstatt Alexander von Humboldt seinem Nachbarn Bäcker Roesike die Stimme geben müsse, von dem er zumindest wisse, »dass er ein allgemein geachteter Mann sei und in der ganzen Gegend die besten Semmeln hätte«. Bäcker Roesike statt Alexander von Humboldt – auf eine knappere Formel lässt sich Fontanes schnodderige basisdemokratische Intuition wohl nicht bringen.
Heute teilen nicht wenige Historiker:innen zumindest Fontanes Einschätzung, dass es bei einem geringeren Professorenanteil nicht so widerstandslos zur Selbstauflösung des Paulskirchenparlaments schon im Jahr darauf gekommen wäre. Wer hier hingegen historische Frühformen eines heutigen Rechtspopulismus wittert, liegt daneben. »Hoffentlich nach links« benennt Wahlmann Fontane ausdrücklich sein über die besten Semmeln hinausgehendes politisches credo. Nicht auf Mobbisierung zielt Fontanes Parteinahme für Bäcker, Dienstpersonal und Friseure, sondern auf Anerkennung und Zivilität.
Auch wenn das alles Fontane noch nicht zum demokratischen Vordenker macht, verweist es doch kritisch auf grundlegende Demokratiedefizite des Kaiserreichs, die sich durchaus auf verschiedenen Seiten des politischen Spektrums fanden: Dies betrifft zuallererst Bismarcks Cäsarismus, dem die Bevölkerung nur als instrumentalisierbares Stimmvolk galt, dessen Wählerwillen sich jederzeit durch Auflösung des Parlaments rückgängig machen lässt und »wo hinter jedem Wähler erst ein Schutzmann, dann ein Bataillon und dann eine Batterie steht«.[6] Fontane steht damit aber ebenso quer zu den dünkelhaften Fantasien kultureller Überlegenheit der Nationalliberalen, mit denen das Bürgertum seine politische Machtlosigkeit im Kaiserreich kompensierte und wo der größte Bevölkerungsanteil (Frauen, Arbeiter:innen) überhaupt nicht vorkam. Schließlich war auch die paternalistische Haltung, mit der selbst wohlmeinende Demokraten die Bevölkerung zu Kindern degradierte, die man überall vor ihrer Verführbarkeit schützen zu müssen glaubte, nicht seine Sache.
Und so endet der Altersrückblick des notorischen, aber durchaus nicht standpunktlosen Skeptikers mit der überraschend optimistischen und geradezu radikaldemokratischen Kalkulation, dass letztlich keine Militärmacht der Welt stark genug sei, den Bevölkerungswillen zu unterdrücken, und dass Volksaufstände beim inzwischen erreichten Stand der Zivilisation »jedesmal mit dem Siege der Revolution enden [müssen], weil ein aufständisches Volk, und wenn es nichts hat als seine nackten Hände, schließlich doch notwendig stärker ist, als die wehrhafteste geordnete Macht«.[7] 1848 war für Fontane – um das Mindeste zu sagen – bis zum Schluss kein erledigtes Thema.
Freiheitserwachen[8]
Der Frühling hat des Winters Kette
Gelöst nach altem gutem Brauch;
O, dass er doch zerbrochen hätte
Die Ketten unserer Freiheit auch.
Er nahm das weiße Totenlinnen,
Das die gestorben Erde trug,
Und sieht die Fürsten weiter spinnen
An unsrer Freiheit Leichentuch.
Wird nie der Lenz der Freiheit kommen?
Und werden immer Schnee und Eis
Und nimmer Ketten uns genommen?
Es seufzt mein Herz: wer weiß, wer weiß?!
Der achtzehnte März
Erstes Kapitel
Der achtzehnte März
Die Jungsche Apotheke, Ecke der Neuen Königs- und Georgenkirchstraße, darin ich den »18. März« erleben sollte, war ein glänzend fundiertes Geschäft, aber von vorstädtischem Charakter, so dass das Publikum vorwiegend aus mittlerer Kaufmannschaft und kleineren Handwerkern bestand. Dazu viel Proletariat mit vielen Kindern. Für letztere wurde seitens der Armenärzte meist Lebertran verschrieben – damals, vielleicht auch jetzt noch, ein bevorzugtes Heilmittel –, und ich habe während meiner ganzen pharmazeutischen Laufbahn nicht halb so viel Lebertran in Flaschen gefüllt wie dort innerhalb weniger Monate. Dieser Massenkonsum erklärt sich dadurch, dass die durch Freimedizin bevorzugten armen Leute gar nicht daran dachten, diesen Lebertran ihren mehr oder weniger verskrofelten Kindern einzutrichtern, sondern ihn gut wirtschaftlich als Lampenbrennmaterial benutzten. Außer dem Tran wurde noch abdestilliertes Nussblätterwasser, das kurz vorher durch Dr. Rademacher berühmt geworden war, ballonweise dispensiert; ich kann mir aber nicht denken, dass dies Mittel viel geholfen hat. Wenn es trotzdem noch in Ansehen stehen sollte, so will ich nichts gesagt haben.
Der Besitzer der Jungschen Apotheke, der bekannten gleichnamigen Berliner Familie zugehörig, war ein älterer Bruder des um seiner vorzüglichen Backware willen in unserer Stadt in freundlichem Andenken stehenden Bäckers Jung Unter den Linden. Beide Brüder waren ungewöhnlich schöne Leute, schwarz, dunkeläugig, von sofort erkennbarem französischem Typus; sie hießen denn auch eigentlich Le Jeune, und erst der Vater hatte den deutschen Namen angenommen. Es ließ sich ganz gut mit ihnen leben, soweit ein Verirrter, der das Unglück hat, sich für »Percy’s Reliques of Ancient English Poetry« mehr als für Radix Sarsaparillae zu interessieren, mit Personen von ausgesprochener Bourgeoisgesinnung überhaupt gut leben kann. Aber freilich mit der Kollegenschaft um mich her stand es desto schlimmer, die Betreffenden wussten nicht recht, was sie mit mir anfangen sollten, und als in einem damals erscheinenden liberalen Blatte, das die »Zeitungshalle« hieß, ein paar mit meinem Namen unterzeichnete Artikel veröffentlicht wurden, wurde die herrschende Verlegenheit nur noch größer. Im Ganzen aber verbesserte sich meine Stellung dadurch doch um ein nicht unbeträchtliches, weil die Menschen mehr oder weniger vor jedem, der zu Zeitungen irgendwelche Beziehungen unterhält, eine gewisse Furcht haben, Furcht, die nun mal für Übelwollende der beste Zügel ist. Wer glaubt, speziell hierzulande, sich ausschließlich mit »Liebe« durchschlagen zu können, der tut mir leid.
Die grotesk komische Furcht vor mir steigerte sich selbstverständlich von dem Tag an, wo die Nachricht von der Pariser Februar-Revolution eintraf, und als in der zweiten Märzwoche kaum noch ein Zweifel darüber sein konnte, dass sich auch in Berlin irgendwas vorbereite, begann sogar die Prinzipalität mich mit einer gewissen Auszeichnung zu behandeln. Man ging davon aus, ich könnte ein verkappter Revolutionär oder auch ein verkappter Spion sein, und das eine war geradeso gefürchtet wie das andere.
So kam der achtzehnte März.
Gleich nach den Februar-Tagen hatte es überall zu gären angefangen, auch in Berlin. Man hatte hier die alte Wirtschaft satt. Nicht dass man sonderlich unter ihr gelitten hätte, nein, das war es nicht, aber man schämte sich ihrer. Aufs Politische hin angesehen, war in unserem gesamten Leben alles antiquiert, und dabei wurden Anstrengungen gemacht, noch viel weiter zurückliegende Dinge heranzuholen und all dies Gerümpel mit einer Art Heiligenschein zu umgeben, immer unter der Vorgabe, »wahrer Freiheit und gesundem Fortschritt dienen zu wollen«. Dabei wurde beständig auf das »Land der Erbweisheit und der historischen Kontinuität« verwiesen, wobei man nur über eine Kleinigkeit hinwegsah.
In England hatte es immer eine Freiheit gegeben, in Preußen nie; England war in der Magna-Charta-Zeit aufgebaut worden, Preußen in der Zeit des blühendsten Absolutismus, in der Zeit Ludwigs XIV., Karls XII. und Peters des Großen. Vor dieser Zeit staatlicher Gründung, beziehungsweise Zusammenfassung, hatten in den einzelnen Landesteilen allerdings mittelalterlich ständische Verfassungen existiert, auf die man jetzt, vielleicht unter Einschiebung einiger Magnifizenzen, zurückgreifen wollte. Das war dann, so hieß es, etwas »historisch Begründetes«, viel besser als eine »Konstitution«, von der es nach königlichem Ausspruche feststand, dass sie was Lebloses sei, ein bloßes Stück Papier. Alles berührte, wie wenn der Hof und die Personen, die den Hof umstanden, mindestens ein halbes Jahrhundert verschlafen hätten. Wiederherstellung und Erweiterung des »Ständischen«, darum drehte sich alles. In den Provinzialhauptstädten, in denen sich, bis in die neueste Zeit hinein, ein Rest schon erwähnten ständischen Lehens tatsächlich – aber freilich nur schattenhaft – fortgesetzt hatte, sollten nach wie vor die Vertreter des Adels, der Geistlichkeit, der städtischen und ländlichen Körperschaften tagen, und bei bestimmten Gelegenheiten – das war eine Neuerung – hatten dann Erwählte dieser Provinziallandtage zu einem großen »Vereinigten Landtag« in der Landeshauptstadt zusammenzutreten. Eine solche Vereinigung sämtlicher Provinzialstände konnte, nach Meinung der maßgebenden, das heißt durch den Wunsch und Willen des Königs bestimmten Kreise, dem Volke bewilligt werden; in ihr sah man einerseits die Tradition gewahrt, andererseits – und das war die Hauptsache – dem Königtum seine Macht und sein Ansehen erhalten.
König Friedrich Wilhelm IV. lebte ganz in diesen Vorstellungen. Man kann zugeben, dass in der Sache Methode war, ja mehr, auch ein gut Stück Ehrlichkeit und Wohlwollen, und hätte die ganze Szene hundertunddreißig Jahre früher gespielt – wobei man freilich von der unbequemen Gestalt Friedrich Wilhelms I. abzusehen hat, der wohl nicht dafür zu haben gewesen wäre –, so hätte sich gegen ein solches Zusammenziehen der »Stände«, die zu jener Zeit, wenn auch angekränkelt und eingeengt, doch immerhin noch bei Leben waren, nicht viel sagen lassen. Es gab noch kein preußisches Volk. Unsere ostelbischen Provinzen, aus denen im Wesentlichen das ganze Land bestand, waren Ackerbauprovinzen, und was in ihnen, neben Adel, Heer und Beamtenschaft, noch so umherkroch, etwa vier Millionen Seelen ohne Seele, das zählte nicht mit. Aber von diesem absolutistisch patriarchalischen Zustand der Dinge zu Beginn des vorigen Jahrhunderts war beim Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. nichts mehr vorhanden.
Alles hatte sich von Grund aus geändert. Aus den 4 Millionen waren 24 Millionen geworden, und diese 24 Millionen waren keine misera plebs mehr, sondern freie Menschen – wenigstens innerlich –, an denen die die Welt umgestaltenden Ideen der Französischen Revolution nicht spurlos vorübergegangen waren. Der ungeheure Fehler des so klugen und auf seine Art so aufrichtig freisinnigen Königs bestand darin, dass er diesen Wandel der Zeiten nicht begriff und, einer vorgefassten Meinung zuliebe, nur sein Ideal, aber nicht die Ideale seines Volkes verwirklichen wollte.
Friedrich Wilhelm IV. handelte, wie wenn er ein Professor gewesen wäre, dem es obgelegen hätte, zwischen dem ethischen Gehalt einer alten landständischen Verfassung und einer modernen Konstitution zu entscheiden, und der nun in dem Alt-Ständischen einen größeren Gehalt an Ethik gefunden. Aber auf solche Feststellungen kam es gar nicht an. Eine Regierung hat nicht das Bessere bez. das Beste zum Ausdruck zu bringen, sondern einzig und allein das, was die Besseren und Besten des Volkes zum Ausdruck gebracht zu sehen wünschen. Diesem Wunsche hat sie nachzugeben, auch wenn sich darin ein Irrtum birgt. Ist die Regierung sehr stark – was sie aber in solchem Falle des Widerstandes gegen den Volkswillen fast nie ist –, so kann sie, länger oder kürzer, ihren Weg gehen, sie wird aber, wenn der Widerstand andauert, schließlich immer unterliegen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: