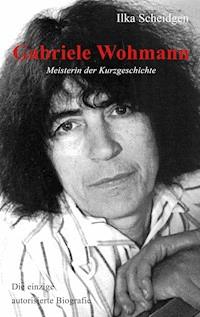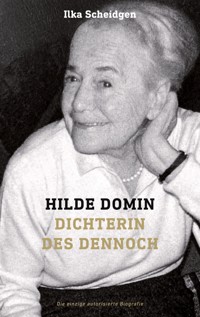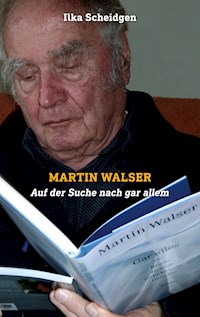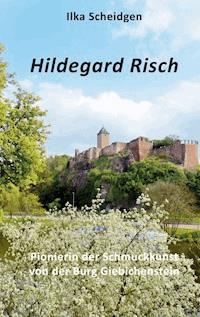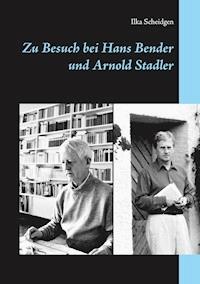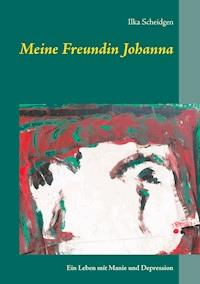Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anders als der Titel "Nutzlos" vermuten lassen könnte, geht es in den Geschichten nicht um Vergeblichkeiten. Im Gegenteil. "Die Rosen duften. Sie fragen nicht. Sie antworten nicht. Sie erfreuen den Menschen. Sie sind", heißt es in der Kurzgeschichte "Unterwegs". Die Geschichten handeln von ungewöhnlichen Begegnungen, von Zufällen und Notwendigkeiten. "Unsere gewöhnlichen Schrecken werden stets in einem zuversichtverströmenden Zauber aufgehoben", schrieb Gabriele Wohmann, die Meisterin der deutschen Kurzgeschichte, über Ilka Scheidgens Geschichten, "und dieses Friedenstiften bleibt doch schön rätselhaft, unerklärlich."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nutzlos
Titel SeiteIlka Scheidgen
Nutzlos
Kurzgeschichten
Impressum:
Texte: 2017 © Ilka Scheidgen
Umschlag:2017 © Ilka Scheidgen
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die Ros ist ohn Warum
Sie blühet weil sie blühet
Sie acht nicht ihrer selbst
Fragt nicht, ob man sie siehet
Angelus Silesius
Inhaltsverzeichnis
Der Nichts-Pfad
Postskriptum
Margarita
Felicitas
Himmelschlüssel
Die Annonce
Sphinx
Der Berg
Nutzlos
Die sichere Seite
Seiner Hände Arbeit
Die grüne Frau
Zwillinge
Das zwölfte Foto
Unterwegs
Geisterhaus
Der blaue Mann
Anselm Frei
Die Freunde
Mein Freund Hilmar
Die silberne Hand
Das Päckchen
Brotkrumen
Das Piano
Die Melodie
Die Weide
Die weiße Taube
Über die Kurzgeschichten von Ilka Scheidgen
Über dieses Buch
Biografisches
Der Nichts-Pfad
Manchmal musste er laut vor sich hinlachen, wenn er daran dachte, wohin seine Entdeckung geführt hatte. Busladungen nichtssüchtiger Menschen wurden vor den Toren seines Bauernhofes abgeladen. Ehrfürchtig und gemessenen Schrittes pilgerten – ja, es gab kein passenderes Wort für jenen tastenden, hingebungsvollen Gang – ganze Scharen von Nichtssuchern den als Initiationsweg beschriebenen Pfad entlang. Der war von Brennnesseln dicht gesäumt, aber auch dieses Detail gehörte unzweifelhaft zur Vorweihe.
Wie hatte es in dem Prospekt geheißen: Folgen Sie dem Pfad am Bach entlang, überqueren Sie die moosbewachsene Holzbrücke (Vorsicht Rutschgefahr!) zum anderen Ufer und konzentrieren Sie sich nur auf Ihren Weg...
Diese „Gebrauchsanweisung“ fand Karl ausgesprochen lächerlich, wenngleich es genauso gewesen war bei ihm, als er zum ersten Mal das Nichts entdeckt hatte. Er hatte seinen tagtäglichen Gang gemacht, hinauf zum Wehr im Fluss, drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück. Der Zulauf musste kontrolliert werden. Steine und Äste konnten sich querlegen. Ratten konnten Gänge graben und das Wasser ableiten. Im Herbst bildeten sich richtige Mauern aus Laub. Der Zulauf musste frei sein, die Turbine konnte sonst nicht arbeiten.
Diese tägliche Übung hatte er nun bereits viele Jahre hindurch absolviert. Karl erfüllte sie ohne Hast, ohne Murren, ohne irgendwelche besondere Gefühle oder Gedanken. Bis zu jenem entscheidenden Tag, an dem in seine gewohnte Welt etwas Ungewöhnliches einbrach. Wie stets völlig gedankenverloren den langen Weg zum Wehr gehend, sah Karl plötzlich vor sich ein Stück Nichts. Er rieb sich die Augen, es blieb dabei. Mitten aus dem Bild vor seinen Augen – das waren die Flusserlen, die knöchelhohen Brennnesseln, die efeuberankten Silberpappeln, der über Steine springende Bach zu seiner Rechten und der Wassergraben, ebenfalls dicht mit Brennnesseln, aber auch vielen anderen wunderschönen Blumen, und der Wassergraben zu seiner Linken – war etwas aus der Landschaft wie mit einer Schere herausgeschnitten.
Zuerst hatte Karl an Nebel gedacht. Fast so war es auch gewesen, als er in dieses Stück Nichts hineintrat: angenehm, konturlos, weich, hell. Nach einer nicht exakt bestimmbaren Zeit hatte er dieses Nichts wieder verlassen, konnte es eigenartigerweise beim Umblicken nicht mehr als solches wahrnehmen.
Karl, den Hund an seiner Seite, erlebte von nun an täglich dasselbe und hatte sich binnen kurzem so sehr an diese Lücke in der Wirklichkeit gewöhnt, dass sie ihm als nichts Außergewöhnliches mehr vorkam. Der Zustand seines Gemüts war durchaus als glücklich zu bezeichnen.
Karl war seit dem Tod seiner Eltern allein auf dem Hof. Die Dörfler hänselten ihn manches Mal, wie es denn mit einer Frau bestellt sei, und die Anverwandten warteten auf ein fettes Erbe. Karl lachte zu allem. Über den Spott und über die Habgier. Doch eines Tages erzählte er in der Wirtschaft von dem Nichts-Loch. Unvorsichtigerweise, wie sich herausstellte. Natürlich hielten sie ihn für einen Spinner. Das wäre aber nicht weiter schlimm gewesen. Schlimm wurde es erst, als einer seiner Neffen, ungeduldig auf das ersehnte Erbe wartend, auf die Idee gekommen war, die Sache mit dem Nichts groß heraus zu posaunen und ein einträgliches Geschäft daraus zu machen.
Dieses Kerlchen hatte sich in der Welt ein bisschen mehr umgesehen als sein Onkel. Und hatte bei der Schilderung des „Nichts-Pfades“ sofort seine große Chance gewittert. Das hatte er doch in Seminaren gelernt, hatte sogar unschuldige Passanten mit Pseudofragen „Glauben Sie, dass Sie Ihren Verstand ganz ausnützen?“ Bewusstseinserweiterungsprogramme verkauft. Wieviel einfacher lag doch dieser Fall. Wandle auf dem Pfade des Nichts, und du wirst dich selbst finden. So hatte es ja der Onkel berichtet. Warum sollte man ihn nicht zum weise gewordenen Guru hochstilisieren? Wie nur es ihm schmackhaft machen, jenem Einfältigen ...
Unerwarteter Weise legte Karl ihm gar keine Steine in den Weg, legte keinen Protest gegen den Plan des Neffen ein, Erleuchtungshungrige zu ihm auf seinen Hof zu führen und den von Nesseln gesäumten Pfad entlangschreiten zu lassen, um einmal in ihrem übervollen Leben nichts zu erleben.
Es gelang tatsächlich. Der Neffe unterhielt fortan ein blühendes Geschäft der gehobenen Touristik, weitete es innerhalb kürzester Zeit aus zu Aberdutzenden von Filialen. Und sie kamen in Heerscharen, von nah und fern. Stiegen sie nach durchwanderter Erleuchtungstour wieder in ihren Bus, so wussten die Dorfbewohner von leuchtenden Augen der Nichts-Aspiranten zu berichten. Worauf diese Erscheinung zurückzuführen war, blieb freilich im Dunkeln. Möglich war wohl, dass niemand sich getraute zuzugeben, das Nichts gar nicht erkannt, erlebt, erfahren zu haben.
Nur Karl wusste, wovon er einst die anderen unterrichtet, welches Geheimnis er preisgegeben hatte. Ihm war die Erscheinung treu geblieben. Sie stellte sich ein, wann immer er seinen Gang machte zum Wehr, sommers und winters. Längst hatte er ja begriffen, was sich ereignete in jenem Stück Nichts. Mit Geld war das nicht zu erkaufen, dachte er, lachte still vergnügt und setzte seinen Weg fort – wie jeden Tag.
Postskriptum
Es war nach einer meiner Lesungen, dass ich einen merkwürdigen Brief erhielt mit folgendem Inhalt: „Nach Teilnahme an Ihrer Lesung und Versenkung in Ihre Geschichten kann ich nicht umhin, mir vorzustellen, dass Sie eine ‘Hexe’ sind. Beides hat mich tagelang so gefangen gehalten, dass ich kaum davon loskommen konnte. Zu dieser Zeit entstand auch die Absicht, Ihnen dafür zu danken und Ihnen zu schreiben.“
Ein bisschen Kopfschütteln, ein wenig Belustigung löste diese Nachricht, geschrieben auf einer Karte mit einem üppigen Blumenbukett (leicht kitschig), bei mir aus, bevor ich sie ablegte unter Leserpost und - vergaß.
Zwei Jahre später erreichte mich der Anruf eines Mannes, der in einem benachbarten Ort wohnt und den ich nur flüchtig kannte. Er trat mit der Bitte an mich heran, mir von seiner kürzlich verstorbenen Frau Gedichte zeigen zu dürfen, die sie im letzten Jahr vor ihrem Tod geschrieben hatte, als sie bereits wusste, dass sie an einem inoperablen Carcinom litt und ihre Lebenszeit nicht mehr lange wehren würde.
Ich wollte diesen eindringlich vorgetragenen Wunsch eines offenbar noch intensiv trauernden Witwers nicht abschlagen und bat ihn, mir die Gedichte seiner Frau doch vorbeizubringen. Was mich schon im Vorfeld neugierig machte und auch beeindruckte, war die Tatsache, dass es nur zehn Gedichte waren, an denen, wie er mir erzählte, seine Frau lange gefeilt und sie schließlich als fertige Gebilde betrachtet hatte.
Der Mann, nennen wir ihn Herrn Harms, kam schon am selben Nachmittag, so froh war er offenbar über meine Zusage, so ungeduldig und gespannt auf meine erste Reaktion. Wie würde mein Urteil lauten? Würde ich die Gedichte gut finden? Vorsichtig, beinahe andächtig holte er aus seiner Aktentasche ein DIN A4-Couvert heraus, aus dem er die zehn Blätter mit den sorgfältig getippten Gedichten mit zitternden Fingern zog. Er reichte sie mir mit einem Blick, dem noch deutlich die Trauer über die schmerzliche Zeit des Abschiednehmens von seiner Lebenspartnerin anzumerken war.
Natürlich hatte ich nicht vor, ad hoc, bereits nach kurzem Überfliegen der Gedichte ein Urteil abzugeben und bat Herrn Harms, mir diese zu überlassen, damit ich mich in Ruhe damit beschäftigen könne, womit er sofort einverstanden war. Die erste Last und Unruhe schien jetzt von ihm genommen, und er begann von seiner Frau zu erzählen und auch ein wenig von sich selbst. Seltsam, Herr Harms erschien mir sehr verändert. Wie bereits gesagt, kannte ich ihn nicht sehr gut. Bei den wenigen Begegnungen war er mir forsch und selbstsicher vorgekommen, eloquent und extrovertiert. Ob das Miterleben der schweren Krankheit seiner Frau ihn so verwandelt hatte, kam mir in den Sinn. Jetzt wirkte er verhalten und in sich gekehrt. Andererseits wagte ich nicht wirklich einen solchen Schluss zu ziehen, da ich ihn, seine Frau, ihrer beider Verhältnis zueinander, ihre Lebensumstände nicht kannte.
„Wann kann ich mich wieder bei Ihnen melden“, fragte Herr Harms, als er sich zum Gehen wandte. „Ich rufe Sie an, wenn ich die Gedichte gelesen habe“, versprach ich ihm und setzte hinzu, dass ich ihn nicht sehr lange warten lassen würde.
Ich war selbst viel zu gespannt, um nicht sofort, nachdem Herr Harms mich verlassen hatte, mich den Gedichten zuzuwenden. Ich las eins nach dem anderen, ich las sie langsam, ich las sie laut vor mich hin, und ich wusste schon bald, dass diese Gedichte, abgerungen dem letzten bisschen Leben vor dem sicheren Tod, gut waren.
„Nicht mehr verrinnen können/ wie Schimmer im Bach“ las ich, „Nie mehr Rinnsal/ in die Arglosigkeit“. Traumsicher hatte hier eine Frau in äußerster Verzweiflung und Einsamkeit zu prägnanten Bildern gegriffen, die ihre Seelenlage ausdrückten. Wenn man wie ich auch als berufsmäßige Kritikerin so viele gutgemeinte Verseschmiedereien kennengelernt hat, so war mein Erstaunen über diese ungeahnte Qualität groß.
Ich wartete mit meinem Anruf nicht lange. Herr Harms war hörbar erleichtert, als ich ihm meine vorläufige Beurteilung am Telefon mitteilte. Aus Andeutungen bei unserem ersten Gespräch hatte ich schon erahnt, dass er sich mit dem Gedanken trug, die Gedichte in irgendeiner Form öffentlich zu machen. Dazu ermunterte ich ihn jetzt ausdrücklich. Herr Harms erzählte mir, dass er einem Freund die Gedichte bereits gezeigt, dieser wiederum sie einer befreundeten Künstlerin weitergereicht hatte mit der Frage, ob sie zu den zehn Gedichten zehn Illustrationen schaffen könne und wolle.
Herr Harms erwartete diese Illustrationen schon in den kommenden Tagen. Er wollte mit ihnen noch einmal bei mir vorbeikommen, um zu besprechen, welche Wege zum Druck eines kleinen Bändchens - wozu er nun nach meinem positiven Urteil fest entschlossen war - beschritten werden könnten. So weit, so gut. Ich wandte mich in der Zwischenzeit meinen Aufgaben zu. Zwei Essays mussten noch verfasst werden, und Rezensionen hatte ich eine ganze Reihe auf dem Schreibtisch liegen, die auf Erledigung warteten.
Als Herr Harms mit den aquarellierten Zeichnungen zu mir kam, wusste ich bereits, dass meine Einbindung in diese Angelegenheit noch nicht beendet sein würde. Neben den Tipps zur Suche einer Druckerei, zum Einholen von Vergleichskostenanschlägen, Überlegungen, wie hoch er die Auflage machen lassen wolle, mit denen ich schnell dienen konnte, stand für mich selbst schon fest, dass ich diese ungewöhnliche Dokumentation, dieses Testament in Gedichten nicht einfach dem Witwer wieder in die Hand drücken könnte mit den besten Wünschen und Empfehlungen. Ich spürte einen fast zwingenden Appell an mich, von wem war nicht leicht zu entscheiden, aber wohl doch am ehesten von der Urheberin der Verse selbst, mich zu ihnen zu äußern, nicht nur mündlich, sondern schriftlich, und zwar in Form eines Nachwortes.
Dass Herr Harms mein diesbezügliches Angebot dankend annahm, muss ich nicht ausdrücklich erwähnen. Natürlich war er froh darüber und wollte sich nun auch schnellstens um die Ausführung seiner Pläne kümmern.
Ich verfasste also ein Nachwort, wofür ich mich noch einmal und diesmal noch viel mehr in die Bildwelt der Gedichte hineinversenkte, die Sprachrhythmen auf mich wirken ließ und die Entwicklung herausarbeitete, die sich vom ersten bis zum letzten Gedicht nacherleben ließ. Immer mehr wurde mir klar, dass eine Frau um ihr Leben, um ihr Überleben geschrieben hatte.
In die anfängliche Verzweiflung und Düsternis, die Ausweg- und Hoffnungslosigkeit bricht mittenhinein ein Lichtstrahl, der Trost verheißt und sogar Freude wieder möglich macht.
Aus gallo-römischer Zeit befindet sich in unserer Nähe ein Standbild mit drei Frauen, „Matronensteine“ genannt. So ist ein Gedicht betitelt, das vorletzte der zehn und sicher eines, welches nicht lange vor Ablauf der tickenden Lebensuhr entstanden ist. Die dem Sterben nahe Frau hört bereits den Gesang der „Drei-Frau vom Feenhügel“, die sie mit süßer Melodie zu sich herüberlockt. Ein handgeschriebener Zettel, der dem Gedicht beiliegt, zeigt mir den Ursprung ihrer Gedanken und Gefühle. Es handelt sich augenscheinlich um ein Exzerpt aus einem Buch, vielleicht aus einem Lexikon. Da lese ich: „Wenn die Banschee diejenigen, die sie ruft, liebt, dann ist ihr Lied ein langsamer, sanfter Gesang, der zwar die Nähe des Todes verkündet, aber mit einer Zartheit, die die Bleibenden beruhigt und die Überlebenden tröstet.“
„Sie hat sich zuerst gegen die todbringende Krankheit aufgelehnt“, erzählt mir Herr Harms, aber dann, so sagt er, habe sich an ihr eine große Wandlung vollzogen. Für ihr Verhältnis zueinander sei diese Zeit die wohl wichtigste überhaupt gewesen. Seine Frau hätte sich während dieser Zeit zunehmender Schmerzen und Schwäche ihm zum ersten Mal wirklich geöffnet. Er hätte mit ihr über Dinge sprechen können, die sie früher immer abgelehnt habe, mit denen sie nichts habe anfangen können. „Wissen Sie“, gesteht er mir bei dieser Unterhaltung, die in seinem Haus stattfindet, „dass ich, bevor ich Psychologe wurde, Theologie studiert habe?“
„Warten Sie einen Augenblick“, sagt Herr Harms und verschwindet durch die Tür, die, wie er mir vorher erklärt hatte, zu seinem Arbeitszimmer führt. Mit einem Buch in der Hand kommt er zurück. „Hier“, sagt er und drückt mir das Buch mit vergilbtem Schutzumschlag in die Hand, „lesen Sie das. Ich glaube, Sie verstehen dann die ganze Geschichte besser.“
Ich will die Geschichte nicht ungebührlich ausdehnen. Das Wesentliche ist auch bereits erzählt. Ein Bändchen mit Gedichten ist entstanden mit einem Vorwort des Ehemanns und einem Nachwort aus meiner Feder. Jedem Gedicht ist eine Illustration gegenübergestellt. Es ist von der örtlichen Presse beachtet worden und verkauft sich im Buchladen gut. Herr Harms hat sich seinen Wunsch, seiner Frau ein ehrendes Andenken zu geben, erfüllt. Auch ich freue mich über den gelungenen Band und darüber, dass er Leser findet.
In dem Buch, das mir Herr Harms mitgab, habe ich eine Reihe sehr bemerkenswerter Sätze gefunden. Da ich die Vorliebe habe, solche zu unterstreichen, habe ich mir den Band „Ich und Du“ von Martin Buber selbst gekauft, nachdem ich den geliehenen zurückgegeben hatte. Eine Stelle hatte es mir von Anfang an angetan. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ In einem zunächst noch eher unbestimmten Sinne schien dieser Satz mir eine nachträgliche Erklärung zu liefern für das Zusammenwirken so unterschiedlicher Personen und Ereignisse mit dem Ergebnis eines Büchleins von vierzig Seiten.
Vor mir liegt der Gedichtband mit blauer Schrift auf weißem Grund. Auf der Rückseite befinden sich ein Foto der Autorin und einige biographische Daten. Das Foto hat ein uns gemeinsamer Bekannter und Freund kurz vor ihrem Tod gemacht. Sie schaut aus dem Bild hinaus ins Weite. Den Hintergrund bildet ein unscharfes Licht-Blätter-Gemenge, wie es entsteht, wenn man mit einem Teleobjektiv arbeitet, um die Person im Vordergrund besonders klar erscheinen zu lassen.
Eine Person, die ich zu Lebzeiten nicht gut kannte, ist mir sehr nah geworden.
Dieser Tage fiel mir jener Brief, von dem ich eingangs erzählte, unvermutet wieder in die Hände. Ich las ihn wieder mit einer gewissen Heiterkeit, bis mir jäh eine Gänsehaut über den Rücken lief. Ich erkannte plötzlich die Unterschrift.
Nun las ich den als Postskriptum hinzugefügten Satz: „Was daraus werden wird und kann, bitte ich abzuwarten.“
Der Brief war von der Verfasserin der Gedichte, und ich hatte es die ganze Zeit über nicht gewusst.
Mir war unheimlich zumute.
Aber ich wusste nun, was daraus geworden war. Und sie wohl auch.
Margarita
Jetzt wusste sie wieder, wann es angefangen hatte. Als ihre Großmutter starb, da war sie acht Jahre alt. Nur zwei Jahre älter war sie damals, als ihre Tochter Friederike heute ist.
Margarita hatte ihre Großmutter über alle Maßen geliebt. Und die Schuld an ihrem Tod, die gab sie dem Großvater. Ja, damals schon. Denn Margarita war ein waches und sensibles Kind. Ihr blieb nicht verborgen, wie der Großvater seine Frau behandelte. Wie ein Nichts. Vielleicht noch weniger, wenn das überhaupt möglich war. Er nahm sich alle Freiheiten heraus. Kam und ging, wie es ihm passte, liebte seine schnellen Wagen mehr als Frau und Kind. Und Frauen gab es in seinem Leben viele. Er machte nicht einmal ein Geheimnis daraus. Seine Frau dagegen maßregelte er, wenn sie einmal von einem „Kaffeekränzchen“ nur eine halbe Stunde zu spät nach Hause zu kommen wagte. Die Großmutter begehrte nicht auf. Das war damals noch nicht in Mode. Sie fraß allen Kummer in sich hinein, bis schließlich der Krebs sich so weit in sie hineingefressen hatte, dass es keine Rettung mehr gab. Margarita hasste den Großvater deswegen und verübelte ihm zeit seines Lebens, dass er so ungeniert ein hohes, ungetrübtes Alter erreichte.
Und irgendwie muss es auch mit dieser Villa zusammengehangen haben, in die sie damals gezogen waren. In dem kleinen Dorf sprach man überall nur von der „Villa“. Zweifelsohne handelte es sich um das schönste Haus im Ort. Und den Respekt, aber auch den Neid hörte Margarita ganz deutlich aus den Stimmen der Dorfbewohner heraus, obwohl sie stets so freundlich taten.
Sie mochte das Haus von Anfang an nicht. Es war dunkel im Innern. Und das gefiel ihr nicht. Sie und ihre Schwestern mussten sich in Acht nehmen beim Spielen, damit nichts von dem wertvollen Inventar kaputt ginge. Die großen verglasten Schiebetüren mit den Jugendstilblüten zum Beispiel. Oder die hübschen Schnitzereien an den hölzernen Wandverkleidungen. Das Turmzimmer – ihr Zimmer -, von außen schön anzusehen und auf Unbefangene äußerst idyllisch wirkend, war innen feucht. Wenn es stark regnete und stürmte, fühlte sich Margarita dort allein und ungemütlich. Die Regentropfen schlugen wie Hämmerchen gegen die Schieferplatten, mit denen der Turm verkleidet war, und der Wind heulte um das Turmrondell, als wolle er sie samt dem Zimmerchen mit sich reißen und irgendwo fernab wieder fallenlassen. Wie käme sie dann zurück nach Hause?
Jedenfalls begann es, kurz nachdem sie in die Villa gezogen waren, der Großmutter sichtlich schlecht zu gehen. Und schon nach einem halben Jahr starb sie. Margarita war alt genug, um zu wissen, was es bedeutete, dass ein Mensch tot ist. Die tröstenden Worte der Mutter vermochten ihr nicht über den Verlust hinwegzuhelfen. Aber dann geschah es.
Als Margarita eines Abends, es mochte seit der Beerdigung der Großmutter etwa eine Woche vergangen gewesen sein, nach dem Spielen in ihr Rundzimmerchen im Turm kam, saß die Großmutter dort auf einem Stuhl, ihr mit dem Rücken zugewandt. Erschrak sie damals? Sie erinnert sich nicht mehr daran. Margarita weiß noch, dass sie es ganz natürlich fand, dass die Großmutter dort saß. Es war ja kein Gespenst, das wusste sie sofort. Und dann sprach die Großmutter mit ihr, so, wie sie es immer getan hatte. Sie erzählte, wie schön es da „drüben“ wäre. Sie sagte, sie brauchte nicht länger traurig zu sein, denn sie wäre immer bei ihr. Sie umarmte Margarita und ging mit Schritten, die kein Geräusch auf den sonst stets knarrenden Dielen verursachten, zur Tür. Margarita versuchte nicht, sie aufzuhalten. Sie lief ihr nicht hinterher. Zum ersten Mal, seit sie in diesem düsteren Haus wohnten, fühlte sie sich glücklich. Sie hatte etwas erfahren, wovon sie schon mit ihrem kindlichen Verstand wusste, dass die Erwachsenen es nicht verstehen würden. Deshalb erzählte sie von dieser Begegnung niemandem. Niemand würde ihr glauben. Erklärungen würden ihr angeboten, die das wirklich Gesehene und Erlebte ins Reich der Phantasie würden bannen wollen. Hirngespinste eines allzu sensiblen Kindes. Projektionen, Wunschvorstellungen aus kindlicher Sehnsucht entsprungen. Nein, sie sprach mit niemandem darüber. Lange Jahre nicht, bis sie es selbst schon fast vergessen hatte.
Margarita entwuchs den Kinderkleidern. Ihr Temperament war sprühend und ungezwungen. Auf den Partys war sie vielumschwärmter Mittelpunkt. Sie war hübsch und selbstbewusst. Der Vater entdeckte in ihr eine wissbegierige Gesprächspartnerin. Margarita interessierte sich für Geschichte und Politik. Sie begannen, geistreiche Dispute zu führen. Und der Vater, in Regierungsgeschäften tätig, förderte und schulte ihre von Natur aus vorhandene Eloquenz zu geschliffener Rhetorik. Bald schon trug sie in Diskussionen unter Jugendlichen stets den Sieg davon. Sie fühlte sich stark und unanfechtbar, weil sie stark war und brillant in der Argumentation.
Mit achtzehn verliebte sie sich in Christian. Und er sich in sie. Der Vater war dagegen. Die Mutter tat und sagte, was der Vater für gut befand. Heute weiß Margarita, dass ihre vermeintliche Stärke Hochmut war. Nach einiger Zeit der Verliebtheit begann sie Christians einfache Ausdrucksweise zu stören. Sie bemängelte an ihm dieses und jenes, bis sie plötzlich nicht mehr wusste, was sie an ihm so toll gefunden hatte. Sein Leid bemerkte sie schon nicht mehr. Christian heiratete einige Zeit später. Heute weiß sie, dass er doch ihre große und im Grunde einzige Liebe gewesen ist. Aber jetzt ist es zu spät. Viele Liebhaber hat sie seit damals gehabt. Du hast das Leben noch vor dir, hatte ihr Vater immer gesagt. Ja, sie hatte sich in ein turbulentes Leben gestürzt, an allem ein wenig genippt: Freunde, Drogen, Alkohol – und es doch als zu leicht, zu schal befunden. Sie war sich nicht bewusst, dass sie mit ihren Eskapaden gegen den überstarken Vater aufbegehrte. Vielleicht stellvertretend für die Mutter, die erst später, als der Vater schon tot war, ein eigenes Leben zu führen begann.
Heute denkt Margarita so. Eines jeden Leben hat seinen ihm zugedachten Sinn. Auch der Tod hat eine Bedeutung.
Alles, was du tust, machst du, um anerkannt zu werden, um geliebt zu werden, sagte vor kurzem jemand zu Margarita. Das kam ihr absurd vor. Sie sollte um etwas, was ihr selbstverständlich zuteil zu werden schien, buhlen? Und dann hat sie diesen Traum gehabt, der sie frösteln lässt, sobald sie daran denkt. Sie hat in der letzten Zeit viel über den Tod nachgedacht, über ein mögliches Weltende. Eine Jahrtausendwende steht bevor. Und von alters her tauchen in diesem Zusammenhang düstere Prognosen auf, die von einem Weltuntergang reden. Sie hat ein Buch gelesen, welches sie in große Unruhe gestürzt hat. Und sie hat sich beinahe zwanghaft vorgestellt, dass in wenigen Jahren die Erde aufhören würde zu existieren. Ich bin doch angstfrei, sagt sie sich. Sie fürchtet sich nicht vor ihrem eigenen Tod. Aber ihr Kind. Es ist doch noch so klein. Sie wehrt sich gegen diese Endzeitgedanken und ist doch infiziert von ihnen. Sie wird verfolgt von Alpträumen. Sie fürchtet sich vor dem Schlaf.
Sie hat Angst, verrückt zu werden. Innen und außen vermischen sich.