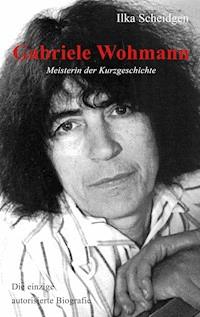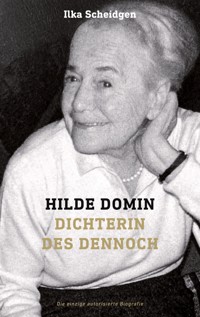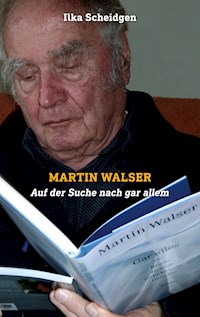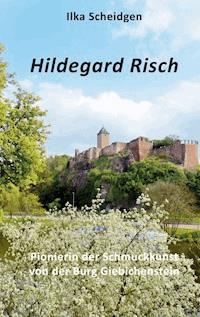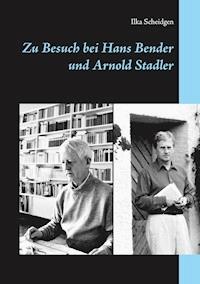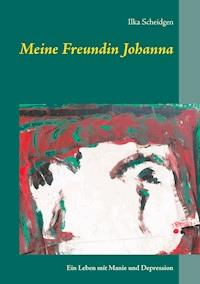Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sprache ist alles. Das gilt besonders für das fragilste sprachliche Gebilde: das Gedicht. "Ich schreibe, weil ich keine bessere Form zu schweigen finde" hat die Lyrikerin Ilse Aichinger einmal gesagt. Und Eva Strittmatter: "Die eigentliche Leistung des Dichters ist die Bejahung des Irdischen, seine rücksichtslose Benennung und dennoch schlackenlose Verbrennung zu Sprache und Licht". 23 Lyriker und Lyrikerinnen, alphabetisch geordnet von A bis Z, werden in diesem Band porträtiert. Man kann sich verführen lassen oder aufrütteln durch Sprache oder, wie es der Lyriker Günter Kunert formulierte, "durch das dichterische Wort an das erinnern zu lassen, was wir rettungslos versäumt haben: uns den Traum zu bewahren, der Leben heißt." Dieses Buch ist eine Einladung, sich mit Dichtern und Dichtung zu beschäftigen. Von A bis Z.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Aichinger Ilse
Dove Rita
Drawert Kurt
Fried Erich
Hannsmann Margarete
Heise Hans-Jürgen
Jaccottet Philippe
Kaschnitz Marie-Luise
Komenda-Soentgerath Olly
Kunert Günter
Maiwald Peter
Mallarmé Stéphane
Meister Ernst
Müller Herta
Müller Inge
Plath Sylvia
Poschmann Marion
Rühmkorf Peter
Sörensen Levke
Strittmatter Eva
Stroheker Tina
Zeller Eva
Zornack Annemarie
Nachwort
Veröffentlichungsnachweis
Pressestimmen
Ilse Aichinger
„Ich schreibe, weil ich keine bessere Form zu schweigen finde.“ So hat die am 1. November 1921 in Wien geborene Ilse Aichinger einmal über ihr Schreiben formuliert. Als Tochter einer jüdischen Ärztin, von der sich ihr nicht jüdischer Vater trennte, um während des Nationalsozialismus keine Repressalien befürchten zu müssen, erlebte Ilse Aichinger schon in jungen Jahren die Schrecken von Verfolgung, Verfemung und Ausgrenzung, den Verlust von Sicherheit und Vertrauen.
Diese frühen Erfahrungen haben ihr gesamtes schriftstellerisches Werk grundlegend beeinflusst. Ihre Mutter überlebte in Österreich, ihre Zwillingsschwester Helga konnte 1939 nach England emigrieren, aber ein Großteil ihrer Verwandten, so auch ihre Großmutter, wurde in Konzentrationslagern ermordet.
Die unglaublichen, eigentlich unbeschreibbaren Geschehnisse der Judenverfolgung machte Ilse Aichinger in ihrem Roman „Die größere Hoffnung“ - ihrem ersten veröffentlichten Werk und dem einzigen Roman überhaupt – zum Thema. Er erschien 1948 und damit in einer Zeit der beginnenden Restauration und stieß beim Lesepublikum nicht auf großes Interesse. Vordergründig wurde das Aichingers Schreibstil, der als hermetisch und unverständlich galt, angelastet. Das Romangeschehen wird aus der Kinderperspektive erzählt und handelt von Hoffnungen und Träumen eines jungen Mädchens, das als Halbjüdin nirgends dazu gehört und doch dazu gehören möchte.
„Träume sind wachsamer als Taten und Ereignisse, Träume bewachen die Welt vor dem Untergang. Träume, nichts als Träume!“ Und so wird in diesem ersten literarischen Werk Ilse Aichingers nicht geradlinig erzählt. Realitäts- und Traumebenen verschwimmen, und die Sprache selbst wird zur verändernden Kraft.
In der Mitte der Gasse lag auf dem grauen Pflaster ein offenes Schulheft, ein Vokabelheft für Englisch. Ein Kind mußte es verloren haben. Sturm blätterte es auf. Als der erste Tropfen fiel, fiel er auf den roten Strich. Und der rote Strich in der Mitte des Blattes trat über die Ufer. Entsetzt floh der Sinn aus den Worten zu seinen beiden Seiten und rief nach einem Fährmann: Übersetz mich, übersetz mich!
Doch der rote Strich schwoll und schwoll, und es wurde klar, daß er die Farbe des Blutes hatte. Der Sinn war immer schon in Gefahr gewesen, nun aber drohte er zu ertrinken, und die Worte blieben wie kleine verlassene Häuser steil und steif und sinnlos zu beiden Seiten des roten Flusses. Es regnete in Strömen, und noch immer irrte der Sinn rufend an den Ufern. Schon stieg die Flut bis zu seiner Mitte. Übersetzt mich, übersetzt mich!
Übersetzen, über einen wilden, tiefen Fluß setzen, und in diesem Augenblick sieht man die Ufer nicht. Übersetzt trotzdem, euch selbst, euch selbst, die andern, übersetzt die Welt. An allen Ufern irrt der verstoßene Sinn: Übersetz mich, übersetz mich! Helft ihm, bringt ihn hinüber!
Was in ihren folgenden Werken für Ilse Aichinger kennzeichnend werden sollte, ist hier bereits angelegt: die aufs Äußerste verknappte Sprache und eine gegen das konventionelle Erzählen mit Anfang und Ende und einem Ziel gerichtete Schreibweise, die sie in ihren Kurzgeschichten weiterentwickelt. Ilse Aichinger hatte nach dem Krieg mit dem Medizinstudium begonnen, dieses aber nach fünf Semestern abgebrochen, um ihren Roman zu vollenden.
Ab 1951 wurde sie als eine der wenigen Frauen in dem von Männern dominierten „Club“ der „Gruppe 47“ eingeladen. Dort begegnete sie dem vierzehn Jahre älteren Schriftsteller Günter Eich, der 1950 den ersten „Preis der Gruppe 47“ für seine Gedichte erhalten hatte. 1953 heirateten sie, bekamen zwei Kinder Clemens (1954-1998) und Mirjam (*1957) und führten ein normales Familienleben, aber darüber hinaus ein für ihrer beider Kunst sehr befruchtendes Dasein. In Interviews hat Ilse Aichinger ihre Ehe als eine sehr beglückende Zeit, frei von Konkurrenzgefühlen beschrieben und hat ebenfalls betont, dass für sie ein Familienleben neben dem Schreiben wichtig war. „Ich würde heute niemandem mehr zureden, nur zu schreiben. Ich habe es auch nie nur getan“, sagte sie einmal in einem Interview.
1972 ist Günter Eich gestorben. Sie waren sich zeitlebens einig, gegen Macht, Ignoranz, Intoleranz und alles, was Menschen zu Opfern werden ließ, anzugehen. Sie taten es nicht mit Agitation. Beide waren eher stille Menschen. Aber dafür umso wortmächtiger. Günter Eich hatte bei der Verleihung des Büchner-Preises 1959 gesagt: „Um die Kritik der Macht geht es, darum, ihrem Anspruch das Ja zu verweigern.“ Und Ilse Aichinger hat im FAZ-Fragebogen
1993 ihre Lieblingstugend folgendermaßen beschrieben: „Identifikation mit den Schwachen, Behinderten, Geschädigten und die Bereitschaft, die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf sich zu nehmen.“ Ihre Jahre unter dem Nationalsozialismus, in denen sie und ihre Familie „auf Abruf“ lebten, machten sie übersensibel für alle Formen der Macht, bis sie ihre Erkenntnis, ihr Erleben in Sprache umsetzte. Zuerst in den Roman „Die größere Hoffnung“, von Walter Jens als „die einzige Antwort von Rang, die unsere Literatur der jüngsten Vergangenheit gegeben hat“, bewertet. Danach ebenso konsequent in ihren Prosastücken und Gedichten.
Die Sprache war und ist ihr wichtig, „wir müssen sie aus der Manipulationsgefahr herausnehmen“, sagt sie, „sonst sind wir alle verloren.“ Insofern kann und muss ein Dichter immer unbequem sein, so wie Günter Eich in einem programmatischen Gedicht formuliert hatte: „Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt“. Ilse Aichinger hat ihre Worte stets prägnant, aber sehr sparsam verwendet, in knappen Notaten bis hin zum Aphorismus, zum Beispiel in der Textsammlung „Kleist, Moos, Fasane“ von 1987: „Alles woran man glaubt, beginnt zu existieren.“ –
„Was verwirklicht wird, wird dem Wesen nach verändert. So schafft Gott Gleichgewicht zwischen den Wünschen.“ Solche Sätze erinnern mich an Ludwig Wittgenstein mit seinem Tractatus logico-philosophicus., bei dem es bekanntlich heißt: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“.
Aichingers Schreiben könnte man als Anwendung dieser Maxime verstehen. In dieser Tradition stehen auch ihre Gedichte. „Verschenkter Rat“ heißt ein Band mit knapp einhundert meist sehr kurzen Gedichten von 1978. Als „Wörter noch Geschenke waren“, wie sie einmal sagte, als sie und Günter Eich sich Briefe schrieben und sie auch im Zusammenleben ihre Worte sorgsam wählten, damit sie nicht ihren Wert verloren.
„So viele Fragen und alle gesprochen, so viele Häuser und alle gebaut…Die Vögel angelockt und den Himmel immer wieder gemalt, bis er verschwand.“ Und deshalb will sie sich den Blick der Kinder bewahren, den sie in ihrem Roman beschwört: „Holt das Geheimnis ein! Lauft blindlings, lauft mit ausgestreckten Armen, lauft wie Kinder“. „Und hätt ich keine Träume, /so wär ich doch kein anderer/ich wär derselbe ohne Träume, /wer rief mich heim?“ (In einem) heißt eins ihrer Gedichte und ein anderes endet so: „die Fensterblumen wollt ich beschreiben, /wie sie zur Sonne wuchsen./Was tat ich?“ Denn: „Wir sind alle/ nur für kurz hier eingefädelt, /aber das Öhr/ hält man uns seither fern, / uns Kamelen.“
Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte Ilse Aichinger mit dem Unfalltod ihres Sohnes Clemens Eich im Jahre 1998, der gerade zu einem vielversprechenden jungen Dichter herangereift war. Danach zog sich die Dichterin aus der Öffentlichkeit zurück. Nach langem literarischem Schweigen begann sie für die Zeitung „Der Standard“ wöchentliche Feuilletons zu schreiben. Diese quasi zu einer Art Autobiografie verdichteten Texte erschienen als Bücher in den Bänden „Film und Verhängnis“ (2001) und „Unglaubwürdige Reisen“ (2005) im Fischer Verlag, in dem ihr gesamtes Werk veröffentlicht ist.
Ilse Aichinger hat mit ihrer unsentimentalen, genauen, aber dennoch so poetischen Sprache die deutschsprachige Literatur bereichert. Sie ist dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Das was sie schrieb, hatte Gewicht, denn es war beglaubigt durch die Tragik in ihrem Leben.
Am 11. November 2016, kurz nach ihrem 95. Geburtstag, ist sie in ihrer Geburtsstadt Wien gestorben.
Rita Dove
In der Lyrikreihe „Das Neueste Gedicht" widmet sich der Heiderhoff-Verlag besonders der internationalen zeitgenössischen Lyrik. Neben bekannten Autoren und Nobelpreisträgern werden auch noch unbekannte Lyriker vorgestellt. Die Lyrikbände sind zweisprachig, in der Originalsprache und deutschen Übersetzung. Photos und Graphiken bereichern die sorgfältige Ausstattung.
Mit dem Lyrikband „Die gläserne Stirn der Gegenwart" wird eine umfassende Auswahl aus dem Schaffen der afroamerikanischen Lyrikerin Rita Dove dem deutschen Publikum präsentiert. Die Lyrikerin, 1952 in Ohio geboren, zählt in Amerika bereits zur anerkannten Autorin ihrer Generation. 1987 erhielt sie den Pulitzer-Preis für ihren Lyrikband „Thomas and Beulah".
Die Gedichte von Rita Dove im Original lesen zu können, ist ein Gewinn. Dieser perlende Ton ist manchmal nur schwer ins Deutsche angemessen zu übertragen. Was in Englisch leicht und anmutig klingt, wirkt in der deutschen Sprache leider oft hölzern und gar nicht lyrisch, „that softening/sky like a sigh of relief' lautet in der Übersetzung „der aufweichende/Himmel wie ein erleichterter Seufzer" oder „It was not äs if he didn't try/to teil us: first he claimed/the velvet armchair, then the sun/on the carpet before it." - was übersetzt so lautet: „Doch war's nicht so, daj3 er sich nicht bemühte,/es uns mitzuteilen: Erst beanspruchte er/den Samtsessel, dann die Sonne/auf dem Teppich davor".
Nicht dem Übersetzer Fred Viehbahn soll dies angelastet werden. Es ist vielmehr ein grundlegendes Problem jeglicher Übertragung. Umso schöner ist es, wenn der Leser die Gedichte in ihrer Originalsprache auf sich wirken lassen kann.
Rita Doves lyrische Sprache ist unprätentiös und kommt fast ohne Metaphern aus. Miniaturen aus dem Leben ringsum beschreibt sie mit einem sehr klaren Ton: „Jemand sitzt im roten Haus./Man kann nicht sagen wer".
Das Erstaunliche ist, daß selbst surreale Bildwelten in der Sprache von Rita Dove nicht einer Sinnlichkeit entbehren, nicht Gefahr laufen, symbolhaft missverstanden zu werden.
Ein Beispiel ist das Gedicht „Ö", in dem sich der Vers befindet, der dem Gedichtband seinen Titel verleiht, „die Gegenwart bietet dem Meer ihre gläserne Stirn/(Gartenbrisen, vereinzelte Kardinale),//und wenn eines Abends das Haus an der Ecke/über der Marsch abheben würde,/wären weder ich noch mein Nachbar/darob verwundert. Manchmal//findet sich ein Wort so treffend, es erzittert/bei der kleinsten Erklärung./ Man fängt mit der einen Sache an, gerät/an eine andere, und nichts bleibt/wie es einst war, nicht mal die Zukunft."
Lakonisch und unsentimental in ihren Versen will die Dichterin keine Botschaft vermitteln. Sie beschreibt Wirklichkeit, auch imaginierte Wirklichkeit „Ich bin draußen im Freien,/ und über mir haben die Fenster sich zu Schmetterlingen verschränkt,/Sonnenlicht glitzert, wo sie einander schneiden./Sie laufen auf einen gewissen Punkt zu, der wahr ist und unbewiesen."
In Versen wie diesen oder auch solchen mit ironischen Untertönen: „Es gibt nicht alles in Büchern zu lesen/(aber Landkarten lügen nicht)./Der Hügel hat ein recht,/hier zu stehen." - regiert der Intellekt die lyrische Sprache, ohne dass sie dadurch kühl oder abstrakt wird.
In der Verknappung ihrer Bildsprache zeigt sich die Meisterschaft der Dichterin Rita Dove. „Sie trat/ins Freie. Ein Wind/erhob sich; hinter ihr/breiteten Felder ihre Segel." -„Weiße Stille. Nacht über den Hügel gedrängt." Beispiele wie diese machen deutlich, worin der Genuss beim Lesen dieser Gedichte liegt.
Während die ersten beiden Teile dieser Gedichtauswahl sich mit Landschaften, Menschen und poetologischen Gedanken befassen, fasst der dritte Teil thematisch Gedichte zusammen, die auf der afroamerikanischen Geschichte basieren. Aber auch hier vermeidet Rita Dove alles Lehrhafte und entzieht sich dadurch der Gefahr, etikettiert zu werden als politisch-soziologische Lyrikerin für die ethnische Gruppe der Afroamerikaner.
Trotzdem gelingt es ihr mit ihren Beschreibungen der Realität der schwarzen Rasse inmitten einer dominierenden weißen und dem Nachspüren historischer „schwarzer" Geistesgrößen eindrucksvoll, den Leser für diese Bevölkerungsgruppe zu interessieren.
Denn Dichtung kann mehr anrühren als ein Pamphlet. „Hab keinen Grund/wegzulaufen-/sowieso würde nicht einer/ mein Leben retten. Also schaufle ich Mutmaßung/in einen Hopfensack./Ich schaufle Flaum, bis/der Erdboden sich weiß erhebt/und ich der einzige dunkle/Fleck am Himmel bin".
„Sprache ist alles.", sagte Rita Dove in einem Interview. Von der Sprache nähert sie sich der Welt, zeigt uns ihre Art der Perzeption.
Eine Verbindung von allgemein menschlichen Gegebenheiten und spezifisch afroamerikanischen Erinnerungsstücken sowie deren Problematik macht die Stärke dieser Gedichte aus. Man wünscht dieser Lyrikerin auch in Deutschland viele interessierte Leser. Das Nachwort von Wolfgang Binder unterrichtet über das Gesamtwerk von Rita Dove, ihren poetologischen Hintergrund und weist in die Zusammenhänge der Schwarz-Amerikanischen Gegenwartsliteratur.
Rita Dove: Die gläserne Stirn der Gegenwart. Gedichte. Amerikanisch und deutsch, ausgewählt und übertragen von Fred Viebahn, mit einem Nachwort von Wolfgang Binder, mit vier Bildern von Laurence Hurst Heiderhoff Verlag, 1989, 161 Seiten, gebunden
Kurt Drawert
Kurt Drawert, 1956 in Brandenburg geboren, mit Lebensstationen Berlin, Dresden und Leipzig, lebt seit 1993 in der Nähe von Bremen. Sein bisheriges Werk wurde u.a. ausgezeichnet mit dem Leonce-und-Lena-Preis (1989), dem Ingeborg-Bach-mann-Preis '(1993) und dem 1. Uwe-Johnson-Preis (1994).
Schon der Titel seines neuen Gedichtbandes „Wo es war" deutet an, worum es darin geht: um eine Vergangenheit in einem „Land der gesplitterten Bäume,/ der verdorrten, der gebrochenen Bäume". Die Form der Gedichte, in denen Drawert unprätentiös, fast berichthaft konstatiert, was gewesen ist, was auch seine Biographie bestimmt hat, ist streng, fast klassisch zu nennen.
Lakonische Feststellungen wie „Die Zeitung ist leergelesen,/die Bücher sind leer", „jedes Jahr wieder/einen falschen Paß in der Tasche,/ wird auch zur Gewohnheit", „Mein Denken funktioniert noch, mein Verstand/ funktioniert noch, aber ich bin nicht zuständig" können nicht darüber hinwegtäuschen, was für Verletzungen der Dichter dort, „wo es war", davongetragen hat.
Die Lakonie ist nicht Resignation, sie wird zur Überlebensstrategie für einen, dem „nur die Dinge im Koffer/sind noch aus einem Leben geblieben,/das ich geführt haben muß./Sie erzählen ins Leere/wann etwas war, und bleiben/zerbrechlich." Diese Zerbrechlichkeit, die Drawert in seine Verse bannt, ohne Pathos und Larmoyanz, ist so privat wie allgemein. Und jeder, der unterwegs ist, der nicht zu suchen und zu fragen aufgehört hat, wird sich in ihnen wiedererkennen: „Auch du reißt keine Lücke ins Spielfeld,/wenn du verschwindest", „Und du hast gedacht du wärest die Welt,/die dich verlor, ein klaffender Riß im Gewebe?".
Es geht um verlorene Träume, die eine große Leere hinterlassen. Nicht von ungefähr taucht dieses Wort häufig auf und auch von Dunkelheit, Schweigen, Tod ist vielfach die Rede. Doch keineswegs metaphorisch, sondern kühl registrierend, wie unter dem Seziermesser des Intellekts: „Deine gefragte Person://sie verschwindet, in besagter Würde/wie immer, im besonderen Stockwerk/unter der Erde".
Es geht um mehr als deutsch/deutsche Verluste und Befindlichkeiten. Natürlich, biographisch gesehen, verarbeitet Drawert seine persönlichen Erfahrungen, z.B. in dem sehr langen Gedicht „Geständnis": „Ich gestehe, im Land der Verwöhnten/lebe ich gern, gern nehme ich/Verwöhnungen hin, ich wehre mich sehr gerne/nicht mehr", worin wir viel vom Scheitern der Visionen, von den Unsicherheiten einer sich neu zu formulierenden Existenz erfahren: „Ich bin herübergefallen/wie eine Frucht vom anderen Grundstück ... ich lehne rigoros ab, mich neu zu erfinden". Thesen und Bücher einer Epoche - alles gründlich abgestanden. Und „vielleicht sind wir ja alle//auch gar nicht mehr da, aber was uns den Umgang mit Toten so schwer macht, ist/daß sie trotzdem noch schweigen."
Soviel steht fest: Kurt Drawert gehört nicht zu den Toten, weil er nicht schweigt. Auch wenn ihm viel zerbrochen ist, wenn er Im vierten Abschnitt des Bandes bekennt, daj3 er „nichts weiß", macht gerade dieses Geständnis seine Gedichte glaubwürdig und zeugen von Unbestechlichkeit. Trost hat er weder für sich noch für andere parat. Das ist auch nicht sein Begehr. Aber etwas ist das schon: „Noch gehen wir aufrecht", obwohl wie nach einem Schiffbruch „liegt nutzlos, was wir erfanden,/wie Strandgut verlassener Küsten auf sterbliche Steine gebettet.
Kurt Drawert versteht es in den Gedichten dieses Bandes meisterhaft, die Gefühle einer zu Ende gehenden Epoche, eines Fin de siècle, zu artikulieren, jedoch ohne Endzeitpathos. Die Lakonie wird dadurch zu einem noch kaum geglaubten Zeichen von Hoffnung. Im vierten Abschnitt des Bandes „Wo es war" ist unter dem Titel „Die Abschaffung der Wirklichkeit" seine Rede zur Verleihung des ersten Uwe-Johnson-Preises nachzulesen.
Auch dieser Text filtert jene Befindlichkeiten heraus, die für Kurt Drawert bestimmend sind: das Gefühl des Vertriebenseins, die Mühen mit der Sprache, die der Wirklichkeit nicht entsprach und noch immer nicht entspricht, welche ihn zu einem Heimatlosen macht. Die vermißte Wirklichkeit zu artikulieren, ist das Vorrecht des Dichters. Es wird für ihn möglich, daß „für den Augenblick/dieser Beschreibung,/der Mythos/vom Glück eingetreten" ist und bleibt zugleich der Zweifel: „vielleicht hat am Ende der Worte/uns in Wahrheit niemals/jemand erwartet ..., und leer/gehen wir hin." Aus diesem Spannungsfeld bezieht Dichtung ihre Legitimation.
Kurt Drawert: Wo es war. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996. 128 Seiten
Erich Fried
1921 in Wien geboren, entkam Erich Fried durch seine und seiner Mutter Flucht nach England im August 1938 nur knapp den Nazi-Häschern. Sein jüdischer Vater war in Gestapohaft so schwer mißhandelt und gefoltert worden, daß er unmittelbar nach seiner Entlassung an deren Folgen starb. Dieses traumatische Erlebnis und die nachfolgende existentielle Heimatlosigkeit im Exil ließen in Erich Fried die Empfindsamkeit heranreifen für den Mangel an Mitmenschlichkeit, für Ungenauigkeit und Verlogenheit im Wortgebrauch.
Sein erster Gedichtband .Deutschland" erschien 1945 und 1946 der zweite mit dem Titel „Österreich". Bereits in diesen frühen Gedichten ist angelegt, was Frieds lebenslanges Thema bleiben sollte, und was er im Vorwort zu einer Neuausgabe 1986 so formulierte: „Die verzweifelte Frage, wie die Aufgaben der Zeit von Menschen, die sich nicht abstumpfen lassen wollen, bewältigt werden können".
So wurde Erich Fried zum nimmermüden Wort-Artisten mit mehr als zwanzig Lyrikbänden, die eine für dieses Genre erstaunliche Auflagenhöhe von mehr als 300.000 noch zu seinen Lebzeiten erreichten. Er, der heimatlos gewordene, blieb seiner Sprache treu. Wie kaum ein anderer hat er unsere gefährdete Welt in seinen Gedichten beschrieben. Mit seinen Worten legte er die Finger auf die überall vorhandenen Wunden. „Wenn er Unglück hat / reißen die Worte / ihn auseinander" -diese Gefahr scheute er nicht. Vielmehr blieb er Mahner und Fragender, der auf Antworten hoffte. Oft mit lauter Stimme, aber auch mit den leisen Tönen eines Liebenden, einen das Leben trotz allem Liebenden.