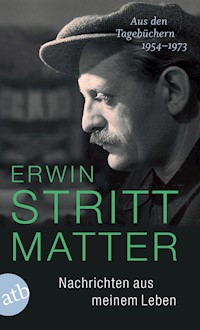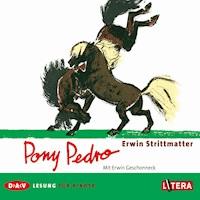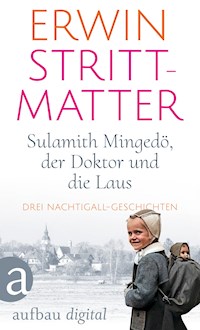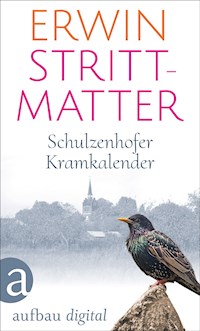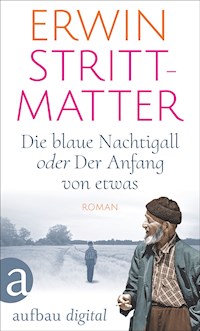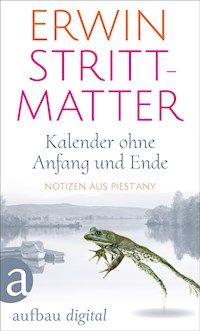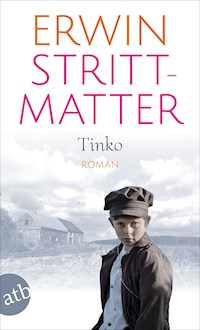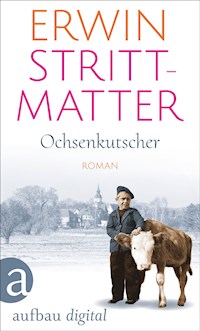
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Erwin Strittmatters Frühwerk.
In einem Dorf in der Niederlausitz kommt Lope Kleinermann als Kind einer armen Landarbeiterfamilie zur Welt. Verzweifelt sucht Lope eine Antwort, warum es so ungerecht zugeht auf der Welt. Erwin Strittmatter kannte das Leben der Kumpel und Tagelöhner, ihre Sehnsucht nach Glück und ihren Humor. Aus dieser Vertrautheit gewinnt der Roman über den heranwachsenden Dorfjungen, der sich mit dem Zustand seiner Welt nicht abfinden will, Wärme und Lebendigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Erwin Strittmatters Frühwerk.
In einem Dorf in der Niederlausitz kommt Lope Kleinermann als Kind einer armen Landarbeiterfamilie zur Welt. Verzweifelt sucht Lope eine Antwort, warum es so ungerecht zugeht auf der Welt. Erwin Strittmatter kannte das Leben der Kumpel und Tagelöhner, ihre Sehnsucht nach Glück und ihren Humor. Aus dieser Vertrautheit gewinnt der Roman über den heranwachsenden Dorfjungen, der sich mit dem Zustand seiner Welt nicht abfinden will, Wärme und Lebendigkeit.
Über Erwin Strittmatter
Erwin Strittmatter wurde 1912 in Spremberg als Sohn eines Bäckers und Kleinbauern geboren. Mit 17 Jahren verließ er das Realgymnasium, begann eine Bäckerlehre und arbeitete danach in verschiedenen Berufen. Von 1941 bis 1945 gehörte er der Ordnungspolizei an. Nach dem Kriegsende arbeitete er als Bäcker, Volkskorrespondent und Amtsvorsteher, später als Zeitungsredakteur in Senftenberg. Seit 1951 lebte er als freier Autor zunächst in Spremberg, später in Berlin, bis er seinen Hauptwohnsitz nach Schulzenhof bei Gransee verlegte. Dort starb er am 31. Januar 1994. Zu seinen bekanntesten Werken zählen sein Debüt »Ochsenkutscher« (1950), der Roman »Tinko« (1954), für den er den Nationalpreis erhielt, sowie die Trilogie »Der Laden« (1983/1987/1992).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Erwin Strittmatter
Ochsenkutscher
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Hans Marchwitza
dem väterlichen Freunde
zum 60. Geburtstag
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Impressum
Es klatscht. Lope fährt aus seinem Traum in die Wirklichkeit. Seine rechte Wange brennt. Er ist quellwach und setzt sich im Bett auf. Mutters wehende Rockfahne verschwindet bei der Tür. Das Türschloss schnappt knallend ein. – Eine Ohrfeige. Er hat eine Ohrfeige erhalten, weiter nichts. Lope kennt das. Mutter hatte ihn geweckt, er schlief wieder ein, sie wurde ärgerlich.
Trude spielt mit einem Käferchen. Ein Viereck des rotweiß gemusterten Bettbezuges ist für Trude ein Zaun. Darüber darf das Insekt nicht hinaus. Trudes dünner Zeigefinger wacht darüber. Der Nagel an Trudes Finger ist abgeknabbert und feucht. Lope lugt zum Waschkorb. Der Säugling schläft. Die Mutter hat ihn trockengelegt. Sie ist schon aufs Feld gegangen. Lope ist zufrieden. Er bewegt sich ganz leise. Die Kleine muss bis zum Mittag schlafen. Das erspart ihm das Trockenlegen. Er flüstert zu Trude hinüber: »Du bist still. Ich nehm dir sonst den Käfer weg.« Trude nickt. Er lässt sich wieder zurückfallen. Einschlafen. Vielleicht findet er seinen Traum wieder.
Der Traum war so:
Er saß auf der Schulbank. Es war der Platz des Klassenersten. Sonst sitzt er auf der Läusebank. Er verhielt sich still. Der Lehrer musste gleich eintreten. Die Klasse lärmte. Er lispelte die Hausaufgabe vor sich hin. Er wollte den Lehrer nicht enttäuschen. Der Lehrer trat ein. Die Klasse brüllte: »Guten Morgen!«
Der hagere Lehrer sagte schrill und drahtig: »Moan!«
Sein geschwungener, glatt angedrückter Schnurrbart zitterte ein wenig. Ein Wetterzeichen. Der Lehrer warf die Bücher aufs Katheder. Er stellte sich davor, schlug die Augen nieder, faltete die Hände am unteren Rockrand, er begann zu beten: »Lieber Gott …«
»… mach mich fromm«, brummte die Klasse, »dass ich in den Himmel komm!«
Die grellgrauen Augen des Lehrers wurden wieder sichtbar. Er räusperte sich. Er begann zu singen: »Ich hab von ferne …«
»… Herr, deinen Thron erblickt«, kreischte die Klasse, »und hätte gern mein Herz vorausgeschickt und hätte gern mein müdes Leben …« Der Lehrer senkte den Blick nicht mehr. Er ließ ihn durch den Schulraum schweifen. Er schaute auf die Kindermünder und suchte solche, die nicht sangen. Er fiel auf Lope. Die Brauen des Lehrers rutschten auf die oberen Augenlider. Seine Nasenwurzel verwandelte sich in eine Hautkerbe. Er gab der Klasse ein Zeichen: Weitersingen! Er sang selbst noch im Gehen: »Schöööpfer der Geister, dir hingegeben.« Dann duckte er sich katzig: »Was fällt dir ein?« Seine Stimme schrillte zwischen die letzten Töne des Gesanges, »was fällt dir ein, dich – auf den ersten Platz zu setzen? Willst mir wohl die ganze Bande verlausen, he?«
Lope sprang auf. Er wollte dem Wütenden seine Hausaufgabe entgegenschnurren.
Zu spät. Der Lehrer war schon bei ihm. Er hob seine Hand. Lope fühlte den leisen Luftzug. Eine Ohrfeige knallte auf seine Wange. Die Ohrfeige war von Mutter. Der Traum hätte anders ausgehen können, sie war dazwischengetreten. Vielleicht hätte er den Lehrer mit der Hausaufgabe überzeugen können. Er saß nicht ohne Kenntnisse auf dem Platz des Klassenersten.
Er müht sich, wieder einzuschlafen. Dabei wird er immer wacher. Trude beginnt auf ihren Käfer einzureden. Schließlich gibt er Schlaf und Traum auf. Er kullert sich aus dem Bett. Der Steinfußboden der Schlafkammer ist kalt. Er hüpft auf einem Bein in die Küche. Dort macht er sich das Haar nass. So sieht er wie gewaschen aus. Seine dünnen, blassen Beine fahren in die Hose. Ein Loch. Der große Zeh bleibt darin haken. Gestern riss er sich’s ein. Das war am Stacheldrahtzaun an der Viehkoppel. Die Hose sagte: Praatsch! Das Loch war wie ein Maul. Das Hemd blitzte dahinter wie eine Zahnreihe. Gestern abend steckte er die Hose hinter den Küchenofen. Er musste das wegen der Mutter. Jetzt muss er sie flicken. Er schiebt den Besenstiel unter den Türgriff. Trude muss ausgesperrt werden. Sie ist noch klein und klatscht … Der schwarze Zwirn ist aufgebraucht. Da nimmt er Ofenruß und schwärzt den weißen. Er zieht das Loch zusammen. Die Falten reibt er zwischen den Ballen seiner mageren Hände glatt. Wieder flutschen seine Beine durch die Hosenröhren, wie weiße Pfeile. Jetzt kann er den Besen vom Türgriff nehmen. Trude hat bereits am Türgriff gerappelt. Er fegt geschäftig die Asche beim Küchenherd zusammen. Trude kommt. Sie hat die dünne Rechte zur Faust geballt. Sie grinst: »Ich will eine Schachtel!« Er gibt ihr eine leere Streichholzdose für ihren Käfer.
»Musst dich selbst waschen, keine Zeit heute.«
»Kaltes Wasser?«
»Ja.«
Trude heult. In Lope rührt sich Mitleid. Manchmal sitzt es bei ihm in der Brust, manchmal in den Augen. Heute spart er Arbeit und Zeit durch das Mitleid.
»Na, lass, aber sag Mutter nichts.«
Dieser Traum aber auch! Er hat zu lange im Bett gelegen. Er muss jetzt Windeln waschen und spülen, sie stehen eingeweicht im Waschzober am Ofen. Er arbeitet hastig und halb.
Die Windeln kochen. Der ätzende Wrasen durchwalmt die Küche. Lope schneidet Brot für sich und die Schwester ab. Auf den Brotlaib hat die Mutter mit dem Daumennagel ein Zeichen geritzt, das tut sie jeden Morgen, bevor sie zur Arbeit geht. Bis zu dieser Marke darf er abschneiden. Das Brotstück ergibt zwei Scheiben. Er gießt die vorgekochte Suppe aus Roggenschrot in die Essnäpfe. Sie essen pustend und klappernd, schmatzen die Teller leer, verspeisen den Rest aus dem Topfe, kratzen mit den Löffeln jedes Krümelchen heraus und sind noch nicht satt. Lope versetzt mit seinem schwarzrandigen Daumennagel das Zeichen am Brotlaib. Das ergibt eine dünne Scheibe. Er teilt sie mit der Schwester.
»So, das muss jetzt reichen!« Er sagt es, um den eigenen Appetit einzudämmen. – Dann hängt er die gelbgestriemten Windeln auf die Schnur. Das Kind im Wäschekorb schläft. Gott sei Dank, schläft noch. Trude muss hinaus auf den Gutshof. Sie macht sonst die Kleine mit ihrem Singsang von »Fliegmariechen« wach. Lope legt seine Schiefertafel zwischen Lese- und Rechenbuch. Er klemmt sie mit dem Schieferkasten zusammen unter den Arm. Dann schließt er die Wohnung ab. Den Schlüssel hängt er sich mit einer Schnurschlinge um den Hals.
In der Schulpause springt Lope nach Hause. Die Kleine ist wach. Sie schreit. Er muss sie trockenlegen. – Er kommt in die Klasse zurück. Die anderen sitzen schon mit gefalteten Händen auf ihren Plätzen.
»Wo treibst du dich herum?« Die Stimme des Lehrers ist wie eine Peitsche.
»Ich … war zu Hause zum Essen.« Lope lügt es. Er will von den anderen nicht gehänselt werden. Nur Mädchen legen sonst Kinder trocken.
»Da hast du wieder zu lange gefressen.« Es kommt gallig, vergiftet. Der Lehrer stakt durch den Klassenraum. Seine Augen sind graugrüne Glasknöpfe. Er steht am Papierkorb.
»Wer hat sein Butterbrot wieder da hineingeworfen?«
Kurt Krumme, der Häuslersohn, duckt sich. Die dickpatschigen Hände einiger Mädchen weisen auf ihn. Die Augen des Lehrers bohren sich in Kurt Krummes Gesicht. Kurt Krumme zieht sich zögernd mit eingeknickter Hüfte vom Sitz hoch.
»Wie oft habe ich gesagt, dass Brot nicht in den Papierkorb gehört! Wie oft soll ich’s noch sagen? – Wer sein Brot nicht essen mag, lege es aufs Katheder. Ich geb’s meinen Hühnern.«
Albert Schneider bringt sein belegtes Brot nach vorn.
»Mensch, der ist verrückt … Schinkenbrot.« Paule Wenskat flüstert es in der vordersten Bank. Der schmächtige Paule Wenskat. Trine Fürwell, eine Bergmannstochter, legt ihr Margarinebrot dazu. Orge Pink klatscht seine Pflaumenmuschnitte drauf. Die Habichtaugen des Lehrers stieren zum Katheder. Lope hat sich über die vordere Bank gelegt. Er erwartet Stockhiebe für seine Verspätung. Der Lehrer ist mit den Frühstücksbroten beschäftigt. Lope liegt ergeben auf der Pultbank. Ein Gelächter taut auf. Die Hautkerbe an der Nasenwurzel des Lehrers wird flacher. Er geht zu Lope, richtet ihn auf, gibt ihm nur ein fahriges Kopfstück: »Morgen pünktlicher, verstanden?«
Lopes Pünktlichkeit regelt die kleine Schwester. Ein Glücksspiel mit den Hieben! Wenn die Kleine nass bleibt, schreit sie. Die Mutter prügelt ihn mittags mit dem Holzpantoffel. Legt er das Kind trocken, kommt er zu spät zum Unterricht, prügelt ihn der Lehrer mit dem Stock. Heute ging es gut. Er entscheidet sich für die Prügel des Lehrers. Er legt die Kleine lieber trocken.
Lope setzt sich in seine Läusebank. – Das war schon eine Weile her, da hatte Trude Läuse bei den Zigeunern aufgelesen. Die Zigeuner rasteten auf dem Dorfanger und brieten einen Igel. Das Erlebnis war gerade in die Erinnerung der Kinder eingeklungen, da gewahrte der Lehrer eine Kopflaus auf Lopes dickem Haarwulst. Mit seinem Raubvogelblick erspähte er sie. Er setzte Lope auf die Läusebank. Sie steht abgesondert an einer Längsseite des Schulzimmers. Viele Läusebrüder haben aus Langeweile die Anfangsbuchstaben ihrer Namen in sie eingeritzt. Klobige Buchstaben, mit Tinte ausgeschmiert.
Läuse also! Die Mutter durchsuchte damals alle getragenen und hängenden Kleidungsstücke der Familie. Sie fand hin und wieder eine Kleiderlaus. Eine bei sich, eine beim Vater. Kopfläuse bei Trude. An diesem Tage ging sie weder aufs Feld noch in den Herrschaftsgarten. Mag werden, was da will, aber Läuse, nä! Es hob ein großes Kochen und Säubern an. Der Vater schnitt Lope das Haar. Er war ausnahmsweise einmal nüchtern dabei. Deshalb überzogen Absätze, Stufen und Treppen den schmalen Schädel des Jungen wie einen Rebhügel. Trudes Haar wurde mit Sabadillessig durchtränkt. Für Tage trug sie ein Tuch. Danach hätte die gnädige Frau in ihrem besten Pelzmantel bei den Kleinermanns auf dem Fußboden frühstücken können – sie hätte keine Läuse in das Schloss getragen. Die Mutter durchsuchte noch wochenlang allabendlich Trudes wüste Haarzotteln. Es rührte sich nichts mehr. – Lope blieb aber auf der Läusebank sitzen. Der Unterricht zog an seinen Augen vorüber. Er fühlte sich wie damals, als er krank im Bett lag. Die Familie setzte sich an den Tisch, aß Pellkartoffeln, und er musste zuschauen. Er war Gast in der Schule. Ein Junge aus dem Wagen eines Puppenspielers, der nach wenigen Tagen wieder weiterzog, der nicht die richtigen Bücher hatte und niemals gefragt wurde. Lope benutzte Gelegenheiten. Er stellte sich vor den Lehrer. Sein kahlgeschorener Schädel musste auffallen. Eine Laus hätte sich darauf wie ein Elefant in der Wüste ausgenommen. Der graugrüne Blick des Dorflehrers schien an der glatten Fläche abzugleiten. Er fiel auf andere Dinge. Als das mit den Läusen passierte, ging Gottlieb Kleinermann, der Vater, unrasiert umher. Er wollte sparen. Er wollte nicht mehr saufen. Der Teufel weiß, weshalb er sich das vornahm. Wollte er dem gnädigen Herrn vielleicht zwei alte Pferde abkaufen? Wollte er sich selbständig machen, freikaufen damit?
Später ging alles wieder normal zu. Liepe Kleinermann soff wieder. An Feiertagen arbeitete er grundsätzlich nicht, verdammt noch mal! An normalen Sonntagen arbeitete die Frau, Mathilde, im Herrschaftsgarten, in den Gewächshäusern oder in der Schlossküche. Liepe ging dann zum Barbier und ließ sich rasieren.
Allerlei Neuigkeiten beim Barbier.
»Die Kaiserin ist krank. Die Frau des Kaisers, mein ich. Ach herrje!«
»In Sachsen wird mit richtigen Gewehren auf die Roten geschossen.«
»Auf die Roten? – Warum nicht, das sind solche, die bloß nicht arbeiten wollen. Sie wollen alles teilen. Aber wenn niemand nicht arbeitet, gibt es nichts zu teilen, bitte.«
Im Wirtshaus bei Wilm Tüdel bestellt Liepe einen Schnaps. – Weshalb nicht? – Ist etwa nicht Sonntag? – »Weshalb arbeiten sie nicht, wie vernünftige Deutsche, die Roten, mein ich. – Einen Pfefferminz noch! – Wenn man nicht arbeitet und streikt, kommt man bloß auf dusslige Gedanken. – Einen Bitteren zum Schluss, einen Magentrost!«
Dann geht Liepe heim. Er ist seinen Bart los. Er hat eine schwere Zunge. Mit dieser Zunge versucht er hochdeutsch zu sprechen. Er verlangt auch hochdeutsche Antworten von den Kindern. Nach seiner »Konfürmation« wollte er eigentlich »Handwörker« werden. Fleischer wollte er werden. Schon im letzten Schuljahr half er im Schlachthaus des Dorfschlächters. Seinen Wunsch zerfraßen die Ochsen des gnädigen Herrn.
»Ooodnung und Saubakeit im Schlllachthaus!« Er nimmt den Eimer von der Wasserbank und kippt ihn auf den Fußboden der Küche. Alles geht, wie oft erprobt: Trude greift leise jammernd nach Birkenbesen und Scheuerlappen, sie verteilt damit das Wasser im Raum.
»Der Stift rennt wieda mit langen Loden um den Wurstkössel herum! Sollen die Läuse vülleicht in die Grützwurst fallen, wie?«
Das ist das Einsatzzeichen für Lope. Er holt Handtuch und Schere, setzt sich auf den wackligen Ofenhocker und legt das Handtuch über seinen Rockkragen. Den Kamm holt der Vater selbst torkelnd aus dem Versteck. Versteck? – Ja. Was brauchen die Kinder den Kamm? Sie brechen nur die Zähne aus. Das Haarschneiden beginnt. Liepe verrichtet es in betrunkenem Zustand mit Geschick und Ausdauer. Nichts von einem Rebhügel! Alles ist glatt. Dabei berichtet er munter von seinen Erlebnissen im Schlachthaus und beim Viehtreiben. Und was er alles kann! Er kann Wurst machen und einen ausgewachsenen Bullen abstechen. Einen, den man mit Blende und gefesselten Vorderfüßen über die Landstraße treibt. Die Kinder sind vergnügt. Wenn der Vater betrunken ist, ist er lustig. Sie versäumen nicht, ihn an manche Vorfälle zu erinnern. Sie kennen seine Geschichten.
»Das war, die Kuh hatte zu kleene Beine … äh, kleine Beene … oder bleine Keene …«, verbessert sich Liepe. – Einmal schor er vor Begeisterung und Eifer auch das heulend abwehrende Mädchen. »Bei dir höcken doch auch die Läuse, denke ich. Jaaa, Ooodnung und Saubakeit im Schlllachthaus ist Grundbedüngung.«
An normalen Tagen spürt man Liepe im Haus kaum. Wenn er abends vom Hofe hereinkommt, isst er schweigend und setzt sich dann auf die Ofenbank. Er kaut Priem und bindet Rutenbesen, oder er bessert etwas an seinen Pferdegeschirren aus. Seine kleinen, grauen, zuweilen traurigen Augen sehen selten von der Arbeit auf. Er denkt sich an seinem Schicksal wund. Das paktiert mit dem gnädigen Herrn. Sonntäglich betäubt er das Brennen der Wunden mit Alkohol. An den Abenden der Woche erfummelt er sich mit dem Besenbinden das Geld für die betäubende Medizin. Manchmal nickt er bei der Arbeit ein. Sein Kopf sinkt nach vorn. Speichel rinnt aus seinem Mund. Die Lippen entblößen die Stoppelzähne. Schließlich sinkt sein Kopf auf die Ruten des Besens. Dann wirkt Liepe wie ein besenbartiger Ginstergreis. Die Kinder schlüpfen belustigt in die Schlafkammer. Liepe sucht an solchen Tagen sein Bett gar nicht auf. Er schläft, wie er ist, auf der breiten Ofenbank. Die Frau, Mathilde, spricht mit ihm wie mit einem Kinde. Sie ist der Kapitän des kleinen Familienschiffes. Er ist nicht einmal ein Steuermann. Er fuhr mit dem Familienschiff um eine Boje herum. Es ist sein siebzehntes Lebensjahr, diese Boje. Seine Gedanken, diese pickenden Möwen, umkreisen diesen Zeitpunkt seines Lebens. Als er die Frau heiratete, als sie ihn nahm, flammten seine Wünsche nach einem anderen Leben noch einmal in ihm auf. Das war um sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr. Sie hatte es damals so eilig. Sie war so bienig geschäftig. Was sie anpackte, ächzte unter ihren harten Händen. Er hoffte, dass sie ihm helfen würde. Aber da kamen schon die Kinder. Viel zu früh. Freilich tauchten Wege aus der Enge manchmal blitzlang hinter seiner schmalen Stirn auf. Sie wurden aber immer wieder von diesen kleinen, ewig hungrigen, schreienden Wänsten versperrt. Er sprach über seine Gedanken nicht zu seiner Frau. Sie ahnte sie wohl. Nein, er widersprach nicht. Die Kinder waren eben da. Sie wurden zur Feder des Uhrwerks, das in den Arbeitstagen ablief, sich abnutzte. –
Er ist selten gereizt oder patzig, der Liepe. Ausgenommen an den Sonntagen, wenn er vom Barbier kommt. Dann schweigt eben Mathilde. Mag er mit dem Wasser planschen, der alte Esel. Wenn er nur sonst keine Dummheiten macht. An solchen Tagen findet sie sich auch mit seiner albernen Wichtigtuerei ab.
Liepe arbeitet auf dem Gutshofe mit zwei Pferden. Er ist dabei, das zweite Gespann aufzubrauchen. Also ein guter Kutscher! Tiere, Geschirr und Gerät gehen gepflegt aus seinen rissigen Händen hervor. Selten, dass er abends seinen Platz auf der Ofenbank nicht einnimmt. Die Familie wartet dann mit dem Abendbrot. Mathilde läuft unruhig in der Küche auf und ab. Sie schaut unauffällig aus dem Fenster. Rein aus Gewohnheit. Im Fenster steht ein viereckiges Stück Finsternis.
»Wird wohl wieder was verschieben.« Sie brummt das mit ihrer halben Männerstimme. Die Worte nehmen ihre fleischigen Lippen kaum in Anspruch. Verschieben? Das ist eine Arbeit, die Lope noch nicht kennt. Es scheint nichts für Kinder zu sein. Auch das Decken und Kalben der Kühe geht die Wänste nichts an. Lope muss also warten, bis er groß ist. Dann wird er wohl das Verschieben lernen.
Er braucht nicht zu warten. Eines Abends ruft ihn der Vater vom Abendbrottisch weg. Sie gehen auf den Hof. Lope muss sich vor die Stalltür stellen.
»Du bist jetzt schon groß genug und kannst mir dies und das helfen!«
Auf dem Hofe hantiert nur noch die Frau des Vogtes mit Eimern am Brunnen. Der Vater weist mit einer Neigung seines schmalen, schlotternden Körpers nach dort hin. »Wenn sie weg ist, pfeifst du ein Lied!«
Sie geht, sie schlägt die Tür ihrer Wohnung zu. Lope pfeift: »Ein Mädchen wollte Brombeern pflücken …«
Der Vater kommt. Er trägt einen gefüllten Sack. Er hat ihn über Schultern und Nacken liegen. Auch er schaut sich noch einmal prüfend um. Er muss die Augen verdrehen unter der Last. Sie gehen durch die Viehkoppel. Lope muss so um dreißig Schritte vorausgehen. Er soll wieder pfeifen, wenn jemand kommt.
»Wieder das gleiche Lied?«
»Ist doch quarkegal«, ächzt der Vater.
Sie haben die Koppel durchquert. Jetzt gehen sie am Dorfrand entlang. »Zum Bäcker«, stöhnt der beladene Liepe. Der Junge stapft hurtig voran. Er tut es unbefangen, wie am helllichten Tage. Was kann geschehen? Vater ist bei ihm. Das ist ein neues, gutes Gefühl. Die Wiesen sind taufeucht. Die Sterne liegen im rabigen Dunkel wie aneinandergefallene Funken im Ofenloch. Es grillt im Grase. Es grischelt in den Bäumen. Etwas Schwarzes steht am Rande des Feldes. Lope zuckt. Der Schreck zerrt seine Lippen breit. Sie wollen sich nicht zur Pfeifründe formen.
»Harre, meine Seele …«, pfeift er dann doch. Nach den ersten Tönen ein dumpfes Aufschlagen im Grase. Der Vater hat den Sack abgeworfen. Er hat sich in einen kleinen Graben rollen lassen. »… harre des Herrn!« pfeift Lope weiter. Er starrt auf das länglich dunkle Ding. Es bleibt stehen. Lope rupft einen Grasbüschel aus und wirft verspielt nach dem schwarzen Ding. Liepe ist herangekommen. Er berührt mit der Rauhhand die Schulter des Sohnes: »Wo?« Sein Atem geht noch keuchend von der Last. Der Junge erschrickt. Er fängt sich wieder und weist mit der in der Schreckbewegung aufgeflogenen Hand zitternd auf das schwarze Etwas vor sich.
»Dummlack«, kommt es raunzig, »der alte Pflaumenbaum. Der letzte Hagel hat ihm die Krone abgeschlagen.« Liepe nimmt den Jungen bei der Hand. Er führt ihn. Lope geht zum ersten Male mit dem Vater Hand in Hand.
Die große, rissige Hand des Vaters zittert ganz leise. Nur so unter der Haut. Lope versucht, im Dunkeln das Gesicht des Alten zu erkennen. Der wischt mit der Linken den Schweiß von Stirn und Augen.
»Wenn da doch jemand steht, dann sagst du: ›Jetzt müssen wir gleich an dem Nest sein. Da sitzt ein Rebhühnchen auf Eiern‹, ja?«
»Wie, welches Rebhühnchen?«
»Na, bloß so …«
Es ist nichts anderes als der Rest eines Pflaumenbaumes. Liepe atmet auf.
»Ja, da kannst du sehen, man muss nicht immer gleich solche Bange haben, hähä!«
Der Vater geht zurück, huckt den Sack wieder auf. Sie kommen zum Hofe des Bäckers. Liepe findet sich gut zurecht. Das hintere Tor ist nur angelehnt. Er stößt mit dem Fuß dagegen. Sie gehen über den Hof in die Backstube. Dort steht der weißbeschürzte Bäcker. Er wirft einen unwilligen Blick auf den Jungen. Liepe nimmt den Bäcker beiseite. Sie flüstern miteinander.
»I wo, denk doch nicht!« Liepe stößt unruhig mit dem Fuß an den Sack. Es raschelt trocken darin. Lope ist nie in einer Backstube gewesen. Das Brot für die Familie holt er im Laden ab. Neue Eindrücke fallen durch seine glänzenden Augen. Ihr verwaschenes Blau zwischen den skrofulösen Lidrändern lässt sie aussehen wie kleine bunte Fenster. Da sind nun der Backofen, die Tröge, die Teigteilmaschine. Der bauchige Bäcker schlürft davon. Der Vater keucht noch. Der Bäcker kommt wieder zurück und hält Lope eine Zuckerstange unter die Nase. Der sieht nur noch die Zuckerstange, keine Brotschieber, keine Kuchenbleche mehr.
Sie gehen den gleichen Weg zurück. Die Bäckerei verschwindet im Abendnebel. Liepe beginnt mit gestrafften Knien auszuschreiten.
» Iss jetzt deine Zuckerstange, sie gehört dir allein. Du hast dafür gearbeitet. Du brauchst den Weibern nichts abzugeben.«
Lope nickt zufrieden. Er beißt ab. Der Vater ist stehengeblieben. Er klimpert mit losem Geld, zieht es aus der Tasche und versucht es im Dunkeln zu zählen. Auch Lope hält ein. Er sieht sich kauend nach dem Vater um.
»Dass du der Trude nicht erzählst, wo wir waren! Du bist jetzt schon bald ein Mann. Das Weibervolk muss den Quark wissen.«
Lope lässt die Zuckerstange im Ärmel verschwinden. Männer essen keine Zuckerstangen. Liepe steckt in jede Tasche etwas von dem Gelde. Sie gehen nicht wieder Hand in Hand. Weshalb auch? Den Pflaumenbaumstumpf kennen sie ja.
Liepe wird froh und gesprächig. Alles in allem, Lope sei jetzt schon erwachsen. Er müsse so manches wissen und lernen, was Kindern verheimlicht werde. Nächstens solle er beim Kalben der Kühe zusehen dürfen. Lope ist wieder mit seiner Zuckerstange beschäftigt. Sie glitzert speichelnass im Mondlicht. »Denkst du, ich habe etwas Unrechtes getan?« fragt der Vater mehr sich selbst. Er habe das Pferdefutter den Monat über gut eingeteilt, das sei nur der Hafer gewesen, der übrigblieb. Lope steckt den Rest seines Naschwerkes in den Mund.
»Es kann doch niemand sagen, dass meine Pferde Dürrländer sind, oder?« will der Vater wissen.
»Mmmnein«, sagt Lope.
Er versteht noch wenig von Pferden.
»Jaja, da kannst du sehen, was das ausmacht: Kartoffeln, Sonnenblumenkerne. Fett wie Schnecken werden die Pferde davon.«
Lope schaut auf den Mond. Er leckt sich die Lippen und nickt stumm.
»Wie?«, der Vater fährt herum, »den übrigen Hafer dem Inspektor zurückgeben?«
Lope hatte eigentlich nichts gesagt. Nein, für so ungescheit solle er den Vater doch nicht halten, hähä! Das fehlt noch gerade! Die Worte seines Selbstgesprächs hüpfen Liepe wie Frösche aus dem Munde: Kein Kutscher gibt zurück, was er herausgewirtschaftet hat. Was würde geschehen, wenn er, Liepe, damit begänne? – Sie würden doch über ihn herfallen. Wie? Ja, punktum und basta.
Die Mutter empfängt sie mürrisch: »Alles ist kalt geworden. Was soll der Fratz so lange in der Nacht draußen?« Liepe bläst mit vollen Backen auf die dampfende Kartoffel, die er pellt. »Wovon hast du so rote Finger, hast du geblutet?« Lope schüttelt den Kopf. Er leckt die Finger nachgenießend ab. Nach dem Essen schlüpft er in die Kammer. Trude und die Kleine schlafen schon. Das Bett steht im grausilbernen Mondlicht. Es ist immer noch das kurze Kinderbett. Trude und er haben es zusammen. Nun muss er wohl ein langes bekommen. »Du bist jetzt schon bald ein Mann.« – Ein Mann kann nicht mit dem »Weibervolk« zusammen schlafen.
Liepe sitzt mit übergeschlagenen Beinen auf der Ofenbank. Seine Augen verfolgen die Bewegungen, die sein rechter Fuß mit dem Holzschuh ausführt. Seine Hände liegen auf den Rocktaschen.
»Du bist wohl ganz und gar verrückt.« Mathilde stützt die Hände in die Hüften. Ihre Klumpennase ist blass. Die Mundwinkel sind wie Drähte aus Zorn. Alle Falten des Gesichts hängen daran.
»Was musst du den Jungen mitnehmen? Bloß weil du allein die Hosen voll Angst hast.«
»Er hat bessere Augen, ich wollte … hier ist mein Geld für deine Schuhe.« Liepe sieht sie von unten herauf an. Er fasst in die Tasche.
»Schuhe, Schuhe? Quark, Schuhe! Schnaps. Behalt deine Silberlinge. Ich verdien mir meine Schuhe selbst. Das kannst du dir merken. Mach ich selber, und wenn ich auf die Nase falle.«
»Eben …«
»Ach, eben! Ich pfeif auf solche Schuhe. Wenn sie dich schnappen, dann hast du deine Schuhe! Und dann der Junge, nein, geh mir los.« Freilich, die Hälfte des Erlöses vom verschobenen Hafer sollte Liepe gehören. Wer aber kann wissen, ob er wirklich vorhatte, das Geld für Schnaps auszugeben? Kann er vielleicht keine Pläne haben? Auch andere Menschen auf Erden haben Pläne. – Es glaubt niemand mehr an seine Pläne. –
So sitzt er; er würde die Nacht auf den Zinken einer Egge geschlafen haben, wenn er die Frau damit von der Redlichkeit seiner Absicht hätte überzeugen können.
Wo der Park noch nicht anmaßend mit Douglastannen, Korkeichen und Mandelbäumen prahlt, steht das Sekretariat. Es steht unter ländlichen Birken, Robinien und dunklen Fichten. Es ist aus den gleichen Steinen erbaut, mit dem gleichen Mörtel verputzt und trägt so leuchtende Dachsteine wie das Schloss. Es hebt sich nicht so hoch und hell wie dieses in den Himmel, es ist aber auch nicht so niedrig und dunkel wie die Hütten der Gutsarbeiter. Efeu und wilder Wein wuchern um den Eingang und die Fenster. Eine Wand aus grünen Blättern. Das Paradies von drei- bis vierhundert Gutssperlingen. Manchmal pulvert der Inspektor an seinen tollen Tagen eine Schrotladung hinein.
»Die Spatzen sind die Prroleten unter den Vögeln! Prrrradautz. Hoa, hoa, hoa, hoaaaa!« Die Stimme des Inspektors. Jeder Grashalm auf dem Gute kennt sie. Alles wird ein wenig kleiner vor Respekt. Sie überflutet den Hof, die Gemüsegärten und den halben Park. Als ob man barfuß über einen Stoppelacker geht, so hart, rauh und stachlig ist diese Stimme. Der Kartoffelschnaps der Brennerei ist schuld daran, dass sie so hart ist.
»Die Hecke muss weg!« stachelt die Stimme. »… muuuss weg«, hallt es aus einer Tenne zurück.
»Ein Spatz frrisst am Tage – wenig gerrechnet – zwanzig Grramm Getrreide. Macht bei dreihunderrt Spatzen auf den Tag sechs Kilogrramm. Das sind – wenig gerrechnet – drreihundert Spatzen im Jahrr, zweitausendeinhunderrtundneunzig Kilogrramm gleich drrreiundvierrrzig Zentner und achtzig Pfund.« Aber der gnädige Herr will sich gerade in dieser Angelegenheit nicht überzeugen lassen.
»Es nisten auch Fliegenschnäpper und Rotschwänzchen in der Hecke, lieber Konrad.«
»Hat sich was, Herr Landrrat, bei dem frrechen Sauvolk von Spatzen fühlt sich kein menschenwürrdiger Vogel wohl.«
»Nun, aber die Spatzen fressen ja wohl nicht nur Getreide, sondern auch andere Vegetabilien, Konrad.«
»Vegetabilien, als da sind Kirrschen, Salatpflänzchen, keimende Errbsen und derrgleichen mehrr.«
»Ach was, ich meine auch Würmer und Schnecken.«
»Wenn – mit Verrlaub zu sagen, gnädiger Herr –, wenn man sie ihnen in den Schnabel stopft.«
»Ach, gehen Sie doch! Ich habe ja schließlich auch meine Erfahrungen, nicht?«
Die Spatzenschlacht ist ausgekämpft. Die Blätter der grünen Wand rascheln leise. Die verjagten Vögel kehren zeternd zu ihrem Genist zurück.
Außer dem Inspektor und seiner Frau wohnt noch jemand im Sekretariat; ihn stören die Spatzen nicht. Es ist der Gutssekretär Ferdinand. Er ist der Sohn des Dorfmüllers.
Als Kind soll er klug gewesen sein. Man erzählt es auf dem Gutshof und im Dorfe. Jetzt kann das niemand mehr beurteilen. Sein Vater wollte einen Pfarrer aus ihm machen. Er schickte ihn in die Kreisstadt Ladenberg auf die hohe Schule. Das hatte seinen Grund. Der Ortspfarrer hatte einmal in einem Gleichnis einen Müller erwähnt. Er ließ den Müller in seinem Gleichnis Mehl mit Kleie fälschen. Da verließ Ferdinands Vater die Kirche, wie er es auf jeder anderen Versammlung auch getan hätte. Er schwor, nicht wieder hineinzugehen, selbst wenn die Kirche abbrennen sollte. Insgeheim wartete er auf den Augenblick, wo sein Sohn die Kanzel besteigen würde. Er sollte den grauen Pfaffen in den Ruhestand predigen. Auf diese Weise wollte er dem Geistlichen beweisen, dass der Kopf eines Müllers das kluge Predigen erlernen könne, niemals aber die Hand eines Pfarrers den kornkundigen Griff des Müllers.
Ferdinand ging mit zweckenbeschlagenen Schuhen in die Stadtschule. Er kam nur in den Ferien nach Hause.
Dann ging er barfuß. Er nahm Vogelnester aus und wunderte sich über die kleinen Häuser des Dorfes. Die Kartoffeln mussten ihm zum Abendbrot geschält werden.
Als er sechzehn Jahre alt war und immer noch im schwarzen Kirchanzug seines Vaters in die Schule ging, verliebte er sich in die Tochter des Gutsherrn. Das Schlossfräulein hieß Kriemhild von Rendsburg. Es war damals fünfzehn Jahre alt. Das Schlossfräulein wurde daheim von einer Hauslehrerin unterrichtet. Die Brüder des Fräuleins waren noch klein. Die Hauslehrerin verschroben, Vater und Mutter immer mit anderen Dingen beschäftigt, die Dorfmädchen zu dumm, die Burschen zu frech. So blieb der Sohn des Müllers. Er war der einzige Mensch im Dorfe, mit dem sie in den großen Ferien über Mädchenromane sprechen konnte. Sie sprachen wohl nicht nur darüber. Die Ferien vergingen. Ferdinand verspürte danach keine Lust mehr, in die Schule zu gehen. Er wisse jetzt genug, erklärte er dem Vater. Der starrte ihn mit aufgerissenen Augen unter bemehlten Wimpern an. Er verprügelte ihn und sperrte ihn drei Tage ins Müllerkämmerchen auf der Windmühle. Auch das fruchtete nicht. Der Alte beschloss seufzend, ihn als Lehrling auf die Mühle zu nehmen.
Ferdinand hatte von der Mühle keine hohe Meinung. Nein, immerfort wie ein Schneehase wollte er nicht umhergehen. Er sah ja geradezu tagaus, tagein wie ein weißer Schornsteinfeger aus. Dazu sei er übrigens nicht auf die hohe Schule gegangen. Da warf ihn der bucklige Müller hinaus.
Kriemhild von Rendsburg fand es reizend, von einem Dorfjungen so stark geliebt zu werden. Es war wie in einem ihrer Romane. Sie schwor und trampelte darauf, dass Ferdinand ein Naturbursche sei. Sie hielt ihn für stark, weil er sich um ihretwillen mit seinem Vater entzweite. Sie zog unter viel Tränen und Verworrenheit ihren Pappi zu Rate. Sie beschwor ihn, Ferdinand im Gutssekretariat zu beschäftigen. Der alte Herr von Rendsburg runzelte die hohe Stirn. Er hatte keine Schwäche für verkrachte Gymnasiasten. Er war wohl selbst einer. Kriemhild ließ nicht ab, ihn zu bewegen, ihre Liebe nicht zu zerstören. Sie sagte allerdings nicht »Liebe«, sie sagte »Freundschaft«. Schließlich gab der gnädige Herr dem Drängen seiner verwöhnten Tochter nach. Ferdinand wurde für sein Essen und ein Taschengeld als Volontär im Gutssekretariat eingestellt.
Es zeigte sich, dass es kein schlechter Gedanke war. Die Zahlen des alten Gutssekretärs Ladewig begannen zittrig zu werden. Der gnädige Herr ging nur mit Widerwillen seine Aufrechnungen durch. Ein Jahr später starb Ladewig. Ferdinand wurde Gutssekretär.
Aber schon nach diesem einen Jahr stellte sich manches heraus: Die Liebe zwischen Ferdinand und Kriemhild war nicht ein so großer Brand. Auf Kriemhilds Seite war sie jedenfalls nach dieser Zeit nur noch wie eine verlöschende Braunkohle im Herd der Schlossküche. Sie hatte inzwischen gelernt, auf feurigen Pferden über die Äcker zu reiten. Das Temperament, mit dem der Gutssekretär Ferdinand dienen konnte, war ihr zu gering. Es genügte ihr nicht mehr, täglich von seinen himmelblauen Blicken umlagert zu sein. Sie war für männliche Taten. Was aber sollte Ferdinand tun? Sollte er vielleicht in den Schlossgraben springen? Aus all den Schlingpflanzen unter Lebensgefahr eine Seerose für sie pflücken?
Der Herr Gutssekretär Ferdinand lässt bei Lopes Mutter seine Wäsche waschen. Langsam und versonnen schaukelt sie am Sonntagmorgen auf der Leine vor dem Gemüsegarten: eine veilchenblaue Unterhose aus Seide, Hemden mit blauen Sternchen am Latz, cremegelbe Taschentücher mit großem, blaugesticktem Namenszug. O ja, feines Zeug! Der Herr Gutssekretär. Liepe kommt lallend vom Barbier. Die Kinder erwarten Schlachthaus-Exerzieren. Mit unsinnigen Bewegungen tritt der Vater an das geöffnete Fenster. Die Mutter hantiert draußen mit der Wäsche.
»Wäschst du immer noch für diesen Bock?«
Keine Antwort.
»Er bezahlt dir wohl deine Schuhe, wie?«
Keine Antwort. Die Mutter sieht nicht einmal von ihrer Arbeit auf.
»Dieser bleiche Bock! Er frisst zuwenig; hähä, gönnt sich kein Fressen; steckt alles in die Bücher.«
Liepe schlägt das Fenster zu. Er wendet sich an die Kinder. »Wenn man arbeitet, so richtig arbeitet, wird man nicht bleich und braucht keine Bücher! Na ja, seht ihr?«
Die Kammertür schlägt zu. Ein Bett knarrt. Die Kinder atmen auf. Sie laufen kichernd hinaus. Manchmal holt Ferdinand seine Wäsche am Sonntag selbst ab. Er benutzt die Zeit, wo Liepe zur Abendfütterung im Stall ist. Manchmal aber klopft er mit dem Handrücken an die Fensterscheibe. Sein Wohnstübchen liegt hinterm Sekretariat. Der dicke, blaue Stein des Ringes klirrt über das Glas. Ferdinand trägt ihn am kleinen Finger der linken Hand. Lope schaut erst eine Weile diese Hand an. Sie hängt schlapp, wie ein grauweißes Tuch, am Gelenk. Dann begreift er. Er huscht durch das Sekretariat in Ferdinands Stübchen. Es duftet nach abgelagertem Zigarrenqualm. Im kleinen Eisenofen flackert trotz der warmen Witterung Feuer. Das Bett ist zum Sonntag mit einer grauen Wolldecke bedeckt. Die Ecken der Decke sind mit großen Hufeisen bemalt. Die Hufeisen werden von Reitpeitschen gekreuzt. – Eine Pferdedecke. – Ein langes Brett, auf dem Ferdinands Bücher stehen, hängt über dem Bett. Unter dem Bücherbrett, dort, wo der Kopf des Herrn Sekretärs zur Nacht ruht, hängt ein kleines Bild: Kriemhild von Rendsburg, als sie noch Zöpfe trug. Hinter das Bild ist eine dunkle Rose gesteckt. Sie lässt abendmüde die ersten Blütenblätter auf die Bettdecke fallen. Auf der andern Seite des Stübchens steht eine Art Sofa. Gutsstellmacher Blasko hat es für den Herrn Sekretär angefertigt. Darüber hängen gekreuzte Florette und ein Eichenkranz. Ferdinand sitzt am Tisch und blättert in einem Stoß Zeitungen. Das Tischtuch ist angeschmutzt: Spuren ausgeschwappten Kaffees, heruntergefallene Zigarrenasche, kleine Tintenkleckse haben sein Weiß mit unregelmäßigen Mustern verziert. Lopes Blicke wandern durch den Raum. Er ist nicht das erstemal hier.
Unaufgefordert setzt er sich auf das Sofa. Ferdinand hat die Ellenbogen auf den Tisch gestützt. Sein Kinn ruht auf den Handwurzeln. Seine langen, dürren Finger reichen dabei bis hinauf in das lange, schüttere Haar. Seine müden Blicke kommen aus der Zeitung wie von weit her. Sie suchen im Dämmerlicht nach dem Jungen. Zwei Kummerfalten durchziehen sein weißes Gesicht von den Nasenflügeln bis zu den Mundwinkeln. Tiefe Vorflutgräben! Seine Lippen sind möhrenrot und glänzend.
»Du könntest wohl nicht mal zur alten Krampe gehen und mir einen Rollmops holen?«
»Ja! Wo hast du den vertrockneten Blumenstrauß gelassen, da oben, Herr Sekretär?«
»Ach, weißt du, der war so langweilig, ich habe ihn ver… ja, ich habe ihn verbrannt.«
Lope schaut auf das Feuer im Ofen. »Jetzt?«
»Nein, nicht gerade jetzt; immerhin schon jetzt; aber vor einer Weile, ja.«
»Du konntest ihn wohl nicht mehr brauchen? – Und das Märchenbuch?«
»Das liegt hier!« Ferdinand holt es unter den Zeitungen hervor. Lope nickt, Erwartung in den Augen. Ferdinand geht an den kleinen Wandschrank. Es ist eine braungesengte Kiste über dem Eisenofen. Er holt eine Untertasse und ein Zehnpfennigstück.
»So, geh jetzt, bitte, ja? Es wird sonst zu spät. Wenn du wiederkommst, will ich dir ein Märchen vorlesen.«
Lopes Holzpantoffeln klappern durch das Sekretariat. Es rennt sich so leicht, wenn Ferdinand »bitte« sagt. Vater, Mutter, der Lehrer, der Vogt, der Inspektor, sie sagen immer nur: »Du musst!« Fünf Minuten später stellt er vorsichtig den silbergrauen Rollmops auf den Tisch. Er setzt sich wieder auf das Sofa. Ferdinand holt eine zweite Untertasse. Er legt den Rollmops da hinauf und gibt die erste mit der Brühe dem Jungen. Er holt einen Kanten Brot aus dem Schränkchen dazu. Sie essen beide.
»Hat sie gebrummt?« erkundigt sich Ferdinand und kaut.
»Sie sagte: ›Immer am Abend, wisst ihr das nicht früher?‹«
»Was sagtest du?«
»Nnnnichts.«
Ein Pfau schreit in den Abend. Ein Pferd wiehert. Aus der Schlossküche dringt Tellergeklapper und Mädchengekicher zu ihnen herüber. Ferdinand öffnet das Fenster.
»Es scheint heute draußen schön zu sein?«
»Du warst wohl noch gar nicht draußen, Herr Sekretär?«
»Nein, ich hatte zu tun. Das heißt, ich war auch draußen, aber die meiste Zeit saß ich hier … Was ich sagen wollte, du kannst mir wohl vielleicht noch die Wäsche von der Mutter holen, ehe wir zu lesen beginnen.«
Lope springt auf. Er ist schon wieder bei der Tür.
»Sag Mutter, dass ich zum Bezahlen selbst hinüberkomme, morgen; vielleicht nicht gerade morgen, Dienstag oder so …«
Lope kommt mit dem Packen zusammengelegter Wäsche.
»Herr Sekretär, du musst heute, bitte, willst … wollen schneller lesen, ich muss gleich wieder zurück, die Mutter …«
»Jaja, schon gut, aber weißt du, wir werden das Märchen nur halb lesen, man kann … Eigentlich kann man sie schon schneller lesen, aber man hat dann nicht den Genuss.«
Ferdinand steckt sich eine Zigarre an. Lope schweigt und reibt sich die immer schmutzigen Hände an den Hosen. Die schmalen Hände des Sekretärs wühlen in den Blättern des Buches. Er hüstelt. Ein dicker blauer Ring aus Zigarrenrauch steigt in die Zimmerschwüle und löst sich in der Nähe des geöffneten Fensters auf.
»Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter, die war so schön wie der taufrische Morgen. Ihre Stimme war wie Ammersang, ihre Lippen schimmerten paradiesapfelrot. Ihre Zähne waren so weiß wie reine Blütenblätter von Margeriten. Ihr Haar glänzte wie die Gerste im Sommer, es hing in Locken, gleich goldenen Korkenziehern, auf ihre Schultern …«
»Was sind Korkenzieher, Herr Sekretär?«
»Korkenzieher sind Instrumente. Die reichen Leute öffnen damit ihre Weinflaschen. Ein Stück gedrehtes Eisen mit einem Holzgriff zum Anpacken. Das heißt, sie machen nicht gerade nur die Weinflaschen damit auf, es können auch Likörflaschen, Sektflaschen, geradezu alle Flaschen sein.«
Lope weiß weder, was Likör- noch was Sektflaschen sind. Er will nicht weiter fragen, er ist begierig auf das Märchen.
»Und da war der Sohn des Müllers. Er schlief in der Mühle bei den Mäusen. Sein Gesicht war mehlgrau wie die staubigen Blätter des Sauerampfers am Wege. Seine Zähne waren so gelb und groß wie die eines Pferdes. Sein Haar stäubte, wenn er seine Kappe aufstülpte. Im Juni stäuben die Roggenblüten so. Seine Stimme war grob wie Getreideschrot. Seine Finger waren verbogen und hart wie die Zinken eines eisernen Rechens. – Eines Tages nun ritt die Prinzessin auf ihrem goldgezäumten Apfelschimmel bis dicht vor die Mühle. Sie rief mit ihrer schönen Stimme etwas zur Sackluke hinauf. Der Müller konnte es beim Gedröhn der Mühle nicht verstehen. Da hielt er die Mühle an, zog seine Kappe und verbeugte sich dreimal bis zur Erde …«
»War er so lang?«
»Nein, nicht gerade so lang; gewissermaßen auch nicht bis auf die richtige Erde, bis auf den Fußboden der Mühle natürlich.«
»Ach so, hmmmm!«
»Da musste die Prinzessin lachen, jedesmal, wenn sie den Mund dabei auftat, hüpfte ein Goldstück aus dem paradiesapfelroten Munde. Es fiel klirrend auf den alten Mahlstein am Fuße der Mühle. Die Augen des Müllersohnes wurden darob so groß wie Spechtlöcher in einem alten Kiefernstamm. Er fragte nach dem Begehr der Prinzessin. ›Komm herunter und spiel mit mir‹, zwitscherte das Fräulein. Sie wippte mit der goldenen Reitgerte. Der Sohn des Müllers erschrak. Er wurde so blass, dass das Mehl auf seinem Gesicht fast wie Ofenruß aussah. Nachher schämte er sich. Da wurde er rot. Seine Wangen prunkten rosarot wie ein Sommerabend durch den Mehlstaub. Doch die Prinzessin wurde ungeduldig, sprang vom Pferde und stürmte die schwankende Mühltreppe hinauf.
›Wenn du nicht zu mir kommen willst, so komme ich eben zu dir.‹
Sie stieß mit ihrem vergoldeten Stiefel ein klein wenig zornig an einen Mehlsack. Der Sohn des Müllers verharrte stumm wie ein Stamm.
›Zeig mir die Mühle!‹ Die Prinzessin packte ihn bei der Hand. Er zog seine Hand zurück, scheuerte sie an seiner Hose und hielt sie ihr ganz verschämt wieder hin …«
»Lope – Lope!«
»Die Mutter ruft. Ich muss gehen, Herr Sekretär.«
»Ja, Kind, geh! Und hab schönen Dank für die Besorgung.«
In der Tür dreht sich Lope noch einmal um. »Und hat er das Gold nachher unter der Mühle eingesammelt?«
»Vielleicht nicht gerade eingesammelt – na, wir werden ja sehen.«
Wenn Lope an das Küchenfenster tritt, kann er zu Blemskas hinübersehen. Er kann sich mit Fritz Blemska Zeichen geben. Fritz ist zwei und Marta Blemska ein Jahr älter als er. Einmal hat Lope sich vorgenommen, alles recht schnell zu machen, auch die Schularbeiten. Er wollte Fritz im Alter einholen: sie wollten zusammen konfirmiert werden. Aber so schnell Lope auch alles machte, Fritz blieb zwei Jahre älter.
Blemskas Haus ist bis an den unteren Dachrand aus großen Feldsteinen erbaut. Wenn Lope lange am Küchenfenster auf ein Zeichen von Fritz warten muss, werden die Steine lebendig. Einen sehr verzackten nennt er den Teufelskopf. Der Teufelskopf bewegt die Eselsohren, wenn Lope lange hinstarrt.
Onkel Blemska fährt die kleinsten Pferde auf dem Gutshof. »Meine Puppen« nennt er sie. Sie glänzen wie braune Ostereier, die man mit Speckschwarte eingerieben hat. Blemska hat sich mal mit dem gnädigen Herrn gehabt, erzählt man sich auf dem Gute. Blemska und der gnädige Herr waren allein auf dem Felde. Es gab einen Wortwechsel unter vier Augen, aber Wenskat, der Leibkutscher, hielt mit der Kutsche bei einer Schonung. Er hörte alles.
»Sie sind so dumm, wie es eben nur ein Pferdechauffeur sein kann«, soll der Herr gar nicht so fein und ruhig wie sonst gesagt haben.
»Aber doch so schlau, dass ich Ihre Frau aufklären könnte«, hat der Blemska wohl geantwortet.
»Sie meinen die Gnädige?« beeilte sich der Herr hinzuzusetzen.
»Gnädig hin – gnädig her, aber genau die meine ich!«
Und der Wenskat will auch noch gehört haben, wie der Herr eine Weile darauf gesagt hat: »Na, wie Sie wollen, Blemska, aber als Leibkutscher würden Sie sich bei mir doch auch ganz gut stehen.«
»Darauf habe ich gerade noch gewartet. Der arme Wenskat soll wohl das Herzbluten kriegen? Ich habe jedenfalls nicht die richtige Zunge zum Speichellecken«, hat Blemska wieder geschrien. Da soll der gnädige Herr ganz wütend ins Schloss gegangen sein. Wenskat musste mit der leeren Kutsche hinterherfahren.
Seitdem weiß Leibkutscher Wenskat nicht mehr so recht, woran er ist. Er hat das Gerede aufgebracht, Blemska bekäme seit jenem Tage eine Mark und fünfzig mehr. Es kann wahr sein, man weiß es nicht, jedenfalls sähe Wenskat den Blemska lieber heute als morgen vom Gute ziehen.
Lope hat keine Furcht vor Onkel Blemska wie die anderen Gutsjungen. »Bist ja auch ein armer Deibel«, sagt Onkel Blemska manchmal. Und wenn Lope zu Blemskas kommt, hebt er ihn bis an die niedrige Balkendecke und ruft: »Na, was machst du nun, du kleiner Bankert?« Das ist wohl, weil Lope oft im Park an einer Bank spielt. Onkel Blemska hat auch ein paar Bücher. Es stehen aber keine Märchen darin wie in den Büchern vom Herrn Sekretär. Blemska liest manchmal an Sonntagvormittagen darin. »Das ist mehr wert, als in die Kirche zu latschen«, sagt er.
Tante Blemska hat einen Riss in der Oberlippe. Die Lippe sieht aus wie ein gespaltenes Stück Holz. Tante Blemska ist fast immer traurig und zischt dabei durch die zerklüftete Oberlippe. Ihr flacher Leib wird von dürren Beinen geschleppt. Manchmal, wenn Vater beim Barbier ist, kommt Onkel Blemska zu Kleinermanns in die Küche. Er redet dann mit Mutter von den schweren Zeiten.
»Das hast du dir auch nicht träumen lassen, Mathilde, dass du mal zu gar nichts kommst, was?« kann Onkel Blemska fragen. Manchmal kommt Vater betrunken vom Barbier, und Onkel Blemska ist noch bei Kleinermanns. Dann braucht Lope nicht zu fürchten, dass es Schlachthaus-Exerzieren gibt. Vater geht gleich in die Kammer. Er spricht dort vor sich hin oder singt.
»Das macht, weil er vor Blemska Schiss hat«, sagt die Mutter.
In der Mitte des Parks, rechts vom Rosenrondell, steht zwischen Flieder- und Schneebeerenbüschen eine Bank. Bis zur Mitte des Parks kommt selten jemand von den Herrschaften. Deshalb gehört die Bank Lope. Unter der Bank in der schwammigen Lauberde befindet sich sein Kuhstall. Abgeschlagene Henkel von Steinguttöpfen und Porzellantassen sind seine Kühe. Er hat weiße, blaugesprenkelte und solche mit Goldrücken. Die goldrückigen lassen sich sehr schlecht melken. Es sind die Herrschaftskühe. Sie liefern die Milch für die Schlossküche.
»Ho-ho … na, na … steh doch«, sagt Lope tätschelnd und ahmt das Melkgeräusch nach: schmurr, schmurr!
Elisabeth, die kleine Schwester, sitzt auf der Bank. Sie hält einen Schneebeerenzweig und macht: »Da, da, dajuuuch! Da, da, da, pioooch!« Sie zieht ihren Nasenausfluss geräuschvoll zurück. Wenn Lope vom Spiel aufblickt, gewahrt er manchmal ihre Not und sagt besänftigend, wie zu seinen Kühen: »Komm her, du kleine Rotznase, du Ferkelchen!«
Er putzt ihr mit einem verschmierten Tuch die Nase. Dann beugt er sich wieder zu seinen Kühen unter die Bank. – Wie das nur kommt? Die Braune melkt nur auf drei Strichen. –
Stimmfetzen flattern durch die Büsche: »Teerosen … Hochstamm … Busch in voller Blüte …«
Lope lugt wie ein Dachs aus dem Dunkel seiner Bankhöhle. Es ist die Stimme des gnädigen Fräuleins. Das gnädige Fräulein, ja, es schreitet mit Gärtner Gunkel zwischen den Rosenstämmen einher. Es trägt in der einen Hand einen Bleistift. Von Zeit zu Zeit schreibt es etwas in ein kleines Buch ein. Von der Schreibhand hat es den weißen Handschuh gezogen. Lope setzt sich sittsam auf die Bank. Er verfolgt die Bewegungen des gnädigen Fräuleins und beobachtet auch das Mienenspiel im Gesicht des Gärtners Gunkel. Er darf hier nicht sitzen; wenn er allein gewesen wäre, würde er sich durch die Büsche davongemacht haben, aber da ist Elisabeth. Er muss auf sie achtgeben.
Das Fräulein wallt über den Rasen: eine weiße Fahne bei lauem Winde. Manchmal bleibt es bei einem Rosenbeet stehen. Es sagt einen Rosennamen. Gärtner Gunkel nickt und zerquetscht Blattläuse zwischen seinen hornigen Fingern.
»Hach, Gunkel, wenn ich wüsste, wohin ich mich um Pluto-Rosen wenden soll. Das hieße doch einen Schritt weiterkommen. Die schwarze Rose geht mir nach bis in meine Träume.« –
Gärtner Gunkel schweigt und zerquetscht eine grüne Blattspinne. Das ungleiche Paar ist herangekommen. Lope kann Spuren von Grasgrün auf den weißen Schuhen der Dame erkennen. Eigentlich hat er noch nie weiße Schuhwichse gesehen. Er wird sie sich von Stina, dem Stubenmädchen, zeigen lassen. Das gnädige Fräulein blättert hastig im Buche. Ihre Fingernägel glänzen wie dicke Tautropfen. Lope schaut ihr Haar an. Es quillt unter dem weißen, breitkrempigen Hut hervor.
»… und hing in Locken, gleich goldenen Korkenziehern, auf ihre Schultern …« Er muss sich von Mine in der Küche außerdem einen Korkenzieher zeigen lassen.
»Da, da, pomm, plutt, ia, iuuuch!« macht Elisabeth. Das Fräulein wendet sich jäh. Lope fühlt Röte in sein Gesicht schießen. Er packt die Kleine unsanft und will davon. Das Fräulein ist mit raschen Schritten auf ihn zugekommen. Ihr Handschuh fällt auf den Boden. Lope weiß von Ferdinand: man muss ihn aufheben. »Galant sein«, nennt es Ferdinand. Er hebt ihn auf. Das Fräulein verzieht die Lippen zu überraschtem Lächeln. Der Mund quillt wie eine feine rote Schnittwunde aus ihrer weißen Haut. Gärtner Gunkel verschluckt einen Tadel. Beifälliges Lächeln durchsäuert sein Gesicht. Er nimmt einen trockenen Ast vom Wege und wirft ihn ins Gebüsch.
»Ach, du Teinchen, wat pielst du denn, wat?«
Elisabeth bleibt stumm. Sie zieht die Lippen weinerlich zurück. Lope reicht der Dame den Handschuh.
»Ja, danke! – Sehr aufmerksam von dir. Ist wohl dein Schwesterchen, hm?«
Lope nickt und zieht wieder sein schmutziges Tuch hervor. Das Schlossfräulein ist schneller. Es nimmt sein Spitzentuch, wischt der Kleinen die Nase und wirft das Tuch ins Gebüsch. Dann nimmt es mit spitzen Fingern den Bleistift und macht »Kicks! Ja, da, da, kicks uuuund kicks!«.
Elisabeth hält nichts von diesem Spaß, sie beginnt jetzt wirklich zu weinen.
»Ach, ach, aaach, wer wird denn weinen? Nö, nö, nö, du!«
Pause. – Ratlosigkeit auf beiden Seiten.
»Macht euch nach Hause! Was lungert ihr hier herum?« Gunkel ist ungehalten. Sein saures Lächeln platzt wie eine übergärige Essigflasche.
»Aaaber, Gunkel!« Das Fräulein geht wieder zu den Rosen hinüber. »Bääääh, uaaaa, bääh.« Elisabeths Heulen steht anklagend im stillen Park. Das Fräulein kommt wieder zurück.
»Wie heißt du denn?«
»Kleinermann.«
»Wie?«
»Gottlob Kleinermann.«
»Ach, seltsam! Dann bist du ja …«, sie sieht sinnend auf. »Dann bist du ja das Kind von Mathilde. Von Mathilde und … Ja, ja, danke, wie interessant!«
Noch einmal schaut sie Lope an, dann schickt sie sich an zu gehen. »Ja, schönen Dank auch! Du bist ja ein vollkommener Kavalier. Jööööi!«
Lope hat seine Hände in die Hosentaschen gesteckt. Sicher hat das Fräulein sie so angeschaut, weil sie nicht sauber waren. Sie hat also nichts dagegen; er darf hier sitzen und seinen Kuhstall haben. Er hätte ihr seine Kühe zeigen können – aber nein! Elisabeth beruhigt sich. Die Schwarzdrossel singt in den Silbertannen. Draußen auf den Feldern klappert ein Wagen.
Lope hat das gnädige Fräulein schon oft gesehen. Einmal kam sie aus Ferdinands Stübchen, als er ihm einen Brathering brachte. Heute kannte sie ihn nicht.
Auf dem Gutshof läuft Lope dem Vater in die Hände. Der fährt Mist mit Wechselwagen.
»Was schleppst du großer Bengel dich mit den kleinen Kindern rum? Hast du nichts anderes vor? Wo steckt Trude? Geh lieber Birkenreisig schneiden, großer Schloddrian, mit kleinen Kindern spielen, was?«
Lope stiehlt sich über den Hof. Er findet Trude und übergibt ihr die Kleine, holt sich ein Messer aus der Küche und geht pfeifend die Dorfstraße entlang, der Heide zu. Albert Schneider steckt den Kopf durch die Zaunlücke am elterlichen Hofe.
»Jetzt haben wir den Fußball vom Sportklub abgekauft.«
»Wann?«
»Gestern. Aber du kannst nicht mitspielen. Bloß die, die zusammengesteuert haben. Siehst du, ich hab dir’s gleich gesagt: weshalb hast du nicht mitgesteuert?«
»Oooch, der alte Ball! Eine richtige Flanke, und er platzt.«
»Bäh, nee, er platzt nicht! Und wenn er platzt, näht ihn Schuster Schurig wieder, hat er gesagt.«
»Er platzt aber gleich wieder.«
»Dann näht er ihn wieder, hat er gesagt.«
»Und dann platzt er immer wieder, tausendmal platzt er, ja.«
»Er näht ihn millionenmal wieder, na? Du bist bloß neidisch, weil du nicht mitspielen kannst, äääh!«
Lope grapscht einen Stein und wirft ihn … Krachend schlägt er gegen den Bretterzaun. Der Kopf von Albert Schneider verschwindet. Ein anderer Stein von Schneiders Hof fliegt auf die Straße. Er plumpst in den Mahlsand. Dort wirbelt er eine Staubwolke auf und kullert in den Nachbargarten.
Lope ist längst weiter. Beim Heidhügel, auf dem die Schäferei steht, schneidet er eine Bürde Birkenruten zusammen. Er dreht ein Seil aus Honiggras und umschnürt die Birkenruten damit. Das geht schnell. Er kümmert sich kaum um die Eidechsen. Sie schlängeln sich raschelnd durch das Heidegras. Der Schafstall ist geschlossen. Die Tiere blöken darin. Schäfer Malten hat sie nicht ausgetrieben. Lope beschließt hinaufzugehen. Minka, die zottige Hündin, muss jetzt Junge haben. Hunde hecken im März oder April, hat jemand gesagt. Minka ist kein gewöhnlicher Hund, sie kann ebensogut jetzt hecken.
»Minka, Minka, Miiiinkaaa!« Hinter der Schäferei jiffst ein Hund. Sie ist eingesperrt. Lope überlegt. Es ist so gut wie sicher, sie hat Junge. Lope beginnt zu laufen.
Schafstall und Wohnung des Schäfers sind aus Feldsteinen erbaut. Manche von ihnen glitzern. Goldkörnchen scheinen darin eingepresst. Die Tür zu Schäfer Maltzens Stube besteht aus zwei Teilen. Manchmal klappt er nur den oberen Teil auf. Er lehnt dann auf der unteren Hälfte und sieht pfeiferauchend ins Dorf hinunter. Der obere Türteil ist ein dunkles Viereck. Er ist wie ein Rahmen. Manchmal steht der halbe Malten in diesem Rahmen. Das sieht so aus wie die Kaiserbilder in der Stube. Heute ist dieser Rahmen leer.
»Miiiinka!«
Oben wird hastig die untere Tür aufgestoßen. Eine Frauengestalt kommt heraus. Sie verhält ein Weilchen und stolpert vorwärts. Sie kommt auf Lope zu. An einer Krüppelkiefer bleibt sie wieder stehen. Sie hält sich daran fest. Da gewahrt die Frau den Jungen und geht schwankend weiter.
Lope erkennt Stina. Sie ist bleich wie Wäsche. Ihre Augen sind klein, rot und tränennass. Stina strafft sich. Sie will mit unwahrem Lächeln an Lope vorüber.
»Sind die Jungen tot?« Lope bleibt stehen.
»Was … welche Jungen?«
»Warum jault sie, hat er sie eingesperrt? Hat er die Jungen ins Wasser geschmissen?«
Stina beginnt zu begreifen. Ihr Gesicht ist gerötet. Ihre Rechte krampft sich in die Herzkuhle.
»Na … nein, sie heult wohl bloß so.« Abwesendes Lachen.
»Weshalb hat er sie eingesperrt?«
Stina zuckt die Schultern und geht weiter. Lope blickt auf den Weg.
»Stina, du blutest ja! Hast du dich geschnitten?«
»Geschnitten? – Ja, verdammt, eine Wunde am Bein, so unglücklich, ja. Aaach, da kannst du sehen.«
»Hat er’s nicht verbunden?« Lope weist mit gewinkeltem Arm zur Schäferei.
»Verbunden? … Ja, hat er auch … und blutet immer noch … das da. Dieser elende Säbel vom gnädigen Herrn … fällt von der Wand, ich will ihn aufheben, ja, ich trete auf den Griff, sie stellt sich auf, diese Klimpe, sticht mich ins dicke Fleisch, ooooh, mein Gott!«
»Ja, ja, da hast du was gemacht.«
»Ooooh, ich …«
»Hast du weiße Schuhwichse?«
Stina stutzt. »Weiße? – Wozu?«
»Nur so. Damit kannst du wohl das Grüne vom Gras aus den Schuhen putzen?« Stina versteht nicht. Der Hund heult. Sie wendet sich ab und geht weiter. Der Junge springt in Maltens Stube. »Weshalb hast du sie eingesperrt, hat sie geworfen?« fragt er ohne Gruß.
Schäfer Malten kehrt ihm den Rücken zu. Er hantiert mit Instrumenten. »Sie ist nicht eingesperrt, sie ging doch …« Malten wendet sich langsam dem Jungen zu. »Ach so, Minka, nein, sie hat nicht geworfen. Minka meinst du also. Zum Sultan, es ist vorbei. Keine Jungen dieses Jahr, nein.«
Lopes Eifer zerschellt wie ein zerworfenes Glas. »Aber warum hast du sie eingesperrt?«
»Sie war mir im Wege bei Schah… Sie hat Flöhe, wie Mistkäfer so groß.«
»Stina hat draußen geweint. Ich sah es. Aber sie wird nicht sterben? Oder wird sie doch sterben? Sie blutete noch. Wenska blutete damals auch, als er in die Sense trat. Er starb nicht.«
Malten wirft die gesäuberten Instrumente in einen Blechkasten. »Nein, nein, natürlich wird sie nicht sterben, wenn du Stina meinst, beim Elefanten des Kalifen. Sie weinte, sagst du?«
»Ich sah es an ihren Augen. Sie wischte sie mit dem Ärmel ab … Weshalb ließ sie den Säbel nicht liegen? Der gnädige Herr hätte ihn selbst wieder an die Wand gehängt. Vielleicht ist er vergiftet.«
»Säbel?« Malten stutzt. »Freilich, ach so, der Säbel, jaja! Was fassen ihn die Mädels an? Es ist doch kein Küchenmesser, keine Sichel, pfui Teufel.«
»Kannst du etwas machen, wenn er vergiftet war?«
»Was denkst du!« Der Schäfer weist auf ein Glas. Es steht verschlossen bei anderen Gläsern auf einem Brett neben Maltens Ruhestuhl. In klarer Flüssigkeit liegt darin eine zusammengeringelte Kreuzotter. »Drei Tropfen davon, und sie lebt wie zuvor.«
»Und das Blut?«
»Das Blut … das Blut springt zum Herzen zurück. Außerdem ist nicht gesagt, dass der Säbel vergiftet war. Vielleicht ist er alt und rostig.«
»Wenn ihn der gnädige Herr aus Afrika mitgebracht hat, dann, dann … hat er mehr Gift als alle Schlangen zusammen.«
»In Afrika gibt es keine Säbel, Junge. Nicht die Spitze von einem Säbel. Es sei denn, wir schleppen sie erst hin.«
»Aber er war auch in der Türkei, sagte Herr Sekretär.«
»Er war wohl überall, außer in der Hölle, na ja, weiß man das? Vielleicht kommt er daher?«
Malten macht sich jetzt am Ofen zu schaffen.
Lopes Augen wandern. Seiner Neugier entgeht kein neues Spinngewebe in den Balkennischen. Da ist der ausgestopfte Habicht mit den wütenden Augen. Er hat sich einmal auf ein Junglamm fallen lassen. Da erschlug Malten ihn. Da sind die vielen Töpfe und Töpfchen mit Salben und Gallerten. Die schmutzigen Flaschen mit braunen, grünen, roten und milchigen Flüssigkeiten. Das Strickstück vom alten Schneider, der sich im Soff erhängte, liegt neben der Bibel. Da sind Knochen von toten Menschen, unzählige Holzschieber mit schmutzigen Griffen stehen in einem Regal mit glattgeschliffenen Leisten. Dort trocknen Blätter und Blüten von Pflanzen. Ein Gewirr kleiner, verstaubter Säcke hängt von den Deckenbalken herab. Trockene Pflanzen rascheln darin, wenn Malten mit dem Kopf daran stößt. Gebündelte Kräuter hängen über dem Ofen. Flockiger Staub nistet zwischen ihren Stengeln.
Hinter dem Ofen ist Maltens Lagerstatt. Sie ist ein Häuschen für sich. Eine Holzvertäfelung schützt sie gegen die rauhe Wand aus Feldsteinen. Auf einem Sims liegen alte Bücher. Ihre speckigen Lederrücken haben graugrünen Schimmel angesetzt. Vor dem Bett – es liegt wie ein ruhendes Riesenschaf in all seinem Gewölle – hängt eine rotgemusterte Gardine. Sie ist auf eine Birkenstange gezogen und lässt sich hin und her schieben.
Wenn die Bettbutze mit der Gardine geschlossen ist, kann man Malten nicht sprechen. Nacht oder Tag, im Betthäuschen brennt dann die zerbeulte Sturmlaterne. – Man kann warten und rufen. »Nicht zu Hause, zum Donnerschlag!« – Seine Stimme ist brausend wie Frühjahrswind. Buchblätter rascheln wie trockenes Laub.
Wempels Wilhelm wurde von der Kreuzotter gebissen, erzählt man. »Lieber, lieber Malten«, wimmerte er, in die Stube stürzend. »Ich sehe, du studierst, ja, das muss wohl sein, damit du anderen Menschen Hilfe bringen kannst, aber dieses Biest, es hat mich gebissen, die Otter, was soll ich sagen … ich glaube, ich bin schon blitzeblau – du musst mir helfen!«
Schäfer Malten muss nicht. Das Wörtchen »muss« ist eine summende, kitzelnde Mücke in seiner Ohrmuschel.
»Renn neunundneunzigmal um den Schafstall!«
»Malten, Malten, das kann ich wohl nicht mehr. Wenn du nur einmal hersehen würdest, wie weit ich von Kräften bin! Nein, das kann … das geht nicht mehr.«
»Renn neunundneunzigmal um den Schafstall!« kommt es eindringlicher.
»Nein, nein, du musst es brennen! Ich fühle, wie es zum Herzen rinnt. Mein Blut ist wohl schon kloakig und klumpig wie Froscheier.«
»Renn neunundneunzigmal um den Schafstall, bei den goldgezackten Myriaden!« Und die Scheiben der Schäferstube zittern vom Schall der Stimme.
»Ich falle beim dritten Male, du wirst es sehen. – Wegen mir, ich renn auch, aber du bist schuld an meinem Tode, ooch, mein Blut, vielleicht ist es jetzt schon blau und steht wie ein Zimmermannsstift fest in den Adern.«
Keine Antwort.
Wempels Wilhelm erhebt sich, schlurft nach draußen. Er setzt sich auf den großen Stein bei der Tür. Sein Leben lang ist er ungern gelaufen. Und jetzt, kurz vor seinem Tode, soll er neunundneunzigmal, neunund… nein, er kann nicht. Außerdem ist das Blut jetzt hart, er kann ja hören, wie es in den Adern knarrt. Er sitzt noch eine Weile auf dem Stein und stirbt dann.
»Die Otter hat ihn gebissen, aber an Faulheit und Einbildung ist er gestorben«, erklärt der Schäfer. Die dürre, abgehetzte Karline Wempel holte ihren dicken, toten Mann mit der Schubkarre von der Schäferei …
Daran muss Lope denken.
»We… wenn der Säbel doch vergiftet war, dann wird Stina sterben wie Wempel.«
»Ein Säbel ist keine Otter. Überdies ist das Mädchen nicht dick und faul, und ich habe noch stärkere Mittel als dieses.« Malten weist auf das Schlangenglas. »Es macht Vergiftete wieder lebendig, die schon an die drei Tage auf dem Kirchhof gelegen haben, sapperment!«
Malten hat sich wieder dem Herde und seinen rußigen Töpfen zugewandt. Lope prüft den Inhalt eines Glases.
»Das hast du wohl da drin?«
Keine Antwort.
Malten rasselt mit dem Schürhaken im Ofenloch. »Kerrrrl, Junge, beim grünen Ganges, du fragst einem ja ein Loch in den Brägen.«
»Ist das das Gift von der Schlange?«
»Ich habe ihr die Giftzähne ausgerissen.«
Malten hat sich umgedreht. Er geht ungeschlacht grinsend auf Lope zu, packt ihn jäh, reißt ihn hoch und lässt ihn bei ausgestrecktem Arm zappelnd in der Luft hängen. Er schaut mit alterlosem, gütigem Blick in Lopes rotumränderte Augen.
»Deine Augen, Junge, der Teufel müsste ein altes Kirchenweib sein, wenn da nicht was dahinter sitzt. Mit solchen Augen kannst du später manches machen. – So, und jetzt still, du kleine Dreckschleuder, nichts mehr gefragt! Geh und lass den Hund raus!«
Lope steht auf dem Fußboden und schlenkert die Arme. Er muss den schweren Griff des Schäfers abschütteln. Dann rennt er hinaus. Der weiße Sand in der Schäferstube mülmt auf.