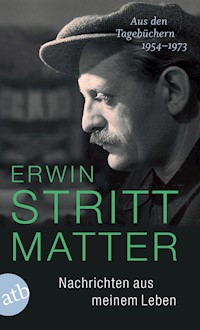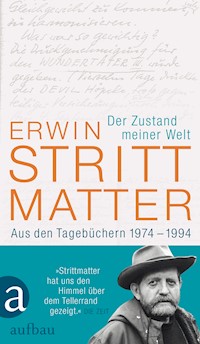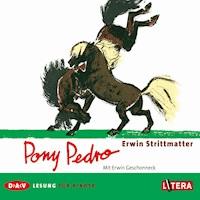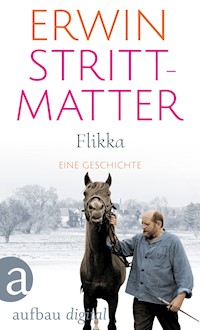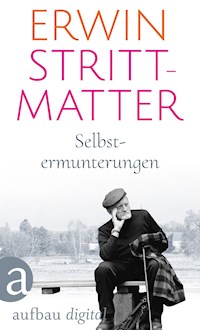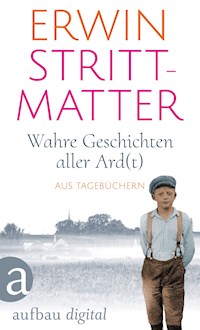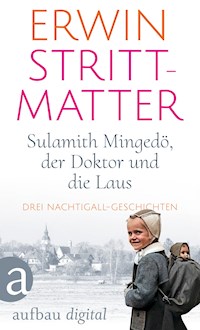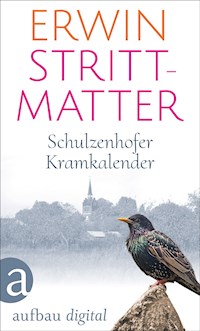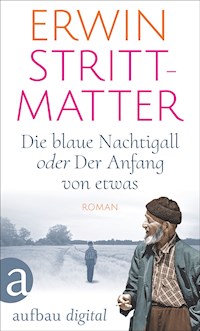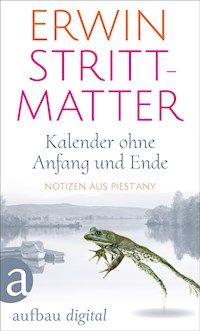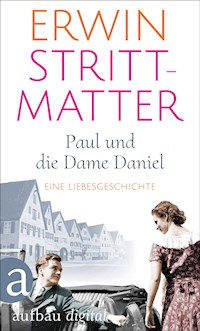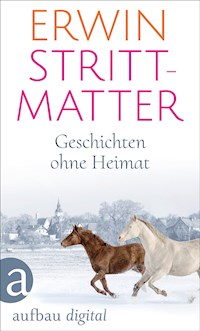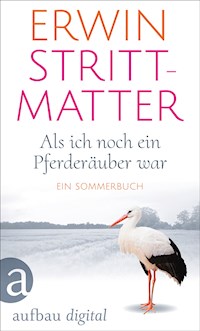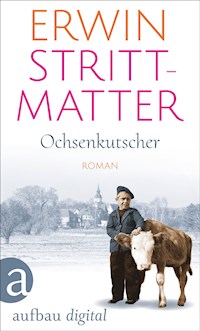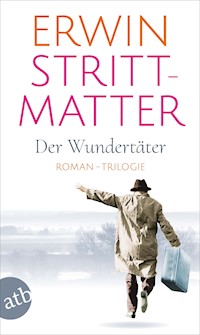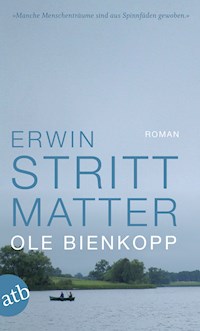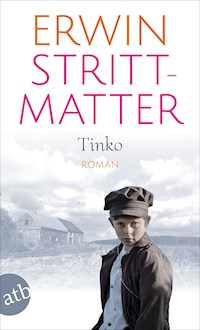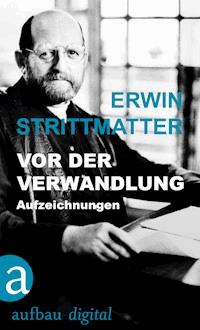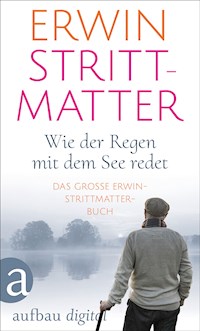
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Facetten eines großen Erzählers.
Das opulente Lese-Buch präsentiert Strittmatter als exzellenten Erzähler in jener einmaligen Mischung aus Poesie, Philosophie und Humor, die seinen besonderen Ton ausmacht. Seiner Lebenschronologie folgend, bietet es Auszüge aus den beliebtesten Romanen und eine Auswahl der schönsten Geschichten, Reflexionen und Anekdoten über das Poetische, die Natur und den Sinn des Lebens.
"Im Großen das Kleine erkennen und zeigen und beschreiben - das hat Strittmatter getan, gleich Tolstoi, Hesse, Faulkner, Proust, Emerson." SZ
"Ein gelungener Einstieg in ein meisterhaftes literarisches Lebenswerk." Zeitpunkt, Leipzig
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Facetten eines großen Erzählers.
Das opulente Lese-Buch präsentiert Strittmatter als exzellenten Erzähler in jener einmaligen Mischung aus Poesie, Philosophie und Humor, die seinen besonderen Ton ausmacht. Seiner Lebenschronologie folgend, bietet es Auszüge aus den beliebtesten Romanen und eine Auswahl der schönsten Geschichten, Reflexionen und Anekdoten über das Poetische, die Natur und den Sinn des Lebens.
»Im Großen das Kleine erkennen und zeigen und beschreiben – das hat Strittmatter getan, gleich Tolstoi, Hesse, Faulkner, Proust, Emerson.« SZ
»Ein gelungener Einstieg in ein meisterhaftes literarisches Lebenswerk.« Zeitpunkt, Leipzig
Über Erwin Strittmatter
Erwin Strittmatter wurde 1912 in Spremberg als Sohn eines Bäckers und Kleinbauern geboren. Mit 17 Jahren verließ er das Realgymnasium, begann eine Bäckerlehre und arbeitete danach in verschiedenen Berufen. Von 1941 bis 1945 gehörte er der Ordnungspolizei an. Nach dem Kriegsende arbeitete er als Bäcker, Volkskorrespondent und Amtsvorsteher, später als Zeitungsredakteur in Senftenberg. Seit 1951 lebte er als freier Autor zunächst in Spremberg, später in Berlin, bis er seinen Hauptwohnsitz nach Schulzenhof bei Gransee verlegte. Dort starb er am 31. Januar 1994. Zu seinen bekanntesten Werken zählen sein Debüt »Ochsenkutscher« (1950), der Roman »Tinko« (1954), für den er den Nationalpreis erhielt, sowie die Trilogie »Der Laden« (1983/1987/1992).
Klaus Walther, geboren 1937, ist promovierter Literaturwissenschaftler und arbeitete viele Jahre als Lektor und Programmleiter. Heute lebt er als Autor, Herausgeber und Kritiker im Erzgebirge. Zu seinen Veröffentlichungen zählen u. a. Mit Büchern leben (1995), Hermann Hesse. Biographie (2002), Karl May (2002), Bücher sammeln. Kleine Philosophie der Passionen (2004), Der schöne Monat Mai. Eine Erinnerung (2007).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Erwin Strittmatter
Wie der Regen mit dem See redet
Das große Erwin-Strittmatter-Buch
Herausgegeben von Klaus Walther
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Großvaters Welt
Wie ich meinen Großvater kennenlernte
Großvaters Welt
Die Tabakpfeife
Die Macht des Wortes
Das Teufelsmesser
Der Pelzmantel
Großvaters Tod
Selbstermunterungen: Leben
Jahre mit Brecht
Der Hut
Bal i mal stirb …
Die Brecht-Nessel
Kundenerziehung
Der Kommissar
Die Katze
Selbstermunterungen: Schreiben
Mein Mantel aus Pferdeduft
Als ich noch ein Pferderäuber war
Pferdekauf
Mein Mantel aus Pferdeduft
Kutschpartie
Flikka
Selbstermunterungen: Natur
Wie der Regen mit dem See redet
Gebrochener Stolz
Die Eiskuh
Die Noten der Stieglitze
Der Wendehals
Die fliegende Wiese
Maus und Schicksal
Regentag
Sommerausklang
Holundersuppe
Gänse und Pirol
Rehe auf der Wiese
Pilzfieber
Schneefrühling
Das fliegende Rehkitz
Südwind
Nordwind
Der große Gesang
Selbstermunterungen: Welt und Wahrheit
Ole Bienkopp – Anfang und Ende eines Romans
Selbstermunterungen: Kindheit
Geschichten von Leben und Tod
Die blaue Nachtigall
Schneewittchen
Hasen über den Zaun
Nebel
Aphorismen aus dem Nachlass
Der wendische Kito – »Laden«-Geschichten
Ankunft in Bossdom
Lehrer Rumposch
Auf der hochen Jungsenschule
Ich heiße Meta
Rundfunk-Abenteuer
Fotografieren und Motorradzeit
Der alte Nickel
Lebens-Zeremonien
Ende des Ladens
Tod des Vaters
Dichters Ort
Dichters Ort
Mein Vater und Graf Tolstoi
Einer seiner Tage
Bücher
Erzählen
Wundertäter-Zeit – Geschichten von Stanislaus Büdner
Vor der Verwandlung – Wilhelminele und Ernstle
Anhang
Biographische Zeittafel
Nachwort
Quellennachweis
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Großvaters Welt
Wie ich meinen Großvater kennenlernte
Großvaters Welt
Die Tabakpfeife
Die Macht des Wortes
Das Teufelsmesser
Der Pelzmantel
Großvaters Tod
Selbstermunterungen: Leben
Jahre mit Brecht
Der Hut
Bal i mal stirb …
Die Brecht-Nessel
Kundenerziehung
Der Kommissar
Die Katze
Selbstermunterungen: Schreiben
Mein Mantel aus Pferdeduft
Als ich noch ein Pferderäuber war
Pferdekauf
Mein Mantel aus Pferdeduft
Kutschpartie
Flikka
Selbstermunterungen: Natur
Wie der Regen mit dem See redet
Gebrochener Stolz
Die Eiskuh
Die Noten der Stieglitze
Der Wendehals
Die fliegende Wiese
Maus und Schicksal
Regentag
Sommerausklang
Holundersuppe
Gänse und Pirol
Rehe auf der Wiese
Pilzfieber
Schneefrühling
Das fliegende Rehkitz
Südwind
Nordwind
Der große Gesang
Selbstermunterungen: Welt und Wahrheit
Ole Bienkopp – Anfang und Ende eines Romans
Selbstermunterungen: Kindheit
Geschichten von Leben und Tod
Die blaue Nachtigall
Schneewittchen
Hasen über den Zaun
Nebel
Aphorismen aus dem Nachlass
Der wendische Kito – »Laden«-Geschichten
Ankunft in Bossdom
Lehrer Rumposch
Auf der hochen Jungsenschule
Ich heiße Meta
Rundfunk-Abenteuer
Fotografieren und Motorradzeit
Der alte Nickel
Lebens-Zeremonien
Ende des Ladens
Tod des Vaters
Dichters Ort
Dichters Ort
Mein Vater und Graf Tolstoi
Einer seiner Tage
Bücher
Erzählen
Wundertäter-Zeit – Geschichten von Stanislaus Büdner
Vor der Verwandlung – Wilhelminele und Ernstle
Anhang
Biographische Zeittafel
Nachwort
Quellennachweis
Impressum
Großvaters Welt
Wie ich meinen Großvater kennenlernte
Ich wurde an einem Mittwoch geboren, an einem Mittwochvormittag um zehn Uhr, falls jemand die Zeit vergleichen möchte. Obwohl der Monat August gewitterfreundlich ist, donnerte es nicht, und die Sonne stand nicht im Zeichen der Jungfrau, und es ging keinesfalls goethisch bei meiner Geburt zu.
Aber ich soll mich sofort so umgesehen haben, als ob ich die Welt schon kennte, behauptete meine Mutter, doch sie verriet es erst, nachdem mein erstes Buch gedruckt war. Und dass ich mich so kenntnisreich umblickte, gleich nachdem ich in die Welt gefahren war, das war nur ein Trick von mir, und ich habe diesen Trick im Leben noch oft benutzen müssen, denn wundern darf man sich nur unauffällig, wenn man nicht haben möchte, dass einen die Schlauberger unter den Zeitgenossen für einen Naiven halten und dass sie einen unter ihre Botmäßigkeit zwingen.
In bezug auf mein Dasein nahmen meine Mutter und ich übrigens verschiedene Standpunkte ein; denn als ich für die Mutter schon da war, wähnte ich mich noch im Niemandsland, und das bewies, dass ich kein Wunderkind war, denn nur Wunderkinder erinnern sich ihrer ersten Lebensminuten, und sie machen Aussagen über die Schürze ihrer Hebamme, und sie verkünden, diese Schürze wäre »weuß gewösen«, und alle Wunderkindgläubigen staunen.
Ach ja, es gibt bis heute keine andere Pforte, um in diese Welt zu schlüpfen, als eine Mutter, aber man arbeitet bereits an anderen Einstiegsmöglichkeiten, wie ich lese, doch wenn der Menschenbrutschrank, an dem man arbeitet, zuerst von Schaftlern in einem Lande erfunden wird, das antihuman regiert wird, so werden dort die Industriellen den Professoren das Brutschrankprinzip abkaufen und entreißen, und sie werden serienmäßig homunculi als billige Arbeitskräfte und zu Kriegszwecken herstellen. Dieser Umstand wird auch die Regierungen anderer Länder zwingen, solche homunculi herzustellen, und wenn ich an die Folgen denk, so möcht ich mit Hašeks Schwejk sagen: »Davor hab ich immer die größte Angst gehabt!«
Aber ich schweife ab. Ich bin nicht sicher, ob man sich das schon am Anfang einer Erzählung erlauben darf, weil nur wenige Leser geneigt sein dürften, mühsam und wie in ein Dickicht in eine Geschichte einzudringen, denn die meisten wollen durch die lieblichen Flötentöne einer Fabel in dieses Dickicht gelockt werden.
Ich wurde also noch von einem Weibe geboren. Meine Mutter war eine liebestüchtige Frau: ein Vierteljahr nach meiner Geburt beschäftigte sie sich bereits damit, einen zweiten Menschen herzustellen, und sie stattete meine Schwester mit Gliedmaßen und komplizierten Organen aus, denn der Mensch braucht allerlei, um hier im sichtbaren Leben mitreden und mitagieren zu können. Meine arme Frau Mutter schwächte sich mit diesen beiden zeitmäßig so hintereinander liegenden Arbeitsleistungen. Ihre Säfte flossen nur noch nach innen, nicht mehr nach außen, und ich blieb ohne Muttersaft. Ich wurde kraftlos, und im Alter von einem halben Jahr wurde mir das Aufderweltsein über, und ich bekam, ohne mit dem Rauch von Zigaretten dran zu arbeiten, den keuchenden Husten und eine Entzündung der Lunge und wollte mein Hiersein quittieren.
Und als meine Haut bereits so lappig an den Knochen hing wie das Segeltuch am Drahtgestell einer Lumpenpuppe, griff mein Großvater ein. Er atzte mich auf, und ohne ihn wäre ich gestorben, und daran erinnerte er mich, solange er lebte, und daran erinnerte er mich noch auf seinem Totenbette.
Ich wurde also zweimal geboren. Wenn das auch der Titel eines politischen Schlagers ist, so gibts tatsächlich so etwas wie eine zweite Geburt, eine zweite geistige und eine zweite körperliche. Die meine war damals eine körperliche, und das zweitemal gebar mich mein Großvater, und das mag ein wenig erklären, weshalb mir dieser Mann über die Kindheit hin und länger nahestand.
Es gibt Konstellationen im Erdenleben eines Menschen, die man Unglück nennt: Es kann ein Unglück sein, wenn ein Mensch keinen von den beiden Menschen kennenlernt, die ihn in die Welt wiegten. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich meinen Zeuger später kennenlernte als den anderen Mitarbeiter an meinem Ich, denn ich wurde in Deutschland geboren, und in Deutschland hatten die Männer bislang eine Vorliebe dafür, sich jahrelang nach auswärts abkommandieren zu lassen, um Schaden in der Welt zu stiften.
Eines Tages gewahrte ich, dass ich nicht mehr dem unverbindlichen Nichts, dem Nirwana, angehörte, dass ich mich in der Welt der Selbstverpflichtungen befand, dass ich Akteur in einem Lebensfilm war und dass ich Partner hatte, auf die ich mich einstellen musste. Als mein Großvater mir als Partner in meinem Lebensfilm zu erscheinen begann, wohnten wir in einem Kotten in einem Dorfe an einer Landstraße, und die Landstraße führte nach Schlesien.
Mein Vater befand sich im Kriege. Das war für mich eine Ortschaft hinter Berlin oder dort wo, ein Ort unter den Augen des Kaisers Wilhelm und seiner Gemahlin Auguste Viktoria.
Meine Mutter betrieb im Kotten an der Landstraße eine Nähwerkstatt und einen schmalbrüstigen Kurzwarenladen, denn sie hatte den Geldvermehrungsdrang meines Großvaters geerbt, aber bei der Weitergabe dieses Dranges war den entsprechenden Genen das kühle Rechnertum verlorengegangen.
Die Wohnstube des Kottens an der Landstraße nach Schlesien war die Szenerie, in der ich für mein jetziges Leben erwachte. Als ich aufwachte, sah ich, dass nichts mehr zu ändern war und dass ich bleiben musste, wo ich war. Für gewisse Umstände in unserem Lande wäre es günstiger gewesen, wenn ich ein paar Monate früher geboren worden wäre, weil mein Vater dann noch Hilfsarbeiter in einer Tuchfabrik gewesen wäre. So aber war mein Vater Soldat, als ich in die Welt eindrang, und Tuchfabrikhilfsarbeiter war nicht sein erlernter Beruf, und ich musste in die einhundertunddreiundzwanzig Fragebögen, ohne die mein Leben ein Nichts gewesen wäre, in die Spalte Soziales Herkommen schreiben: Sohn eines Bäckers. Nun ist ein Bäckergeselle oft der einzige Untertan eines Bäckermeisters und einer der Ausgebeutetsten unter den Ausgebeuteten, doch in der proletarischen Hierarchie wird er unter der Kategorie Handwerker geführt und politisch minderbewusst eingestuft. Tatsächlich soll bei dieser Menschenkaste hier und dort ein politischer Bewusstseinsmangel anzutreffen sein, aber es fiel mir bis heute schwer, dran zu »glauben«, dass sich auch bei uns, wie dennmals bei den Verdammten in der Bibel, »die Sünden der Väter fortpflanzen bis ins dritte und vierte Glied«, aber eine gewisse Frieda Simson, die in Kaderangelegenheiten beschlagen sein will, sagte, als ich ihr zeigte, was ich hier niederschrieb, dass das bereits wieder ein Ausfluss meiner kleinbürgerlichen Abstammung von einem Bäckereiarbeiter wäre. Es bleibt mir nur übrig, mich mit Marx, Engels, Lenin und anderen zu trösten, die in bezug auf ihre Väter noch schlechter dran waren als ich, so schlecht, dass sie von jener Frieda wahrscheinlich nicht in unsere Partei aufgenommen worden wären.
Die Wohnstube im Kotten an der Landstraße nach Schlesien war Schneiderwerkstatt, Kurzwarengeschäft und Kinderspielplatz in einem. Die beiden Geschäftsbereiche waren durch eine dünne Portiere voneinander getrennt. Der Wohn- und der Geschäftsbereich waren nicht besonders gekennzeichnet, und der Kinderspielplatz erstreckte sich über beide Bereiche bis in die kleine Küche hinein, denn wir Kinder waren wie die Hühner, die keine Grundstücksgrenzen anerkennen. Wir scharrten da, und wir scharrten dort, und was für die Hühner Grassamen und Steinchen waren, das waren für uns unsere Erlebnisse, und wir pickten unsere Erlebnisse in der Schneiderwerkstatt oder in der Ladenabteilung der Wohnstube auf.
Der Kurzwarenladen der Mutter war ein halbstaatliches Geschäft, aber es war nicht so lukrativ, wie es heute manche halbstaatlichen Geschäfte sind, denn in das Geschäft meiner Mutter wirkte das Kaiserreich, in einem negativen Sinne, hinein, und von den mageren Stoffballen durfte nur abgeschnitten werden, wenn die Käufer amtlich ausgestellte »Bezugscheine« vorweisen konnten.
Meine Mutter betrieb sowohl die Schneiderwerkstatt als auch den Kurzwarenladen mit Gemüt und Gefühl. Sie nahms mit den kaiserlichen Beziehscheinen nicht allzu genau. »Fräulein, sind Sie noch bezugscheinfrei? …« So begann ein sogenannter Gassenhauer jener Zeit, und meine lebenslustige Mutter sang diesen Schlager. Sie legte in ihrer Gutmütigkeit hier und da einen halben Meter Stoff zu, und sie verhalf den Kleinkindern der Kundschaft auf diese Weise zu einer Weste oder einer Joppe, aber beim Neueinkauf reichten die vereinnahmten Beziehscheine nicht aus, um die gehabte Menge Stoff zurückzukaufen.
Für mich waren die Stoffballen in den Regalen Kühe. Diese Kühe wurden mit Zetteln gefüttert. Sie wurden mager, wenn man ihnen zuwenig Zettel zu fressen gab, und weil diese Stoffballenkühe mit Zetteln ernährt wurden, enthielten sie von Kriegsmonat zu Kriegsmonat mehr Papier.
Unsere Kinderschürzen waren aus dünnen Papierbindfäden gewebt. Die Papierbindfäden waren mit einer Schicht Dextrin beleimt, und meine neue Schürze war so schön steif wie die Lederschürze des Hufschmiedes von gegenüber, aber im Regen löste sich meine Schürze auf, wie andere Stoffe sich in Salzsäure auflösen.
Und auch das Nähgarn ließ sich von Jahr zu Jahr leichter zerreißen, und seine sich mindernde Qualität täuschte uns vor, dass unsere Kräfte wüchsen, aber im Jahre neunzehnhundertundsiebzehn war das Garn schließlich so leicht zerreißbar, dass man keinen Maikäfer mehr damit fesseln konnte; das Garn war nur noch gesponnener Rauch.
Außer papierdurchschossenen Stoffen und groben Nesselschürzen konnte man im Kurzwarenladen der Mutter Schleifchen zum Aufhübschen von Frauenblusen kaufen. Diese Schleifchen raschelten kalt. Sie stammten aus der Familie der Weißblechbüchsen, während die Herrenschlipse aus der Vorkriegszeit seidig und weich waren, aber sie lagen in ihren Pappschachteln wie in weißen Särgen, denn sie waren überflüssig geworden, weil die Herrenwelt hochgeschlossenes Feldgrau im Leben und im Tode trug.
In der Mitte des Krieges erhielt Mutters Kurzwarenladen keinen Steck- und Sicherheitsnadelnachschub mehr. Es wurde verlautbart, man benötige alles Metall zur Herstellung von Kanonen, und die Kanonen benötige man zum Erschießen der Feinde, und ich hätte gar zu gern gesehen, wie ein mit Sicherheitsnadeln zusammengehaltenes Kanonenrohr das Schießen nach Feinden überstand.
Es gab wenig Männer im Dorf. Die Dorffrauen wussten nicht, weshalb sie noch deutsch-aufrecht und mit hochgestemmtem Busen umhergehen sollten; sollten sie es für die Großväter oder für die Konfirmanden tun? Nein, diese Schande nicht! Deshalb langweilten sich die Korsettersatzstäbchen in den Schubladen des Kurzwarenladens. Wir nahmen sie heraus, und wir bauten auf den Dielen der Schneiderstube Zäune aus ihnen. Wenn doch eine Frau im Laden erschien und nach Korsettstäbchen verlangte, so wussten wir, dass sie ihre »Rüstung« reparierte und dass sie ihren »Urlauber« erwartete.
Die Annäherung eines Urlaubers aus Frankreich oder Russland wurde auch an anderen Anzeichen erkennbar, denn meine Mutter wurde beauftragt, für die Heldenfrau aus dem Rock einer verstorbenen Großmutter eine Bluse im Auguste-Viktoria-Look mit Achselstücken, Feinblechverzierungen und roten Paspeln aus dem Friesunterrock einer alten Sorbin anzufertigen. Meine Mutter arbeitete die ganze Nacht hindurch, und die Kundin nahm das Gewand dankbar entgegen, und sie trat aus der Zeit der Liebesdürre in die Zeit der Liebesfülle.
Ach, es geschah oft, dass bereits eine Woche nach dem liebesvollen Urlaub eines Kriegers die Nachricht von seinem »Heldentode auf dem Felde der Ehre« eintraf, und die Kriegerwitwe musste die rot paspelierte Bluse schwarz einfärben, und die Witwenklagen stiegen gen Himmel.
Mutters Arbeitslohn für die Umarbeitungen von Großmutterröcken zu »Heldenempfangsblusen« stand in keinem Verhältnis zur aufgewendeten Zeit, wenn er nicht in Form von Magerquark oder einigen Eiern einpassierte, und da die Einnahmen aus dem Kurzwarengeschäft auch nur pfennigweis in die diebessichere Ladenkasse tropften, war es für die Mutter nicht leicht, uns ohne Hungerunfälle und gesundheitliches Stolpern durch die Kriegsjahre zu schleppen, zumal wir uns während des Krieges noch um zwei Brüder, sogenannte Urlauber, vermehrten.
Und wieder war es der Großvater, der achtgab, dass wir nicht verkümmerten. Bei den »Unterstützungsbesuchen«, die er uns angedeihen ließ, lernte ich ihn kennen, und sein Vorhandensein teilte sich meinem Vorhandensein mit.
Großvater, der ehemalige sorbische Pferdeknecht, hatte sich als Pferdehändler, Herrschafts- und Bierkutscher, Bergarbeiter, Gutsvogt und Fabrikarbeiter erprobt, und er führte um die Zeit, da ich ihn kennenlernte, die Berufsbezeichnung Handelsmann, und der Volksmund auf der Lausitzer Heide nannte solche Leute Rumgeher.
Solange Großvater auf Erden umherging, suchte er nach einer ihm gemäßen Tätigkeit, doch er fand sie nicht, wie mir scheint, nein, er fand sie nicht. Er hatte dies und das, was zur Ausstattung eines Dichters gehörte, und es ist schwer bestimmbar, welcher Mangel ihn hinderte, ein Dichter zu werden. Ich meine heute, es waren nicht Bücher, die ihm fehlten, denn es hat Naturdichter wie Suleiman Stalski gegeben, die ohne Bücher lebten und groß wurden. Fehlte Großvater ein Gran Intelligenz? Fehlte ihm der Glaube an sich selber? Schien ihm der Sinn des Lebens darin zu bestehen, anpackbare Dinge zu besitzen und zu vermehren?
Und damals, als Großvater als ein Rumgeher umherging, war das keine schlechte Grundlage für das Leben eines Dichters, aber Großvaters Dichtungen bestanden nur aus Gesprächen. Großvater riss die Leute in die Gespräche hinein, um sie kauflustig zu machen, und er handelte vor allem mit Kriegstuchen.
Seine Tuche kaufte Großvater bei der Firma Schwetasch und Seidel, Stoffe und Tuche en gros, an der Hammerlache. Das war eine teichartige Ausbuchtung der Spree, hinter der Stadt, denn die Muttereltern wohnten in der Kreisstadt, und sie wohnten dort im ältesten Haus, An der Mühlen Numero eins. Die Großmutter betrieb in diesem Hause einen Flaschenbier- und Gemüseladen. Das hatte zur Folge, dass sich Großvater im Herbst zum Pächter einer Apfelbaumallee zwischen den Dörfern Graustein und Schönheide machte und dass er bei den Bauern Gemüse aufkaufte. Er nahm damit den Bauern den Weg in die Stadt ab. Die Bauern wussten das zu schätzen, denn sie hatten ihre Pferde in den Krieg liefern müssen, und die Landgendarmen hatten ihnen die Pneumatiks von den Fahrradfelgen patriotisiert. Man gestattete ihnen, sich als Pneumatikersatz Spiralfedern aus Eisendraht zu kaufen. Die Spiralfedern wurden in die Fahrradfelgen einmontiert, und sie machten das Radfahren zur Qual, und das Geholper erreichte fast die Lärmstärke heutiger Motorräder mit abgesägtem Auspuff.
Großvater machte sich also zum fahrbaren Kauf- und Tauschhaus. Er treckte seinen Handwagen täglich zwanzig und dreißig Kilometer über die Sandwege der Heide. Der Handwagen war mit Obst oder Gemüse beladen, und Großvaters Handelsmannskoffer lagen obenauf, und es war eine Schinderei für Großvater, doch gewiss nicht ohne Gewinn.
Wenn Großvater seinen Handwagen mit einem langgezogenen Brrrrr! auf dem Hofe des Kottens angehalten hatte, küsste er uns. Er zwirbelte sich den aschblonden Schnurrbart und zwinkerte uns zu, und er kramte aus dem Handwagenkasten ein Stückchen Speck oder eine Schinkenscheibe, einen Klecks Butter, ein Töpfchen Magerquark oder ein Kännchen Buttermilch, und er schleuste die Raritäten heimlich in die Küche der Mutter, denn die Vorratsschränke in dieser Küche waren in der Regel so leer, dass sich dort nicht eine Fliege hätte von Krümeln ernähren können.
Sodann führte uns Großvater seine musizierende Taschenuhr vor, und wir durften mit seinem Kompass spielen. Wenn uns diese »technischen Wunderwerke« zu langweilen begannen und unsere Gier auf Neues wieder emporquoll, so packte uns Großvater, und er ließ uns kopfunter in der niedrigen Bodenstube an der Decke entlanglaufen. Da hatten wir dann den Tisch und die Waschkommode unter uns, und die gewohnte Welt verkehrte sich und verströmte einen neuen Reiz, und damals wuchs die Lust in mir, meinen anerzogenen Standpunkt zur Welt mit einem poetischen Standpunkt auszutauschen.
Wenn die Äpfel an den Alleebäumen reiften, kam Großvater mit einem alten Schafpelz und einem geborgten Fernglas aus der Stadt. Er quartierte sich für Wochen bei uns ein. Wenn Zepter und Krone auf den Bildern in unserem Märchenbuch aus einem bärtigen Mann einen König machten, so machten Schafpelz und Fernglas aus unsrem Großvater einen Apfelwächter, und es war so reizvoll an unserem Muttervater, dass er heute dies und morgen das sein konnte.
Über den knirschenden Grobkies der Landstraße bewegten sich Bauernwagen, Militärfahrzeuge, Fußgänger und Kolonnen von Kriegsgefangenen. Es gab in der notdurchwirkten Kriegszeit viele Menschen, die der Marmelade aus roten Rüben überdrüssig waren und zu Apfeldieben wurden.
Großvater bewachte Tag und Nacht die erpachtete Obsternte. Am Tage half das Fernglas und nachts half der Schafpelz Großvater beim Bewachen seiner gepachteten Ernte, und er wickelte sich in den Pelz, und er legte sich in den Chausseegraben, und er »wartete« auf die Apfeldiebe.
Am Tage durfte ich mit auf die Apfelwache. Wenn die Straße frei war, hängte mir Großvater das Fernglas um. Das Fernglas war für mich ein Zauberglas, und ich holte mir mit ihm die fernen Bäume, die Sträucher, die Äpfel, den Kirchturm und die Herbstblumen näher. Wenn ich das Glas absetzte, verschwanden die Blumen und die Äpfel. Sie verschrumpften in der Ferne. Ich drehte das Glas um, und es schrumpften auch der Kirchturm und die Bäume in die Ferne ein, und sie verschwanden in der Unendlichkeit.
Das war wieder ein aufregendes Spiel mit Gesichts- und Standpunkten. Es beschäftigte mich bis in meine Jünglingsjahre hinein, und es beschäftigt mich noch heute, weil ich feststellte, dass viele große Geister, die über die Erde gingen, das Leben vieldimensional an- und überschauten und dass sie das allein mit ihrer Phantasie bewältigten, ohne die vielen Apparaturen, auf die wir Menschen des Wissenschaftlichen Jahrhunderts nicht glauben verzichten zu können. Aber eine Weile später erkannte ich, dass all die von uns erfundenen Apparate nichts anderes sind als greifbar gemachte Phantasie, und der Kreis meiner Beobachtungen schloss sich.
Einmal fuhr die Nachzucht des Gutsbesitzers in der Kutsche unter Großvaters gepachteten Apfelbäumen dahin, und die halbwüchsigen Adelssprösslinge schlugen die Goldparmänen und die Reinetten mit Stöcken und Peitschen zu sich in den Kutschkasten. Großvater stellte sich auf die Straße, breitete die Arme aus, trat dem Fuhrwerk entgegen, fiel den Kutschpferden in die Zügel und rief den äpfelkauenden Adelskindern zu: »Bezahlen, oder ich zeig eich an!«
Die Freiherrenkinder durchkramten ihre Taschen. Auch der Kutscher suchte in seiner Livree nach Kleingeld, aber Großvater sagte zum Kutscher: »Dein Geld will ich nicht!« Aber das Geld der Adelskinder kassierte er, und er sammelte die gestohlenen Äpfel ein, und als die Kutsche davongefahren war, sagte Großvater zu mir: »So kummt man zu Gelde!«
Großvater schenkte mir die eingesammelten Geldstücke. Ich dachte an meine Sparkasse daheim. Das war eine blecherne Windmühle mit einem Schlitz zum Einwerfen von Geldstücken. Das Sparen war mir von der Mutter zur Tugend heraufgeredet worden: Du sollst nicht lügen! Du sollst nicht stehlen! Du sollst sparen! Aber für mich war nur lustig, dass sich die Flügel der blechernen Windmühle drehten, wenn ich ein Geldstück durch das eingeschlitzte Dach steckte.
Es war ein Sonntagvormittag. Wir sahen durch unser Fernrohr, wie sich eine schwarzgemummte Kleinbäuerin näherte. Sie kam vom Gottesdienst. Sie trug ihr Kirchengesangbuch in einem weißen Bündelchen, und sie trug außerdem einen geflochtenen Henkelkorb, und sie pflückte sich Äpfel in den Henkelkorb, denn sie wollte wohl nicht ganz leer aus der Kirche in die Küche zurückkehren.
Wir lagen im Chausseegraben. Die Herbstfliegen umsummten uns, und die Heidelerchen sangen. Die Frau kam näher und näher, und Großvater hielt sie an, und er sagte: »Mir scheint, du hast gestohlen, Frau!« Die Alte sagte mit weinerlicher Stimme: »Lieber, lieber Mann, zeigen Sie mir nicht an. Ich will dem Jungchen ein Talerchen schenken, ja, das will ich, will ich!«
Und sie suchte in der Tiefe ihrer Rocktasche nach ihrem bestickten Geldtäschchen, und sie zog es mit zitternden Händen heraus, und sie weinte, und sie tat mir leid. Ich weigerte mich, den hingereichten Taler anzunehmen, aber das ging gegen die Konsequenz des Großvaters, das ging gegen seinen Starrsinn und seinen Erwerbsgeist. Dieser Starrsinn und dieser Erwerbsgeist zeugten viel Böses in Großvaters und in unserem Leben, aber das wusste ich damals noch nicht; und damals war Großvater für mich noch der unantastbare, der unfehlbare Mann.
Und weil ich den Reuetaler der Alten nicht nahm, tadelte mich der Großvater und sagte: »Du wärscht mir ein Geschäftsmann!« Er strich den Taler selber ein, nahm der Kleinbäuerin die Äpfel ab und sagte: »Nu geh, alte Tschedrauka, wie würde es dir gefallen, wenn ich mir bei euch im Garten Äpfel mausen möchte!« Die Alte nickte, und sie trippelte davon. Die Heidelerchen sangen, und sie ließen ihre weichen Töne auf uns herabkullern, und jeder Baum, auf den sich eine Heidelerche setzte, gehörte ihr.
Und es war an einem anderen Tage (die Kindheit kennt keine Daten), da sah ich durch das verkehrt herum angesetzte Fernrohr einen kleinen Mann um die Chausseekurve schlendern. Der Mann zog mit einem Rechen die Baumzweige herunter, und er pflückte sich die Taschen voll Äpfel.
Ich gab das Fernrohr dem Großvater. Der Großvater sah hindurch. Er fluchte, denn der Apfeldieb war mein anderer Großvater, mein Stiefgroßvater, und der hieß Jurischka, und er wohnte in unserem Dorfe. Die beiden Großväter waren nicht die besten Freunde, und als Großvater Jurischka heran war, sagte Großvater Kulka: »Eine feine, feine Verwandtschaft!«
Die beiden Großväter stritten auf sorbisch. Da sie wütend und verschliffen sprachen, verstand ich wenig, aber das Wort Teufel wurde von beiden mehrmals gebraucht. Dann wandte sich Großvater Jurischka ungewohnt liebevoll an mich, und er sah durchs Fernglas gegen das Dorf Schönheide hin, und Großvater Kulka zog ihm hinterrücks die gestohlenen Äpfel aus den Taschen. Aber dann fragte mich Großvater Jurischka, von wem wir das Fernglas hätten, und ich sagte es ihm arglos. Zwei Tage später wurden wir unser Fernglas los, und das Fernrohr musste abgeliefert werden, weil alle Fernrohre in den Krieg gehörten, auf dass unsere Helden den Feind besser sähen.
Das war eine der ersten diplomatischen Spannungen in unserer Familie, aber sie schlug zu jener Zeit noch nicht in einen Familienkrieg um, weil ein größerer Krieg über allem hing.
Ich lebte wochenlang bei den Großeltern in der Kreisstadt. Ich würde dort nicht »soviel entbehren wie daheim«, sagte die Mutter. Ich wusste nicht, was ich entbehrte. Was der Mensch nicht kennt, das entbehrt er nicht. Ich kannte kein Weizenbrot und gierte nicht danach, ich kannte keine Schokolade und ich verspürte keinen Appetit auf sie. Ach, es gibt so wenige echte, aber so viele unechte Bedürfnisse, und ich träume davon, dass wir Kommunisten uns eines Tages aufschwingen und den Menschen helfen, die unechten von den echten Bedürfnissen zu scheiden, selbst wenn wir uns dabei wieder einmal ganz und gar »unpopulär« machen sollten.
Auch in mir wurden damals Bedürfnisse geweckt, echte und unechte, denn Großvater nahm mich mit auf Fettlebe in die Hoyerswerdaer Sorbei, und dort wohnten seine Verwandten und Altbekannten. Die Bewohner der sorbischen Dörfer kauften ihre Tuche auf Beziehscheine gern bei einem Rumgeher, mit dem sie auf sorbisch feilschen konnten. Großvater war beredsam, und er war witzig, und er verstand die Schönheit der Frauen zu loben, und er sagte zum Beispiel: »Maika, wenn ich dir so in die Augen seh, tut mir leid, dass ich schon verpaart bin!« Und er verkaufte seine Nesselschürzen.
Ich hörte mit an, wie Großvater warb. Die Abbilder von Orten, Dingen und Handlungen verschwanden in meinen Augen, und ich kleiner Mensch fiel den mütterlichen Frauen in die Augen. Ich wurde hier mit Butterbroten und dort mit Grützwürsten abgefüttert, und ich kam zu den ersten Himbeeren meines Lebens.
Eines Tages nahmen wir Großmutters Rückenkorb mit auf die Hausierertour.
»Was soll dir die Kiepe, Matthes?«
»Warts ab, Lenka, warts ab!«
Wir kamen in ein Dorf, und das hieß Proschim. Auf den Teichen hinter dem Dorfe wimmelten und blühten die Teichrosen. Sie waren die Materialisation der Zartheit.
Großvater zog sich die Schuhe und er zog sich die Strümpfe aus. Er krempelte seine Hosenbeinlinge auf, und er ermunterte auch mich. Wir stiegen ins Wasser, und wir pflückten Seerosen, Seerosen, Seerosen, und wir warfen sie in den Tragkorb.
Das Wasser erreichte die unteren Ränder meiner Hosenbeinlinge, aber Großvater hielt nicht ein. Er pflückte sich bis an den Bauch in den Teich, und ich pflückte mich bis an die Brust in den Teich hinein, und die weißweißen Wasserrosen waren in dieser Stunde für uns die wichtigsten Dinge der Welt.
Die Kiepe war gefüllt. Wir zogen uns am Ufer die Hosen aus. Wir legten sie zum Trocknen in die Sonne, und wir lagerten uns hemdig nahbei ins Schilfgras. Der Großvater sagte: »Großmutter erzählen wir das nicht erst lange!«, und es machte mich stolz, mit dem Großvater ein Männergeheimnis zu haben.
Der Teichschlamm duftete, und die Fliegen summten, die Libellen flirrten, und die Wildenten krächzten, die Spiegelkarpfen plantschten, und im Dorfe krähten die Hähne. Alles zusammen verwob sich in mir zu einer Stimmung, und diese Stimmung heißt heute bei mir Kindheitssommer. Ich kann mir diese Stimmung zurückholen, wenn ich mich an das Ufer eines Teiches lege und wenn ich das Summen und Flirren, das Krächzen und Plantschen auf mich einwirken lasse wie damals. Und obwohl es andere Duftwellen sind und obwohl es andere Tonwellen sind, die ich wahrnehme, scheint etwas von dem, was ich meine Kindheit nenne, in diesen Wellen aufgehoben zu sein.
Wir brachten unsere Teichrosen heim. Ich verriet nicht, wie wir zu ihnen kamen, doch die Großmutter sagte: »Der Junge hätt dir hinterrücks ersaufen können, du wirst grau und immer dümmer!« Die Großmutter rollte ihren Waschzuber herzu, und sie schleppte Schüsseln herbei, und zuletzt wurden die Wassereimer gefüllt, und die weißen Blüten der Teichrosen erhellten Großmutters dunklen Gemüseladen.
Es kamen einsame Soldatenfrauen. Sie kauften unsere Teichblumen. Sie lächelten, und sie dachten vielleicht an den letzten Sommerspaziergang mit dem Geliebten. Es schickten Fabrikbesitzersgattinnen ihre Hausmädchen und Köchinnen in den Klein-Leute- Laden der Großmutter, und die kauften unsere Teichrosen als extraordinären Zimmerschmuck für ihre Gnädigen. Wir hatten eine Kiepe voll Freude in die kriegsgraue Fabrikstadt geschleppt, und der Großvater sagte beim Geklimper der Ladenkasse: »So kummt man zu Gelde!«
Im Frühling wimmelten im seichten Strandwasser unserer Seerosenteiche Stechfischchen umher, und die hießen Stichlinge. Die Stichlingsmännchen hatten bunte Frühlingsbrüste, und sie hingen im Wasser vor den nestbauenden Weibchen, und sie zitterten, und sie warteten darauf, dass die Stichlingsweibchen den Laich ausstießen, und es gingen Wellen komprimierter Lebenslust durch die Leiber der Fische.
Wir sahen den balzenden Stichlingsmännchen zu, aber dann regte sich in Großvater der Lebenserhaltungstrieb, denn es war Krieg, und die Menschen hungerten, und auch wir hungerten. Wir fingen viele, viele liebesdumme Stichlinge, und wir stopften sie in unseren Hamstersack, und wir schleppten sie nach Hause.
Großvater kochte die Fischchen. Er kochte sie so lange, bis sich ihre Stachelflossen auflösten und nur mehr Fischzellen im Kochwasser schwammen. Die Fischzellen machten das Wasser seimig. Nach dem Erkalten entstand aus dem Seim ein Gallert, und wir nannten die unsichtbar gewordenen Stichlinge – Fischsülze. Wir aßen diese Sülze zu Brot, und das Brot war mit Holzmehl gestreckt, und Großvater wischte sich nach der Mahlzeit den Schnurrbart und sagte: »So kummt man zu wase!«
Einige der schönsten Stichlingsmännchen ließ Großvater am Leben. Er setzte sie in ein Goldfischglas, und das Goldfischglas hatte eine barocke Form, und Großvater hatte es auf einer Auktion gekauft.
Großvater stellte das Fischglas auf Großmutters Kommode vor den Spiegel. Die Stichlinge schwammen dort umher und verdoppelten sich im Spiegel. Großvater sagte: »Scheener als Schwetaschens Goldfische!«, und dabei handelte es sich um die Goldfische auf dem Vertiko der Tuchhändlersfrau Schwetasch, und damit ist alles erklärt. Jenes barocke Goldfischglas aber behielt ich als Andenken. Es gehört zu jenen Andenken, die in unserer Kate bald hier, bald dort im Wege stehen, und es zeugt mit anderen unnützen Dingen, die uns »umstehen«, von meinen nie ganz besiegten Sentimentalitäten.
Die Mutter wollte mich wieder einmal sehen, und Großvater treckte einen Handwagen voll nützlicher Sachen aufs Dorf. Auf der Fuhre saß ich, und aus dem Geratter des Handwagens und aus Großvaters rhythmischen Tritten, aus dem Rauschen der Kiefern und dem Gezirp der Vögel entstanden Melodien, und die Melodien drangen auf mich ein.
Ich kannte damals nur Choräle und Kinderliedchen. Die Choräle holten die überalterten Blasmusiker des Dorfes aus ihrem gebogenen Blech, wenn wieder ein Held auf dem Felde der Ehre gefallen war. Meine Handwagenmusik war mächtiger als die Choräle, und als ich später Symphonien hörte, überraschten sie mich nicht, und es war nichts Unfassliches für mich in ihnen, denn ich wusste, dass sie aus dem pfeifenden Wind, aus dem Rauschen der Bäume, dem Säuseln der Gräser, dem Gesumm der Insekten und dem Glucksen des Wassers kommen und dass sie das Weltall durchschweben und dass sie hören kann, wers vermag. Ich hörte sie damals, und ich höre sie heute, aber ich vermag nicht, sie in Form von Punkten aufs Papier zu bringen, und es gelänge mir nicht, sie mit Taktstrichen zu bändigen und zu bannen. Ich versuche sie deshalb mit der knarrenden Wortkunst zwischen Sätzen einzufangen, so gut ich es vermag, und ich bewundere Beethoven, Mozart, Schubert und andere gesegnete Bemeisterer der Musik.
So lustig und von solcher Farbe war mein Leben um die Zeit, da ich meinen Großvater kennenlernte: wir lebten wie auf einem Stern, und wir wurden einander nicht müde. Es gab keine Misshelligkeiten zwischen uns, weil Großvater mir in überväterlicher Liebe alles erlaubte und vieles nachsah, und alles, was uns entgegenkam, und alles, was wir an Erleben zu packen kriegten, war erregend, und das besonders für mich, denn ich war neu in der Welt, und mein Leben trug noch den Silberhauch eines jungen Baumblattes.
Der Krieg dauerte vier Jahre. Ich hörte die Erwachsenen von Jahr zu Jahr mehr von Mängeln, Hunger, Leid und Sterben reden. Als der Krieg zu Ende ging, hätte man erwarten können, dass die Erde in Krämpfen erbeben oder wenigstens einen Tag lang freudig zittern würde, aber es geschah nichts dergleichen, denn die Nachricht vom Ende des Krieges ging wie ein Gerücht durchs Land, und man hatte dennmals bereits gelernt, Gerüchte mit Vorsicht aufzunehmen.
Viele Menschen freuten sich, weil sie sich noch auf der Erde und in der sichtbaren Welt befanden; die einen freuten sich, weil man sie nicht erschossen hatte, und die anderen freuten sich, weil man sie nicht hatte verhungern lassen. Die patriotisch geblähten Worte kamen eine Weile aus der Mode, und die Kriegs- und die Hungerkunst gerieten in Misskredit.
Verhungert, zerlumpt und verlaust taumelte mein Vater aus dem Kriege. Man nannte ihn einen Heimkehrer, und dieses gesalbte Wort Heimkehrer, scheint mir, war der Same für neue nationale Phrasen.
Nun war der Vater da. Ich wurde mit meiner Schwester aus der mütterlichen Schlafkammer quartiert, und wir bezogen die kleine Bodenstube des Kottens, und es hieß, dass der Vater nun immer bei uns bleiben würde.
»Immer, immer, Mutter?«
»Immer, immer!«
Im Gastwirtschaftssaal der Großeltern Jurischka fand ein Heimkehrerball statt. Da war es wieder, dieses Samenwort für patriotischen Schwulst! Der Vater stieg in den Bräutigamsanzug. Der schwarze Anzug hing lappig an ihm herunter, und die Mutter überzog sich mit einem blassblauen Kleid, und sie ging steif hinter ihrem Korsett umher, und sie erschien uns unnahbar und fremd.
Bis zum Tage des Heimkehrerballes kannte ich keine Furcht. Man konnte mich in der Dunkelheit in die Nachbarschaft schicken, und ich bestellte, was dort zu bestellen war, aber an jenem Abend drang das Tanzgedudel bis zu uns in die kleine Bodenstube, und ich begann mich zu fürchten. Vielleicht wars, weil die Mutter so fremd getan hatte; vielleicht wars, weil sie in einer geheimen Freude von uns gegangen war; vielleicht wars, weil wir den Ursprung dieser Freude nicht kannten.
Auf unserem Nachttisch stand eine kleine Karbidlampe. Sie stand in einem Wassertopf. Das gasbildende Karbid ging zu Ende. Ich lag neben meiner Schwester im Bett und starrte auf die kleiner werdende Flamme. Ich fürchtete mich, und die Furcht war so neu, und ich rührte mich nicht, und manchmal denk ich, dass heute oder morgen der Tod eine so neue Erfahrung für mich sein würde und dass sie eine ähnliche Erstarrung in mir auslösen würde, eine Erstarrung für Jahrtausende.
Aber auch damals wähnte ich, die kleine Karbidflamme würde verlöschen und mein Leben würde damit verlöschen. Ich entsann mich meiner unerstarrten Stimme und schrie. Meine Schwester erwachte, und ich beschwor sie, die Lampe zu schütteln.
Meine Schwester schüttelte die Karbidlampe, und ich lag selbsthypnotisiert daneben und schrie, und die Flammenmandel der Lampe vergrößerte sich, und es war mir, als hätte mein Leben noch eine Frist erhalten.
Meine Schwester schlief wieder ein, und die Flamme des Lämpchens verkleinerte sich wieder, und ich schrie wieder, und ich weckte meine Schwester, und ich flehte sie an, die Lampe zu schütteln, und sie tat es, und ich schrie trotzdem, schrie und schrie …
Und die Tür unseres Stübchens öffnete sich, und es war, als ob sie ein Windstrahl getroffen hätte. Meine Mutter stand in der Stube. Ihr Gesicht war zornig, und das zornige Gesicht passte zu ihrem fremden Kleide. Die Stube war klein, und die Mutter war eine Riesin. Sie packte mich mit der linken Hand, und sie hob mich aus dem Bett, und sie schlug und schlug mich mit der rechten Hand, und die Hand steckte in einem Tüllhandschuh, und ich fühlte die runde Härte des mütterlichen Eheringes auf meinem nackten Gesäß, und meine Stimme erstarrte.
Die Mutter blies die Lampe aus. Sie entfernte sich. Es war, als wäre sie hinter dem Korsett nicht nur steif, sondern auch stumm geworden. Sie schloss die Tür, und sie ging treppab und der Heimkehrerballmusik entgegen.
Und als meine Stimme zurückkehrte, rief ich nach meinem Großvater, und der Großvater schien mir in diesem Augenblick der verlässlichste Mensch der Welt zu sein, und ich winselte mich in eine der ersten Verwandlungen meines Lebens hinein.
Großvaters Welt
Großvater wurde neunzig Jahre alt, und ich sah ihn nie mutlos, nie kraftlos. Auf seinem Totenbett prügelte er sich noch mit einem jungen Mann, der ihn zu zeitig beerben und ihm die Uhr wegnehmen wollte. Die Uhr und der Kalender waren Großvaters Navigationsgeräte durchs Leben.
Wenn im Frühling der Kopfsalat im Garten einwuchs und der Wind mit den zartgrünen Blättern spielte, so hieß es bei Großvater: »Vorwärts geht’s, der Salat spielt schon mit den Ohren!«
Die Tiere hatten für ihn eine ins Menschliche übersetzte Sprache:
Der Kater vor dem Scheunentor sagte zur Katze auf dem Heuboden: »Katharina, komm mal raus, komm mal raus!«
Der Hengst rief der Stute zu: »Hiiier bin ich, hiiier!«, und die Kohlmeise sang: »Hier sitz ich fein, hier sitz ich fein!«
Die Krähen ermunterten im Winter einander: »Knoche dürr, Knoche dürr. – Klaube ab! Klaube ab!«, und die Schwalbe sang im Sommer am Hausgiebel: »Hosen flicken, Hosen flicken? Kein Zwirrn, kein Zwirrn.«
Der Grünspecht schrie nach Großvaters Auslegung im Frühling: »Weib, Weib, Weib!« und im Herbst: »Strick, Strick, Strick!«
Der Täuber gurrte: »Heb den Rock hoch, heb den Rock hoch!«, und der Goldammerhahn sang im Birkenwipfel: »Wie, wie, wie hab ich dich lieb!«
Manchmal mein ich, Großvater sei ein Dichter gewesen, einer, dem sein hartes Leben nicht Zeit ließ, aufzuschreiben, wie er die Welt sah.
Die Tabakpfeife
Alles, was Großvater im Bauernkalender las, war für ihn naturreine Wahrheit. Was in den Zeitungen stand, war teils wahr und teils erlogen. In den Büchern standen erdichtete Geschichten, und etwas ausdichten konnte Großvater sich selber. Er tat es auf dem Kutschbock beim Klappern des Fuhrwerks: »In der Linde, der krummen, hörst du Bienchen und Hummchen summen …«
Wenn wir Großvater beim lauten Versemachen ertappten, machte er: »Simm, simm, simm«, als striche er alles durch, sah uns an und sagte: »Ja, ja, so ist das, so ist das!« – Nach der Meinung der Dorfleute konnte ein Häusler, der Verse machte, nicht ganz richtig im Kopfe sein.
Abends, nur abends, rauchte Großvater seine lange Tabakpfeife. Sie hatte einen Porzellankopf, und der war mit einer Waldlandschaft bemalt: Zwischen giftgrünen Bäumen stand ein röhrender Hirsch, dem viel Atemdampf aus dem Geäse kam.
Die Tabakpfeife war eine Lehrerpfeife, und Großvater war stolz auf sie. Er hatte sie zusammen mit einem hölzernen Lehnsessel auf einer Auktion erstanden. Sie gehörte zum Nachlass des Lehrers aus Großvaters Heimatdorf Klein-Partwitz; der Lehrer hatte Kopetzki geheißen und war nach Großvaters Meinung der beste Vogelkenner des Sorbenlandes gewesen. »Er konnte dir jeden Vogel nachmachen, er war dir schon selber ein Vogel.« Großvater blies und puffte bläuliche Tabakwölkchen in die Stube. Er rauchte nur Rippentabak; denn der war am billigsten, und er kaufte ihn in der Kreisstadt beim Zigarrenmacher in kleinen Bündeln. Den Tabak schnitten meine Schwester und ich mit Großvaters scharfem Jagdnicker, den wir sonst nicht anrühren durften.
Die Kaufmannsstreichhölzer waren für den tiefen Porzellankopf an Großvaters Pfeife zu kurz, und sie waren vor allem ungesund, wie Großvater behauptete, deshalb fertigten wir Schwefelhölzchen an, wenn Großmutter bei einer Nachbarin zum Schwatz war. Wir waren dann für längere Zeit sicher, denn Großmutter schwatzte gern und nichts als Papperepapp, wie Großvater sagte. Er schnitt mit seinem Jagdnicker zweifingerlange Hölzchen von einem Kiefernkloben, während auf der glühenden Herdplatte in einer alten Kasserolle Schwefelklumpen flüssig gemacht wurden. Schwefel war sehr gesund, wenn man Großvater glauben durfte, und wir glaubten es ihm, weil er selber glaubte, was er sagte. Er biss ein Stück von einem Schwefelklumpen herunter und verzehrte es, und auch wir verzehrten je unser Schwefelstück, ohne die Gesichter zu verziehen.
In einer Alchimistenkuchel kann’s nicht schlimmer gestunken haben als in Großvaters Stube, wenn der Schwefel kochte. Wir tauchten die Enden der zugeschnittenen Hölzchen bündelweis in den flüssigen Schwefel, und die Schwefeltropfen erstarrten in der Stubenluft zu gelben Schwefelholzkuppen.
Zum Anzünden der Schwefelhölzer benötigte man ein Herdfeuer oder eine glühende Ofenplatte, deshalb konnte Großvater seine Pfeife nur in der Nähe des Ofens rauchen.
Der geschnittene Rippentabak hing in einem Beutel am Türpfosten. Den Beutel hatte meine Mutter als Kind für Großvater zum Geburtstag aus Flicklappen zusammengenäht und mit bunten Glasperlen bestickt. »Unsere Lene, was hat sie für geschickte Finger!« konnte Großvater sagen, wenn er den Tabakbeutel besah.
Auch wir durften Großvaters Tabakpfeife rauchen, wenn wir Zahnschmerzen hatten. Wir hatten Zahnschmerzen, wenn wir für die Schule die Bücher des Alten Testaments auswendig lernen sollten: »Jesaja, Jeremia …«
Großvater achtete darauf, dass wir den Rauch lange genug im Munde behielten, damit der Zahnschmerz ausgeräuchert wurde. Eine solche Zahnbehandlung endete meist mit schwerer Blässe und nachfolgendem Erbrechen des Patienten. Beide Erscheinungen reichten aus, die Schule mit Berechtigung zu schwänzen.
Um die Weihnachtszeit kam alljährlich der neue Kalender. Er enthielt die Daten der Kram-, Vieh- und Pferdemärkte unseres Bezirks, und er brachte die Wettervorhersagen nach dem Hundertjährigen Kalender.
Einmal waren wir in der Heuernte, und der Kalender hatte gut Wetter vorausgesagt, doch als wir das Heu schon fast trocken hatten, brach ein Gewitter los und verdarb es. Großvater zog den Tischkasten auf, packte den Kalender und warf ihn aus dem Fenster hinaus in den Regen: »Was fällt dir ein? Da überführ dir, du Lügensack!«
Großmutter holte den Kalender herein. Er hatte achtzig Pfennig gekostet. Sie entschuldigte den Kalender: »Es kann doch vorkommen, dass eins mal die Unwahrheit sagt.«
»Du vielleicht, ich nicht«, sagte Großvater.
Die Kalendergeschichten las Großvater jahrsüber mehrmals, und manche Partien der Geschichten konnte er auswendig, besonders, wenn sie sich auf Personen aus der Geschichte der von ihm gehassten Preußen bezogen, oder auf Personen, die einem Mord zum Opfer gefallen waren, oder auf andere, die sich selber umgebracht hatten.
Als sich im Dorf ein heimatloser Fleischergeselle erhängte, zitierte Großvater aus einer Kalendergeschichte: »Er sah kein Land mehr, nur böse Menschenzungen, und er ließ sich von ihnen treiben und suchte die Handwärme seiner Mutter, und die war nicht mehr, und da legte er sich ein Seil aus Hanf um seinen Nacken und schied …«
Im Kalender standen auch Inserate, zwielichtige Bücher wurden angeboten: Freie Liebe oder Ehe in Not und Wie lerne ich mich Japanisch selbstverteidigen, auch Herren rauchen Bremer Keulen.
Die Inserate kümmerten Großvater nicht. Er nannte sie: »Schisschen, schisschen.« Aber die Ratschläge für gesunde und kranke Tage las Großvater eifrig, obwohl er nie ernstlich krank war. Er hatte sich vorgenommen, sehr alt zu werden, einerseits, um sehen zu können, ob seine Enkel einmal reiche Männer werden würden, andererseits, damit Großmutter, die er für leichtsinnig hielt, seinen Nachlass nicht würde verprassen können.
In dem Jahr, von dem ich erzähle, brachte der Kalender eine Abhandlung über die Schädlichkeit des Tabakrauchens. Großvater rauchte fortan nicht mehr und stellte seine Tabakpfeife in die Bodenkammer. Uns erzählte er, im Tabak kämen bestimmte Tierchen, sogenannte Nikotina vor, die mit dem Rauch in die Lungen und Mägen der Menschen drängen, um sie allmählich zu töten. Großmutter spuckte vor Entsetzen aus.
Ohne Tabakpfeife wurden Großvater die Winterabende lang. Er lehrte uns das Kartenspielen: Schafkopp und Sechsundsechzig. Wir wurden abgefeimte Kartenspieler und spielten nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kirche während der Predigt hinter der Orgel. So kamen wir unangefochten vom Bußdrang, den uns der Pastor einzuverleiben gedachte, über den Winter.
Was sich nun jahrsüber in der Kalenderredaktion der Stadt Sorau auch abgespielt haben mochte, ob die Firmen, die die Zigarren Bremer Keule oder den Tabak Krauses schwarzer Knaster als besonderen Lebensgenuss angepriesen hatten, der Antinikotinkampagne des Kalendermachers wegen ihre Inserate zurückgezogen oder wenigstens mit deren Zurückziehung gedroht hatten, im neuen Kalender erschien eine vorsichtige Zurücknahme des allzu strengen Gesundheitsratschlages vom Vorjahr. Man dürfe schon ein wenig rauchen, ja, ja, hieß es, vor allem Zigarren und Pfeife, doch sei wichtig, die Pfeife stets sauberzuhalten.
Da holte Großvater seine Tabakpfeife aus der Kammer und rauchte fortan wieder, aber er säuberte die Pfeife täglich mit einem langen Draht in der Regentonne auf dem Hofe, und er trocknete sie tagsüber auf dem Ofen, um sie am Abend rauchen zu können.
Alles kam in die Reihe: Wir schnitten wieder Tabak und stellten zu Großmutters Unfreude Schwefelhölzer her, und Großvater sog mit den feinen Tabakpüffchen winters eine Menge Geschichten aus der Pfeife, die mich noch heute bewegen.
Die Macht des Wortes
Jedes Jahr setzte Großvater vorgezogene Kürbispflanzen in Kompost und zog große gelbe Kürbisse für den Winter. Der Komposthaufen war auf dem Felde. Durch die Felder schlichen zuweilen redliche Menschen, wenn man den Worten der Bibel traun kann: Sie säten nicht, und sie ernteten doch, und deshalb nächtigte Großvater, wenn die Kürbisse reiften, draußen. Er breitete seine blaue Schürze aus, legte sich hin und schlief im Raingras, und da er beim Schlafen schnarchte, waren die Diebe gewarnt.
Eine Weile ging’s gut, aber Großmutter war noch eifersüchtig. Sie wollte kein Mannsbild, das nachts »umherzigeunerte«. »Denk an den Winter! Denk an dein Rheuma. Ich reib dich nicht ein, wenn es dich wieder quält. Im Grase liegen – bist doch kein Rehbock!«
Großvater nahm seine Schürze und ging zur Großmutter in die Kammer, doch bevor er das Feld verließ, nahm er sein Messer und ritzte in alle Kürbishäute: »Gestohlen bei Kulka.«
Die Kürbisse wuchsen. Großvaters Schrift wuchs mit. »Gestohlen bei Kulka.« Die Diebe umschlichen den Komposthaufen und ließen die Kürbisse, wo sie waren. Großvaters Buchstaben wirkten wie Zauberrunen.
Das Teufelsmesser
Großvaters Tischschublade enthielt merkwürdige Dinge: einen Glasschneider, eine Anreißschnur für Zimmerleute, die mit Ofenruß geschwärzt werden musste, um mit ihr den Weg der Schrotsäge auf Brettern und Balken vorzuzeichnen; Munition für ein Zündnadelgewehr; ein Tütchen Teufelsdreck, vor dem jede Hexe floh, wenn man ihn anzündete und schwelen ließ, und ein Stück vom Hängestrick eines gewissen Sastupeit, der sein Leben im Schnapsrausch beendete; aber das schaurigste Ding war ein Taschenmesser mit Hirschhornschalen, das nichts weniger als in der Wade eines Teufels gesteckt hatte. Der Teufel war blass gewesen, jung noch und unerfahren, ein Anfänger in seinem Beruf, und wir kannten ihn fast mit Vornamen aus Großvaters Erzählungen, und mit den Jahren tat er uns leid.
Nach Großvaters Berichten steckte in jedem Wirbelwind, der sommers über die Felder küselte, ein Teufel. Je kleiner der Wirbelwind, desto kleiner der Teufel, der drin saß und Dinge lebendig machte, die sonst still dort lagen, wo sie hingehörten, wie Misthalme, welke Baumblätter, Papierstückchen, verdorrte Blumen und den nötigen Weg- und Feldstaub, natürlich, der die bekannten Trichter und Wirbel abgab, in denen sich der Teufel versteckte.
Ja, wenn es überall so beherzte Männer wie Großvater gegeben hätte, hätte es nirgendwo in der Welt zu Wirbelsturmteufeleien kommen können, bei denen Häuser niedergerissen, Fabrikschornsteine gefällt und Menschen emporgeschleudert wurden.
Alles Niewiederkehrende hatte sich in Großvaters Kindheit und in seiner Jugendzeit und im Lande Klein-Partwitz im Kreise Hoyerswerda ereignet; das war Großvaters Heimatdorf.
Großvater macht Mittag beim Heidekornmähen, und er trinkt aus der bauchigen Tonflasche, und wie er in die flimmernden Felder sieht, erblickt er über Schubeinz’ Feld einen kleinen Wirbelwind, und der Wirbelwind kommt auf Großvater zu und packt Großvaters Brottuch und hebt es empor, und das Brottuch gehört dem Förster aus Blunow, bei dem Großvater Knecht ist, und Großvater nimmt sein Taschenmesser, mit dem er vom Brotkanten heruntergeschnitten hat, und er wirft es in den Wirbelwind, und der Wirbelwind pfeift, und die Luft geht ihm aus, und er verschwindet, und am Rain sitzt ein kleiner Teufel, und das Messer, Großvaters Messer, steckt in der Wade des Teufels.
Das Teufelchen ist blass und hilflos, und es bittet Großvater, er möge es vom Messer befrein, und es ist der unentbehrliche Pferdefuß, in dessen Wade das Messer steckt.
Großvater ist nicht bereit zu tanzen, wie so ein kleiner Teufel pfeift, und er springt hin und schüttelt den kleinen Teufel: »Sieh dir vor und lass die Leite in Ruhe!«
Und der kleine Teufel bittet um Gnade und ist bleich und zittert wie ein Lehrling nach der ersten Zigarette, und Großvater zieht ihm das Messer aus der Wade, und fort ist der Teufel, und Großvaters Brottuch stinkt, und die Förstermagd muss es waschen, dreimal nach Regel und Kunst, und auch dann stinkt es noch, dass man es nicht im Hause behalten kann.
»Ach, der arme Teufel, hatte er am Pferdefuß eine Wade, Großvater?« – »Ssa, ssa«, machte Großvater, und er überhörte die Frage, »ja, so ist das mit dem Deibel!« Großvater zeigte an der Messerklinge, wie tief das Messer in der Wade des Teufels gesteckt hatte, und da war vor allem das Messer, das keinen Zweifel an der Wahrheit der Geschichte zuließ, zumal wir wussten, dass Großvater es seither nie mehr benutzte.
An diese Teufelei muss ich denken, wenn ich in gewissen westlichen Zeitungen etwas über mein Land oder gar über mich lese, und ich finde, dass sich manche Zeitungsschreiber dort der Methode meines sorbischen Großvaters bedienen, Teufelsgeschichten aufzutischen. Was mich wundert, ist, dass es dort Leser gibt, die so naiv und glaubfreudig sind wie wir als Dorfkinder in den Niederlausitzer Wäldern.
Der Pelzmantel
Als junger Mann hatte sich Großvater auf einer Auktion einen alten Pelzmantel gekauft, einen Mantel aus ungeschorenem Schaffell. Im Sommer hing er im Großvaterschrank, und Großmutter band die Ärmel zu und stopfte sie voll Mottenkraut.
Manchmal holten wir uns beim Spielen Großvaters Pelzmantel aus dem Schrank. Wir zogen ihn über, er war uns zu lang; wir konnten nicht gehen, wir standen gebeugt, wir ertranken in Schaffell.
Wir wurden älter, der Pelz wurde älter. Kamen die kalten Tage des Jahres, hieß es: »Alte, flick mir den Pelz!« Großmutter flickte den Pelz. Flicken an Flicken – das war der Pelzüberzug. Wer von uns mit dem Fuhrwerk zur Stadt fuhr, durfte sich Großvaters Pelz anziehen. Wenn Großvater fuhr, schlug er den breiten Pelzkragen hoch. Von hinten sah er aus wie ein Mann ohne Kopf. Großvaters Atem strich über den Pelz hin. Der Pelz bereifte und roch wie die Schafe im Winter.
Großvater prahlte mit seinem Pelz: »Durch den geht kein Gewehrschuss, das sag ich!«
»Na, Großvater, na?«
»Wenn doch bloß mal einer auf mir schießen wollte!«
»Na, Großvater, na?«
»Mit Schrot natürlich.«
Einmal fiel Großvater winters vom hohen Braunkohlenfuder. Wir erschraken. »Hast du dir weh getan?«
»Ja, Schisschen, ich stak doch in meinem Pelz.«
Ich hab ihn noch heute in Verdacht, den Alten, dass er sich vom Fuder stürzte, um ein bisschen mit seinem Pelz zu prahlen.
Großvaters Tod
Großvater wurde neunzig Jahre alt, und mir ist, als hätte ihn nicht das Alter, sondern der Hunger gefällt. Als der zweite große Krieg der deutschen Übermenschen endlich zu Ende war, lag Großvater ausgehungert und entkräftet zu Bett und navigierte sich, wie früher durch sein arbeitsreiches Leben, mit der Uhr und mit dem Kalender auf seine Sterbezeit zu. Er sah auf dem Sterbebett nicht zum Fenster hinaus in die vielhundertjährigen Eichen auf dem Dorfanger, weil er auf seine Enkel wartete und die Stubentür im Auge haben wollte, und neben der Stubentür hing die Uhr. Das Zifferblatt und die Zeiger konnte Großvater ohne Brille nicht mehr erkennen, aber da waren die drahtherben Stunden- und Halbstundenschläge, die seine Sterbezeit in kleine Strecken aufteilten. Wenn die Gewichte der Uhr – in Gusseisen nachgeformte Tannenzapfen – tiefer als die Abstellplatte des Küchenschrankes waren, auf der die Brotbüchse stand, so hieß es: »Die Uhr zieh auf, Alte!«
Den Kalender ließ sich Großvater von Zeit zu Zeit aus dem Tischkasten reichen, und auch das geschah im Befehlston. »Den Kalender!« Er sah nach, wie weit es bis zum Frühling war, und er krakeelte, als die Aussaatzeit des Hafers herankam, ohne dass jemand in den Nachkriegswirren Anstalten traf zu säen.
Die kleine Großmutter rackerte sich ab, denn bald hieß es: »Bett aufschütteln!« oder: »Kartoffeln ran!« Und manchmal aß Großvater einen Topf Pellkartoffeln aus, und manchmal aß er nur eine. Die Hauptsache, die Kartoffeln erschienen auf dem Deckbett, wenn er sie verlangte, und er ließ sich einen Knotenstock geben, mit dem er auf die Dielen stampfte, um seinen Befehlen bei Großmutter Nachdruck zu verleihen.
Bevor er bettlägerig wurde, hatte Großvater diesen Knotenstock nie benutzt, denn er war sein Leben lang steil und dabei beweglich, hatte fast volles Haar, das nicht einmal sehr grau war, bis er sich legte. Den Stock hatte Großvater wie manche seiner Sachen auf einer Auktion erworben. Es war ein Herrenstock mit einer kleinen Silberplatte am Ende des waagerechten Knaufs. Großvater fühlte wohl, dass er sich lächerlich gemacht hätte, wenn er mit diesem Stock in den Wald und in die Pilze gegangen wäre. Wichtig war, dass er einen so feinen Stock zum Vererben besaß, vielleicht, dass einer seiner Enkel doch ein Herr werden sollte, und wenn das nicht eintreten würde, so sollte der Stock mir, als dem ältesten Enkel, gehören.
Dann kam der junge Mann, der Großvaters Navigationsgerät, die alte Uhr mit den gusseisernen Tannenzapfen, fortnehmen wollte. Es war ein junger Pole, den die Faschisten während des Krieges verschleppt hatten und der sich auf dem Rückweg in sein ausgeraubtes Heimatland befand. Er trat in Großvaters Stube, nahm vom kranken Greis kaum Notiz und suchte nach brauchbaren Gegenständen. Er steckte dies und das in die Taschen, und Großvater ließ es geschehen, aber dann griff der Jüngling nach der Uhr, und niemand weiß, woher Großvater die Kraft nahm, aus dem Bett zu fahren. Er schwang den Stock und ging auf den jungen Menschen los. Vielleicht wurde in diesem Augenblick die Vorstellung des jungen Mannes von Gespenstern zur Wirklichkeit; denn er flüchtete, obwohl er Großvater mit einer Armbewegung hätte umreißen können.
Großvater pochte auf die Dielen, bis Großmutter kam, die sich versteckt hatte, und Großvater prahlte sogar ein wenig: »An die Uhr wollt er, aber Schisschen, die brauch ich!«
Großvater machte sich ans Sterben wie an eine große Arbeit. Er starb wochen- und monatelang, lag Tag und Nacht auf der Lauer und schrie von Zeit zu Zeit: »Hähä, jetzt kommt er. Er will mir holen. Kahler Hund, du! Zeigen werd ich dir!« Großvater schwang den Stock gegen den Unsichtbaren, und die energischen Stockschwünge holten ihn wohl immer wieder ins Leben zurück. Er schrie und ächzte, dass es durchs ganze Haus hallte, und meine Mutter hielt sich nachts die Ohren zu. Tassen und Teller, Kannen und Schüsseln mussten aus der Nähe des Krankenlagers und vor Großvaters Stockhieben in Sicherheit gebracht werden.
Ich kam zu Besuch aus dem Thüringischen, wo ich arbeitete, und hörte schon im Hausflur Großvaters Sterbeflüche. Ich zögerte, zu ihm in die Sterbestube zu steigen. Ich kann leidenden Tieren, die stumm sind, helfen, kann sie sogar heilen, aber ich versage, wenn ich Menschen körperlich leiden sehe. Eine Lähmung befällt mich, nicht einmal Trostworte kann ich formen und kann nicht ergründen, wo dieses Versagen seinen Sitz hat, und manchmal meine ich, dass es schiere Feigheit ist, die mich da lähmt.
Die kleine geschundene Großmutter kam nur für einen Augenblick zu uns herunter in die Wohnstube, um etwas zu besprechen, da hörten wir oben nach teuflischen Großvaterflüchen ein dumpfes Fallgeräusch. Großvater hatte sich, um Großmutter für ihre Abwesenheit zu strafen, aus dem Bett fallen lassen.
Wir rannten treppauf. Großvater lag auf den Dielen, das Gesicht nach unten, und schrie und verfluchte die Großmutter – ein Totengerippe in blau-weiß gestreiftem Barchenthemd, kein Zoll Fleisch mehr an irgendeinem Glied, lag da, fluchte und fluchte.
Meine Lähmung setzte ein. Ich sah zu, wie mein Bruder den ehemaligen Großvater von den Dielen hob, doch als das Großvatergerippe wieder gebettet war, erkannte es mich: »Ich sterb hier, und du treibst dir rum, und ich hab dir gerettet, wie du kleene warst!«
Und das war wahr: Großvater hatte mich gesund gepflegt, als ich im Säuglingsalter eine Lungenentzündung hatte und die Mutter im Kindbettfieber lag, und er war nicht von meinem Bett gegangen, bis ich, sein erster Enkel, genas.
Nun schüttete Großvater seinen Zorn über mich aus, seine Enttäuschung, und er verkündete, dass ich seinen Knotenstock nicht haben sollte. Was sollte ein Herumtreiber mit einem Knotenstock? Den Knotenstock sollte mein Bruder haben, der schon Neubauer mit zwanzig Morgen Land war und nach Großvaters Vorstellung die meiste Aussicht hatte, ein Herr zu werden.
Ich stand da – keine Handbewegung, kein Wort.
Ich musste wieder weiter, und ich sah Großvater nicht sterben, aber seine Flüche hörte ich Jahr für Jahr, wenn ich dasaß und an die Kindheit dachte, die poetisch war durch Großvater. Und eines Tages begann ich die Geschichten vom Großvater zu schreiben, und jede Geschichte war eine Abbitte für mein Versagen.
Selbstermunterungen: Leben
Der Sinn meines Lebens scheint mir darin zu bestehen, hinter den Sinn meines Lebens zu kommen.
*
Ich will auf jeden Tag neugierig sein und den Morgen eines jeden Tages feiern.
*
Und ich will danach trachten, dass mein Tagwerk wenigstens um eine Winzigkeit anders ist als das des Vortags.
*
Ich sehe auf meine Väter und sage: »Das Leben vergeht!« Ich sehe auf meine Kinder und sage: »Das Leben fängt an.« Ich sehe nach innen und fühle weder Vergehen noch Anfang.
*
In der Jugend erwartete ich was vom Leben; jetzt erwarte ich nur noch von mir was, und wenn ich nichts mehr von mir erwarte, werde ich tot sein, selbst, wenn ich noch leben sollte.
*
Wortbrüchiger vor mir dazustehen wird mir von Jahr zu Jahr peinlicher.
*
Eine Stunde ist eine Stunde, aber wichtig ist, wo ich sie verbringe, ob vor, ob hinter den Kulissen des Lebens.
*
Es wäre mir lieb, wenns mir gelänge, immer ein anderer zu sein als der, für den andere mich halten.
*
Das Leben ist verwickelt, verknotet; man erkennt nicht, von wannen der Faden kommt.
*
Es braucht viele Jahre, bis mir aufgeht, dass das, was ein Aufschreiber mit dem, was er aufschreibt, erreichen will, nicht mit Händen zu greifen sein darf.
Jahre mit Brecht
Der Hut
Wir wollten nach Holland fahren. »An Hut sollten mir uns kaufn«, sagte Brecht, »über die Grenze geht man besser mit Hut.«
Ich hielt das für einen Scherz und lachte; er lächelte.
Wir kamen nach Aachen. »Jetzt wär’s also Zeit z’wegn dem Hut«, sagte Brecht, und da erst erspürte ich, dass es ihm ernst war mit dem Hutkauf, und mir fiel jene Stelle aus der Carrar ein, in der es um die Arbeitermütze geht, nach der die Reaktion schießt.