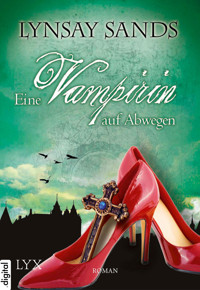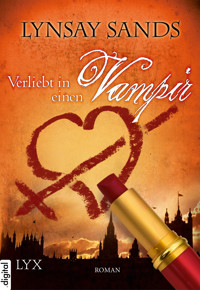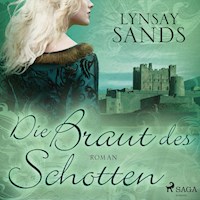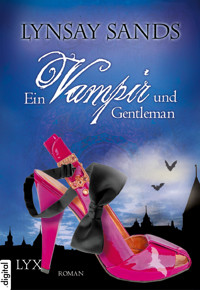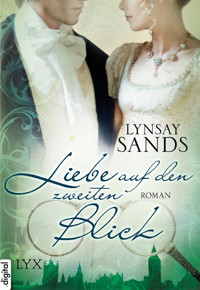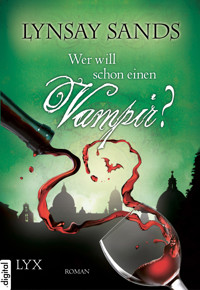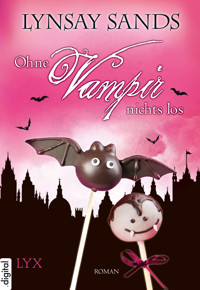
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Argeneau
- Sprache: Deutsch
Als Unsterbliche Sherry Carnes Laden verwüsten, kommt ihr der Vampir Basileios Argeneau zu Hilfe. Basil erkennt in Sherry sofort seine Seelengefährtin, auch wenn er nicht weiß, was er von ihrer scharfzüngigen und offenherzigen Art zu halten hat. Doch der Überfall auf Sherrys Laden macht ihm eines deutlich: Sherry schwebt in großer Gefahr, und Basil ist der Einzige, der sie retten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Die Autorin
Die Romane von Lynsay Sands bei LYX
Impressum
LYNSAY SANDS
Ohne Vampir
nichts los
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Ralph Sander
Zu diesem Buch
Als ein panischer Teenager in Sherry Carnes Laden stolpert und kurz darauf einige finstere Gesellen dort auftauchen und alles verwüsten, ahnt Sherry noch nicht, in welchen Schlamassel sie hineingeraten ist. Sie glaubt zu träumen, als plötzlich leibhaftige Vampire vor ihr stehen, und damit nicht genug: Ihr charismatischer Anführer Basileios Argeneau behauptet auch noch ernsthaft, dass ausgerechnet Sherry seine auserwählte Lebensgefährtin ist! Sherry mag es überhaupt nicht, derart bevormundet zu werden, dummerweise fühlt sie sich aber in Basils starken Armen mehr als wohl. Tatsächlich hat Basil sich seine Gefährtin für die Ewigkeit etwas weniger eigensinnig vorgestellt, Sherrys vorwitzige Küsse räumen allerdings schnell alle Zweifel aus. Die Leidenschaft, die sofort zwischen ihnen entflammt, macht eine Trennung undenkbar. Die Zeit drängt jedoch. Denn wie Basil erkennen muss, steht seine Auserwählte schon seit langer Zeit unter dem Einfluss eines mächtigen Vampirs – und dieser ist nicht bereit, Sherry so einfach gehen zu lassen …
1
Sherry saß da und erledigte missmutig ihre Arbeit. Sie hasste es, ihre Steuererklärung zu machen. Und sie hasste es noch mehr, Steuern zu zahlen.
Sie schnaubte wutentbrannt, während sie den Betrag errechnete, den sie in diesem Quartal zahlen musste. Sie speicherte die Datei, schloss das Programm und wollte eben den Computer runterfahren, als die Tür zu ihrem Büro aufgerissen wurde. Noch immer schlecht gelaunt hob Sherry den Kopf und war wild entschlossen, dem Mitarbeiter sprichwörtlich den Kopf abzureißen, der es wagte, ohne anzuklopfen ins Zimmer gestürmt zu kommen. Doch ihre Worte blieben ihr buchstäblich im Hals stecken, als sie ein zierliches blondes Mädchen im Teenageralter erblickte, das die Tür hinter sich zuwarf.
Die Kleine nahm so gut wie keine Notiz von Sherry, wenn man von einem flüchtigen Blick in ihre Richtung absah, während sie sich im Raum umschaute. In dem Moment, als ihr das Fenster auffiel, von dem aus man das Geschäft überblicken konnte, duckte sie sich hastig auf den Boden. Das Büro lag acht Treppenstufen über dem Niveau des Geschäfts, das man durch dieses Fenster aus der Vogelperspektive überblicken konnte. Ein paar Sekunden später hob die Kleine zögerlich den Kopf und spähte ängstlich zum Fenster.
Sherry zog verwundert die Augenbrauen hoch. »Das Glas ist auf der anderen Seite verspiegelt. Vom Geschäft aus kann dich niemand sehen«, erklärte sie.
Das Mädchen warf ihr einen gereizten Blick zu. »Schhhht!«
»Wie bitte?«, gab Sherry mit einer Mischung aus Belustigung und Fassungslosigkeit zurück. Sie wurde ernst und fügte in energischem Tonfall an: »Das hier ist mein Büro, Kleine. Wenn du mir keinen guten Grund für deine Anwesenheit nennen kannst, rate ich dir, auf der Stelle von hier zu verschwinden.«
Anstatt dieser Aufforderung Folge zu leisten, bewirkten Sherrys Worte, dass die Kleine sich zu ihr umdrehte und sie mit finsterer Miene anstarrte. Das Erstaunlichste waren ihre silbrig-grünen Augen, die fast zu glühen schienen. Von diesen wunderschönen, ungewöhnlichen Augen in den Bann gezogen, starrte Sherry das Mädchen ebenfalls an. Dann aber zog sie fragend die Augenbrauen hoch. »Also? Willst du weiter nur auf dem Boden hocken oder wirst du mir jetzt erklären, was du hier zu suchen hast?«
Statt zu antworten, legte das Mädchen die Stirn in Falten und fragte: »Wieso kann ich dich nicht lesen?«
Diese scheinbar in keinerlei Zusammenhang stehende Frage ließ Sherry kurz auflachen. Aber als von der Kleinen immer noch keine Reaktion kam, sagte sie in ernstem Tonfall: »Vielleicht liegt es daran, dass ich kein Buch bin.«
Aber auch das änderte nichts an dem starren, eindringlichen Blick ihres Gegenübers. »Wie heißt du?«, versuchte Sherry es mit einem erneuten Anlauf.
»Stephanie«, kam die gedankenverloren klingende Antwort. Der forschende Blick, der Sherry das Gefühl gab, ein Käfer unter dem Mikroskop eines Wissenschaftlers zu sein, wurde jäh unterbrochen, als ein Gong ertönte und über die Lautsprecheranlage des Geschäfts verkündet wurde, dass der Vordereingang nun geöffnet sei. Stephanie schien sich dabei an etwas zu erinnern, duckte sich wieder und spähte vorsichtig über die Fensterbank hinweg in den Laden.
»Wie ich schon sagte, die Scheiben sind von der anderen Seite verspiegelt«, erklärte Sherry ein wenig aufgebracht. »Niemand kann sehen …«
»Schht!«, zischte Stephanie sie an, ohne sich zu ihr umzudrehen. Sie hob nur einen Arm und hielt die Hand hoch, um Ruhe zu gebieten.
Gegen ihren Willen kam Sherry dieser unausgesprochenen Aufforderung nach. Dieses Mädchen hatte etwas Seltsames an sich, eine plötzliche Reglosigkeit und Anpassung, die jetzt noch viel intensiver waren als vor ein paar Minuten. Ratlos warf Sherry selbst einen Blick durch das Fenster und sah, wie vier Männer das Geschäft betraten. Wobei die Formulierung »betraten« die Sache nicht ganz traf. Das war ein zu normaler Begriff. Wären die Männer so wie jeder andere in den Laden gekommen, hätte Sherry das nur beiläufig zur Kenntnis genommen und sich wieder dem Mädchen in ihrem Büro gewidmet. Aber an diesen Männern war nichts normal.
Diese vier Kunden schienen alle Mitte zwanzig zu sein, und sie hatten alle lange, schmutzigblonde Haare. Einer trug sie zum Pferdeschwanz gebunden, ein anderer zum Dutt hochgesteckt, der dritte mit Gel so in Form gebracht, dass sein Kopf wie ein Igel wirkte. Der vierte dagegen, der entweder der Anführer war oder zumindest den Eindruck erweckte, die Gruppe anzuführen, trug seine Haare wie eine Löwenmähne.
Da sie das Gefühl hatte, dass Ärger im Anmarsch war, beobachtete sie die Männer genauer, die einheitlich in Jeans und T-Shirts gekleidet waren, die alle dringend eine Waschmaschine von innen hätten sehen sollen. Ihr fiel auf, dass diese Männer nicht gingen, sondern sich bewegten wie Raubtiere, die sich an ihre Beute heranschlichen. Unwillkürlich kam Sherry sich wie eine Gazelle in der Serengeti vor. Sie konnte nur froh sein, dass die vier sich auf der anderen Seite des Fensters befanden.
Ohne es zu bemerken, war sie aufgestanden und hatte sich zu Stephanie gestellt. Von dort sah sie mit an, wie der Anführer den Kopf hob und durch die Nase einatmete, als würde er Witterung aufnehmen. Es passte zu diesem Erscheinungsbild eines Raubtiers. Dann nickte er, nahm den Kopf runter und sah sich um. »Wo ist das Mädchen?«, fragte er.
Es war nicht weiter verwunderlich, dass die Kunden weiter nach den Küchenutensilien suchten, für die sie hergekommen waren. Wahrscheinlich fühlte sich keiner von ihnen angesprochen, da sie nicht wussten, welches Mädchen er meinte. Sherry bezweifelte, dass irgendwer von ihrem Personal Stephanie überhaupt bemerkt hatte, von den Kunden ganz zu schweigen, die nur Augen für ihren Einkauf hatten.
Als niemand reagierte, warf der Anführer einen grimmigen Blick über die Schulter zu dem Mann mit der Igelfrisur, der noch immer in der offenen Eingangstür stand. Er machte zwei Schritte nach vorn, dann warf er die Tür mit solcher Wucht zu, dass das Glockenspiel wie verrückt hin und her schaukelte. Als es zur Ruhe kam, legte sich Stille über das Geschäft. Alle Blicke waren nun auf das Quartett gerichtet, die Luft schien vor Angst wie aufgeladen, die Sherry nicht nur den Leuten da unten anmerkte, sondern die sie selbst am eigenen Leib verspürte.
»Danke für Ihre Aufmerksamkeit«, sagte der Anführer und schlenderte weiter. Nach ein paar Metern blieb er vor einer Angestellten stehen, die einer jungen Frau behilflich gewesen war, deren Tochter sich an ihren Rock klammerte.
Sherry schnappte nach Luft, als die Hand des Mannes nach vorn schoss und sich in den Sweater der Mutter verkrallte. Er sah sie nicht mal an, als er sie packte und zu sich zerrte. Erst dann drehte er den Kopf zu ihr um. Seine Nasenspitze berührte dabei fast die ihre, während er energisch fragte: »Wo ist das …?«
Sherry verkrampfte sich noch heftiger, als er mitten im Satz abbrach. Sie biss sich auf die Lippe, ihre Nackenhaare sträubten sich, da er erneut durch die Nase einatmete, diesmal noch genüsslicher als zuvor. Sie konnte es sich nicht erklären, aber dieses Verhalten löste bei ihr Sorge um diese Kundin aus, zumal er sich dann auch noch wie erregt leicht schüttelte, als er wieder ausatmete.
»Du bist schwanger«, sagte er und begann zu lächeln. Er beugte den Kopf vor und schnupperte an ihrem Hals entlang. Nach einem glücklichen Seufzer erklärte er: »Ich mag Schwangere fast so sehr wie unbehandelte Diabetiker. All diese Hormone im Blut …« Er lehnte sich leicht zurück und sah ihr ins Gesicht. »Das ist ein gehaltvoller Cocktail.«
»Verdammt.«
Sherry stutzte und wandte ihren Blick von dem Szenario ab, das sich vor ihren Augen abspielte. Sie sah Stephanie an und musste zu ihrem Erstaunen feststellen, dass sie das Mädchen völlig vergessen hatte.
»Was?«, fragte sie und flüsterte instinktiv. Sie kannte diese Leute nicht, und sie hatte auch keine Ahnung, was da unten los war, aber Alarmglocken schrillten in ihrem Kopf, weil irgendetwas nicht stimmte. Etwas Übles bahnte sich vor ihren Augen an, und eine innere Stimme sagte ihr, dass es nur noch schlimmer werden würde.
Stephanie sah sich nervös um. »Gibt es hier einen Hinterausgang?«
»Ja, durch die Tür da drüben kommt man in eine Gasse hinter den Geschäften«, antwortete Sherry und zeigte auf eine nach unten führende Treppe am anderen Ende ihres Büros.
Sherry konnte es der Kleinen nicht verübeln, dass sie sich aus dem Staub machen wollte. Sie selbst hätte das am liebsten auch gemacht, aber das ging nicht. Sie konnte ihre Angestellten und Kunden nicht einfach der Gnade dieser Männer ausliefern, die momentan ihr kleines Geschäft belagerten. Es war so, als hätten sich vier Löwen in einen Stall voller Lämmer geschlichen. Obwohl der Vergleich hinkte. Schließlich waren es Löwinnen, die auf die Jagd gingen, und nicht die Herren der Schöpfung. Diese Männer ließen sich wohl zutreffender mit Wölfen vergleichen.
»Du hast nicht zufällig einen Wagen in der Gasse geparkt, oder?«, fragte Stephanie in hoffnungsvollem Tonfall.
Sherry starrte sie an. Zwar hatte sie die Frage akustisch vernommen, aber sie hatte nichts davon mitbekommen, dass das Mädchen dabei auch die Lippen bewegt hatte. Wie …?
»Oder?«, wiederholte Stephanie, und jetzt machte sie dabei auch eindeutig den Mund auf.
»Nein, ich nehme immer die U-Bahn«, antwortete Sherry. Die meisten Leute machten es so wie sie, weil sie nicht die völlig überzogenen Parkgebühren bezahlen wollten.
Stephanie seufzte betrübt und sah sich wieder das Drama an, das sich auf der anderen Seite des verspiegelten Fensters abspielte.
Sherry folgte ihrer Blickrichtung. Der Anführer drückte die junge Mutter jetzt gegen die Kassentheke, sie stand weit nach hinten gebeugt da, und er schnupperte wie ein Hund an ihrem Hals. Es war eigenartig, und vielleicht hätte man das Ganze sogar als amüsant betrachten können, wäre da nicht das Messer gewesen, das der Mann in diesem Moment aus der Tasche zog und aufklappte.
»Oh, Scheiße«, keuchte sie.
»Das kann man wohl sagen«, pflichtete Stephanie ihr bei. »Mit einem Auto wäre das alles viel leichter.«
»Was wäre leichter?«, fragte Sherry beiläufig, während sie zusah, wie der Mann mit der Klinge der offensichtlich schwangeren Frau über den Bauch strich und das Messer dann gegen ihren Hals drückte. Die Frau zeigte keinerlei Reaktion, sie schaute völlig ausdruckslos drein, was auch für die anderen Kunden und das Personal galt. Sogar das Kind stand da und starrte ins Nichts, als wäre alles ganz normal. Nur das Quartett ließ Gefühlsregungen erkennen. Der Anführer stellte ein fast schon sanftes Lächeln zur Schau, die drei anderen – die seine Brüder hätten sein können – grinsten auf eine Weise, die ihr wie Vorfreude vorkam.
»Du solltest dich besser davonmachen », meinte Stephanie ernst und ging zur Bürotür, um sie abzuschließen.
»Ich werde mich ganz sicher nicht davonmachen«, gab Sherry energischer zurück als gewollt. »Ich werde die Polizei holen.«
»Die Polizei kann da nichts ausrichten«, ließ Stephanie sie wissen, ging zum Aktenschrank, hob ihn an und trug ihn die Stufen runter, um ihn vor die Tür zu stellen, durch die man vom Geschäft aus ins Büro gelangte.
Sherry war von dem Anblick so überrumpelt, dass sie nicht wusste, was sie sagen oder tun sollte. Der Aktenschrank war ein Monstrum mit vier großen Schubladen vollgestopft mit Akten und Belegen, der mühelos ein paar Zentner auf die Waage brachte. Sie bezweifelte, dass sie in der Lage war, den Schrank auch nur einen einzigen Zentimeter von der Stelle zu rücken. Ganz sicher aber hätte sie ihn nicht wie einen leeren Wäschekorb durch die Gegend tragen können, so viel stand fest. Sie versuchte zu begreifen, was sie da gerade eben gesehen hatte, aber dann lenkte eine Bewegung unten im Geschäft ihre Aufmerksamkeit auf sich. Der Anführer hatte die Schwangere losgelassen und einen Schritt nach hinten gemacht.
Vielleicht würden er und die anderen doch noch den Laden verlassen. Diese vage Hoffnung hatte sie noch nicht ganz zu Ende gedacht, da nahm der Mann eine Rührschüssel aus dem Regal gleich neben ihm und drückte der Schwangeren die Schüssel und sein Messer in die Hand. Dann sagte er in freundlichem Tonfall: »Das mit dem Blut ist immer so eine Sauerei, außerdem ist das mein Lieblingsshirt. Warum erledigst du das nicht für mich? Beug dich über die Theke, stell die Schüssel so auf den Hocker, dass sie sich unter deinem Hals befindet. Dann schneidest du dir die Kehle auf und lässt das Blut in die Schüssel laufen.«
»Dieser durchgeknallte Hu…« Sherry verstummte vor lauter Entsetzen, als sie sah, dass die Mutter mit unverändert ausdrucksloser Miene genau das tat, was er gesagt hatte. Sie drehte sich so um, dass sie sich über die Theke lehnen konnte, hielt den Kopf über die Schüssel und schlitzte sich die Kehle auf.
»Verdammt«, hauchte Sherry, die kaum fassen konnte, was diese Frau soeben gemacht hatte. »Ich hole die Polizei.«
»Die Zeit reicht nicht«, knurrte Stephanie und fasste sie am Arm. »Er kontrolliert diese Leute. Siehst du das denn nicht? Oder glaubst du, die Frau hätte sich tatsächlich aus freien Stücken die Kehle aufgeschlitzt?«
»Aber die Polizei …«
»Selbst wenn die eintrifft, bevor Leonius fertig ist, kann die nichts ausrichten. Er bezieht die Cops dann nur auch noch in sein Gemetzel ein. Retten kann man diese Leute nur, wenn man Leo und seine Jungs von hier weglockt. Und um das zu erreichen, muss ich sie auf mich aufmerksam machen und dann losrennen, als wär der Teufel persönlich hinter mir her.«
»Wenn das so ist, machen wir sie auf uns aufmerksam und rennen los, als wäre der Teufel persönlich hinter uns her«, sagte Sherry entschieden und lief die Stufen hinunter, um die Hintertür aufzuschließen. Auf keinen Fall würde sie Stephanie das allein überlassen. Himmel, sie war doch fast noch ein Kind!
Sherry hatte eben den Feststeller an der Tür nach unten gedrückt, da hörte sie hinter sich einen Knall und ein lautes Klirren. Sie drehte sich um und sah gerade noch, wie ihr Bürostuhl durch die verspiegelte Scheibe in den Verkaufsraum geschleudert wurde. Das war Stephanies Werk gewesen.
Sofort lief sie zurück nach oben und sah durch das Loch in der Scheibe nach unten in den Laden. Der Stuhl hatte niemanden getroffen, aber die Aktion hatte genug Lärm erzeugt, um die Aufmerksamkeit des Quartetts zu erregen.
Kunden und Personal starrten weiter ins Leere, nur die vier Männer sahen in Richtung Büro. Sofort zeigte Stephanie ihnen den Mittelfinger, dann rannte sie zu Sherry und schrie: »Lauf!«
Der Ruf war noch gar nicht richtig bis zu ihren Ohren vorgedrungen, da raste Stephanie an ihr vorbei, packte sie am Arm und riss sie mit sich. Im nächsten Augenblick eilte sie mit ihr die Treppe runter und nach draußen in die Gasse. Stephanie musste den Türstopper gelöst haben, da die Tür hinter ihnen mit lautem Knall ins Schloss fiel.
Stephanie war schnell, übermenschlich schnell sogar. Aber auch Sherry rannte so schnell wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Das Adrenalin spornte sie so sehr an, dass sie das Gefühl hatte, mit den Füßen gar nicht den Boden zu berühren. Trotzdem war Stephanie noch etwas schneller als sie, sodass sie Sherry mehr oder weniger mit sich schleifte. Die Gasse war recht kurz, dennoch hatten sie nicht mal die Hälfte des Weges bis zur Hauptstraße zurückgelegt, als hinter ihnen ein lautes Bersten ertönte. Ein Blick über die Schulter ließ Sherry erkennen, dass die vier Männer die Tür aus den Angeln getreten hatten und sie verfolgten.
Bei diesem Anblick machte Sherrys Herz einen Satz. Die vier konnten genauso schnell rennen wie Stephanie, nein, sogar noch schneller. Sie würde nicht vor ihnen weglaufen können, und Stephanie war ihretwegen umso langsamer.
»Lauf du!«, rief sie und versuchte sich aus dem Griff des Mädchens zu befreien. »Ich halte dich nur auf. Lass mich los und lauf, so schnell du kannst!«
Stephanie sah kurz zu dem Quartett, das näher und näher kam, dann machte sie das, was Sherry gesagt hat. Sie ließ ihren Arm los und rannte weiter zum Ende der Gasse. Sherry war froh darüber, dass das Mädchen auf sie gehört hatte. Zugleich blieb ihr vor Angst fast das Herz stehen, weil ihr klar war, dass sie mit diesen Hyänen, die ihr auf den Fersen waren, auf einmal ganz allein war. Trotz aller Angst oder wohl eher gerade wegen dieser Angst brachte Sherry es fertig, noch etwas schneller zu laufen, als sie es sich zugetraut hätte. Trotzdem war es so, als wollte man einem Rennwagen entkommen. Es war schlichtweg unmöglich. Ihre einzige Hoffnung war die, dass dieses Quartett ausschließlich an dem Mädchen interessiert war und sie links liegen lassen würde.
Kaum war ihr dieser Gedanke durch den Kopf gegangen, geriet sie in Sorge, die vier könnten genau das tun. Sie durfte nicht zulassen, dass Stephanie dieser Bande in die Hände fiel, ohne nicht wenigstens versucht zu haben, sie möglichst lange aufzuhalten, damit Stephanies Vorsprung größer wurde. Der Entschluss war gefasst, und sie sah sich kurz um, was sie benutzen könnte, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das Einzige, was sie entdecken konnte, waren ein paar Müllcontainer.
»Arbeite mit dem, was du hast«, ermahnte sie sich leise und lief auf die großen blauen Metallbehältnisse zu. Würde die Zeit reichen, um eine von ihnen zu nehmen und den Männern in den Weg zu schieben? War sie überhaupt stark genug, um so ein Ding von der Stelle zu bewegen? Hatten Müllcontainer Feststellbremsen an ihren Rädern? Und falls ja, waren die Bremsen an diesen Containern eingerastet oder nicht?
Eine Antwort auf all diese Fragen erhielt Sherry nicht, denn in diesem Moment gellte ein Schuss durch die Gasse. Sie war sich sicher, dass die Kugel dicht an ihrem Ohr vorbeiflog, zumindest hatte sie das Gefühl. Im ersten Augenblick glaubte sie, dass einer der Verfolger auf sie oder auf Stephanie geschossen hatte. Mit zusammengekniffenen Augen sah sie zum Ende des Wegs, das vielleicht noch sechs oder sieben Meter entfernt war. Sie wollte herausfinden, ob das Mädchen getroffen worden war, konnte jedoch ihren Augen kaum glauben, als sie Stephanie in der breitbeinigen Haltung eines Schützen vor sich sah, die Waffe auf das Quartett gerichtet, gleich neben ihr ein Polizist, der von dem Geschehen nichts mitzubekommen schien.
Während sie versuchte zu begreifen, was sich da gerade abspielte, wurden weitere Schüsse abgegeben. Diesmal hörte sie hinter sich ein Aufstöhnen und erschrak beim Blick über die Schulter, dass der Anführer der Bande nur noch drei oder vier Schritte von ihr entfernt war und die Hand ausgestreckt hielt, um sie zu fassen zu bekommen. Tatsächlich strichen seine Fingerspitzen über den Stoff ihrer Bluse, aber dann brach er zusammen und fiel zu Boden.
Während er in sich zusammenklappte, konnte sie noch sehen, dass drei Löcher in seiner Brust klafften. Seine drei Begleiter schlitterten ein Stück weit, weil sie abrupt anhielten, um ihm zu helfen. Voller Hoffnung, das Ganze doch noch lebend zu überstehen, rannte Sherry weiter. Wenn sie es bis zu Stephanie und diesem Polizisten schaffte, würde alles gut werden.
Als Sherry bei den beiden ankam, steckte Stephanie gerade die Pistole zurück in das Halfter des Polizisten und sagte zu ihm: »Das hier ist nie geschehen. Sie haben uns niemals gesehen, und Sie sollten unbedingt ein Stück weiter nördlich patrouillieren. Kommen Sie erst wieder her, wenn niemand mehr hier ist.«
Sie machte den Druckknopf am Halfter zu, daraufhin drehte sich der Polizist um und ging in Richtung Norden die Straße entlang.
»Aber …?«, begann Sherry erstaunt, kam jedoch nicht weiter, da Stephanie sie an der Hand nahm und weiterrannte, um die Gasse hinter sich zu lassen. Da Sherry ohnehin nichts lieber wollte, als ihren Verfolgern zu entkommen, widersetzte sie sich nicht und gab sich Mühe, mit Stephanies Tempo mitzuhalten. Aber kaum waren sie um die nächste Ecke gebogen, versuchte Sherry sie vom Weiterlaufen abzuhalten. »Warte … halt …«, keuchte sie. »Ich kann … nicht mehr … laufen.«
»Wir können jetzt nicht stehen bleiben«, gab Stephanie eindringlich zurück und zog sie weiter hinter sich her, drosselte allerdings ein wenig das Tempo. »Leo wird uns weiter auf den Fersen sein, sobald er sich erholt hat.«
»Der Typ … auf den du … geschossen hast?«, japste sie ungläubig. Selbst das relativ gemächliche Tempo war für ihre Lungen zu viel, und sie konnte immer nur zwischen zwei angestrengten Atemzügen ein paar Silben hervorbringen. »Der wird sich … so schnell … nicht erholen … er hat … drei Kugeln in der Brust … der muss erst mal … ins Krankenhaus.«
»Er braucht kein Krankenhaus«, versicherte ihr Stephanie, die kein bisschen außer Atem war. Mit ernster Miene sah sie sich um, da sie das Ende der kurzen Straße erreicht hatten. Plötzlich zog sie Sherry hinter sich her zu einer kleinen Pizzeria auf der gegenüberliegenden Ecke.
»Mädchen … der Mann braucht … ein Krankenhaus«, beharrte Sherry und ließ sich von Stephanie ins Restaurant schleifen, wo sie zum hintersten Tisch gingen, wo man sie von der Straße aus wohl nicht sehen würde.
»Kann ich mal dein iPhone benutzen?«, fragte Stephanie, als sie und Sherry sich mit dem Rücken zum Eingang an einen Tisch setzten.
Sherry verzog den Mund und keuchte: »Hab ich nicht dabei. Genauso wenig wie meine Handtasche.«
»Atme du erst mal durch, ich hole dir was zu trinken«, sagte Stephanie und war auch schon verschwunden.
Sherry strich sich die Haare aus dem schweißnassen Gesicht, dann kniff sie seufzend die Augen zu. Wie Szenen aus einem Film gingen ihr die letzten Minuten durch den Kopf. Die arme Frau, die sich selbst die Kehle aufschlitzte, ihr Bürostuhl, der durch das Fenster zum Ladenlokal hindurchschoss, der Anführer dieser wüsten Bande, der noch versuchte, sie zu fassen zu bekommen, als er von der Kugel getroffen bereits zu Boden ging … seine Augen, die so fremdartig leuchteten.
Sie schüttelte den Kopf und hielt sich für einen Moment die Hand vor die Augen, als könne sie so diese Bilder vertreiben. Sie fragte sich, was aus ihrem so angenehm langweiligen und sicheren Leben geworden war … und wieso sie wie ein wohlerzogenes Kind in einer Pizzeria saß, wenn sie doch eigentlich die Polizei alarmieren und ins Geschäft zurückkehren sollte, um nach ihren Kunden und ihrem Personal zu sehen und …
»Hier.«
Sherry hob den Kopf und setzte sich ein wenig gerader hin, als Stephanie ein Glas Cola und einen Teller mit einem Stück Pizza darauf vor sie hinstellte. Ihr Blick wanderte zu Stephanies Platz, wo genau das Gleiche noch einmal stand.
»Ich wusste nicht, was du magst, darum habe ich ein großes Stück Pizza und eine Coke mitgebracht«, erklärte Stephanie, nahm ihre Pizza vom Teller und biss ein Stück ab.
Ungläubig sah Sherry mit an, wie das Mädchen genüsslich kaute, dann fragte sie verwundert: »Wie kannst du jetzt essen?«
»Ich habe Hunger«, bekam sie zur Antwort. »Du solltest auch was essen.«
»Ich esse nichts mit Kohlenhydraten … und ich trinke auch nichts, wo Kohlenhydrate drinstecken. Coke ist nichts als Wasser mit Sirup«, erwiderte Sherry reflexartig. Auf einmal wurde ihr bewusst, wie bedeutungslos ihre Worte angesichts der Situation waren, in der sie sich befanden, und sie schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht verstehen, dass du da sitzt und isst, als wäre nichts …«
»Zucker ist Energie«, wurde sie von Stephanie unterbrochen. »Du brauchst Energie für den Fall, dass wir wieder wegrennen müssen. Also iss«, forderte sie Sherry in einem Tonfall auf, als wäre sie die Erwachsene am Tisch.
Was Stephanie gesagt hatte, machte sie nachdenklich. »Wir sollten die Polizei holen.«
»Ja, nachdem der Cop vorhin ja schon so hilfreich war«, gab Stephanie sarkastisch zurück und biss wieder von ihrer Pizza ab.
Dagegen war nichts einzuwenden, allerdings warf das eine andere Frage auf. »Apropos … was genau war da eigentlich passiert?«
Stephanie zog eine Augenbraue hoch, kaute aber weiter und schluckte erst noch, ehe sie leise seufzte und antwortete: »Es war mir klar, dass du Leo und seinen Jungs nicht entkommen konntest. Ich konnte dich nicht einfach zurücklassen, sonst hätten sie dich eingeholt, dich gefoltert und dann umgebracht. Als ich also den Cop entdeckte, bin ich zu ihm gelaufen, hab mir seine Waffe genommen und Leo niedergeschossen, damit wir etwas Zeit gewinnen. Glücklicherweise hat das ja dann auch funktioniert.«
Sherry sparte sich die Bemerkung, dass sie schließlich selbst dabei gewesen sei, stattdessen fragte sie nur: »Und der Co… der Polizist hat dir einfach so seine Waffe überlassen?«
Stephanie zuckte mit den Schultern. »Ich habe ihn kontrolliert, er wird sich an nichts davon erinnern.«
»Was ihm ein großes Rätsel sein wird, wenn er sieht, dass mit seiner Dienstwaffe geschossen wurde«, murmelte Sherry, aber ihre Gedanken kreisten um Stephanies Bemerkung, dass sie den Polizisten kontrolliert habe. Am liebsten hätte sie das mit einem Lachen abgetan, doch der Mann hatte genauso geistesabwesend gewirkt wie die Frau im Geschäft, die sich selbst die Kehle aufgeschlitzt hatte. Da hatte Stephanie behauptet, Leo habe die Frau kontrolliert. Das mochte ja alles stimmen, aber es warf die Frage nach dem Wie auf. Eine solche Fähigkeit besaß keiner der Menschen, die Sherry kannte.
»Da sind sie.«
Sherry drehte sich abrupt um und sah die vier Männer am Lokal vorbeigehen. Als einer von ihnen einen Blick durch das Schaufenster warf, drückte sie sich in die Ecke, aber da er nicht stehen blieb, hatte er sie offenbar nicht gesehen. Das überraschte sie nicht, da sie in der hintersten Ecke ziemlich im Dunkeln saßen. Überraschend war nur, dass der Anführer der Gruppe – der, den Stephanie Leo nannte – mit den anderen drei durch die Gegend lief, als wäre nichts geschehen.
»Verdammt«, murmelte sie und schaute der Gruppe hinterher, bis sie aus ihrem Blickfeld verschwunden war.
»Ich habe dir ja gesagt, dass er sich nicht aufhalten lässt, nur weil auf ihn geschossen wurde«, sagte Stephanie ernst.
»Das sehe ich auch gerade. Aber … wie kann das sein?«, fragte sie völlig perplex.
Stephanie aß weiter ihre Pizza und schwieg, aber nach ein paar Happen seufzte sie resigniert, legte den Rest des Stücks zurück auf den Teller und trank einen Schluck. Dann betrachtete sie Sherry nachdenklich und nickte schließlich. »Ich werde dir das wohl erklären müssen.«
»Das wäre zu nett von dir«, gab Sherry ironisch zurück. »Vampire existieren tatsächlich. Leonius und seine Leute sind zwar Schlitzer, aber sie brauchen ebenfalls Blut zum Überleben. Also sind sie eigentlich auch Vampire, genauso wie ich, auch wenn ich eigentlich eine Edentate bin.«
Sherry kniff die Augen ein wenig zusammen, während rätselhafte Worte durch ihren Kopf schwirrten. Schlitzer? Edentate? Sie hatte keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hatte, daher konzentrierte sie sich auf den einen Begriff, der ihr vertraut war.
»Vampire?«, wiederholte sie, wobei ihr Tonfall keinen Zweifel daran ließ, was sie davon hielt. »Schätzchen, ich sag’s dir ja nicht gern, aber Vampire gibt es nicht. Außerdem würden die Leute beißen, aber sie nicht dazu auffordern, sich die Kehle aufzuschlitzen und ihr eigenes Blut in eine Schüssel laufen zu lassen.«
»M-hm.« Stephanie schien über diese Bemerkung nicht verärgert zu sein. »Und wie erklärst du dir, dass er diese Frau dazu gebracht hat, sich umzubringen? Oder dass ich diesem Cop die Dienstwaffe abgenommen und ihn anschließend davongeschickt habe?«
Sherry dachte kurz darüber nach und entgegnete: »Hypnose?«
Stephanie verdrehte die Augen. »Komm schon, sei nicht albern. Leo hatte keine Zeit, diese Kundin zu hypnotisieren, und ich hatte bei dem Cop erst recht keine.« Sie setzte eine ernste Miene auf. »Wie heißt du?«
»Sherry Carne«, sagte sie. »Zugegeben, dieser Leo hat die Frau vielleicht nicht hypnotisiert, aber er hat irgendetwas mit ihr angestellt, und das hat nichts damit zu tun, dass er ein Vampir ist. Vampire haben Fangzähne und beißen Leute.«
»Eben hast du noch gesagt, dass es gar keine Vampire gibt, und jetzt sagst du, dass es sie doch gibt und dass sie Fangzähne haben?«, konterte Stephanie amüsiert.
»Na ja …« Sherry verzog den Mund. »Wenn du mit dieser Vampirgeschichte schon das überspielen willst, was tatsächlich passiert ist, dann sollte das wenigstens in sich stimmig sein. Vampire sind tote, seelenlose Kreaturen, die aus einem Sarg steigen und Leute beißen.«
»Ja, das dachte ich auch immer«, stimmte Stephanie ihr zu und klang wie jemand, der viel älter war als sie. Sie zuckte mit den Schultern, dann drückte sie den Rücken durch und fügte an: »Aber du bist im Irrtum. Vampire sind weder tot noch seelenlos, und die meisten von ihnen haben Fangzähne. Leo und seine kleinen Leos sind ein bisschen aus der Art geschlagen, weshalb sie auch als Schlitzer bezeichnet werden. Sie werden nicht älter und sie brauchen Blut zum Überleben, aber sie haben keine Fangzähne, obwohl sie die dafür benötigen. Also schlitzen sie ihre Opfer auf. Und sie sind für gewöhnlich verrückt. Aber nicht auf die harmlose Art, sondern auf die völlig abgedrehte Tour.«
Sherry legte den Kopf ein wenig schräg und betrachtete Stephanie. Die Art, wie sie redete, erinnerte sie an … an einen Vortrag. Doch in ihren Worten schwang etwas mit, das ihr fast wie Scham vorkam, auch wenn sie sich das nicht erklären konnte.
»Du glaubst mir nicht«, sagte Stephanie mit einem gleichgültigen Schulterzucken. »Das ist schon okay. Aber lass mich dir wenigstens erklären, was hier vor sich geht. Es steht dir frei, es zu glauben oder auch nicht, aber du solltest dich bei Gelegenheit daran erinnern. Es könnte dir das Leben retten, solange das hier noch nicht beendet ist.«
Eine Weile saß Sherry schweigend da und dachte nach, bis sie zu dem Schluss kam, dass es nichts schaden konnte, sich anzuhören, was Stephanie zu erzählen hatte. Außerdem war es eine gute Ausrede, um einfach nur dazusitzen und wieder zu Kräften zu kommen. Also lehnte sie sich zurück und nickte. »Dann erzähl mal.«
Daraufhin entspannte sich Stephanie ein wenig und brachte sogar ein flüchtiges Lächeln zustande. »Okay. Also, damit das klar ist: Ich behaupte, dass es Vampire tatsächlich gibt. Die meisten von ihnen haben Fangzähne, einige nicht, aber alle können Sterbliche lesen und kontrollieren. Leo und seine kleinen Leos – Zwei, Drei und Vier – gehören zu der Sorte ohne Fangzähne.«
»Zwei, Drei und Vier?«, warf Sherry ein.
»Okay, wahrscheinlich sind sie nicht Leo Zwei, Leo Drei und Leo Vier, aber er gibt all seinen Söhnen seinen Namen, deshalb bekommen sie eine Zahl, damit man sie auseinanderhalten kann.«
»Seine Söhne? Diese Männer können unmöglich seine Kinder sein. Die sehen alle gleich alt aus.«
»Vampire, schon vergessen?«, gab Stephanie nachdrücklich zurück. »Vampire hören mit ungefähr fünfundzwanzig auf, äußerlich zu altern.«
Sherry atmete laut seufzend aus und fand, dass das ein bisschen viel auf einmal war. Allerdings hatte sie sich damit einverstanden erklärt, sich alles anzuhören. Also gab sie Stephanie ein Zeichen, fortzufahren.
»Ich bin so normal und unwissend aufgewachsen wie du, aber Leo und ein paar von seinen Söhnen entführten meine Schwester und mich auf einem Supermarktparkplatz, als ich vierzehn war«, fuhr Stephanie fort und presste für einen Moment die Lippen zusammen. »Wir wurden zwar gerettet, und Leos Söhne wurden von den Vollstreckern geschnappt und hingerichtet, aber …«
»Vollstrecker?«, unterbrach Sherry sie.
»Die Cops der Unsterblichen. Oder Vampire, wie du sie nennen würdest. Sie achten darauf, dass andere Unsterbliche sich an die Gesetze halten«, erläuterte sie. »Jedenfalls weiß ich nicht, ob es etwas damit zu tun hat, dass seine Söhne getötet wurden, aber aus irgendeinem Grund ist Leo von meiner Schwester und mir besessen. Er will uns unbedingt seinem Zuchtbestand einverleiben.«
Sherry sah sie an und versuchte zu verarbeiten, was sie da gerade gehört hatte. Dann räusperte sie sich. »Was meinst du damit, er will euch unbedingt seinem Zuchtbestand einverleiben? Doch nicht etwa …«
Stephanie nickte. »So kommt er an all die kleinen Leos. Ich bezweifle, dass irgendeine der Mütter sich freiwillig dazu bereit erklärt hat.«
»Wenn man dich so hört, könnte man meinen, dass er viele Söhne hat.«
»Einer von den Leos, die ihm dabei geholfen hatten, meine Schwester und mich zu entführen, war Leo Einundzwanzig. Seiner eigenen Aussage nach war er einer von den älteren Söhnen«, fügte Stephanie an. »Er behauptete, dass es momentan so zwischen fünfzig und sechzig seiner Art gebe. Über die Jahrhunderte müssen es mehrere Hundert gewesen sein, aber einige nahmen sich das Leben, andere wiederum starben bei Unfällen, und Leo selbst brachte etliche von ihnen um – entweder weil sie nicht das taten, was er von ihnen verlangte, oder weil er sich aus anderen Gründen über sie geärgert hatte.«
Sherry sagte nichts. Das war ja völlig verrückt, so als würde es aus einer Vampir-Soap stammen. So etwas konnte es unmöglich geben. Oder …?
»Auf jeden Fall«, fuhr Stephanie wieder fort, »hat Leo Senior wie gesagt einen Narren an meiner Schwester und mir gefressen. Er hat geschworen, uns zu sich zu holen, deshalb werden Dani … also meine Schwester … und ich vor ihm versteckt und bewacht.«
»Bis heute«, fügte Sherry an.
Stephanie verzog den Mund. »Ich wurde bewacht. Ich war mit Drina und Katricia unterwegs. Sie sind beide Vollstreckerinnen.«
»Vampir-Cops«, murmelte Sherry.
»Unsterblichen-Cops, um genau zu sein. Aber Vampir-Cops geht auch. Erwähn übrigens lieber nicht das Wort Vampir, wenn du einen Unsterblichen vor dir hast. Die können da ganz schön sauer reagieren«, ließ Stephanie sie wissen. »Drina und Katricia werden beide heiraten, darum waren wir unterwegs, um Hochzeitskleider zu kaufen. Ich …« Sie seufzte leise und verzog den Mund. »Ich hatte was im Wagen vergessen und war nur schnell rausgelaufen, um es zu holen, aber …« Sie schüttelte den Kopf. »Ich hatte das Pech, mir ausgerechnet den Moment auszusuchen, als Leo und seine Jungs vorbeikamen.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Seit Dani und ich gerettet wurden, hat niemand Leo und seine Jungs in Toronto gesehen. Sie hatten sich zurückgezogen und sich lange Zeit südlich der Grenze aufgehalten. Zuletzt waren sie jemandem in den Südstaaten aufgefallen. Hätte ich gewusst, dass die auch nur in der Nähe sind, wäre ich niemals allein zum Wagen gegangen. Es war einfach …« Sie stieß einen schweren Seufzer aus. »Jedenfalls bemerkte ich sie zuerst und bin in deinen Laden gelaufen, weil ich dachte, sie haben mich nicht gesehen und gehen weiter. Aber da hatte ich mich geirrt.«
Als Stephanie weiter von ihrer Pizza aß, begann Sherry darüber nachzudenken, ob sie auch nur ein einziges Wort davon glaubte. So seltsam es auch war, hatte Sherry das Ganze im ersten Moment noch für völligen Unsinn gehalten, doch jetzt glaubte sie Stephanie. Eine Erklärung dafür hatte sie selbst nicht. Es war eigentlich völlig absurd: Vampire, Gedankenkontrolle, Zuchtbestand …
Sherry verdrängte diese Überlegungen, um auf eine Sache zu sprechen zu kommen, die ihr nicht mehr aus dem Kopf ging, seit sie aus ihrem Geschäft geflohen waren. »Wie lange hält diese Kontrolle an?«
Nach einem kurzen forschenden Blick verstand Stephanie, was sie meinte, und versicherte ihr: »Nicht lange. Das heißt, es kann noch eine Weile anhalten, wenn der Vampir seinem Opfer etwas Entsprechendes suggeriert, aber ich bin mir sicher, dass Leo und die Jungs keine Gelegenheit mehr dazu hatten, als sie uns nachgerannt sind. Sobald sie das Gebäude verlassen haben, werden deine Angestellten und die Kunden wieder aus ihrer Trance erwacht sein, und sie werden der Frau geholfen haben, die sich selbst verletzt hat.«
»Sofern sie ihr überhaupt noch helfen konnten«, gab Sherry betrübt zu bedenken, nahm ihr Stück Pizza vom Teller, betrachtete es einen Moment lang kritisch und biss schließlich davon ab. Überraschenderweise schmeckte es gut, obwohl sie nicht damit gerechnet hatte, dass sie nach diesem Erlebnis überhaupt irgendeinen Geschmack wahrnehmen würde. Aber vermutlich lag es daran, dass sie nur knapp dem Tod entronnen war. Der Schreck musste ihre Geschmacksnerven auf Touren gebracht haben. Auf jeden Fall schmeckte es, auch mit Kohlenhydraten.
»Sie konnten ihr helfen«, versicherte Stephanie ihr. »Sie hat sich nicht so tief in den Hals geschnitten, dass sie die Schlagader hätte treffen können. Es dürfte ihr gut gehen.«
Sherry sah sie verblüfft an. »Woher willst du wissen, dass sie nicht die Schlagader erwischt hat?«
»Weil ich ihr einen geistigen Schubser verpasst habe, damit sie sich nicht zu tief in den Hals schneidet«, erklärte sie. »Leo hätte das natürlich sofort bemerkt, deshalb mussten wir in dem Moment in Aktion treten. Er hätte die Leute im Geschäft benutzt, um sein Ziel zu erreichen. Er hätte einen nach dem anderen gefoltert, bis ich mich gestellt hätte. Also musste ich dafür sorgen, dass er mich sieht und dass er auch sieht, wie ich weglaufe, weil er nur dann die Leute in Ruhe lassen würde.«
Sherry wunderte sich nicht über die Bemerkung, der Frau einen geistigen Schubser verpasst zu haben, damit sie sich nicht selbst umbrachte. Immerhin hatte Stephanie ja auch den Cop kontrolliert. Was sie jedoch verwunderte, war die Tatsache, dass sie überhaupt einen Gedanken an die Kunden und die Angestellten verschwendet hatte. Stephanie war nett, auch wenn immer noch die Möglichkeit bestand, dass sie einfach nur durchgedreht war. Aber Sherry neigte dazu, ihr die Geschichte abzunehmen, die allerdings erst mal verarbeitet werden musste. Also war Stephanie entweder ein mutiges und umsichtiges Mädchen, das sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hatte, um eine schwangere Frau zu retten, oder aber sie war komplett durchgeknallt. Auf jeden Fall war sie eine verdammt gute Schützin, befand Sherry. Stephanie hatte mühelos ein bewegliches Ziel gleich mehrfach getroffen und dabei auch noch knapp an Sherry vorbeischießen müssen.
»Wo hast du gelernt, so gut zu schießen?«, wollte sie wissen.
»Victor und D. J. nehmen mich alle paar Tage mit zum Schießstand«, antwortete sie. Die Namen sagten Sherry natürlich nichts, daher war sie froh, dass die Erklärung gleich darauf folgte. »Victor ist … na ja, er ist so was wie mein Adoptivvater.« Ihre Stimme klang mit einem Mal ein wenig erstickt, dann redete sie hastig weiter: »Und D. J. ist der junge nervtötende Onkel, der einen bei jeder Gelegenheit ärgert und in aller Öffentlichkeit in Verlegenheit bringt.«
Sherry lächelte, als sie diese Beschreibung hörte. »Und dein leiblicher Dad?«
»Der lebt, ist wohlauf und sterblich«, kam die viel zu beiläufige Antwort, bei der Stephanie jeden Blickkontakt mied und mit den Resten ihrer Pizza spielte. »Er und Mom denken, ich sei tot.« Ehe Sherry eine Frage stellen konnte, fügte sie an: »Aber Victor und Elvi haben mich bei sich aufgenommen und passen auf mich auf. Elvi hat ihre Tochter verloren und sagt, dass ich ein Geschenk für sie sei. Die beiden sind echt toll.«
Toll, aber nicht die leiblichen Eltern, übersetzte Sherry für sich das Gesagte, während Stephanie den Kopf wegdrehte und sich flüchtig über die Augen wischte. Sie hielt es für angebracht, das Thema zu wechseln, und fragte: »Wenn uns die Polizei nicht helfen kann … was ist denn dann mit diesen Vollstreckern? Wir sollten uns ein Telefon suchen und sie anrufen, damit sie diesen Leo und seine Leute zur Strecke bringen.« Sherry brachte es nicht fertig, die Begleiter dieses Mannes als seine Söhne zu bezeichnen. Es kam ihr schlichtweg unmöglich vor, dass es sich bei ihnen um seine Kinder handeln sollte. Sie sahen alle ungefähr gleich alt aus, als dass sie Brüder hätten sein können. Als sie merkte, dass Stephanie nicht auf ihre Worte reagierte, zog sie die Augenbrauen hoch. »Meinst du nicht?«
»Was?«, fragte Stephanie. Ihr ratloser Gesichtsausdruck ließ erkennen, dass sie überhaupt nicht zugehört hatte.
Da es nur zu offensichtlich war, dass Stephanie mit ihren Gedanken bei ihren leiblichen Eltern war, wiederholte Sherry geduldig ihren Vorschlag: »Meinst du nicht, wir sollten deine Vollstrecker anrufen?«
Stephanie schüttelte den Kopf und starrte auf den Rand ihrer Pizza, den sie unbewusst in kleine Stücke zerlegt hatte. Die Art, wie sie die Schultern hängen ließ, und die Niedergeschlagenheit, die sie mit einem Mal ausstrahlte, hatten etwas Beunruhigendes an sich. Zwar wusste Sherry nicht, was genau in diesem Moment in Stephanie vorging, aber auf keinen Fall durfte sie jetzt die Nerven verlieren.
Sherry lehnte sich zurück und sagte in absichtlich verärgertem Tonfall: »Oh, ich verstehe schon.«
Daraufhin reagierte Stephanie, sah sie an und fragte interessiert: »Was verstehst du?«
»Dich«, gab sie achselzuckend zurück. »Ich war auch mal Teenager.«
Stephanie schnaubte abfällig. »Ach, komm. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diesen immer gleichen Spruch schon anhören musste. Dass ihr Tattergreise immer so tun müsst, als wüsstet ihr, was in meinem Leben los ist, nur weil ihr in der Steinzeit selbst mal jung gewesen seid. Du hast keine Ahnung von meinem Leben. Als du jung warst … wann war das? In den Sechzigern?«
»Besten Dank! In den Sechzigern war ich nicht mal auf der Welt«, konterte Sherry amüsiert. »Ich bin erst zweiunddreißig.«
»Von mir aus.« Stephanie machte eine wegwerfende Geste. »Du hast keine Ahnung von meinem Leben.«
»Hm. Was hältst du davon, wenn ich dir erzähle, was meiner Meinung nach in deinem Leben los ist, und dann kannst du mir ja sagen, ob ich mich irre? Sofern ich mich irre«, setzte sie hinzu, um Stephanie aufzuziehen.
Die zuckte nur mit den Schultern. »Von mir aus.«
Sherry legte den Kopf schräg und musterte ihr Gegenüber eine Zeit lang. »Du warst also mit dieser Drina und ihrer Freundin unterwegs, um Hochzeitskleider zu kaufen?«
»Katricia«, erklärte sie. »Sie ist Drinas Cousine, und eine Vollstreckerin. Sie wird auch heiraten, nämlich Teddy, den Polizeichef von Port Henry, wo ich lebe. Wir sind für ein Mädelwochenende nach Toronto gekommen, um hier zu shoppen.«
»Hmmm.« Sherry dachte darüber nach. »Und du sagst, sie haben dich zum Wagen gehen lassen, weil du etwas holen wolltest.«
Stephanie nickte, dabei wanderte ihr Blick zum Schaufenster, ihre Miene nahm einen nachdenklichen Zug an.
Vermutlich fragte sie sich, wo die beiden Frauen waren. Sie selbst fragte sich das jedenfalls. Zweifellos mussten sie Stephanies Verschwinden längst bemerkt haben. Und wenn sie sich in der Nähe aufhielten, hätten die Schüsse sie herlocken müssen. Sie sprach das aber nicht aus, sondern sagte nur: »Tja, ich bin mir sicher, es ist gelogen, dass sie dich zum Wagen haben gehen lassen, weil du was vergessen hattest.«
Stephanie warf ihr einen empörten Blick zu. »Wie kommst du denn darauf?«
»Kleine, wenn diese Frauen Vollstreckerinnen oder Vampir-Cops sind und dieser Leo es so auf dich abgesehen hat, wie du sagst, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dich an die kurze Leine nehmen, damit dir nichts passiert. Die beiden würden dich niemals allein aus dem Geschäft gehen lassen. Also war Drina wohl gerade in der Umkleidekabine, um ein Hochzeitskleid anzuprobieren. Und Katricia hat ihr bei den Unmengen Stoff geholfen, aus denen so ein Kleid besteht, oder sie hat selbst ein Kleid anprobiert. Du hast vor der Umkleide gesessen, dich gelangweilt und das Gefühl gehabt, dass sich niemand für dich interessiert. Bestimmt wolltest du dein iPhone aus der Tasche ziehen, um dir die Wartezeit mit Musik oder einem Film zu verkürzen, aber dann fiel dir auf, dass du es im Wagen hattest liegen lassen. Vermutlich ist das iPhone mit der Soundanlage im Wagen verbunden gewesen, weshalb du vergessen hast, es mitzunehmen. Also hast du dir gedacht, du schleichst dich aus dem Laden, holst dein iPhone aus dem Auto und bist zurück, bevor die beiden überhaupt bemerken, dass du weg warst. Dummerweise«, fuhr sie fort, »bist du gar nicht bis zum Wagen gekommen, weil du Leonius und seine Spießgesellen gesehen hast und daraufhin in mein Geschäft gekommen bist, um dich vor ihnen zu verstecken.«
Stephanie konnte ihr Erstaunen nicht verbergen. »Woher weißt du das alles?«
Sherry zuckte gelassen mit den Schultern. »Du hast mich darum gebeten, mein iPhone benutzen zu dürfen.«
»Na und?«
»Das heißt, du hast deines nicht dabei, also kannst du es nicht bis zum Auto geschafft haben.«
»Und wenn ich gar kein iPhone habe und was anderes aus dem Wagen holen wollte?«, hielt Stephanie dagegen.
Sherry schüttelte entschieden den Kopf. »Es gibt heutzutage kaum einen Teenager, der kein Handy hat. Außerdem hast du speziell nach einem iPhone gefragt, anstatt von einem Handy zu reden. Das legt den Verdacht nahe, dass du selbst ein iPhone besitzt.«
»Okay, aber woher wusstest du, dass ich mein iPhone an die Soundanlage angeschlossen hatte?«
»Weil ich aus genau diesem Grund mein Handy immer wieder im Wagen vergesse«, gab Sherry zu. »Ich schließe es mit dem USB-Stecker an, damit ich unterwegs die Musik hören kann, die mir gefällt. Wenn ich dann angekommen bin, steige ich aus und vergesse, mein Handy mitzunehmen.«
»Hm«, machte Stephanie und sah sie interessiert an. »Aber vielleicht besitzt du ja auch irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten, und ich kann dich deswegen weder lesen noch kontrollieren.«
Dazu äußerte sich Sherry nicht. Ihr Verstand wollte gegen die Vorstellung rebellieren, dass jemand in der Lage sein könnte, ihre Gedanken und ihr Verhalten zu kontrollieren. Allerdings hatte sie gesehen, wie die schwangere Mutter sich die Kehle aufgeschlitzt hatte. Niemand würde so etwas freiwillig machen, daher gab es keinen Zweifel daran, dass diese Kundin kontrolliert worden sein musste … und wenn jemand sie kontrollieren konnte …
Sie verdrängte diese verstörenden Gedanken und sagte: »Wenn also alles stimmt, was ich eben gesagt habe, willst du diese beiden Vollstreckerinnen nicht anrufen, weil du dich ohne Erlaubnis entfernt und dein Leben aufs Spiel gesetzt hast.«
»Nöö«, antwortete Stephanie und musste grinsen.
Sherry zog zweifelnd die Augenbrauen hoch. »Du wirst deswegen keinen Ärger kriegen?«
»Oh, und wie. Wenn Drina, Katricia, Harper, Elvi und Victor mir einer nach dem anderen Vorhaltungen gemacht haben, wird Lucian persönlich dazukommen und mir den Rest geben«, gestand Stephanie ihr resignierend. »Aber das ist nicht der Grund, wieso ich nicht anrufe.«
»Okay«, sagte Sherry gedehnt. »Und aus welchem Grund willst du nicht anrufen?«
»Es ist nicht so, dass ich nicht anrufen will … ich muss es nicht«, erklärte sie. »Ich habe längst angerufen, und Bricker ist in diesem Moment auf dem Weg zu uns.« Sie legte den Kopf schräg und fügte grinsend an: »Und er bringt dir eine Überraschung mit.«
2
»Er ist hier.«
Basileios war bereits auf dem Weg durch den Flur, als Marguerite diese Ankündigung machte. Bei ihr angekommen, warf er einen Blick auf den SUV, der jetzt in der Auffahrt stand. Ein anhaltendes Hupen drang an seine Ohren. Er sah zu Marguerite und zog die Brauen hoch, als ihm ihr besorgter Gesichtsausdruck auffiel. »Stimmt was nicht?«
»Bricker ist normalerweise nicht so unhöflich. Er hätte zur Tür kommen sollen, um dich abzuholen«, sagte sie irritiert.
Basileios lächelte flüchtig und drückte sie kurz an sich. »Er holt mich nicht zu einem Date ab, Marguerite. Wahrscheinlich hat er es nur eilig, Stephanie und ihre Freundin in Sicherheit zu bringen, ehe Leo und seine Brut die beiden finden.«
»Ja, vermutlich hast du recht«, murmelte sie, doch er merkte ihr an, dass sie wegen des jungen Unsterblichen beunruhigt war und sie sich fragte, was seine »Unhöflichkeit« zu bedeuten hatte.
Mit einem Kopfschütteln drückte er ihre Hand und wandte sich ab, um das Haus zu verlassen. »Es ist schon in Ordnung«, versicherte er ihr im Weggehen. »Ich rufe an, wenn wir mit ihnen im Hauptquartier der Vollstrecker angekommen sind.«
Mit zügigen Schritten ging er zur Beifahrertür des SUV und stieg ein.
»Ich weiß gar nicht, warum ich losgeschickt werde, um Steph abzuholen«, beklagte sich Bricker, kaum dass Basileios die Tür aufgemacht hatte. »Drina und Katricia sollten sich darum kümmern. Sie sind diejenigen, die auf sie aufpassen sollten … zumal sie ja schon in der Gegend sind.«
Als Begrüßung ging das nun wirklich nicht durch, fand Basileios und verkniff sich ein Hallo, während er die Tür zuzog und nach dem Sicherheitsgurt griff.
»Und warum zum Teufel soll ich dich mitnehmen?«, grummelte Justin weiter. »Verdammt noch mal, du bist Anwalt und kein Jäger. Wozu soll es gut sein, dich dabeizuhaben, wenn es plötzlich zur Sache geht?«
Basileios zog eine Braue hoch und sah seinen Mitfahrer an. Ob Marguerite tatsächlich Grund zur Sorge hatte, wusste er nicht, aber Justin Bricker war eindeutig nicht gut gelaunt. Er wusste nicht, worüber der Mann sich so geärgert haben mochte, trotzdem würde er sich nicht angesprochen fühlen. Mit sanfter Stimme erwiderte er: »Ich war nicht immer Anwalt, Justin. Über tausend Jahre lang bin ich Krieger gewesen. Anwalt bin ich erst seit zwanzig Jahren. Falls es zur Sache gehen sollte …« Er zuckte gelassen mit den Schultern. »… dann kriegen wir das schon geregelt.«
Als Bricker nur noch die Straße mit finsterer Miene bedachte, setzte Basileios hinzu: »Und zur Frage, warum wir die Damen abholen sollen, kann ich nur sagen, dass meines Wissens Drina und meine Tochter in dieses Geschäft geschickt wurden, um dort für Ordnung zu sorgen. Schnelles Handeln war erforderlich, damit sich von dem Vorfall nichts herumsprach, und die beiden befanden sich in unmittelbarer Nähe. Außerdem wird es wohl kaum noch zur Sache gehen. Die Gefahr ist allem Anschein nach vorbei, und wir sollen nur die Mädchen einsammeln und zum Haus der Vollstrecker bringen, bis Lucian entscheidet, wie in der Angelegenheit verfahren werden soll.«
»Ja, ich darf wieder mal Babysitter spielen«, knurrte Justin und sah zu Basileios. »Also, dann lass mich mal raten. Marguerite wollte, dass du mitkommst, weil Stephanie deine Lebensgefährtin ist?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, aber sie glaubt, diese Sterbliche – Sherry – könnte es sein.«
»Das ist nicht möglich. Marguerite kennt sie doch gar nicht«, widersprach Justin und schob dann zweifelnd hinterher: »Oder doch?«
»Wer weiß das bei Marguerite schon«, gab Basileios amüsiert zurück. »Seit sie wieder Spaß am Essen hat, kauft sie alles Mögliche für die Küche ein, und wenn ich das richtig verstanden habe, verkauft die fragliche Frau Küchenutensilien aller Art.« Mit dem Ansatz eines Lächelns fügte er hinzu: »Allerdings wurde mir gesagt, dass Stephanie auch ein gewisses Gespür für Lebensgefährten hat, und sie scheint ebenfalls zu glauben, dass diese Sterbliche meine Lebensgefährtin ist.«
Bricker warf ihm einen Seitenblick zu. »Du kennst Stephanie?«
»Ja«, sagte Basileios, schränkte dann aber ein: »Obwohl … man kann nicht sagen, dass ich sie kenne. Wir wurden einander nicht vorgestellt, aber ich war gerade bei Katricia im Haus der Vollstrecker, als die Mädchen dort eintrafen. Wir haben uns eigentlich nur gesehen. Ich nehme an, jemand hat ihr gesagt, wer ich bin, so wie ich erfahren habe, wer sie ist.« Er zuckte ratlos mit den Schultern. »Ich bin mir nicht sicher, wie man zueinander passende Lebensgefährten identifiziert, aber vermutlich hat dieser kurze Augenblick gereicht, damit sie lesen konnte, was sie lesen muss, um zu entscheiden, dass diese Sherry eine geeignete Lebensgefährtin für mich sein dürfte.«
»Verdammt noch mal«, brummte Bricker missmutig und trat an der nächsten Ecke etwas fester auf die Bremse als eigentlich nötig.
Basil wurde dadurch gegen den Gurt gedrückt, der ihn zurückhielt. Dem jüngeren Mann am Steuer warf er einen wütenden Blick zu. »Was soll das heißen ›verdammt noch mal‹?«
»Weißt du, wie viele Lebensgefährten sich in den letzten Jahren gefunden haben, während ich jedes Mal leer ausgegangen bin?«, gab Bricker zurück. »Ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, aber zwanzig werden es wohl sein, auch wenn ich es nicht bei allen von Anfang an mitbekommen habe. Christian und Caro haben sich in St. Lucia kennengelernt und leben nun hier als zwei wunschlos glückliche Lebensgefährten.« Er verzog den Mund. »Ich wünschte, Marguerite oder Stephanie würde sich mal fünf Minuten Zeit nehmen, um nach einer Lebensgefährtin für mich zu suchen.«
Basileios entspannte sich und musste unwillkürlich lächeln. »Du klingst wie ein sterbliches Kind.«
»Was?«, fragte er pikiert.
»Na ja, sterbliche Kinder können es nicht erwarten, alt genug zu sein, um Auto zu fahren, die Schule hinter sich zu bringen, legal Alkohol trinken zu können und so weiter«, erklärte er und fuhr dann in aller Ruhe fort: »Du bist doch gerade erst knapp über hundert, Justin.«
»Ja, ja, und ein paar von euch haben Jahrtausende darauf warten müssen, deshalb soll ich mich doch bitteschön in Geduld üben. Wenn die Zeit reif ist, wird es schon passieren«, murmelte er mürrisch vor sich hin. Es war offensichtlich, dass er sich diese Predigt schon einige Male hatte anhören müssen.
Basileios sagte nichts dazu. Der Mann war am Ende seiner Geduld und verbittert, und egal, was man dazu sagte, es würde an seiner Einstellung nichts ändern. Also war es besser, das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Bricker würde sich schon damit abfinden … oder vielleicht auch nicht.
»Wie alt bist du eigentlich?«, fragte Justin plötzlich. »Du gehörst zu den älteren Argeneaus, nicht wahr?«
»Ich wurde 1529 vor Christus geboren«, sagte er und wunderte sich nicht über den vorwurfsvollen Blick, den Justin ihm zuwarf.
»Aber Lucian und Jean Claude wurden 1534 vor Christus geboren. Das heißt, du bist nur fünf Jahre jünger als die beiden.«
Basileios nickte und ließ sich von dem anklagenden Unterton nicht aus der Ruhe bringen.
»Hmpf«, machte Justin missmutig. »Dann scheint die Vorschrift mit einem Kind in hundert Jahren für euch Argeneaus wohl nicht zu gelten.«
»Ich wurde in Atlantis geboren, Bricker«, stellte er geduldig klar. »Diese Vorschrift existierte damals noch gar nicht. Sie wurde erst nach dem Untergang erlassen, nachdem Leonius Livius versucht hatte, eine Armee aus seinen Nachkommen aufzubauen.«
»Ja, stimmt«, knurrte Justin, schwieg eine Zeit lang und sagte schließlich: »Und Katricia ist also deine Tochter? Dann hattest du schon mal eine Lebensgefährtin?«
»In Atlantis hatte ich für kurze Zeit eine Lebensgefährtin. Aber sie war nicht Katricias Mutter. Wir hatten keine Kinder, und sie überlebte den Untergang nicht.«
»Dann hast du also zweimal eine Lebensgefährtin gefunden«, merkte er an. »Nett.«
»Nicht wirklich. Mary Delacort, die Mutter meiner Kinder, ist eine Unsterbliche, die für mich eine gute Freundin ist, aber mehr auch nicht.«
Bricker warf ihm einen entrüsteten Blick zu. »Deine Kinder stammen aus einer Beziehung, die du neben der mit deiner Lebensgefährtin hattest?«
»Du sagst das so, als wäre es etwas Unanständiges«, kommentierte Basileios grinsend diese Frage und wurde wieder ernst. »Ich habe meine Lebensgefährtin wie gesagt beim Untergang verloren, Bricker. Ich war sehr lange Zeit ganz allein. Lucian musste sich um die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Familie, der Unsterblichen und Sterblichen insgesamt kümmern. Das hat ihm geholfen, sich seinen Verstand und seine Menschlichkeit zu bewahren. Ich hatte all das nicht. Ich brauchte einen Fixpunkt in meinem Leben. Ich brauchte jemanden, um den ich mich kümmern konnte. Einen Grund, am Abend aufzustehen. Wenn ich schon keine Lebensgefährtin haben konnte, waren Kinder der nächstbeste Ersatz.« Er schaute aus dem Fenster. »Vermutlich sind meine Kinder der einzige Grund, wieso ich nicht so wie mein Bruder Jean Claude zum Abtrünnigen geworden bin.«
Wieder sah Justin ihn kurz an und fragte neugierig. »Und diese Mary? Das hat ihr nichts ausgemacht?«
»Glücklicherweise befand Mary sich in einer ganz ähnlichen Situation. Na ja, für sie wird das nicht gerade ein Glücksfall gewesen sein«, fügte er nachdenklich hinzu. »Aber du verstehst, was ich meine.«
»Hm«, gab Justin seufzend von sich. »Und wie sieht deine Traumlebensgefährtin aus?«
Basileios sah ihn fragend an. »Ich bin mir nicht sicher, wie ich das verstehen soll.«
»Na ja, du wirst dir doch im Lauf der Jahrtausende ausgemalt haben, wie sie aussehen sollte. Wie hast du sie dir vorgestellt? Groß oder klein? Zierlich oder kurvig? Blond oder brünett?«, führte er aus. »Und welche Persönlichkeit schwebt dir vor? Witzig, klug, quirlig, lieblich?« Wieder ließ er einen neugierigen Blick folgen. »Wovon träumst du?«
Mit ernster Miene dachte Basileios über diese Fragen nach. Natürlich träumte er davon, eines Tages eine Lebensgefährtin zu haben, und er hatte sich auch Gedanken darüber gemacht, wie sie so sein würde. Aber über all diese Einzelheiten hatte er noch nie genauer nachgedacht, auch wenn er die eine oder andere Vorstellung hatte. »Blonde Frauen sind mir lieber als dunkelhaarige, und ich mag sie gern etwas kleiner. Und zierlich. Mit einem angenehmen Charakter, lieb und gehorsam.«
»Gehorsam?« Justin musste schnauben. »Mann, da ist wohl jemand im fünfzehnten Jahrhundert vor Christus stehen geblieben. Heutzutage sind Frauen ganz eindeutig nicht mehr gehorsam.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Na ja, wenn du eine Braut aus einem Katalog bestellst, die aus einem Land kommt, in dem von Frauen erwartet wird, dass sie tun, was man ihnen sagt. Aber ich habe gehört, wenn sie erst mal eine Weile in Kanada oder in den Staaten leben, werden sie von unseren Frauen mit deren Einstellung und Drang zur Selbstständigkeit infiziert.«
Basileios zuckte mit den Schultern. Er ging davon aus, mit seiner Lebensgefährtin glücklich zu werden, ganz gleich, wie sie aussah und welche Charakterzüge sie hatte. Das war schließlich genau das, was Lebensgefährten ausmachte. Die Nanos wählten denjenigen aus, mit dem man glücklich werden würde.
»Jetzt ich«, sagte Justin plötzlich. »Mir ist egal, ob sie klug oder witzig ist. Hauptsache, sie ist groß und kurvenreich, hat dunkle Haare und einen knackigen Hintern.«
»Ah«, entgegnete Basileios. Mehr fiel ihm dazu nicht ein. Es war völlig egal, wie eine Lebensgefährtin vor der Wandlung aussah, sie würde anschließend auf jeden Fall ein etwas verändertes Erscheinungsbild haben. Ob dazu auch ein knackiger Hintern gehörte, hing ganz allein von den Genen ab. Es war etwas oberflächlich, bei einer Lebensgefährtin auf so etwas zu achten, was nur bewies, wie jung und unreif der Junge war. Er würde aber noch erwachsen werden und mit der Zeit auch lernen, was im Leben wichtig war und was nicht.
Sherry starrte Stephanie verwundert an. »Du hast schon angerufen? Wann denn?«
»Ich habe das Telefon hier im Büro benutzt, während ich auf die Pizza gewartet habe«, erklärte Stephanie. »Ich musste doch dafür sorgen, dass den Leuten im Geschäft geholfen wird und jemand Erinnerungen löscht und alles wieder in Ordnung bringt.« Lächelnd fügte sie hinzu: »Außerdem wollte ich mit Marguerite reden, damit sie dir was mitschickt.«