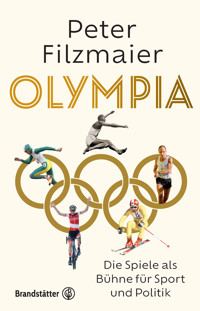
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Olympischen Spiele wollten unpolitisch sein und waren es nie. Sie dienten stets auch Antidemokraten als Bühne. Peter Filzmaier, Politikwissenschaftler und Sportfan, erzählt von der Faszination Olympia: Sowohl von Szenen, die Sportgeschichte geschrieben haben, als auch von politischen Ereignissen. Es geht um einen betenden Ziegenhirten und um angebliche Sexspioninnen, um schillernde Sportstars und unglaubliche Rekorde. Genauso jedoch drehen sich die Spiele um Propaganda und Heldenverehrung, Nationalismus und Rassismus, Sexismus und Doping, Kommerzialisierung und Korruption, und um die politische Macht der Bilder. Gewürzt mit überraschenden Anekdoten erzählt Peter Filzmaier in seinem neuen Buch eine fesselnde Geschichte des Sports und der Politik bei den Olympischen Spielen: Zeitgeschichte einmal anders.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Filzmaier
OLYMPIA
Die Spiele alsBühne für Sportund Politik
INHALT
Warum ich das Buch schreibe
Was alles passiert ist
Kapitel 1
Die Anfänge der Lebenslüge vom unpolitischen Sport 1896–1912
Kapitel 2
Der Fall Deutschland und andere Nationalismen 1920–1932
Kapitel 3
Die Nazispiele 1936 als Rassenwahn
Kapitel 4
Der Kalte Krieg der Supermächte 1948–1988
Kapitel 5
Gegen den Rassismus 1968 und der Terror von München 1972
Kapitel 6
Re-Nationalisierung und Ökonomisierung ab 1992
Kapitel 7
Armut, Demokratiedefizite und Umweltzerstörung bis 2016
Kapitel 8
Vom jahrzehntelangen Doping bis nach Corona 2021
Kapitel 9
Krieg und Sport … und das dummdreiste Ideal der unpolitischen Spiele 2024
Kapitel 10
Die politische Geschichte der Olympischen Winterspiele und das kleine Österreich 1924–2022
Schlussanalyse: Die zehn olympischen Probleme
Anhang: Austragungsorte der Olympischen Sommer- und Winterspiele 1896–2032
Impressum
Warum ich das Buch schreibe
Ich bin ein Sportfan. Alle Jahre wieder ist bei mir zur Zeit der Olympischen Spiele der Fernseher im Dauereinsatz. Schon in meiner Jugend, als es in Österreich ein Rundfunkmonopol gab, schaute ich televisionär viele Stunden lang einem Sportbewerb nach dem anderen zu. Sogar beim Mannschaftszeitfahren der Radfahrer oder den Segelregatten. Was damals ohne moderne elektronische und grafische Hilfen auf einem Schwarzweiß-TV-Gerät ungefähr so spannend war, wie Gras beim Wachsen zuzusehen.
Danach perfektionierte ich das Hin- und Herspringen zwischen mindestens drei Sportkanälen. Dem Kabel- und Satellitenfernsehen sei Dank. In der jüngeren Vergangenheit ist daraus mittels Laptop und Handy eine Interaktivität mit zweitem und drittem Bildschirm geworden. Wie sonst könnte man Zwischenstände, Ergebnisse und Statistiken parallel zum Verlauf eines Bewerbs parat haben? Bei jedem Sprintfinish im Laufen oder der letzten Saltowende beim Schwimmen hatte ich stets leuchtende Augen und glühende Ohren. Übrigens auch bei Punktewertungen im Federball oder Taekwondo. Was immer Taekwondo genau sein mag.
Als Kind wollte ich unbedingt Sportreporter werden. Ein Bubentraum, den ich mir mit dem Buch „Atemlos“, der Sammlung meiner schönsten Sportgeschichten, vor vier Jahren ansatzweise erfüllte. Nachher durfte ich sogar einige Male live im Fernsehen den Linzer Marathon kommentieren. Doch es gibt bei aller Begeisterung stets einen Wermutstropfen: Große Sportereignisse und allen voran Olympische Spiele waren und sind gleichermaßen zutiefst politisch.
Das ist schön, wenn es um den Friedensgedanken geht. Doch dienten die Spiele oft im übelsten Sinn als Schauplatz für Diktatoren und sogar Massenmörder, für eitle Selbstdarsteller und skrupellose Geschäftemacher, für karrieregeile und nicht selten korrupte Olympiafunktionäre oder sportliche Dopingbetrüger und frech lügende Marketinggurus.
In den Neunzigerjahren wollte ich nach meiner Diplomarbeit über die Todesstrafe in den USA meine Dissertation an der Universität über ein weniger deprimierendes Thema schreiben. Es sollte um politische Aspekte der Olympischen Spiele gehen. So gedachte ich das Studium der Politikwissenschaft mit meinem Lieblingshobby Sport zu verknüpfen.
Aber ich geriet vom Regen in die Traufe. Meine Doktorarbeit wurde zur endlosen Geschichte einer Analyse der widerlichsten Dinge der Welt wie Faschismus und Rassismus. Seitdem – und genauso im Olympiajahr 2024 – bin ich eine gespaltene Persönlichkeit: einerseits der Fan, welcher sehr subjektiv und oft politisch inkorrekt mit Sportlerinnen und Sportlern mitfiebert. Andererseits bin ich in meinem Hauptberuf Wissenschaftler und müsste viel kritischer sein. Vor rund dreißig Jahren war ich das, nämlich beim Doktorat mit einem systemtheoretischen Ansatz der Zusammenhänge von Politik und Sport, mit akribischen Recherchen sowie Tausenden Quellen und Fußnoten. Dieses Buch beruht indirekt darauf und auf späteren Zeitungstexten oder Onlineartikeln, ist jedoch viel emotionaler. Ich wollte mir einfach anhand von auf einer historischen Längsachse geordneten und ansonsten bloß auszugsweise wiedergegebenen Olympiaereignissen von der Seele schreiben, wie politisch Olympische Spiele sind und dass wir viel häufiger darüber nachdenken sollten. Und ich kann nur hoffen, dass das Lesen trotz aller Nachdenklichkeit Spaß macht. Insbesondere den Sportfans.
Peter Filzmaier
Was alles passiert ist
Mehr als 800 Jahre vor Christi Geburt sollen König Iphitos von Elis und der spartanische Gesetzgeber Lykurg einen Vertrag geschlossen haben, der eine Waffenruhe für die Zeit des olympischen Festes sichern sollte. Athener und Spartaner wollten sich für fünf Tage nicht bekriegen. Oder das zumindest nicht an den olympischen Sport- und Religionsstätten tun. Als die Spartaner später die Vereinbarung brachen, wurden sie quasi exkommuniziert, zu Strafzahlungen verurteilt und von den Spielen ausgeschlossen. Ja eh. Das klingt lieb und nett.
Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. So beschreibt der amerikanische Buchautor William O. Johnson die Olympischen Spiele der Antike. Die damaligen Athleten wären für eine verwöhnte Oberschicht gewesen, ein Haufen prahlerischer Selbstdarsteller, die von einem Jahr zum nächsten kaum etwas für die Gesellschaft getan, sondern nur ihren Körper geformt und ihr Ego massiert haben sollen. Trotzdem wird kaum ein historisches Ereignis so idealisiert und mythologisiert wie die Spiele der Antike.
Diskriminierung und das liebe Geld
Während in der Gegenwart heftig über geschlechtergerechte Formulierungen gestritten wird, waren im alten Griechenland Frauen nicht einmal mitgemeint. Sondern sie wurden sogar als Zuseherinnen von den Spielen ausgeschlossen. Dasselbe galt ursprünglich für alle Fremden, die keine Griechen waren, sowie für Sklaven und Freigelassene. Mehr als neun Zehntel der altgriechischen Bevölkerung durften somit keine Teilhabe an den antiken Spielen haben.
Was das mit der Jetztzeit zu tun hat? Es ist folgendes Zitat belegt: „Olympische Spiele sind ein Ausbund männlicher Athletik, und der Beifall der Frauen ist deren Lohn.“ Eine passende Quizfrage dazu in der Millionenshow – oder besser noch zum Weltfrauentag – wäre, welcher Blödmann das gesagt hat. Die Antwort: Es war Baron Pierre de Coubertin, der zu Ende des 19. Jahrhunderts Begründer der modernen Olympischen Spiele war.
Man kann heutzutage zudem die provokante Frage stellen, ob moderne Sportler sich wirklich so sehr von ihren altgriechischen Vorbildern – die selten gute waren – unterscheiden. Man müsste Johnsons Worten bloß hinzufügen, dass sie und die Olympische Bewegung zusätzlich viel für die eigene Geldbörse tun anstatt für die Gesellschaft. Vor allem das Internationale Olympische Komitee, im Buchtext künftig als IOC abgekürzt, und alle Nationalen Olympischen Komitees.
Neu wäre das freilich nicht, denn die Olympiasieger der Antike hatten ausgesorgt. Sie wurden nicht nur als Nationalhelden in Liedern gepriesen und in Plastiken abgebildet. Die Verehrung hatte zudem einen sehr praktischen Nutzen, weil sie eine Art lebenslängliche Pension ausbezahlt bekamen. Der mehrfache Laufolympiasieger Dikon ließ sich sogar für Geld als Vertreter verschiedener Städte Griechenlands ausrufen.
Diese Manipulation erinnert an das Phänomen der Moderne, dass arabische Staaten afrikanische Laufstars einkaufen, um sie für ihr Land starten zu lassen. Was in anderen Sportarten ähnlich ist. Auch wenn sie vorher null Komma null Bezug zu ihrer neuen Heimat hatten. Die Nationalmannschaft der Handballer Katars etwa ist in Wahrheit eine für Petrodollars zusammengewürfelte Weltauswahl.
Sind Friede und Internationalisierung unpolitisch?
Der historische Friedensgedanke wurde für die modernen Spiele übernommen. Pierre de Coubertin, Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, offenbarte zugleich seinen mangelhaften Realitätsbezug: „Ich fände es richtig, dass die gegnerischen Armeen mitten im Kriege kurze Zeit ihre Kämpfe unterbrechen, um ehrliche und ritterliche Muskel-Spiele zu feiern.“ Wenig überraschend unterbrachen im 20. Jahrhundert aber zwei Weltkriege die Olympiaden, und natürlich nicht umgekehrt.
Handelte es sich in der Antike um einen „Gottesfrieden“, der durch ein sakrales Gesetz gesichert war – und dessen Bruch mit Geldbußen sowie Ächtung der Frevler bestraft wurde –, sind solche Vorstellungen nicht erst seit dem Münchner Terroranschlag bei den Olympischen Spielen 1972 vor über fünfzig Jahren lächerlich. Genauso sind der Nahostkonflikt und daraus resultierender Terror und Krieg auch auf europäischem Boden wohl die größte Bedrohung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Man kann entweder diskutieren, ob – siehe Russland – Angriffskriege führende Staaten ausgeschlossen werden. Oder man entscheidet sich für zweifelhafte Kompromisse in Form von neutralen Fahnen und weggelassenen Hymnen. Doch über Vladimir Putins Sportorganisationen nur Strafgelder zu verhängen, womit vom Doping bis zum Truppeneinmarsch in ein anderes Land alle Schandtaten in Vergessenheit geraten oder gar eine Reinwaschung erfolgt, das ist absurd.
Doch zurück ins alte Griechenland: Sport war damals kein Freizeitvergnügen, sondern vor allem eine Übung vor dem und für den Kampf. So gesehen dienten auch Olympische Spiele mehr der Vorbereitung von Kriegen als dem Frieden, obwohl man sich während der sportlichen Wettkämpfe nicht gegenseitig den Schädel einschlug. Gleichfalls sollten die antiken Spiele das kriegerische National- und Zusammengehörigkeitsgefühl gegen die Perser als gemeinsamen Feind stärken.
Bis heute betrachten olympische Funktionäre auf allen Ebenen einerseits den Sport als unpolitisch und betonen andererseits die zentrale Funktion der Spiele als friedensfördernd, eine Verständigung der Völker unterstützend sowie Diskriminierung verhindernd. Genau diese Dinge – Frieden, Internationalität und Antidiskriminierung – sind als Grundprinzipien in der vom IOC herausgegebenen Olympischen Charta verankert. Was freilich im Widerspruch zum GAU – dem größtmöglichen anzunehmenden Unsinn – einer These vom unpolitischen Sport steht.
Weil ist eine Friedensbewegung – ältere Menschen in Europa erinnern sich noch an die Achtzigerjahre, als Abertausende im Kalten Krieg der Supermächte USA und UdSSR für den Frieden und gegen den atomaren Overkill mit noch mehr Raketen demonstrierten – nicht sehr politisch? Klar ist sie das, was denn sonst.
Ist es nicht ein politisches Ziel, gegen Nationalismus zu sein und als Völkerverständigung vom Hunger in der Welt bis zum globalen Klimaschutz mehr internationales Gemeinschaftsdenken zu wollen? No, na, ned. Ist es etwa keine Politik, für Demokratie und Menschenwürde sowie gegen jede Form der Diskriminierung von Personen zu sein? Selbstverständlich ist es das.
Es ist eine zutiefst politische Aussage, der Olympischen Charta entsprechend Diktaturen und Kriegstreiber strikt abzulehnen. Dasselbe gilt für alle Tendenzen zur Schwächung demokratischer Prinzipien und Grundrechte. Genauso politisch ist die Überzeugung, dass niemand aufgrund seines oder ihres Geschlechts benachteiligt werden darf. Auch nicht infolge der ethnischen Herkunft und Hautfarbe. Ebenfalls nicht wegen jemandes religiöser Überzeugung und sexuellen Orientierung.
Die politischen Spiele
Olympische Spiele wollten demzufolge unpolitisch sein und waren es nie. Gegen die eigenen Bestimmungen zur Völkerverständigung handelte das IOC mittels raffinierter Umgehungstaktiken schon vor über einem Jahrhundert, als man die Verlierermächte des Ersten Weltkriegs nicht bei den Spielen 1920 sehen wollte. Endgültig ihre Unschuld hat die Olympische Bewegung 1936 verloren, als man sich mit den Nationalsozialisten arrangierte, damit diese in Berlin Propagandaspiele abhalten konnten.
1948 wiederum blieb Deutschland wie Japan ausgeschlossen. Danach war es jahrzehntelang ein politischer Zankapfel, ob und mit welchen Staatssymbolen die Deutschen als BRD und DDR teilnehmen durften. Erst 1968 gab es erstmals eine eigene Mannschaft der Ostdeutschen. Die Verwendung von Flagge und Hymne der DDR war pikanterweise erst 1972 in München erlaubt. Seit 1992 gibt es nach der Wiedervereinigung naturgemäß nur ein deutsches Team. In dem sich aber beispielsweise die aus der DDR stammende Schwimmolympiasiegerin Dagmar Hase als Sportlerin zweiter Klasse fühlte.
Ähnlich umstritten war der Fall Korea, wo das IOC mit seinen Bemühungen für die Völkerverständigung und eine Teilnahme beider Länder an den Spielen lange Zeit keinen Erfolg hatte. Nordkorea boykottierte auch die Olympischen Spiele im südkoreanischen Seoul 1988, obwohl beide Länder da längst in der Olympischen Bewegung vertreten waren.
Erst bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang war nicht nur das Veranstalterland Südkorea dabei, sondern gab es für das Eishockeyturnier der Frauen ein gesamtkoreanisches Team. Davor bedeutete ein Einmarsch beider Koreas bei den Eröffnungsfeiern in Sydney 2000 und Athen 2004 sowie bei den Winterspielen in Turin 2006 keineswegs ein Antreten miteinander. Generell dienten im seltenen Fall eines Miteinanders bei Sportereignissen – etwa im Tischtennis – als Symbole der gemeinsamen koreanischen Mannschaft übrigens eine weiße Flagge mit der blauen Silhouette der koreanischen Halbinsel und ein beliebtes Volkslied als Hymne.
Ähnlich schwierig gestaltete sich das politische Wechselspiel zwischen Nationalchina, also Taiwan, und der kommunistischen Volksrepublik China. Zunächst war nur Taiwan in der Olympischen Bewegung, 1954 nahm man die Volksrepublik auf, welche prompt den Ausschluss Taiwans forderte und 1958 wieder austrat. Erst seit den Achtzigerjahren gibt es zwei chinesische Mannschaften. Es ist also kompliziert.
Wir können zusammenfassen: Hitlers Spiele in Berlin 1936, erste Boykottbewegungen nach der Niederschlagung des Ungarnaufstands durch sowjetische Truppen und der Suezkrieg in Melbourne 1956 – unter anderem waren die Niederlande, Schweiz und Spanien nicht dabei –, der Boykott der Afrikaner in Montreal 1976 (man wollte den Ausschluss Neuseelands, das verbotene Sportkontakte im Rugby mit Südafrika als Land des Apartheidregimes unterhielt) sowie Boykott und Gegenboykott der Supermächte in Moskau 1980 und Los Angeles 1984, Black Power-Proteste in Mexico City 1968 und insbesondere der palästinensische Terroranschlag von München 1972 sind Allgemeinwissen und doch nur die Spitze eines politischen Eisbergs.
Seit München und noch viel mehr nach „9/11“ – dem 11. September 2001, als bei einem Terroranschlag Flugzeuge in das New Yorker World Trade Center krachten – müssen aus Sicherheitsgründen für die Olympischen Spiele mehr militärische Mittel aufgewendet werden, als für Kriege erforderlich sind.
Die Spiele waren stets eine Spielwiese der Politik, und zwar vor allem für Antidemokraten. Im Lauf der Geschichte kamen als Problembereiche die gigantische Kommerzialisierung und Mediatisierung der Olympischen Spiele, Umweltzerstörung und Doping dazu. Wir müssen reden. Nämlich über all das, ganz egal, wie toll und spannend die Sportbewerbe sind. Es schließt sich nicht aus, sowohl begeisterter Sportfan zu sein als auch kritisch gegenüber der Olympischen Bewegung und ihren nationalen und internationalen Funktionären.
KAPITEL 1
Die Anfänge der Lebenslüge vom unpolitischen Sport 1896–1912
Sind Frieden, Völkerverständigung und Diskriminierungsverbot als idealistische Ziele der antiken und modernen Olympischen Spiele zugleich deren Lebenslüge? Abgesehen davon, dass solche Vorgaben Teil der – in diesem Fall theoretisch positiven – Politisierung Olympias sind, klafften Anspruch und Wirklichkeit von Beginn an weit auseinander.
Der betende Ziegenhirt
Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fanden 1896 in Athen statt. Ja, natürlich, das klingt von der Historie her logisch. Es passte jedoch zusätzlich dem griechischen Königshaus bestens in sein politisches Konzept. Die Könige entstammten nämlich bayrischen und dänischen Herrscherfamilien und waren dem griechischen Volk ziemlich fremd. Doch der erste Tag der Spiele fiel mit dem Jahrestag der Unabhängigkeit Griechenlands von einer türkischen Oberhoheit im Jahr 1830 zusammen. Also waren die Spiele den Herrschern zur pseudomäßigen Demonstration ihrer Volksverbundenheit hochwillkommen.
Parallel sollten Integrations- und Identifikationseffekte des Sports die nationale Selbstfindung begünstigen. Wie das geht? Ganz einfach. Alle jubeln zusammen über einen Sporthelden. Am besten im mit sündteurem Marmor wiederhergestellten oder eher mehr als weniger neu gebauten Olympiastadion der Antike. Zum Superhelden wurde der Sieger im Marathonlauf. Ein Grieche namens Spiridon Louis.
Die Legende rund um die heute als Massenveranstaltung so populären Marathonläufe hat ihre erzählerischen Schwächen, die keinen kümmern. Der Geschichtsschreiber Herodot überlieferte zunächst die Geschichte des Laufboten Pheidippides, der 490 Jahre vor Christi Geburt von Athen nach Sparta rannte, um Unterstützung im Krieg gegen die Perser zu erbitten. Erst nach Christus entstand die irgendwie hübschere Version Plutarchs und Lukians, dass der Bote nach einem Sieg der Athener in der Schlacht auf der Ebene einen Marathon von 42,195 Kilometern ins Stadtzentrum wieselte, um den Triumph zu verkünden. Nach dem Ausrufen seiner Botschaft „Wir haben gesiegt!“ sei er tot zusammengebrochen. Auch weil er in voller Kampfausrüstung gelaufen sei. Hier stellen sich zwei Fragen: Erstens hat natürlich niemand die Strecke so genau vermessen. Zweitens: Warum zum Teufel hat der Typ seine Rüstung anbehalten und sich dieser nicht auf dem Weg entledigt? Die Schlacht war ja vorbei …
Wie auch immer. Der griechische Kronprinz und noch so ein Prinz sollen Herrn Louis im Stadion entgegen und an beiden Seiten neben ihm hergelaufen sein. Na gut. Das würde heute eine Disqualifikation mit sich bringen. Der flotte Spiridon Louis war aber seinem Landsmann Vasilakos und dem Ungarn Keller offenbar so weit voraus, dass er sich grüßend vor dem sich auf der Tribüne erhebenden König verneigt hat.
Ach ja, aus unerfindlichen Gründen hätte Louis zudem eine Marinemütze getragen und sie minutenlang mit lebhafter Rührung vor seinem Beherrscher geschwenkt. Daraufhin wäre er von Adjutanten des Königs umarmt und geküsst worden. Zu guter Letzt saß Spiridon Louis auf den Schultern der Prinzen.
Wenn das kein Stoff ist, aus dem Legenden gemacht werden. Nur war das erst der Anfang. Romantischen Geschichten zufolge lief Louis bloß über 42 Kilometer, um die hartherzigen Eltern seines geliebten Mädchens zu beeindrucken. Einem anderen Märchen zufolge wollte er seinen schwerkranken Vater erfreuen. Und den König dazu bringen, seinen im Gefängnis sitzenden Bruder freizulassen. Wobei Louis gar keinen Bruder hatte. Dumm gelaufen.
Pierre de Coubertin als Gründer der modernen Olympischen Spiele verbreitete selbst die Mär, dass Louis ein einfacher Ziegenhirt war, der sich viele Wochen und Monate lang ausschließlich durch Beten und Fasten auf den Marathon vorbereitet hätte. Liebe Kinder und Lauffreunde, bitte macht das bloß nicht nach. In Wirklichkeit war Spiridon ein Botenjunge und somit für damalige Verhältnisse bestens trainiert.
Der Rest ist schnell erzählt: Der 24-jährige Spiridon Louis war für einige Zeit der erste richtige Star des Sports. Als Volksheld wurde er in jedem Gasthaus und beim Friseur gratis bedient. Noch 1936 in Berlin war er so etwas wie ein eingeladener Ehrengast. Zugleich aber ein Vorzeigegegenstand, den Hitlers Sportschergen und Propagandaminister Joseph Goebbels für eine Jubelberichterstattung missbrauchten. Im Vergleich dazu ist das politische Tamtam rund um Eliud Kipchoge, den aktuellen Doppelolympiasieger im Marathonlauf, harmlos. Kipchoge gilt einerseits als Symbol für den Aufstieg Kenias. Andererseits wird kritisiert, dass sein Erfolg mit einer gigantischen Kommerzialisierung einherging, zumal sein Lauf von unter zwei Stunden in Wien ausgerechnet von einem Unternehmen der chemischen Industrie finanziert und inszeniert wurde.
Olympia als frühe Bühne des Nationalismus
Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit gab es keine Mannschaften der Nationen im heutigen Sinn. Fast jeder, der männlich und mehr oder weniger zufällig vor Ort war, konnte teilnehmen. Zum Beispiel das Personal der britischen Botschaft in Athen: Der dortige Mitarbeiter Edwin Flack war eigentlich Australier, startete aber als Mitglied eines Londoner Sportvereins für die Briten und wurde Olympiasieger im Mittelstreckenlauf. Im Tauziehen – ja, das gab es wirklich – traten aus mehreren Ländern bunt zusammengewürfelte Teams an. Ähnliches geschah im Rudern, Segeln und Tennis.
Trotzdem erwies sich der Gedanke der Internationalität und einer dadurch bedingten Völkerverständigung bald als wenig realistisch. Böhmen (damals bei Österreich) und Finnland (als Teil Russlands) beispielsweise strebten nach Selbstständigkeit und erkannten bei einzelnen Spielen von 1900 in Paris bis 1912 in Stockholm jeweils eine Chance, ihre politischen Forderungen bis hin zur Bereitschaft für einen nationalen Unabhängigkeitskampf auf olympischer Ebene zu präsentieren. Lediglich Vertreter Irlands, das erst 1922 unabhängig wurde, starteten gerne in der Mannschaft Großbritanniens.
Nur rein theoretisch sollte das Nationalgefühl mittels der Olympischen Spiele durch ein Weltbürgertum ersetzt werden. Praktisch sah es anders aus. Am deutlichsten traten die nationalistischen Gegensätze im deutsch-französischen Konflikt hervor: 1896 wollte Frankreich nicht teilnehmen, weil auch Deutschland vertreten war. Ausgerechnet der Begründer der Neuzeitspiele, der Franzose Coubertin, soll in einem Interview seiner Hoffnung Ausdruck verliehen haben, die Deutschen – die auch kein Gründungsmitglied des IOC waren – aus der Olympischen Bewegung ausschließen zu können. Überraschend war diese Position Coubertins nicht. Es war kein Zufall, dass die Bewegung zur Wiedereinführung der Olympischen Spiele im Frankreich des auslaufenden 19. Jahrhunderts entstand. Nach der Niederlage im deutschfranzösischen Krieg 1870/71 suchte man nach neuen Bereichen, um Stärke und Leistungsfähigkeit zu beweisen. Die Spiele waren laut Coubertin ein Mittel, um die Schmach Frankreichs zu tilgen und das nationale Selbstwertgefühl zu fördern.
In Deutschland wiederum wurde die olympische Idee gerade aufgrund ihrer Internationalität von den in der klaren Mehrzahl nationalistisch gesinnten Sportvereinigungen abgelehnt. Wer als Deutscher in Athen teilnehmen wollte, dem warf man „Untreue und eitle Ruhmsucht“ vor. Den trotzdem nach Griechenland reisenden Turnern wurde erklärt, sie hätten kein Recht, „sich als Träger des deutschen Volkswillens“ oder „als Träger des deutschen Turnens, Spiels und Sports anzusehen“. Nach den Spielen wurden diese Turner aus der reaktionären Deutschen Turnerschaft ausgeschlossen.
Schmutzige Bettgeschichten
Der als Vorstandsvorsitzender der Turnerschaft als „deutscher Turnerführer“ geltende Ferdinand Götz bezeichnete in einem Brief die Olympiateilnahme als „mit der Ehre eines deutschen Mannes unverträglich“ und die Spiele als eine „dem deutschen Volke angetane Schmach“. Es entwickelte sich ein Kleinkrieg wechselseitiger Unfreundlichkeiten und Beleidigungen.
1900 kam es in Paris zur Eskalation des Konflikts, als Deutschlands Sportler zum Teil ausgerechnet in Kasernen mit französischen Soldaten untergebracht wurden. Zuerst gab es keine Betten für die Deutschen. Dann verstanden nationalistische Franzosen den Umstand zu nutzen, dass die Quartiere nicht verschließbar waren; die Zimmer der Deutschen waren eines Tages voll von Urin und Fäkalien sowie mit Wandinschriften wie „Cochons!“, „À bas la Prusse!“ und „Vive la France!“ verziert.
Wer nicht in der besch…eidenen Kaserne untergebracht war, musste Quartiere beziehen, die zwei Stunden von den Sportstätten entfernt und für die weder Wegweiser noch Transport bereitgestellt waren. Bedauernswert waren freilich nur die deutschen Sportler, während ihre Sportvereinigungen in der Heimat vice versa keine Gelegenheit ungenutzt ließen, um die Olympischen Spiele zum Schüren antifranzösischer Stimmung heranzuziehen.
Die Affäre hatte auch konkret sportliche Auswirkungen. In einem Rugbyspiel führten die Deutschen gegen Frankreich zur Pause mit 14 zu 5 Punkten. Nach der Halbzeit tat sich wenig, das Ende des Spiels rückte nahe. Nur der nicht ganz unparteiische Schiedsrichter wollte angesichts der deutschen Führung kein Ende finden. Er war Franzose. Erst nach über zwanzig Minuten Nachspielzeit und einigen fragwürdigen Entscheidungen war das Spiel aus, und Frankreich hatte 25 zu 16 gewonnen.
Dass Frankreich in Paris in Summe 29 erste, 41 zweite und 32 dritte Plätze errang, hatte einen banalen Grund: Rund zwei Drittel der 1.344 Teilnehmer kamen aus dem Veranstalterland. Herausragendster Sportler war wiederum ein Amerikaner: Alvin C. Kraenzlein holte lange vor Jesse Owens und Carl Lewis in gleich vier Disziplinen Gold: über 60 Meter, 110 Meter und 200 Hürden (eine heutzutage unbekannte Disziplin) sowie im Weitsprung.
Anglo-amerikanische Provokationen 1908
Auch Großbritannien war von Anfang an bei den Spielen erfolgreich dabei. Wobei manche Siege einen kuriosen Beigeschmack hatten. Im Langstreckenlauf über 5.000 Meter gab es eine Mannschaftswertung. Die jeweils besten vier Läufer wurden gewertet, es mussten pro Team jedoch fünf Athleten am Start sein. Also komplettierte der Australier Stanley Rowley 1900 die britische Mannschaft, obwohl er ein Sprinter war. Die fünf Kilometer absolvierte er gehend, unter dem Gelächter des Publikums genussvoll an einer Zitrone lutschend.
Nicht weniger seltsame Siege errangen die USA in Saint Louis 1904. Insgesamt belegten die Amerikaner gar 84 Prozent der drei Ehrenplätze. Weil im Basketball, Boxen, Ringen, Turnen, Rudern mit Ausnahme des Achters und beim Tauziehen ausschließlich Sportler aus den USA und deren Teams antraten. Gegen sich selbst kann man nicht verlieren.
Der nationalistische Jubel hielt sich nur deshalb in Grenzen, weil die Spiele in Saint Louis Anhängsel einer Weltausstellung waren. Chronisten sind sich nicht einmal einig, wann genau sie im Rahmen dieser begonnen haben. Die Ergebnisse der weit verstreut ausgetragenen Sportbewerbe wurden nirgendwo ausgehängt oder auf andere Art offiziell verkündet.
Zudem folgte auf den deutsch-französischen Konflikt von 1900 eine Fülle ernsterer Provokationen und Insultationen zwischen England und den USA während der Spiele in London 1908. US-Fahnenträger Sheridan erklärte, dass er seine Stars-and-Stripes-Flagge vor keinem irdischen Herrscher – und folgerichtig auch nicht auf der Eröffnungsfeier zu Ehren König Edward VII. – senken würde. Alle Olympiasieger erhielten neben der Goldmedaille einen in die britische Fahne Union Jack gewickelten Lorbeerkranz. Was Nichtbriten wenig begeisterte. Die Olympioniken der USA führten dafür einen gefesselten (Stoff-)Löwen als Symbol für unterlegene Sportler aus Großbritannien vor.
Der 400-Meter-Lauf wurde zur sportlichen Farce und tragischen Lachnummer, weil zwei Amerikaner angeblich einen Briten behinderten und daraufhin ein heimischer Kampfrichter einen dritten Amerikaner mitten im Rennen gewaltsam stoppte. In Footballmanier. Die Rennwiederholung wurde von dem Gestoppten und seinen zwei Landsmännern boykottiert. Der Brite Wyndham Halswelle gewann damals als Vierter der vier Finalisten die Goldmedaille im Spaziertempo. Halswelle war einer von 56 britischen Siegern und trug zum Gewinn des für das erfolgreichste Land gestifteten Pallas-Athene-Pokals bei. Heute zu einer Anekdote geworden, symbolisierte der Fall damals die Interessengegensätze zwischen dem an Einfluss verlierenden Weltreich Großbritannien und der neuen Großmacht USA. Das politische Forum für den Konflikt lieferten die Olympischen Spiele inklusive ihrer vermeintlichen Völkerverständigung.
Auch im Marathon hätte das Publikum jeden Sieger akzeptiert, nur niemanden aus den USA. Also trug man den total erschöpften Italiener Petri Dorado einfach ins Ziel, damit John J. Hayes ihn nicht einholte. Wer hätte das geahnt, als Britanniens Hauptstadt 1908 für Rom einsprang – nach dem Vesuvausbruch gab es in Italien kein Geld für Brot und Spiele –, dass man einen Mann aus Italien so zum Olympiasieger machen wollte?
Zu den sportlichen Skurrilitäten kamen nationale Grenzfälle, weil Kanada und Südafrika – politisch zum britischen Königreich gehörend – mit einer eigenen Mannschaft antraten. Der Gegenentwurf eines „British Empire Team“ für die Spiele 1916 in Berlin scheiterte nur, weil diese infolge des Ersten Weltkriegs nicht stattfanden. Dafür rechneten die Nazis in ihrer Propagandaolympiade 1936 Medaillen für Kunst und Kultur in die Nationenwertung mit ein. Aber dazu mehr im Kapitel zu den Spielen in Berlin.
Rassistische Spektakel und ein Diskriminierungsverbot mit vielen Ausnahmen
Das Diskriminierungsverbot der Olympischen Spiele bezog sich ursprünglich auf „Rasse“, Religion und politische Überzeugung. Doch hatten Frauen und wirtschaftlich schlechter gestellte Personen lange Zeit in Olympia nichts zu suchen. Den Begründern der Olympischen Spiele in der Neuzeit fiel zum Thema Gleichberechtigung bei einer ihrer ersten Sitzungen nicht mehr ein, als dass man das „Problem“ einer Teilnahme von Frauen dadurch lösen könne, wenn wie in antiken Zeiten alle Teilnehmer nackt sein müssten.
Nicht nur in Berlin 1936, sondern bereits seit 1896 waren Menschen mit anders pigmentierter Haut, nicht christliche Gläubige und Andersdenkende unerwünscht. Es dauerte bis 1904, bis mit George C. Poage ein afroamerikanischer Athlet an den Spielen teilnahm. Überschattet wurde sein Auftritt von einem rassistischen Parallelspektakel der besagten Weltausstellung in Saint Louis, wo es anthropologische Tage „zur Prüfung der alarmierenden Gerüchte über Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft der wilden Stämme“ – gemeint waren neben Afroamerikanern auch „Indianer“, Philippinos, Ainos und so weiter – gab. Diese seltsame Schaustellung der Minderheiten zur Erheiterung des Publikums im rassistischen Süden der USA erhielt von Pierre de Coubertin Lob als „die ersten Wettkämpfe, die jemals ausschließlich für Wilde veranstaltet wurden“. Coubertin empörte sich lediglich darüber, dass von ihm als „Kulturvölker“ anerkannte Türken und Syrer auf eine Stufe wie von ihm nicht als gleichwertig angesehene Völker gestellt wurden.
Ist es vor einem solchen olympischen Hintergrund überraschend, dass wenig später von Siegen gegen „Nigger“ und bei Niederlagen von „Rassenschande“ gesprochen wurde? Auch wenn das nationalsozialistische Regime den Propagandawert der Olympischen Spiele relativ spät entdeckte – die Wurzeln dafür, dass sich die Olympische Bewegung allzu willfährig mit Hitlers Schergen für eine rassistische Instrumentalisierung der Spiele arrangierte, die reichen bis weit vor den Ersten Weltkrieg zurück.
Die Sache mit den Medaillen
Ab London 1908 grassierte das Olympiafieber. Zudem wurde etwas immer populärer, was es offiziell gar nicht gibt: der Medaillenspiegel als Auflistung der Gold-, Silber- und Bronzegewinner nach Nationen. Das IOC hat diese Statistik vor langer Zeit in weiser Voraussicht verboten. Das war ehrenwert und naiv zugleich. Natürlich werden die schönen Ziele internationaler Spiele ad absurdum geführt, wenn nicht mehr Friedensgedanke und Völkerverständigung zählen, sondern ein Sporterfolg zum Triumph über Athleten eines anderen Landes uminterpretiert wird. Das freilich erledigen Politik und Medien als nationale Komplizen; es gibt kein globales Fernsehen und nicht einmal in der Gegenwart so richtig EU-ropäische Zeitungen. Printmedien und auch deren Onlineangebote richten sich nicht an „Weltbürger“ als Zielpublikum, sondern sind national oder regional fokussiert. Zwischen den Zeilen ist dort oft zu lesen, dass „unsere Guten gegen die bösen anderen“ gewonnen haben.





























