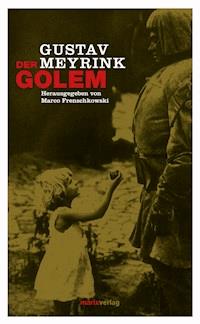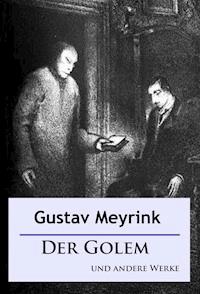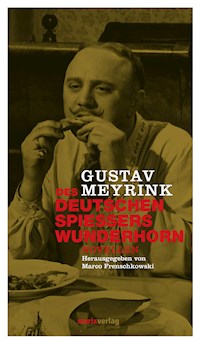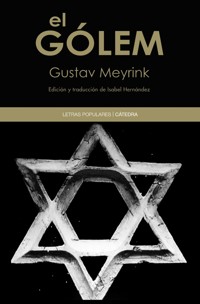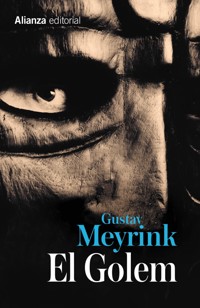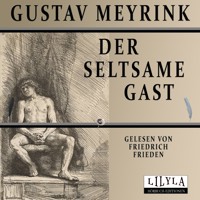0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gustav Meyrink war das Pseudonym von Gustav Meyer, einem 1932 verstorbenen österreichischen Schriftsteller, Romanautor, Dramatiker, Übersetzer und Bankier, der vor allem durch seinen Roman "Der Golem" bekannt wurde. Er galt als einer der angesehensten deutschsprachigen Schriftsteller auf dem Gebiet der übernatürlichen Literatur. In diesem zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienenen Werk sammelte er mystische Geschichten, die aber oft auch satirisch angehaucht sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Orchideen
GUSTAV MEYRINK
Orchideen, G. Meyrink
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849663698
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Die schwarze Kugel1
Dr. Lederer5
Das dicke Wasser9
Das Präparat14
Chimäre. 19
Der Schrecken. 23
Jörn Uhl27
Das Gehirn. 31
Eine Suggestion. 35
G. M.41
Bologneser Tränen. 48
Blamol53
Hony soit qui mal y pense.60
Der Opal65
Der Untergang. 70
„Krank“. 75
Der Tod des Selchers Schmel77
Der Mann auf der Flasche. 80
Coagulum... 88
Die schwarze Kugel
Anfangs sagenhaft gerüchteweise ohne Zusammenhang drang aus Asien die Nachricht in die Zentren westlicher Kultur, daß in Sikkhim südlich vom Himalaja von ganz ungebildeten, halbbarbarischen Büßern sogenannten Gosains eine geradezu fabelhafte Erfindung gemacht worden sei.
Die anglo-indischen Zeitungen meldeten zwar auch das Gerücht, schienen aber schlechter als die russischen informiert, und Kenner der Verhältnisse staunten hierüber nicht, da bekanntlich Sikkhim allem, was englisch ist, mit Abscheu aus dem Wege geht.
Das war wohl auch der Grund, weshalb die rätselhafte Erfindung auf dem Umwege Petersburg–Berlin nach Europa drang.
Die gelehrten Kreise Berlins waren fast vom Veitstanz ergriffen, als ihnen die Phänomene vorgeführt wurden.
Der große Saal, der sonst nur wissenschaftlichen Vorträgen diente, war dicht gefüllt.
In der Mitte, auf einem Podium, standen die beiden indischen Experimentatoren, der Gosain Deb Schumscher Dschung, das eingefallene Gesicht mit heiliger weißer Asche bestrichen, und der dunkelhäutige Brahmane Radschendralalamitra, als solcher durch die dünne Baumwollschnur kenntlich, die ihm über die linke Brusthälfte hing.
An Drähten von der Saaldecke herab waren in Mannshöhe gläserne, chemische Kochkolben befestigt, in denen sich Spuren eines weißlichen Pulvers befanden. Leicht explodierbare Stoffe, vermutlich Jodide, wie der Dolmetsch angab.
Unter lautloser Stille des Auditoriums näherte sich der Gosain einem solchen Kochkolben, band eine dünne Goldkette um den Hals des Glases und knüpfte die Enden dem Brahmanen um die Schläfen. Dann trat er hinter ihn, erhob beide Arme und murmelte die Mantrams Beschwörungsformeln seiner Sekte.
Die beiden asketischen Gestalten standen wie Statuen mit jener Regungslosigkeit, die man nur an arischen Asiaten sieht, wenn sie sich ihren religiösen Meditationen hingeben.
Die schwarzen Augen des Brahmanen starrten auf den Kolben. Die Menge war wie gebannt.
Viele mußten die Lider schließen oder wegsehen, um nicht ohnmächtig zu werden. Der Anblick solcher versteinerter Gestalten wirkt wie hypnotisierend, und mancher fragte flüsternd seinen Nebenmann, ob es ihm nicht auch scheine, daß das Gesicht des Brahmanen manchmal wie in Nebel getaucht sei.
Dieser Eindruck wurde aber nur durch den Anblick des heiligen Tilakzeichens auf der dunklen Haut des Inders erweckt, ein großes weißes U, welches jeder Gläubige als Symbol Vishnus des Erhalters auf Stirne, Brust und Armen trägt.
Plötzlich blitzte ein Funken in dem Glaskolben auf, der das Pulver zur Explosion brachte. Einen Augenblick Rauch, dann erschien in der Flasche eine indische Landschaft von unbeschreiblicher Schönheit: Der Brahmane hatte seine Gedanken projiziert!
Es war der Tadsch Mahal von Agra, jenes Zauberschloß des Großmoguls Aurungzeb, in welchem dieser vor Jahrhunderten seinen Vater einkerkern ließ.
Der Kuppelbau aus bläulichem Weiß wie Krystallschnee mit schlanken Seitenminaretts, in einer Pracht, die den Menschen in die Knie zwingt, warf sein Spiegelbild auf den endlosen schimmernden Wasserweg zwischen traumgeschmiegten Cypressen.
Ein Bild, das dunkles Heimweh weckt nach vergessenen Gefilden, die der Tiefschlaf der Seelenwanderung verschlungen.
Stimmengewirr der Zuschauer, ein Staunen und Fragen. Die Flasche wurde losgewickelt und ging von Hand zu Hand.
Monate lang halte sich so ein fixiertes plastisches Gedankenbild, übersetzte der Dolmetsch, zumal es der immensen stetigen Vorstellungskraft Radschendralalamitras entsprungen sei, Projektionen europäischer Gehirne dagegen hätten nicht annähernd diese Farbenpracht und Dauer.
Viele ähnliche Experimente wurden noch gemacht, bei denen teils wieder der Brahmane, teils einer oder der andere der berufensten Gelehrten die Goldkette um die Schläfen knüpfte.
Klar wurden eigentlich nur die Vorstellungsbilder der Mathematiker; recht sonderbar fielen zuweilen die Resultate aus, die den Köpfen juridischer Kapazitäten entsprangen, allgemeines Staunen aber und Kopfschütteln bewirkte die angestrengte Gedankenprojektion des berühmten Professors für innere Medizin, Sanitätsrats Mauldrescher. Sogar den feierlichen Asiaten blieb der Mund offen: Eine unglaubliche Menge kleiner mißfarbener Brocken, dann wieder ein Konglomerat verschwommener Klumpen und Zacken war in dem Versuchskolben entstanden.
„Wie italienischer Salat,“ sagte spöttisch ein Theologe, der sich vorsichtshalber garnicht an den Experimenten beteiligt hatte.
Besonders der Mitte zu, wo sich bei wissenschaftlichen Gedanken die Vorstellungen über Physik und Chemie niederschlagen, wie der Dolmetsch betonte, war die Materie gänzlich versulzt.
Auf Erklärungen, wieso und wodurch die Phänomene eigentlich zustande kämen, ließen sich die Inder nicht ein. „Später einmal, später“ sagten sie in ihrem gebrochenen Deutsch.
Zwei Tage nachher fand wieder eine Vorführung der Apparate diesmal halb populär in einer andern europäischen Metropole statt.
Wieder die atemlose Spannung des Publikums, dieselben bewundernden Ausrufe, als zuerst unter der Einwirkung des Brahmanen ein Bild der seltsamen tibetanischen Festung Taklakot erschien.
Dann folgten wieder die mehr oder minder nichtssagenden Gedankenbilder der Stadtgrößen.
Die Mediziner lächelten nur überlegen, waren aber diesmal nicht zu bewegen, in die Flasche hineinzudenken.
Als dann endlich eine Gesellschaft Offiziere näher trat, machte alles respektvoll Platz. Na selbstverständlich!
„Gustl, was meinst, denk du amol wos,“ sagte ein Leutnant mit gefettetem Scheitel zu einem Kameraden.
„Ah, i nöt, mir is vüll z’vüll Ziwüll do.“
„Na aber ich biddde, ich biddde, doch einer von die Herren“ forderte gereizt der Major auf.
Ein Hauptmann trat vor: „Sö, Dolmetscher, kann ma sich a wos Idealls denken? i wüll ma wos Idealls denken!“
„Was wird es denn sein, Herr Hauptmann?“ („Auf den Zwockel bin ich neugierig,“ schrie einer aus der Menge.)
„No,“ sagte der Hauptmann, „no, i wier halt an die ehrenrädddlichen Vurschriften denken!“
„Hm,“ strich sich der Dolmetsch das Kinn, „hm, ich hm, ich denke, Herr Hauptmann, hm, dazu hm sind die Flaschen vielleicht doch nicht widerstandsfähig genug.“
„Alsdann laß mich, Kamerad,“ drängte sich ein Oberleutnant vor.
„Ja, ja, laßt’s ’n Katschmatschek“, schrien alle, „dös is a scharfer Denker.“
Der Oberleutnant legte sich die Kette um den Kopf. „Bitte“, reichte ihm der Dolmetsch verlegen ein Tuch, „bitte: … Pomade isoliert nämlich.“
Deb Schumscher Dschung der Gosain mit seinem roten Lendentuch und dem weißgetünchten Gesicht trat hinter den Offizier. Er sah heute noch unheimlicher aus als in Berlin.
Dann hob er die Arme.
Fünf Minuten
Zehn Minuten nichts.
Der Gosain biß vor Anstrengung die Zähne zusammen, und der Schweiß lief ihm in die Augen.
Da! Endlich. Das Pulver war zwar nicht explodiert, aber eine sammetschwarze Kugel so groß wie ein Apfel schwebte frei in der Flasche.
„Dös Werkl spüllt nimmer“, lächelte der Offizier verlegen und trat vom Podium herab. Die Menge brüllte vor Lachen.
Erstaunt nahm der Brahmane die Flasche Da! Wie er sie bewegte, berührte die innen schwebende Kugel die Glaswand. Sofort zersprang diese, und die Splitter, wie von einem Magnet angezogen, flogen in die Kugel, um darin spurlos zu verschwinden.
Der sammetschwarze runde Körper schwebte jetzt unbeweglich frei im Raum.
Eigentlich sah das Ding gar nicht wie eine Kugel aus und machte eher den Eindruck eines gähnenden Loches. Und es war auch gar nichts anderes als ein Loch.
Es war ein absolutes ein mathematisches „Nichts!“
Was jetzt geschah, war nichts als die notwendige Folgeerscheinung dieses „Nichts“. Alles an dieses „Nichts“ angrenzende stürzte naturnotwendig hinein, um darin augenblicklich ebenfalls zu „Nichts“ zu werden, d. h. spurlos zu verschwinden.
Wirklich entstand sofort ein heftiges Sausen, das immer mehr und mehr anschwoll, denn die Luft im Saale wurde in die Kugel hineingesaugt. Kleine Papierschnitzel, Handschuhe, Damenschleier alles riß es mit hinein.
Ja, als ein Offizier mit dem Säbel in das unheimliche Loch stieß, verschwand die Klinge, als ob sie abgeschmolzen wäre.
„Jetzt dös geht zu weit“, rief der Major bei diesem Anblick, „dös kann i nöt dulden, geh’mer, meine Herren, geh’ mer. Biddde, ich biddde.“
„Was host dir denn denkt, eigentlich, Katschmatschek?“ fragten die Herren beim Verlassen des Saales.
„I? No, wos ma sich halt a so denkt.“
Die Menge, die sich das Phänomen nicht erklären konnte, und nur das schreckliche, immer mehr anwachsende Sausen hörte, drängte angsterfüllt zu den Türen.
Die einzigen Zurückbleibenden waren die beiden Inder.
„Das ganze Universum, das Brahma schuf, Vishnu erhält und Siva zerstört, wird nach und nach in diese Kugel stürzen“, sagte feierlich Radschendralalamitra, „das ist der Fluch, daß wir nach Westen gingen, Bruder!“
„Was liegt daran,“ murmelte der Gosain, „einmal müssen wir alle ins negative Reich des Seins.“
Dr. Lederer
„Haben Sie den Blitz gesehen? Da muß etwas an der elektrischen Zentrale passiert sein. Gerade dort über den Häusern.“
Tatsächlich waren einige Personen stehen geblieben und blickten in derselben Richtung. Eine schwere Wolkenschicht lag regungslos über der Stadt und bedeckte das Tal wie ein schwarzer Deckel: der Dunst, der von den Dächern aufstieg und nicht wollte, daß die Sterne sich lustig machen über die törichten Menschen.
Wieder blitzte etwas auf von der Anhöhe zum Himmel empor und verschwand.
„Weiß Gott, was das sein kann, vorhin hat es doch links geblitzt, und jetzt wieder da drüben?! Vielleicht sind’s gar die Preußen,“ meinte einer.
„Wo sollen denn die herkommen, bitt’ Sie?! Übrigens habe ich noch vor zehn Minuten die Herren Generäle im Hôtel de Saxe sitzen sehen.“
„Na, wissen Sie, das wäre gerade kein Grund, aber die Preußen! das ist doch nicht einmal ein Witz, so etwas kann ja selbst bei uns nicht“
Eine blendendhelle eiförmige Scheibe stand plötzlich am Himmel, riesengroß und die Menge starrte mit offenem Munde in die Höhe.
„Ein Kompaß, ein Kompaß,“ rief die dicke Frau Schmiedl und eilte auf ihren Balkon.
„Erstens heißt es Komet, und zweitens hätte er doch einen Schweif,“ wies die vornehme Tochter sie zu recht.
Ein Schrei barst in der Stadt und lief durch die Straßen und Gäßchen, in die Haustore, durch dunkle Gänge und über krumme Treppen bis in die ärmsten Stübchen. Alles riß die Vorhänge zur Seite und stieß die Scheiben auf, die Fenster waren im Nu von Köpfen erfüllt: Ah!
Da oben am Himmel in dem nächtigen Dunst eine leuchtende Scheibe, und mitten darin zeichnete sich jetzt die Silhouette eines Ungeheuers, eines drachenartigen Geschöpfes ab.
So groß wie der Josefsplatz, pechschwarz und mit einem gräßlichen Maul.
Ein Chamäleon, ein Chamäleon! Scheußlich.
Ehe die Menge zur Besinnung kam, war das Phantom verschwunden und der Himmel so dunkel wie früher.
Die Menschen sahen stundenlang empor, bis sie Nasenbluten bekamen, aber nichts zeigte sich mehr.
Als ob sich der Teufel einen Spaß gemacht hätte.
„Das apokalyptische Tier,“ meinten die Katholiken und schlugen ein Kreuz nach dem anderen.
„Nein, nein, ein Chamäleon,“ beruhigten die Protestanten.
Glöng, glöng, glöng: Ein Wagen der Rettungsgesellschaft stürmte in die Menge, die schreiend auseinanderstob, und hielt vor einem niedrigen Haustore.
„Ist wem was geschehen?“ bahnte sich der Herr Stadtarzt einen Weg durch das Menschenknäuel. Man schob gerade eine mit Tüchern bedeckte Tragbahre aus dem Hause.
„Ach Gott, Herr Doktor, die gnädige Frau ist vor Schrecken niedergekommen“, weinte das Stubenmädchen, „und es kann höchstens acht Monate alt sein, er wisse es ganz genau, sagt der gnädige Herr.“
„Die Frau Cinibulk hat sich „versehen“ an dem Ungeheuer,“ lief es von Mund zu Mund.
Eine große Unruhe entstand.
„Machen Sie doch Platz, Himmel Herrgott ich muß nach Hause,“ hörte man vereinzelte Stimmen.
„Laßt uns nach Hause gehen, nach unsern Frauen sehen,“ intonierten ein paar Gassenbuben, und der Mob johlte.
„Kusch, ihr Lausbuben,“ schie der Herr Stadtarzt und lief ebenfalls so schnell er konnte heim.
Wenn es nicht zu regnen angefangen hätte, wer weiß, wie lange die Leute noch auf der Straße geblieben wären. So leerten sich allmählich die Plätze und Gassen, und nächtliche Ruhe legte sich auf die nassen Steine, die trüb im Laternenlichte glänzten.
Mit dem Eheglück der Cinibulks war es seit jener Nacht vorbei.
Gerade in so einer Musterehe mußte das passieren! Wenn das Kind wenigstens gestorben wäre, Achtmonatskinder sterben doch sonst gewöhnlich.
Der Gatte, der Stadtrat Tarquinius Cinibulk, schäumte vor Wut, die Buben auf der Gasse liefen ihm nach und johlten; die mährische Amme hatte die Freisen bekommen, wie sie das Kleine erblickt, und er mußte in die Zeitung handgroße Annoncen einrücken lassen, um eine blinde Amme aufzutreiben.
Schon am nächsten Tage nach jenem schrecklichen Ereignis hatte er angestrengt zu tun, um alle die Agenten von Castans Panoptikum aus dem Hause zu scheuchen, welche das Kind sehen und für die nächstjährige Weltausstellung gewinnen wollten.
Vielleicht war es einer dieser Leute gewesen, der ihm, um seine Vaterfreuden noch mehr zu dämpfen, die verhängnisvolle Idee, er sei von seiner Gattin hintergangen worden, eingegeben hatte, denn kurz darauf war er zum Herrn Polizeirat gelaufen, der nicht nur gerne Silberzeug zu Weihnachten annahm, sondern auch durch emsiges Verdächtigen mißliebiger Personen Karriere gemacht hatte.
Es vergingen richtig kaum acht Wochen, als bekannt wurde, daß der Stadtrat Cinibulk einen gewissen Dr. Max Lederer wegen Ehebruchs verklagt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte auf die Befürwortung des Polizeirates die Sache selbstverständlich aufgegriffen, obwohl keine Ertappung in flagranti vorlag.
Die Gerichtsverhandlung war äußerst interessant. Die Anklage des Staatsanwaltes stützte sich auf die frappante Ähnlichkeit der kleinen Mißgeburt, welche nackt und kreischend in einem rosa Korbe lag, mit dem Dr. Max Lederer.
„Sehen Sie sich, hoher Gerichtshof, nur einmal den Unterkiefer an und die krummen Beine, von der niedrigen Stirne, wenn man das überhaupt Stirne nennen darf, ganz zu schweigen. Betrachten Sie die Glotzaugen, bitte, und den borniert viehischen Ausdruck des Kindes und vergleichen Sie all das mit den Zügen des Angeklagten“, sagte der Staatsanwalt, „wenn Sie dann noch an seiner Schuld zweifeln!“
„Es wird wohl keinem Menschen einfallen, hier eine gewisse Ähnlichkeit zu leugnen“, fiel der Verteidiger ein, „ich muß aber ausdrücklich betonen, daß diese Ähnlichkeit nicht dem Verhältnis von Vater zu Kind entspringt, sondern nur dem Umstand einer gemeinsamen Ähnlichkeit mit einem Chamäleon. Wenn hier jemand die Schuld trägt, so ist es das Chamäleon und nicht der Angeklagte! Säbelbeine, hoher Gerichtshof, Glotzaugen, hoher Gerichtshof, sogar ein derartiger Unterkiefer“
„Zur Sache, Herr Verteidiger!“
Der Advokat verbeugte sich: „Also kurz und gut, ich stelle den Antrag auf Einvernahme von Sachverständigen aus der Zoologie.“
Der Gerichtshof hatte nach kurzer Beratung den Antrag mit dem Bemerken abgelehnt, daß er seit neuester Zeit prinzipiell nur noch Sachverständige aus dem Schreibfache zulasse, und schon hatte sich der Staatsanwalt wieder erhoben, um eine neue Rede zu beginnen, als der Verteidiger, der sich bis dahin eifrig mit seinem Klienten besprochen hatte, energisch vortrat, auf die Füße des Kindes wies und anhob:
„Hoher Gerichtshof, ich bemerke soeben, daß das Kind an den Fußsohlen sehr auffallende sogenannte Muttermale trägt. Hoher Gerichtshof, können das nicht vielleicht Vatermale sein?! Forschen Sie nach, ich bitte Sie mit aufgehobenen Händen; lassen Sie Herrn Cinibulk sowohl, als auch Dr. Lederer hier Schuhe und Strümpfe ausziehen, vielleicht können wir das Rätsel, wer der Vater ist, in einem Augenblicke lösen.“
Der Stadtrat Cinibulk wurde sehr rot und erklärte, lieber seinerseits von der Anklage zurückzutreten, als das zu tun, und er beruhigte sich erst, als man ihm erlaubte, sich vorher draußen die Füße waschen zu dürfen.
Der Angeklagte Max Lederer zog zuerst seine Strümpfe aus.
Als seine Füße sichtbar wurden, erhob sich ein brüllendes Gelächter im Auditorium: Er hatte nämlich Klauen, jawohl, zweigespaltene Klauen wie ein Chamäleon.
„No Servus, das sind doch überhaupt keine Füße,“ brummte der Staatsanwalt ärgerlich und schmiß seinen Bleistift zu Boden.
Der Verteidiger machte sogleich den Vorsitzenden aufmerksam, daß es denn doch wohl ausgeschlossen sei, daß so eine stattliche Dame wie Frau Cinibulk jemals mit einem so häßlichen Menschen hätte intim verkehren können; doch der Gerichtshof meinte, während der fraglichen Delikte hätte der Angeklagte doch nicht die Stiefel ausziehen müssen.
„Sagen Sie, Herr Doktor,“ wandte sich leise der Verteidiger während der noch immer herrschenden Unruhe an den Gerichtsarzt, mit dem er gut befreundet war, „sagen Sie, können Sie nicht aus der Mißbildung der Füße des Angeklagten etwa auch auf geistige Umnachtung schließen?“
„Natürlich kann ich das, ich kann alles, ich war doch früher Regimentsarzt, warten wir aber noch ab, bis der Herr Stadtrat hereinkommt.“
Der Stadtrat Cinibulk aber kam nicht und kam nicht.
Da könne man noch lange warten, hieß es, und die Verhandlung hätte vertagt werden müssen, wenn nicht plötzlich aus dem Auditorium der Optiker Cervenka hervorgetreten wäre und der Sache eine neue Wendung gegeben hätte:
„Ich kann es nicht mehr mit ansehen,“ sagte er, „daß ein Unschuldiger leidet, und unterziehe mich lieber freiwillig einer Disziplinarstrafe wegen nächtlicher Ruhestörung. Ich war es, der damals die Erscheinung am Himmel hervorgebracht hat.
Mittels zweier Sonnenmikroskope oder Scheinwerfer, die eine neue wunderbare Erfindung von mir sind, habe ich damals zersetzte, also unsichtbare Lichtstrahlen gegen den Himmel geworfen.
Wo sie sich trafen, wurden sie sichtbar und bildeten die helle Scheibe. Das vermeintliche Chamäleon jedoch war ein kleines Diapositivbild des Herrn Dr. Lederer, welches ich an die Wolken reflektieren wollte und im Dunkeln mit meinem eigenen verwechselte. Ich habe nämlich früher einmal den Dr. Lederer im Dampfbad der Kuriosität wegen photographisch aufgenommen. Also, wenn sich die Frau Cinibulk, die damals hochschwanger war, an diesem Bilde „versehen“ hat, ist es sehr begreiflich, daß das Kind dem Angeklagten ähnlich sieht.“
Der eine Gerichtsdiener kam jetzt herein und meldete, daß tatsächlich an den Sohlen des Herrn Stadtrates muttermalartige Flecken anfingen sichtbar zu werden, doch müsse man immerhin weiter versuchen, ob sie sich nicht auch noch wegwaschen ließen.
Der Gerichtshof beschloß jedoch, das Resultat nicht erst abzuwarten, sondern sprach den Angeklagten mangels Beweisen frei.
Das dicke Wasser
Im Ruderklub „Clia“ herrschte brausender Jubel, Rudi, genannt der Sulzfisch, der zweite „Bug“, hatte sich überreden lassen und sein Mitwirken zugesagt. Nun war der „Achter“ komplett, Gott sei Dank.
Und Pepi Staudacher, der berühmte Steuermann, hielt eine schwungvolle Rede über das Geheimnis des englischen Schlages und toastierte auf den blauen Donaustrand und den alten Stefansturm (duliö, duliö). Dann schritt er feierlich von einem Ruderer zum andern, jedem das Trainingsehrenwort vorerst das kleine abzunehmen.
Was da alles verboten wurde, es war zum Staunen! Staudacher, für den als Steuermann dies keinerlei Geltung hatte, wußte es auswendig: Erstens nicht rauchen, zweitens nicht trinken, drittens keinen Kaffee, viertens keinen Pfeffer, fünftens kein Salz, sechstens, siebentens, achtens, und vor allem keine Liebe, hören Sie, keine Liebe! weder praktische noch theoretische
Die anwesenden Klubjungfrauen sanken um einen halben Kopf zusammen, weil sie die Beine ausstrecken mußten, um ihren Freundinnen vis-à-vis bedeutungsvolle Fußtritte unter dem Tisch zu versetzen.
Der schöne Rudi schwellte die Heldenbrust und stieß drei schwere Seufzer aus, die anderen schrien wild nach Bier, der kommenden schrecklichen Tage gedenkend.