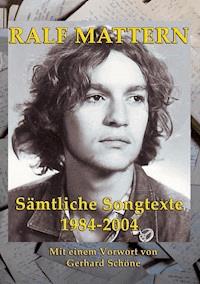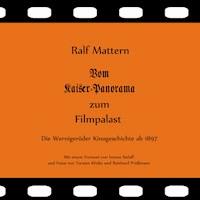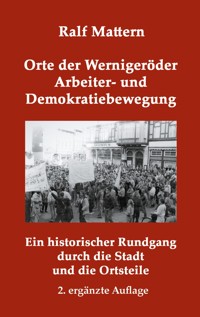
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Arbeiterbewegung Wernigerodes hat eine erstaunlich lange Geschichte - und kommuniziert dabei oft mit der Geschichte des Grafen-/Fürstenhauses zu Stolberg-Wernigerode. In Wernigerode wurde das erste Parteihaus der europäischen Sozialdemokratie, der "Volksgarten" gebaut. Das erste, gleichzeitig als Hotel betriebene Gewerkschaftshaus Deutschlands befindet sich - in Wernigerode. Hier wurde durch Vizekanzler Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode die "Sozialgesetzgebung", die später Bismarck übernahm, entworfen und getestet. Die Demokratiebewegung ging dabei stets mit der Arbeiterbewegung einher. Das Wahl- und das Mitbestimmungsrecht in den Betrieben, heute selbstverständliche Rechte und Freiheiten, wie die Versammlungsfreiheit, die Gleichberechtigung der Frau oder das Koalitionsrecht waren stets Themen der organisierten Arbeiterbewegung. Wernigerode war eine Hochburg des Aufstandes am 17. Juni 1953. Die Revolution im Herbst 1989 trieb hier tausende Menschen in die Kirchen und auf die Straßen. Dieser Rundgang führt zu den Orten, die im Mittelpunkt des politischen Geschehens seit 1848 standen - und zu Orten, in denen (Vor)Kämpfer und (Vor)Kämpferinnen der Arbeiter- und Demokratiebewegung von Wernigerode lebten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung:
Herzlich bedanken für die Unterstützung, Hilfe und Zuarbeit möchte ich mich bei: Olaf Ahrens (Kulturamt Stadt Wernigerode), Michael Boos (Ortschronist Silstedt), Prof. Dr. Konrad Breitenborn (Kulturstiftung Sachsen-Anhalt), Otto-Gerhard Büchting, Bettina Drube (Friedhof Wernigerode), Saskia Düsedau (Stadtarchiv Wernigerode), Heike Fischer, Otmar Groß, Wolfgang Grothe, Franziska Herker (Rezeption Hotel »Erbprinzenpalais«), Ingrid Hintze (Ortschronistin Schierke), Ludwig Hoffmann, Steffi Hoyer (Harzbücherei Wernigerode), Peter Lehmann, Herbert Leimhuth, Christa Lorenz (Ortschronistin Minsleben), Hans-Peter Mahrenholz (Stadtarchiv Wernigerode), Andrea Maleka (Kulturstiftung Sachsen-Anhalt), Matthias Meißner (Mahn- und Gedenkstätte Wernigerode), Angelika Münchhoff (Kulturstiftung Sachsen-Anhalt), Mandy Reinhard (Bauarchiv Wernigerode), Burkhard Rudo (Bauamt Wernigerode), Horst Schädel (Ortschronist Reddeber und Minsleben), Petra Schulz (Pflegeheim »Sonneck-Harzfriede«), Rainer Schulze, Herbert Siedler (Leiter Gerhart-Hauptmann-Gymnasium), Siegfried Siegel, Ottmar Wolff (Ortschronist Benzingerode)
und natürlich bei meiner Frau Melanie.
Vorwort
Dieser Stadtrundgang richtet sich besonders an politisch und historisch Interessierte. Er dauert, wenn man gemütlich geht, etwa elf Stunden und kann natürlich jederzeit unterbrochen oder abgekürzt werden. Naturgemäß müssen sich einige Informationen zu den im Rundgang benannten Orten doppeln, um die Hintergründe zu erklären. Zitiert wird in den für die jeweilige Zeit gültigen Rechtschreibungs- und Grammatikregeln.
Er beginnt verkehrsgünstig am Hauptbahnhof, den man auch mit dem eigenen PKW gut erreichen kann. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Er endet an der Haltestelle Wernigerode-Elmowerk. In einer kleinen Stadt wie Wernigerode ist von dort der Hauptbahnhof zu Fuß unkompliziert wieder zu erreichen. Aber es kann eben auch die Bahn genutzt werden.
Das bis Ende 1944 betriebene Außenlager des KZ Buchenwald und die dann als bewachtes Lager für Zwangsarbeiter genutzten Baracken sind als Ort der Nazi-Barbarei ebenso wenig Teil des Rundgangs, wie das dem KZ Mittelbau-Dora unterstellte Außenlager Steinerne Renne. Orte der Repression des DDR-Regimes, wie Dienststellen und Gefängnisse von Polizei, Justiz und Ministerium für Staatssicherheit wurden hier ebenso wenig einbezogen.
Die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie kann zumindest bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg als Synonym begriffen werden: Die Partei verstand sich – oft genug in Personalunion – als der politische Arm der Gewerkschaft. Deshalb war der Wahlerfolg eines SPD-Mitglieds immer auch ein Wahlerfolg der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung.
Ähnliches gilt für die Demokratiebewegung, die mit der Arbeiterbewegung einherging. Das Wahl- und das Mitbestimmungsrecht in den Betrieben, heute selbstverständliche Rechte und Freiheiten, wie die Versammlungsfreiheit, die Gleichberechtigung der Frau oder das Koalitionsrecht waren stets Themen der organisierten Arbeiterbewegung. »Mehr Demokratie wagen« wollte ein Bundeskanzler der SPD und in der DDR landeten viele von denjenigen, die speziell in den 1980er Jahren Bürger- und Menschenrechte in der DDR anmahnten und dafür vom Geheimdienst verfolgt wurden, noch im Revolutionsherbst 1989 in der neugegründeten Sozialdemokratischen Partei der DDR (SDP) oder bei den bürgerbewegten Gruppen, die sich später mit den Grünen vereinigten. Deshalb befinden sich auch Orte, in denen (Vor)Kämpfer und (Vor)Kämpferinnen der Arbeiter- und Demokratiebewegung von Wernigerode lebten, in diesem Rundgang. Keine Erwähnung finden allerdings Wohnorte von noch lebenden Persönlichkeiten der Arbeiter- und Demokratiebewegung. Hingewiesen sei darauf, dass insbesondere die Protagonisten der Wernigeröder DDR-Menschen- und Bürgerrechtsbewegung sich selbst nicht als »Oppositionelle« sahen – auch wenn sie im Text als solche benannt werden, weil sie es letztlich in ihrer Wirkung dennoch waren.
Möglicherweise fällt auf, dass es kaum Orte im Rundgang gibt, die auf eine kommunistische Vergangenheit verweisen. Zum einen liegt dies daran, dass die hier erst 1921 gegründete KPD in der Wernigeröder Arbeiterbewegung relativ unbedeutend war – wie übrigens auch christliche und liberale Gewerkschaften und deren politische Vertretungen, wie das Zentrum oder die Deutsche Demokratische Partei (DDP) und ihre Vorläufer während der Kaiserzeit. Zum anderen darf nicht vergessen werden, dass es die Kommunisten waren, die freie Gewerkschaften – und damit die wichtigsten Interessenvertretungen der lohnabhängig Beschäftigten – ab 1945 verhinderten und die seit Mitte des 19. Jahrhunderts von der Arbeiterbewegung erkämpften Errungenschaften (wie das Streikrecht) in der DDR abschafften. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die kommunistische Bewegung und die Arbeiterbewegung überhaupt gleiche Ziele verfolgten.1 Dies lässt sich auch an der Mitgliederstruktur von KPD und SPD in den 1920er Jahren nachvollziehen: Während die SPD politische Heimat vor allem der Facharbeiter, der Angestellten und Beamten des einfachen und mittleren Dienstes und der Handwerker war, war die KPD dort stark, wo es viele nur einfach gebildete in oft prekären Verhältnissen lebende Menschen gab, die als Ungelernte oder »einfache« Arbeiter ihren Lebensunterhalt verdienten oder arbeitslos waren.2 Die SPD und die freien Gewerkschaften wurden zudem stets als Hauptfeind von der KPD betrachtet.
Dass Orte mit kommunistischer Vergangenheit nicht unter dem Begriff »Demokratiebewegung« subsumiert werden können, ist Geschichtsinteressierten ohnehin bekannt.
Letztlich: In der von einer kommunistischen Partei und ihren Satellitenparteien, wie z. B. CDU und LDPD, regierten DDR galt das Eintreten für Menschen- und Bürgerrechte als staatsgefährdend. Demokraten wurden mit den Mitteln des Strafgesetzes verfolgt. Ihre Geschichte(n) – und nicht die ihrer Verfolger – gilt es zu bewahren.
Inhalt
Hauptbahnhof Wernigerode
Otto Büchting: An der Holtemme 45
Pauline Wilke: Schmatzfelder Straße 15
Volksgarten
Karl Kaiser: Schmatzfelder Straße 38
Landratsamt
Friedrich Kuring: Minslebener Straße 50
Karl Husung: Halberstädter Straße 20
Erste SDP-Geschäftsstelle
Liebfrauenkirche
Richard Bartels: Burgstraße 30
Albert Bartels: Burgstraße 9
Druckerei »Wernigeröder Tageblatt«
Johanniskirche
Kreiskulturhaus
Knaben-Mittelschule
Logenhaus
Marktplatz
Rathaus
Remise
Erste Geschäftsstelle B90/Die Grünen
Nöschenröder Hof
Max Otto: Wildmeisterweg 4
Harzfriede
Papenanneken
Katechetisches Seminar
Nöschenröder Schützenhaus
Kreuzkirche
Karl Freidank: Promenade 10c
Stadt Stolberg / Bauders Klause
Wernigeröder Kurhaus
Kontaktlinse
Sylvestrikirche
Wernigeröder Schützenhaus
Karl-Marx-Denkmal
Gewerkschaftshaus »Monopol«
Paul Eichfeld: Salzbergstraße 11
Heinrich Bopp: Wüstenteichen 14
Otto Herfurth: Triangel 2a
Städtischer Friedhof
Hermann Paul Reichardt: Pfälzergasse 10b
Zum Deutschen Kaiser
Zur Neuen Quelle
Fürst Bismarck
Hermann Mallin: Unterm Ratskopf 45
SA-Führerschule
Walter Jung: Plemnitzstraße 3
Willy Steigerwald: Georgiistraße 31
Karl-Marx-Haus
Benzingerode
Minsleben
Reddeber
Schierke
Silstedt
Bildernachweis
Quellennachweis
Der Rundgang beginnt am Hauptbahnhof Wernigerode.
Hauptbahnhof Wernigerode
Bahnhöfe gelten als Beginn- und/oder Endpunkt einer Reise. Und sie waren für die Infrastruktur neuralgische Punkte. Das bestätigt sich auch für Wernigerode. Errichtet wurde das Bahnhofsgebäude 1872. Im Jahr 1902 schloss sich eine Erweiterung an.3
Nach der auch in den Harz geschwappten Novemberrevolution soll Anfang 1919 ein Panzerzug auf dem Bahnhof Wernigerode stationiert worden sein, um eventuelle revolutionäre Bewegungen zu ersticken. Deshalb sei das Wernigeröder Gewerkschaftskartell zusammengetreten, um eine 12-Mann-Delegation zu bilden, die Verhandlungen mit dem Magistrat führen sollte, damit der Panzerzug Wernigerode wieder verlasse. Der Bürgermeister erklärte sich demnach als Leiter einer Verhandlungskommission bereit, mit der Besatzung des Panzerzuges zu verhandeln.4
Der Staatsbahnhof Anfang des 20. Jahrhunderts
Im Juli 1922 fand in Wernigerode die dritte Reichskonferenz des Verbandes der Arbeiterjugendvereine statt. Das »Wernigeröder Tageblatt« hieß bereits in seiner Ausgabe am 30.06.1922 die Jugendlichen auf der Titelseite »Willkommen in Wernigerode« und schrieb, dass auch »am Bahnhof die Reichsfarben und ein mächtiges Transparent die Delegierten der Arbeiterjugend, die aus ganz Deutschland heute herbeigeeilt ist«, begrüßen.
Weniger willkommen waren bestimmte Besucher der Stadt ein Jahr später: Im September 1923 wollten in ganz Deutschland faschistische Organisationen einen »Deutschen Tag« begehen – so auch in Wernigerode. Hier hatte die verbotene Mitteldeutsche Arbeiterpartei aufgerufen. Am vereinten Widerstand der Arbeiter von Wernigerode scheiterte diese Kundgebung. So riegelten hiesige Arbeiter alle Wege nach Wernigerode ab. Mitglieder der SPD, der KPD und der Gewerkschaften umstellten auch den Bahnhof und vereinigten sich dort mit den aus Ilsenburg gekommenen Arbeitern um in Zusammenarbeit mit der Polizei ankommende Nazis am Aussteigen zu hindern. Bereits anwesende auswärtige Teilnehmer der Veranstaltung wurden von der Polizei zum Bahnhof geleitet. In der Presse hieß es: »Damit waren die letzten der nach hier beorderten Hakenkreuzler aus Wernigerode wieder abgeschoben und die Stadt zeigte ihr gewohntes friedliches Bild.«
Das Elend des Zweiten Weltkrieges ging auch an Wernigerode nicht vorbei: 1945 zogen mehrere Todesmärsche mit entkräfteten Häftlingen aus evakuierten Konzentrationslagern auch durch Wernigerode. Am 09.04.1945 verließen die Stadt rund 1.130 Häftlinge der III. Baubrigade des KZ Mittelbau-Dora mit dem Zug, der sie in geschlossenen Güterwagen in Richtung Braunschweig bringen sollte, jedoch in der Nähe von Gardelegen landete.
Den Bahnhof durch den Fußgängertunnel auf Gleis 1 auf die Feldstraße verlassend, dort kurz nach rechts und dann gleich links in die Straße Am Lüttgegraben bis zu dessen Ende gehen. Hier beginnt die Straße An der Holtemme. Dort nach rechts wenden.
An der Holtemme 45
Hier lebte zuletzt Otto Büchting, der am 20. Mai 1868 geboren wurde und am 16. Juni 1951 starb (Bild aus den 1940er Jahren). Er machte sich als liberaler Politiker um die demokratische Entwicklung in Wernigerode in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdient. Otto Büchting wurde als fünfter Sohn des Lohngerbereibesitzers Karl Büchting geboren. Er besuchte die Mittelschule, lernte zunächst den Beruf des Kaufmanns und dann den des Lohgerbers. Schon 1887 übernahm er den väterlichen Betrieb. Otto Büchting wurde erstmals 1903 in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Von 1908 bis 1933 war er zugleich Vorsitzender dieses Gremiums – laut den Angaben in seinem Lebenslauf5. Gemäß den glaubhaften Angaben in den Wernigeröder Adressbüchern erhielt er jedoch erst 1911 das Amt des Stadtverordnetenvorstehers.
Während der Zeit der Weimarer Republik war Büchting auch in den Provinziallandtag der preußischen Provinz Sachsen gewählt worden.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Büchting zu jenen Politikern, die das Vertrauen der Besatzungsmächte erhielten und die schwere Aufgabe übernahmen, nach dem vollständigen Zusammenbruch in Wernigerode eine neue Verwaltungsinfrastruktur aufzubauen. Otto Büchting leitete den städtischen Schlachthof und später auch das Verkehrsamt. Büchting, in der Kaiserzeit Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei, die in der Weimarer Republik zur Deutschen Demokratischen Partei (DDP) wurde und dann als Deutsche Staatspartei firmierte, wurde mit der Gründung des Ortsverbandes der Liberaldemokratischen Partei (LDP) am 23.07.1945 deren Vorsitzender auf (zunächst) Stadt- und (dann) Kreisebene.
Stark schnitt die LDP, später LDPD, bei den noch relativ freien Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung am 08.09.1946 ab: Die LDP bekam immerhin 13 Mandate und hätte (rechnerisch) mit der CDU, die acht Mandate bekam, einen SED-Bürgermeister verhindern können. Die SED erhielt nämlich nur 19 Sitze. Die CDU passte sich jedoch den Vorstellungen der SED an. Ein undatierter Zeitungsbericht6 beschrieb die Wahl des Ersten Bürgermeisters in der ersten Stadtverordnetensitzung, die von Büchting als Alterspräsident am 08.10.1946 eröffnet wurde: »Die LDP versuchte in Opposition zu machen, als von der SED der Vorschlag kam, als ersten Bürgermeister den bewährten Genossen Max Otto wiederzuwählen. Hierauf brachte diese Fraktion es fertig, zu dem einzigen eingegangenen Vorschlag für den Posten des ersten Bürgermeisters weiße Zettel abzugeben. Genosse Otto wurde mit 18 Stimmen der SED und 8 Stimmen der CDU unter lebhaftem Beifall auch aus den Reihen der Zuhörer zum ersten Bürgermeister gewählt. Als hierauf bei der Wahl des zweiten Bürgermeisters die LDP Anspruch auf diesen Posten erhob, bekam sie die Quittung. Die SED-Fraktion stimmte geschlossen für den Kandidaten der CDU, den Dreher Josef Mause, der damit mit 26 Stimmen gegen 13 der LDP zum zweiten Bürgermeister von Wernigerode gewählt wurde.« Otto Büchting wurde zum unbesoldeten, also ehrenamtlichen Stadtrat ernannt, blieb aber auch Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.
Einem Schreiben des Wernigeröder Landrates vom 24.12.1946 an den Minister des Innern des Landes Sachsen-Anhalt ist zu entnehmen, dass in der Stadtverordnetensitzung am 19.11.1946 der Beschluss gefasst wurde, Büchting »das Prädikat Stadtältester« zu verleihen. Dieser Beschluss wurde anlässlich Büchtings 80. Geburtstag 1948 umgesetzt.
Der Straße An der Holtemme weiter folgen, bis am Kreisverkehr die Schmatzfelder Straße erreicht wird. Hier nach rechts gehen.
Mitschurinstraße 15 – heute: Schmatzfelder Straße 15
Hier lebte zuletzt Pauline Wilke, die am 16. Juli 1874 geboren wurde und am 11. Juli 1960 starb (Bild aus dem Jahr 1946). Wilke war die erste Frau aus der Arbeiterbewegung in der Wernigeröder Stadtverordnetenversammlung. Die Sozialdemokratin war eine von 30 Mitgliedern des Gremiums, das am 23.02.1919 gewählt wurde. Für diese Wahl wurde abgesprochen, eine Einheitsliste mit jeweils 15 sozialdemokratischen und »bürgerlichen« Kandidaten zu bilden. Auch bei der Kommunalwahl 1924 wurde Pauline (»Paula«) Wilke als Stadtverordnete gewählt und blieb dies bis Ende 1926.
Sie war zudem die erste Frau im Wernigeröder Kreistag. Die Wernigeröder Stadtverordneten bestimmten für den Kreistag Ende April 1919 die Vertreter der Stadt (die jedoch nicht der Stadtverordnetenversammlung angehören mussten) analog der Sitzverteilung. Als ihr Beruf wurde zu diesem Zeitpunkt »Ehefrau« angegeben. Offenbar nahm sie jedoch eine Tätigkeit in der Wohlfahrtspflege an: Im Jahr 1922 wurde ihr vom Zweiten Bürgermeister von Wernigerode, →Hermann Paul Reichardt, in einer öffentlichen Versammlung »für ihr vorbildliches, selbstloses und unermüdliches Wirken in diesem schweren Dienst ein wohlverdientes und ehrenvolles Zeugnis« ausgestellt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Pauline Wilke erneut Verantwortung als 2. Vorsitzende der Frauenortsgruppe der SPD.7 Auch bei der Planung der ersten Kreisleitung der aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD 1946 entstandenen SED fiel ihr Name als mögliche Beisitzerin.8 Auf einer undatierten späteren Aufstellung9 des SED-Kreisvorstandes findet sich ihr Name jedoch nicht.
Der Schmatzfelder Straße weiter folgen.
Volksgarten, Schmatzfelder Straße 9a
Auf dem Grundstück der ehemaligen Schmelzerschen Sägemühle wurde 1893 der »Volksgarten« gebaut. Er war Eigentum der SPD – obwohl es einen SPD-Ortsverein erst ab 1900 gab. Er war nicht in gewerkschaftlichem Besitz. Dies verkündete die DDR-Geschichtsschreibung, um die Bedeutung der (Wernigeröder) Sozialdemokratie abzuschwächen und zu relativieren.
Den 1. Mai 1893 feierte man bereits im Rohbau und verband dies mit der Grundsteinlegung am Abend. In den Grundstein wurde ein Exemplar des »Vorwärts«, ein Exemplar der Maifeierzeitung, die Mai-Nummer des »Wahren Jacob«, ein Exemplar der Schrift »Die Zukunftsdebatten im Deutschen Reichstag«, und eine kurze von →Albert Bartels verfasste Abhandlung über die Entwicklung der Organisation der Arbeiter vor Ort gesteckt.
Das »Wernigeröder Tageblatt« schrieb im Juni 1893 zu einer Wahlkampfveranstaltung, die noch im Rohbau stattfand: »Herr Maler Bartels eröffnete die Versammlung und hieß die Erschienenen im neuen Lokal willkommen; er führte aus, daß den Sozialdemokraten seitens der hiesigen Lokalinhaber ein Saal zur Abhaltung von Versammlungen seit längerer Zeit verweigert worden sei; hierdurch sei man veranlaßt worden, ein Grundstück zu erwerben und auf diesem das eigene Versammlungslokal zu erbauen (…).«
Der »Volksgarten« wohl Anfang des 20. Jahrhunderts
Am 20.08.1893 wurde der »Volksgarten« eingeweiht. Er war zugleich das erste der sogenannten »Volkshäuser« oder »Volksparks« der europäischen Sozialdemokratie. Der Saal fasste 300, der Garten mehr als 1.000 Personen. Die Verwaltung des Wirtschaftsbetriebs lag in der Hand eines gebildeten Vereins, des »Verein Arbeitercasino Wernigerode a. H.«. Bei seiner Gründung zählte der Verein 117 Mitglieder. Im »Volksgarten« hatten auch die sozialdemokratischen Umfeldorganisationen, wie der 1894 gegründete Arbeiterturnverein »Vorwärts«, und die gewerkschaftlichen Vertretungen ihren Sitz.
In Gewerbeakten findet man verzeichnet, dass 1906 genehmigt wurde, im »Volksgarten« eine Schankwirtschaft mit Ausschluss des Verkaufs von Brandwein bei Veranstaltungen zu betreiben. 1908 erfolgte ein Um- und Erweiterungsbau.10
Letzte Höhepunkte des politischen Lebens im »Volkgarten« waren die Koordinierung des Generalstreiks gegen den Kapp-Putsch im März 1920 und die erste Versammlung nach der Wiedervereinigung der in Wernigerode 1919 gegründeten USPD mit der SPD im Januar 1921 – also über ein Jahr, bevor sich beide Parteien auf dem Nürnberger Parteitag im September 1922 offiziell wieder zusammenschlossen. Diese Zusammenkunft am 18.01.1921 war zugleich die letzte Versammlung im bereits verkauften »Volksgarten«.
Der neue Eigentümer des Grundstücks nahm 1923 die Fabrikation und den Vertrieb von Drahtstiften und Nägeln auf. 1931 verkaufte er die Firma, die nun als Maschinenfabrik »Phönix« weitergeführt wurde. Der neue Besitzer ließ eine Zufahrt von der Schmatzfelder Straße errichten. Damit änderte sich die Postanschrift von Feldstraße 55 nun in Schmatzfelder Straße 9a. Anfang 1935 wurde die Fabrik erneut verkauft. 1950 wurde die Schmatzfelder Straße in Mitschurinstraße umbenannt. In dieser Zeit wurden auf dem Grundstück Nr. 9a die VE Kommunale Dienstleistungsbetriebe Wernigerode/Harz, die spätere Stadtwirtschaft, untergebracht.11 Heute wird der »Volksgarten« von seinem Eigentümer als Lagerhalle genutzt.
Die Schmatzfelder Straße unter der Eisenbahnbrücke hindurch auf der rechten Seite bis zur Kreuzung mit der Schreiberstraße gehen.
Schmatzfelder Straße 38
Hier lebte zuletzt Karl Kaiser, der am 29. November 1877 geboren wurde und am 1. März 1941 starb. Kaiser war der erste Kreisdeputierte der SPD, berufen nach der Kreistagswahl am 29.04.1919. Er blieb dies bis zur Kommunalwahl 1929. Bei Kreisdeputierten handelte es sich um ehrenamtliche Stellvertreter des Landrates.
Leider existieren zu Kaiser nur wenig Informationen: Der »Maurer Karl Kaiser«, wohnhaft Hinterstraße 9, war im Jahr 1903 der Vorsitzende des Wernigeröder Gewerkschaftskartells, nachdem er im Gründungsjahr des Kartells, 1901, zunächst als Kassierer fungierte.
Im Wernigeröder Adressbuch von 1914 gibt es einen »Buffettier Karl Kaiser«, welcher in der Schmatzfelder Straße 14a wohnte. 1919 wurde »Karl Kaiser, Maurerpolier«, wohnhaft Schmatzfelder Straße 12, ehrenamtlicher Stadtrat in Wernigerode. Bei der Kreistagswahl 1921 wurde »Karl Kaiser, Stadtrat«, (wieder) in den Kreistag gewählt. Im Adressbuch von 1922 wird zugleich benannt, dass er Kreisdeputierter ist. Sein Beruf wird mit Maurerpolier bzw. Gastwirt angegeben. Nach der Kreistagswahl 1925 wird »Karl Kaiser, Bauunternehmer«, wohnhaft Schmatzfelder Straße 12, erneut Kreisdeputierter, war jedoch nicht in den Kreistag gewählt worden.
In die Schreiberstraße rechts (an der Gaststätte vorbei) hinein bis zur nächsten Kreuzung gehen. Dort nach links wenden.
Landratsamt, Rudolf-Breitscheid-Straße 10
Am 01.10.1876 wurde durch die neue preußische Kreisordnung die gräfliche Regierung in Wernigerode aufgehoben. Die Obliegenheiten des gräflichen Oberbeamten gingen auf den Landrat über. Aber erst 1891 erfolgte der Bau einer eigenen Kreisverwaltung und Sitz des Kreistages.12
Das Landratsamt im Jahr 1910 bei einer Feuerwehrübung
Ende 1915 wurde mit →Albert Bartels der erste Sozialdemokrat von der Wernigeröder Stadtverordnetenversammlung als Kreistagsabgeordneter bestimmt. Am 01.01.1916 trat er das Amt an. Die Kreistagsabgeordneten der Städte wurden zu jener Zeit nicht von der Bevölkerung, sondern von der Stadtverordnetenversammlung gewählt.
Am 09.11.1918 zog während der Novemberrevolution eine Demonstration zum Landratsamt zu Landrat Erich von Stosch (1877-1946), der seit 1912 im Amt war und es bis 1945 bleiben sollte. Vertreter der Demonstranten verhandelten mit dem Landrat über die prekäre Versorgungslage und brachten den Wunsch nach Frieden zum Ausdruck. Auf dem Landratsamt (und auf dem →Rathaus) wehten »vom 11. d. Mts. ab, die rote Fahne 8 Tage lang«, wie es in einem Protokoll vom 10.11.1918 festgelegt wurde.
1919 fanden erstmals Kommunalwahlen, die nicht im Drei-Klassen-Wahlrecht durchgeführt wurden, statt. Im Kreistag waren anschließend zwölf Vertreter der SPD und 14 »Bürgerliche«. Die Kreistagsmitglieder aus den Städten wurden allerdings nach wie vor von den Stadtverordneten bestimmt. Mit dem Wernigeröder →Karl Kaiser wurde erstmals ein Sozialdemokrat Kreisdeputierter (ein ehrenamtlicher Stellvertreter des Landrates) und mit der Wernigeröderin →Pauline Wilke wurde erstmals eine Frau – und Sozialdemokratin – Mitglied des Kreistages. Erst 1921 konnten auch die städtischen Bevölkerungen ihre Vertreter direkt wählen. Die nun 21 Sitze des ersten demokratisch gewählten Kreistages verteilten sich wie folgt: Die SPD errang neun Sitze, ebenso neun Sitze erhielt der konservative Bürgerblock. Zwei Sitze bekam die DDP, ein Sitz ging an die KPD.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde im April 1945 von der amerikanischen Besatzungsmacht als Landrat →Paul Eichfeld (SPD) eingesetzt, der bis zum 31.08.1945 in diesem Amt blieb, dann amtierte kurz der Bürgermeister von Wernigerode →Max Otto (SPD), ehe →Hermann Paul Reichardt (SPD) im September 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzt und 1947 dann durch seinen Stellvertreter Wilhelm Falkenbach (1904-k.A., vormals KPD) abgelöst wurde. Strukturiert wurde die Kreisebene erst unter sowjetischer Besatzung. Von neun Amtsleitern (inklusive des stellvertretenden Landrats) waren zunächst sechs, dann sieben ehemalige Kommunisten. Obwohl die KPD-Mitglieder im Kreis in der Minderheit waren (es gab im Mai 1946 6.622 ehemalige SPD-Mitglieder und 2.675 ehemalige KPD-Mitglieder; für die Stadt Wernigerode war das Verhältnis noch klarer: 2.528 frühere SPD-Mitglieder und 555 frühere KPD-Mitglieder)13, übernahmen die Kommunisten mit Hilfe der sowjetischen Besatzungsmacht die Schlüsselpositionen in der Verwaltung. Erst ab 1990 konnte die Verwaltung und mit der Wahl vom 06.05.1990 auch der Kreistag wieder demokratisiert werden.
Vor dem Landratsamt nach rechts die Rudolf-Breitscheidt-Straße entlang bis zum Kreisverkehr, dort in die Minslebener Straße nach links biegen und dem Straßenverlauf folgen.
Minslebener Straße 50
Hier lebte zuletzt Friedrich Kuring, der am 08. Juli 1881 geboren wurde und am 12. Juni 1953 starb (Bild aus dem Jahr 1946). Kuring gehörte in der Nazi-Zeit zu einer deutschlandweit agierenden Widerstandsgruppe um frühere Metallgewerkschafter.
Vom Oberlandesgericht Dresden wurde er am 23.02.1937 zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus und einem zweijährigen Ehrverlust verurteilt.
Kuring wurde 1929 bei den letzten freien Kommunalwahlen einer von elf Stadtverordneten der SPD, die zur stärksten Partei gewählt wurde. Friedrich Kuring arbeitete bis 1933 als hiesiger Geschäftsführer des Deutschen Metallarbeiterverbandes (DMV). Nachdem 1933 von den Nazis die Gewerkschaften verboten worden waren, verlor auch Kuring seine Stellung. Er gehörte zu jenen 81 Sozialdemokraten aus Wernigerode und dem Kreisgebiet, die am 24.06.1933 quer durch die Stadt in einem sogenannten »Schandmarsch« zur →»SA-Führerschule« getrieben und dort schwer misshandelt wurden.