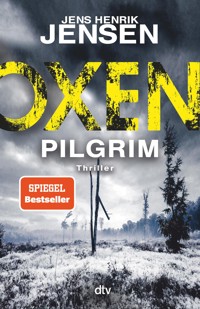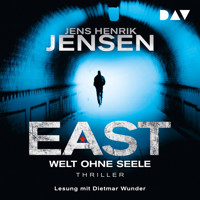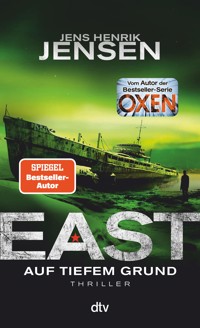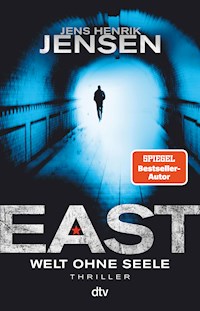9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Niels-Oxen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der große Erfolg geht weiter! Der zweite Band der skandinavischen Thriller-Serie OXEN. Niels Oxen, der traumatisierte Elitesoldat, ist untergetaucht. Um dem mächtigen Geheimbund ›Danehof‹ das Handwerk zu legen, hat er Museumsdirektor Malte Bulbjerg brisante Unterlagen zugespielt. Doch kurze Zeit später ist Bulbjerg tot – und ein weiterer Mord wird Oxen in die Schuhe geschoben. Ihm bleibt keine andere Wahl, als aus dem Untergrund heraus zu agieren. Als es der Geheimdienstmitarbeiterin Margrethe Franck gelingt, Oxen aufzuspüren, werden beide vom ›Danehof‹ in eine raffinierte Falle gelockt. Unglaublich spannend, dramatisch und actionreich. »Jens Henrik Jensen ist der neuen skandinavische Krimi-Star. Nun legt er Band 2 seine OXEN-Serie vor. Eine raffinierte Agenten-Story mit umwerfendem Showdown.« ›Buch-Szene‹ »›Der dunkle Mann‹ ist gnadenlos fesselnd und ein wahres Meisterwerk der Thrillerkunst.« Ulrich Hoffmann auf ›NDR 90,3‹ Alle Bände der Niels-Oxen-Reihe: Band 1: OXEN. Das erste Opfer Band 2: OXEN. Der dunkle Mann Band 3: OXEN. Gefrorene Flammen Band 4: OXEN. Lupus Band 5: OXEN. Noctis Band 6: OXEN. Pilgrim Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem die skandinavischen Thriller-Serien SØG und EAST erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jens Henrik Jensen
Oxen
Der dunkle Mann
Thriller
Aus dem Dänischen von Friederike Buchinger
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
1.
Die Ratte saß am Rand des Mondes, fett und selbstgefällig. Ihre Silhouette zeichnete sich messerscharf gegen die bleiche Himmelsscheibe ab.
Riesengroße Douglasien, zahllose Fichten, in Reih und Glied aufgestellt und im Osten ergänzt von einigen winterkahlen Lärchen, bildeten eine schwarze, gezackte Kulisse und rahmten die Welt der Ratte ein.
Wie ein Großmogul saß sie reglos da oben und genoss ihr Reich unter den Sternen. Sie ließ sich nicht einmal zu einem flüchtigen Blick auf das armselige Geschöpf herab, das dort unter ihr lag.
Seine Augen öffneten sich nur widerwillig. Er schwebte. In Zeit und Raum. Die Fähigkeit, in Sekundenschnelle hellwach zu sein, diese kostbare Rettungsleine, geflochten in den vielen Jahren in gefährlichen Regionen, hatte nachgelassen.
Er lag einfach ganz still da. Seine Sinne absorbierten die Dunkelheit. Er hob den Blick – und sah sie, die Ratte.
Erst als er sich bewegte und das Stroh raschelte, gab das Biest seine erhabene Pose auf, trippelte demonstrativ langsam über den Hahnenbalken davon und verschwand.
Die Landschaft war in silbernes Licht getaucht. Bassins und Brunnen, so weit das Auge reichte. Er war zurück am Peterhof des Zaren. Seltsam eigentlich …
Die Augenlider wurden ihm wieder schwer und fielen zu.
Irgendwo tief in seinem Unterbewusstsein zog eine vage Duftspur vorbei. Blühender Jasmin und morgendlicher Sex …
Schloss Peterhof, das russische Versailles bei Sankt Petersburg. Im August. Er konnte ihr glucksendes Lachen hören. Die Ringe glänzten und fühlten sich noch so ungewohnt an ihren Fingern an. Birgitte in einem dünnen Baumwollkleid im Gegenlicht am Finnischen Meerbusen. »Bis dass der Tod euch scheidet.«
Er riss die Augen auf und drückte sich auf die Ellenbogen hoch.
Doch, da draußen durchschnitt ein Kanal die flache Landschaft, da waren auch einige Becken, und ein paar Fontänen versprühten ihr glitzerndes Silber – aber …
Er ließ sich schwer ins Stroh zurücksinken. Ein schwacher Gestank nach Misthaufen kroch ihm in die Nase. Sollten die Fontänen nicht eigentlich golden sein? Ein Zar gab sich nicht mit Silber zufrieden.
Mit einem Ruck setzte er sich auf und kehrte in die Wirklichkeit zurück. An der einen Wand fehlten gleich mehrere Bretter, und eisiger Wind fuhr durch den Schuppen. Er schlug die Kapuze des Schlafsacks hoch und zog sie enger zu. Es war arschkalt. Um die null Grad. Wenigstens dämpfte die Kälte den Gestank.
Vor den Büschen rechts vom Kanal konnte er eine Handvoll Schafe ausmachen. Die hatten ihm also das Nest verdreckt. Aber abgesehen davon war der Strohhaufen trocken und gemütlich. Er hatte schon in schlechteren Betten geschlafen. Viel schlechteren. Und gefährlicheren.
Ein paar Hundert Meter zu seiner Linken stand ein kleines weiß gekalktes Haus. Hinter den Fenstern brannte Licht, aber sonst gab es kein Anzeichen von Leben.
Sankt Petersburg war ferne Vergangenheit.
Er ließ den Blick wieder über die Landschaft gleiten, die jetzt im Licht der Erkenntnis nackt vor ihm lag. Die Fischzucht in der kleinen Senke und sein Lager unter dem Blechdach waren die Gegenwart. Es war nicht mehr als eine Feststellung, ohne Schmerz, ohne irgendetwas anderes. Er befand sich in Mitteljütland, irgendwo zwischen Brande und Sønder Felding. Der Kanal führte nicht in den Finnischen Meerbusen, sondern in den Skjern Å, und die Fontänen versprühten kein Silber, sondern gefiltertes Wasser für die Forellen.
Gestern hatte er in einem Schuppen bei Nørre Snede übernachtet, und nur die Götter wussten, wo er morgen schlafen würde.
Erst jetzt fiel es ihm wieder ein: Dieser Abend war kein gewöhnlicher Abend. Es war ein Status-Abend. Der beste Zeitpunkt für den mentalen Kassensturz. Die Königin tat es, der Staatsminister tat es – und ihn selbst hatte der Gedanke gestreift wie ein Projektil.
Es war Silvester.
Er drückte auf den Knopf seiner Armbanduhr. 23:57. Es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn er den Jahreswechsel verschlafen hätte, aber jetzt war er nun einmal wach. In drei Minuten fing die Rathausuhr in Kopenhagen an zu läuten. Er sah sich wieder um. Hier war es so still, dass man sogar hören könnte, wenn eins der Schafe ein Wollbüschel verlor.
In Birgittes Familie war es Tradition gewesen, sich an den Händen zu fassen und von einem Stuhl oder Schemel gemeinsam ins neue Jahr zu springen. Für so etwas hatte man in seiner Familie weder genug Fantasie noch Wagemut gehabt. Sie waren immer gesprungen, er und Birgitte. Und sie hatten es sogar geschafft, ein paar Jahre lang mit Magnus in der Mitte zu springen.
Ein großes Tier glitt direkt vor seinem Schuppen durch die Luft. Eine Eule flog ins neue Jahr. Gleich würde sie sich auf einen Ast setzen und ihren Mageninhalt hochwürgen – und sich damit kein bisschen von so vielen anderen in dieser Nacht unterscheiden.
In wenigen Minuten sang der Mädchenchor von Danmarks Radio im Fernsehen. Sekt, Gläserklirren und Neujahrskuchen. Besoffene Männer, Feuerwerk und in den frühen Morgenstunden dann eine kurze Lunte. Er war dabei gewesen. Viel zu oft.
00:00. Von den umliegenden Höfen wurde ein Schwarm Silvesterraketen in den Nachthimmel abgefeuert. Sie explodierten hoch oben, bildeten Wolken aus Gold und Silber, während einzelne laute Böller durch die Dunkelheit knallten. Er hasste Feuerwerk.
Mit leichter Verwunderung nahm er zur Kenntnis, dass niemand aus dem kleinen weißen Haus trat. Niemand, der Raketen in die Luft schießen wollte. Wahrscheinlich stieß man beim Besitzer der Forellenteiche lieber im Warmen an. Vielleicht sprangen sie da drinnen auch Händchen haltend ins neue Jahr?
Er ließ sich zurück ins Stroh sinken und schloss die Augen.
Der Mond war teilweise von Wolken verdeckt und die Dunkelheit deshalb viel kompakter als noch um Mitternacht. Das war seine allererste Wahrnehmung, als er zu sich kam und die Augen öffnete. Dieses Mal fühlte er sich sofort wach. Er hatte nicht tief geschlafen, unruhig, von altem Grauen gequält.
Instinktiv drückte er den Knopf an seiner Armbanduhr. 02:43. Nicht mal drei Stunden.
Er registrierte gerade noch, wie ein Motor verstummte und Scheinwerfer am Rand einer kleinen Fichtenschonung erloschen. Vermutlich hatte ihn das Auto geweckt. Wer war da so spät noch gekommen? Der Fischzüchter war längst ins Bett gegangen. Alle Fenster im Haus waren dunkel.
Er lag ganz still da und lauschte. Die Ratte war auf den Hahnenbalken zurückgekommen, diesmal nicht mehr als ein undeutlicher Schatten. Zwei Autotüren klappten leise zu. Er hörte vorsichtige Schritte auf dem Kies hinter dem Schuppen.
Die Ratte huschte ängstlich davon. Er setzte sich auf und spähte in die Dunkelheit. Sein Herz schlug schneller.
Links von ihm tauchten zwei schwarze Schatten auf. Langsam näherten sie sich dem Haus. Nur an einer Stelle gab es Licht, von einer Leuchtstoffröhre, die auf halber Höhe an einem Telefonmast hing.
Die Wolke vor dem Mond verzog sich, und er konnte sehen, dass es zwei Männer waren. Der eine groß, der andere gedrungen. Sie bewegten sich vorsichtig vorwärts, so wie man es macht, wenn man sich nicht auskennt.
Behutsam schlichen sie die letzten Meter bis zum Haus. Prüfend griff der eine nach der Türklinke, während der andere einen Blick durch das Fenster neben dem Eingang warf. Kurz darauf hörte er ein leises Klirren, offenbar hatten sie die Scheibe eingeschlagen. Der Große half seinem Kumpel durch das offene Fenster ins Haus. Dann ging die Tür auf und auch der Große verschwand nach drinnen.
Oxen fluchte. Für den Bruchteil einer Sekunde ärgerte er sich, dass er nicht doch im Silvestertrubel auf dem Rådhusplads in Kopenhagen steckte.
Das hier war wirklich eine unangenehme Situation. Um nicht zu sagen, eine höllisch heikle Situation für einen Mann, der am liebsten unsichtbar sein wollte.
Er zog den Reißverschluss des Schlafsacks auf, kroch aus dem Stroh und stand langsam auf, den Blick fest auf das Haus gerichtet. Er konnte einen schwachen Lichtschein hinter den Fenstern erahnen, vermutlich die Taschenlampe der beiden Einbrecher.
Er zögerte. Wenn er einfach still unter dem Schutzdach stehen blieb, würde sich diese von außen gekommene Bedrohung von selbst auflösen. Die beiden Männer würden irgendetwas finden, das sie klauen konnten, und sich dann leise zurückziehen, ins Auto steigen und mit ihrem Diebesgut verschwinden.
Es würde sein, als wäre nichts gewesen. Er wäre immer noch unsichtbar. Noch vor Tagesanbruch würde er mit seinem Rucksack auf den Schultern wieder unterwegs sein. Niemand auf diesem Planeten würde je erfahren, dass er hier im Stroh geschlafen hatte.
Das Auto? Sollte er …? Er schlich sich um den Unterstand herum zu dem schwarzen Kleintransporter. Ein alter Fiat Ducato. Auf dem Kennzeichen stand »RO«. Die beiden Männer waren also Rumänen. Nicht die ersten osteuropäischen Einbrecher in der Statistik und sicher nicht die letzten. Manchmal entwickelten sich solche Einbrüche in eine gewalttätige Richtung. Vereinzelt endeten sie sogar mit einem Mord, erinnerte er sich. Er hoffte nicht, dass …
Er blieb stehen und versuchte, den Gedanken zu verdrängen. Natürlich würde nichts passieren. Die Rumänen würden den Flachbildfernseher einpacken, alles nach Wertsachen durchwühlen und sich, sobald sie fertig waren, rausschleichen und abhauen.
Er würde dasselbe tun. Nicht abwarten, sondern jetzt packen und in die Neujahrsnacht hinauswandern.
Gerade als er zurück in den Unterschlupf wollte, um seinen Schlafsack einzurollen, ging drüben im Haus Licht an. Wenig später wurden Stimmen laut. Dann hörte er einen Schrei.
Er rannte los. Sekunden später war er am Haus. Er warf einen Blick durchs Fenster. Ein alter Mann mit grauen Haaren lag im Schlafanzug auf dem Boden und hielt sich die Arme schützend vors Gesicht. Oxen registrierte eine schwarze Gestalt, die mit dem Rücken zu ihm stand, den Arm zum Schlag erhoben.
Er riss die Tür auf und war laut brüllend in wenigen Sätzen im Wohnzimmer, wo der kleinere der beiden Männer wie paralysiert stehen geblieben war, das Brecheisen immer noch zum Schlag bereit. Der Große stand neben einem umgeworfenen Sessel.
Die Überraschung war ihnen ins Gesicht geschrieben, doch sie behielten die Ruhe. Sie drehten sich langsam zu Oxen um und gingen gemeinsam zum Angriff über. Der Kleine blaffte ein scharfes Kommando und machte einen Schritt nach vorn. Er war ziemlich kräftig gebaut und sah absolut nicht so aus, als hätte er Skrupel, das Brecheisen auch einzusetzen.
Alles Weitere passierte instinktiv. Dahinter steckten jahrelanges Training und eine gnadenlose Wirklichkeit. Risk assessment, Risikobewertung – oder einfach die antrainierte Fähigkeit, sich blitzschnell einen Überblick zu verschaffen, zu erkennen, worin die größte Gefahr bestand, und sie als Erstes zu eliminieren.
Oxen tauchte unter dem ersten brutalen Schlag mit der Brechstange weg, ging in die Knie und riss den Rumänen mit einem Roundhouse-Kick von den Beinen. Noch bevor sein Gegner den Boden berührte, hatte er sich mit festem Griff die Brechstange gesichert, sie dem Mann aus den Händen gewunden und ihm gegen die Kniescheibe geschmettert.
Als der ohrenbetäubende Schmerzensschrei das kleine Wohnzimmer erfüllte, stand Oxen schon wieder aufrecht, gerade rechtzeitig, um der Attacke des Großen auszuweichen, der wie ein Stier mit gesenktem Kopf auf ihn zustürmte. Ein schneller Griff in den Nacken des Mannes, und Sekunden später donnerte er den Kopf des Rumänen neben dem Türstock gegen die Wand, und während sein Widersacher zusammensackte, rammte er ihm das Knie in die Magengegend – dann ließ er ihn los.
Der kleine Kräftige wand sich wimmernd auf dem Boden und umklammerte sein zertrümmertes Knie. Der Große war völlig erledigt, er röchelte und schnappte nach Luft.
Erst jetzt konnte Oxen dem Alten etwas Aufmerksamkeit widmen. Der Mann lag immer noch auf dem Rücken. Blut rann aus seinem Mundwinkel, er hatte eine Platzwunde auf der Stirn und hielt sich die linke Schulter. Wortlos zog Oxen ihn in eine Ecke, weg vom Kampfplatz.
Dann ging er zurück zu dem Großen, der immer noch nach Atem rang, und durchsuchte seine Taschen. In einer Reißverschlusstasche entdeckte er einen Pass. Er wiederholte die gleiche Aktion bei dem anderen. Obwohl er aufgrund seiner Schmerzen nicht mehr kampftüchtig zu sein schien, fixierte Oxen mit der linken Hand den Hals des Mannes, während er ihn mit der rechten abtastete. Es dauerte nicht lange, und er hatte in der Innentasche seiner Lederjacke einen zweiten Pass gefunden.
Er betrachtete die beiden Dokumente und steckte sie ein.
Der Große kam langsam auf die Beine. Von der Augenbraue rann Blut über sein Gesicht, sie war bei der Begegnung mit dem Mauerwerk aufgeplatzt. Er keuchte schwer, war jedoch in der Lage, seinen Körper zu kontrollieren.
Oxen zeigte wortlos auf den zweiten Rumänen und gab dem Großen zu verstehen, dass er seinem Kumpel aufhelfen und dann mit ihm verschwinden solle. Ohne ein einziges Wort von sich gegeben zu haben, blieb er in der Mitte des Zimmers stehen und beobachtete den Rückzug der lädierten Einbrecher.
Es dauerte mehrere Minuten, bis der Große seinen Kumpel untergehakt hatte und die beiden in der Dunkelheit zurück zum Auto humpelten.
Oxen wartete an der Tür und sah ihnen hinterher. Nach einer Weile hörte er den Motor und konnte die Lichter der Scheinwerfer sehen. Der Wagen wendete hinter dem Schuppen und fuhr dann über den Feldweg davon.
Oxen spürte eine Hand auf seiner Schulter und drehte sich um. Es war der Alte, der wieder auf die Beine gekommen war. Der Mann im gestreiften Pyjama lächelte breit und sagte:
»Danke, mein Freund. Ich habe keine Ahnung, wer zur Hölle du bist und wo du so plötzlich hergekommen bist, aber du hast mich gerettet. Danke!«
Der Alte streckte ihm die Hand hin. Oxen nahm sie, nickte kurz und lächelte. Er blieb immer noch stumm. Er war exakt in der Situation gelandet, die er um jeden Preis hatte vermeiden wollen.
»Komm rein, komm rein.« Der Alte zog ihn am Arm. »Setz dich, kann ich dir etwas anbieten? Heute ist schließlich Silvester. Ein Bier? Ein Bier geht immer, oder? Moment.«
Der Mann verschwand. Bestimmt in der Küche. Oxen betrachtete wieder die beiden Pässe und steckte sie dann hastig zurück in seine Tasche. Er konnte die Kühlschranktür hören und das Rauschen des Wasserhahns. Dann kam der Alte zurück. Er hatte sich das Blut aus dem Gesicht gewaschen und stellte zwei Flaschen Bier auf den Couchtisch.
»Ich heiße übrigens Johannes, aber nenn mich einfach ›Fisch‹. Das machen alle.«
Der Alte nickte in Richtung der Fischbecken vor dem Haus und streckte ihm die Hand zum zweiten Mal entgegen.
»Und jetzt sag mir, was da los war! Wie heißt du? Wer bist du?«
Der alte Fischzüchter sah ihn aufmerksam an und schob ihm ein Bier hin.
Oxen zuckte mit den Schultern und breitete entschuldigend die Hände aus.
»Sorry, I don’t … Dragos … My name is Dragos. Adrian Dragos.«
»Oh, yes, from where?«
Er bemerkte eine Art Erleichterung in den Worten des Alten. Vielleicht weil der Mann jetzt einen Grund für seine ungewöhnliche Schweigsamkeit bekommen hatte.
»Romania. I am from Romania.«
»Thank you very much«, antwortete Fisch mit ausgeprägtem dänischem Akzent. Dann hob der Alte die Flasche, lächelte breit und zeigte eine Reihe gelber Zähne.
»And a happy new year, Mr Dragos.«
2.
Das weiße, blumengeschmückte Schiff wurde nach draußen getragen, um zu Wasser gelassen zu werden. Es war ein wunderschöner Sommertag, eine milde Brise wehte vom Meer herüber und der Himmel war frei von Sorgen.
Der Kapitän würde das kurze Stück bis zur Schleuse in Hvide Sande dem Fjordufer folgen, sein Schiff von dort hinaus auf die Nordsee lenken und dann Kurs auf die endlosen Ozeane nehmen.
Sie stammte aus einer Fischerfamilie in Thyborøn. Vielleicht stellte sie sich einen Sarg deshalb so gern als Schiff vor und den Tod als eine Reise ins Ungewisse.
Die Zeit im Anker Fjord Hospiz verging wie im Flug. Sie arbeitete jetzt seit drei Jahren dort, angelockt von einer Dokumentarserie im Fernsehen, die zwei Männer während ihrer letzten Monate begleitet hatte. Drei Jahre und viele Schiffe, die vom Hafen des Lebens aus in See gestochen waren. Die tägliche Arbeit mit den Sterbenden war geprägt von einem tiefen Respekt für das Leben. Für die zurückgelegten Seemeilen. Es gab keine sinnvollere Tätigkeit, als einem Schwachen den Übergang vom Leben zum Tod erträglicher zu machen.
Sieh, die Sonne steigt aus dem Meer ans Land,
hüllt Himmel und Wellen in ein glühend Gewand;
und Dunkelheit seligem Jubel weicht,
wenn ihr Licht ganz still die Küste erreicht.
Das Lied hatte sich der Verstorbene natürlich selbst ausgesucht. Vitus Sander wollte Kurs auf die Sonne nehmen. Sie musste lächeln. Seine Eltern hatten ihn nach Vitus Bering benannt, dem Dänen, der auch der Namensgeber für die Meerenge zwischen Sibirien und Alaska war.
Vitus Sander, der reiche Besitzer eines Elektronikkonzerns, war schwach gewesen, aber in letzter Zeit war ihr eine Veränderung aufgefallen. Er hatte seinen letzten Gang aufrechter als zuvor und mit neuer Kraft angetreten.
Er war nur siebenundsechzig Jahre alt geworden. Geboren in Hjørring, hatte er die meiste Zeit seines Lebens in Kopenhagen verbracht, wo sich auch der Hauptsitz seines Konzerns befand. Lungenkrebs. Seine Frau hatte er vor drei Jahren verloren.
Sie ließ den Blick durch die Reihen im Foyer wandern. Da standen seine Kinder, ein Sohn und eine Tochter, Seite an Seite, und da war sein Enkelkind, das sogar ein paarmal während seiner treuen Besuche beim Großvater übernachtet hatte. Lange blonde Haare, Studentin an der Universität in Kopenhagen und ein ausgesprochen hübsches Mädchen.
Aber es war seltsam. Ausgerechnet die Person, die in den letzten Wochen die meiste Zeit mit Vitus Sander verbracht hatte, war nicht gekommen. Ein sympathischer Mann in knallbunten Klamotten und weißen Turnschuhen. Immer in weißen Turnschuhen. »Ein guter Freund«, so hatte Vitus Sander ihn genannt. Aber gute Freunde verabschiedeten sich doch …?
Sie war dem mächtigen Konzernchef nähergekommen als den meisten anderen Patienten.
Zweimal hatte er sie sogar gebeten, ihn nach draußen zu begleiten. Sie hatten nebeneinander auf einer Bank gesessen und auf den Fjord geblickt. Dabei wollte er nie über sich selbst sprechen, sondern nur hören, was sie über ihr Leben zu erzählen hatte, über ihre Kindheit an der Küste. Und er wollte, dass sie ihm ihre Vorstellung von dieser letzten Reise schilderte.
Man musste keine Fischerstochter aus Thyborøn sein, mit einem angeborenen Blick für den Gemütszustand des Himmels, um die dunklen Wolken zu erahnen, die Vitus Sander von Zeit zu Zeit heimsuchten. Aber das war ganz natürlich, wenn man am Ende des irdischen Weges angelangt war.
Der lächelnde Mann mit den weißen Turnschuhen hatte eine heilsame Wirkung auf Sander gehabt. Ein paar Tage nachdem er zum ersten Mal aufgetaucht war, hatte sie den Umschwung bei Vitus Sander bemerkt. Als wäre der Turnschuh, der, wenn sie sich recht erinnerte, eigentlich Rasmus hieß, ein Wanderprediger gewesen, der ihm die Beichte abgenommen und ihn von seinen Sünden freigesprochen hätte.
Sie würde den sanften, mächtigen Mann vermissen, aber schon morgen zog jemand Neues ein. Ein ehemaliger Zimmermann aus Randers.
Vermutlich war Vitus Sander dann schon auf dem Weg in die Biskaya.
3.
Die Angst, die sich in diesem Moment durch sein Zwerchfell fraß, stand in starkem Kontrast zu der friedlichen Umgebung. Von der hohen Wallanlage des Schlosses aus betrachtet, wirkte Nyborg wie ein Ort, an dem es sich gut aushalten ließ.
Er saß auf seiner Lieblingsbank auf der Dronningens Bastion zwischen dem Wasserturm und den vier roten Achtzehn-Pfund-Kanonen. Unterhalb der Bastion lag der Burggraben, breit und mächtig, mit den kleinen Schrebergartenhäuschen am Rand. Drehte er sich um und richtete den Blick nach hinten, bot sich ihm eine herrliche Aussicht über diese Stadt, in die er sich im Laufe der Zeit so verliebt hatte.
Um ihn herum war alles grün. Nicht zartgrün wie im frühen Frühjahr, sondern dunkler, wie es für den Juli so typisch war, wenn die Natur etwas von ihrer Frische verloren hatte.
Er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Die Sonne schien ihm ins Gesicht, aber er spürte die Wärme nicht. Stattdessen jagte die Angst ihm eisige Schauer über den Rücken. Angst? Er hatte in seinem Leben schon oft Angst gehabt. Wer hatte das nicht? Aber nicht so. Nicht wie diese alles durchdringende Angst, die genau in diesem Augenblick in Panik umzuschlagen und ihn zu lähmen drohte.
Hätte er die Konsequenzen seines Handelns rechtzeitig überblicken können, wäre es nie so weit gekommen. Dann hätte er einfach hier gesessen und die Sonne genossen. Aber jetzt war es zu spät. Viel zu spät, um umzukehren.
Er sah nach unten und musterte die Spitzen seiner weißen Converse All Stars. Wippte im Schuh mit den Zehen, als wollte er bekräftigen, dass er immer noch die volle Kontrolle über sein Zentralnervensystem hatte. Converse, die trug er seit seiner Zeit an der Uni. Immer weiß, immer das knöchelhohe Modell. Er konnte seine liebe Tante noch hören, wie sie, trotz seines akademischen Hintergrunds und obwohl er schon achtunddreißig war, rief: »Junge, wann kaufst du dir endlich mal andere Schuhe?«
Es gab so viel Kitt, der alles im Leben zusammenhielt. Die weißen All Stars gehörten dazu.
Diese eisige Schicht aus Angst passte nicht hierher auf den Wall. War die Gegenwart des Todes dafür verantwortlich? Hatte sie den ersten Eisblock in seinem Inneren gebildet und der Angst die Tür geöffnet?
Die vielen verschiedenen Menschen mit ihren unterschiedlichen Leben, versammelt in diesem Haus am Fjord, in der Wartehalle des letzten Bahnhofs, wo nur eine Art von Ticket ausgestellt wurde.
Im Moment war er viel zu eingeschüchtert, um kühl abzuwägen, wie seine eigenen Chancen standen. Wenn sich in dieser Stadt jemand mit Chancen auskannte, dann er. Aber er war wie paralysiert.
Tastend schob er eine Hand in die Jackentasche. Das Bündel aus 15 000 Kronen war noch da und wartete auf seinen Einsatz.
Zehn Tippscheine mit mathematischem System für das Mittwochslotto und ungefähr dieselbe Anzahl für die dänische Ziehung am Samstag, außerdem eine Tippreihe für die wöchentlichen Fußballspiele. Immer mit hohen Gewinnchancen. Immer drei Spiele mit Endergebnissen ohne irgendwelche Absicherungen.
Fußball war seine Leidenschaft, aber die Angst überschattete das alte Gefühl der Befriedigung, die er darin gefunden hatte, die richtigen Spiele mit den richtigen Quoten herauszukriegen. So war es lange gewesen.
Auf dem Weg vom Wall bis zum Kvickly-Supermarkt hatten seine Beine sich schwach und zittrig angefühlt.
Jetzt lächelte das Mädchen hinter dem Tresen etwas bemüht und nickte nur, als er ihr den Stapel Tippscheine hinüberschob.
Er verteilte seine Spiele auf verschiedene Wochentage und vier verschiedene Orte in der Stadt, alles im Dienste der Diskretion. Als Nächstes würde er die ganze Strecke zu Fuß zum Bahnhof gehen und seine letzten 7000 Kronen setzen, Oddset und ein bisschen Extra-Lotto.
Es war sein allerletzter Einsatz. Die Glücksgöttin war ihm bislang noch nicht begegnet. Aber jetzt brauchte er sie mehr als je zuvor in seinem Leben.
4.
Die riesige Fichte stand für einen Augenblick unentschlossen da und schüttelte ihren krausen Schopf. Dann musste sie kapitulieren. Wie ein Turm, dessen Sockel gesprengt wird, fiel sie um. Erst ganz langsam, dann mit einem Mal rasend schnell. Sie rauschte auf den Waldboden und wirbelte eine Wolke aus Staub und Sand auf.
Zufrieden stellte er fest, dass der gewaltige Stamm sich genauso gelegt hatte, wie es geplant gewesen war. Als Nächstes musste der Baum entastet werden, aber vorher würde er erst einmal Pause machen. Er schaltete die Motorsäge aus und legte seinen Helm ab.
Die Jahresringe des Baumstumpfs waren die Spuren einer beeindruckenden Vergangenheit. Jahr hatte sich um Jahr gelegt, und jeder Ring erzählte eine Geschichte über die Zeit. Diesen Baum fallen zu sehen erschien ihm so sinnlos. Aber wenn er in den Jahren, die er selbst zurückgelegt hatte, etwas gelernt hatte, dann, dass vieles sinnlos war. Selbst die Größten und Besten fielen. Selbst die wenigen Jahresringe der Kleinsten und Unschuldigsten wurden brutal gekappt.
Es gab keine Gerechtigkeit, sorgsam bilanziert vom höchsten Buchhalter. Es gab nur Zufälle.
Er setzte sich und packte seine Brotbox und die Thermoskanne aus, die er jeden Tag in seinem kleinen Rucksack mit in den Wald nahm. Er biss in das Leberwurstbrot und schenkte sich dampfenden Kaffee ein. Die Sonne wärmte sein Gesicht. Nur ein Eichelhäher störte die Stille.
Sein Blick wanderte zurück zu dem mächtigen Stumpf. Zeit war eine seltsame Größe … Damals im Reihenhaus war Zeit Mangelware gewesen. Unter anderen Umständen konnte zu wenig Zeit ein konkretes Risiko darstellen, aber zu viel davon führte vielleicht zu Unachtsamkeit, was nicht weniger gefährlich war.
In den späteren Jahren hatte Zeit für ihn keine Rolle mehr gespielt. Sie war zu einer nichtexistenten Größe geworden, und trotzdem legte sie mit jedem Zwölf-Monats-Zyklus, der zu Ende ging, einen neuen unsichtbaren Jahresring um den vorigen.
Hier und jetzt hatte er überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Ob neun Uhr oder fünf Uhr, es war bedeutungslos. Ob Montag oder Samstag, es war egal. Hätte es den Wechsel der Jahreszeiten nicht gegeben, den er wirklich sehr mochte, wären auch die Monate ohne Relevanz gewesen.
Aber jetzt war Juli und Hochsommer. Es war mehr als ein halbes Jahr vergangen, seit er durch einen Zufall Johannes Ottesen kennengelernt hatte. Oder einfach »Fisch«, wie der Mann am liebsten genannt werden wollte, weil das »alle so machten«.
Ob er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war oder ganz im Gegenteil – darüber ließ sich immer noch streiten, aber dass er Johannes Fisch in der Silvesternacht zu Hilfe gekommen war, hatte ganz unvermittelt eine neue Tür in seinem Leben geöffnet. Deshalb war er nicht mehr auf der Landstraße unterwegs. Deshalb saß er hier im Wald.
Fisch war vierundsiebzig Jahre alt, zu alt, zu kaputt und zu sehr von der Gicht geplagt, um sich um seine kleine Fischzucht zu kümmern. Aber er kannte ja nichts anderes, als für sein Essen zu arbeiten.
Schon in der Silvesternacht hatte Fisch ihm in gebrochenem Englisch vorgeschlagen, ein paar Tage zu bleiben. Sich ordentlich satt zu essen, im Warmen zu schlafen – und vielleicht auch an den Fischteichen mit anzupacken. Und dabei war es geblieben.
Nach zwei Wochen war er in die abbruchreife Mitarbeiterunterkunft gezogen, die er notdürftig instand gesetzt hatte, um sie bewohnbar zu machen. Laut Fisch hatte das Haus dreizehn Jahre lang leer gestanden, seitdem er seinen Helfer hatte entlassen müssen, weil er ihm keinen Lohn mehr hatte zahlen können.
Das Häuschen stand auf einer kleinen Lichtung am Rand eines weitläufigen Fichtenwalds, einen halben Kilometer von der Fischzucht entfernt. Fisch hatte das Haus vor vielen Jahren aus Gasbetonsteinen selbst gebaut und verputzt. Wohnraum, Küche, Toilette unten, oben Schlafzimmer und Kammer. Das Dach bestand aus bröckelnden Eternitplatten, die dick mit Moos bewachsen waren.
Oxen stand jeden Tag um sechs Uhr auf und erledigte seine Aufgaben an den Forellenteichen. Die restliche Zeit verbrachte er mit Waldarbeit.
Fisch hatte seinen Wald über Jahre vernachlässigt. Hier gab es Arbeit für mindestens ein ganzes Jahr. Wie lange er bei dem alten, freundlichen Mann bleiben würde, wusste er nicht, aber er …
Motorenlärm auf dem Schotterweg riss ihn aus seinen Gedanken. Konzentriert beobachtete er die Stelle, wo jeden Moment ein Auto zwischen den Bäumen auftauchen würde. Er griff nach seiner Pistole, der zuverlässigen Neuhausen, die er immer mit vollem Magazin in Reichweite hatte.
Jetzt kam es. Es war ein rotes Auto. Fisch in seinem alten Pick-up. Er zögerte einen kurzen Moment, denn auf dem Beifahrersitz saß ein Mann. Dann schob er die Waffe zurück in den Rucksack, ließ seine rechte Hand aber in der Nähe liegen. Fisch kam sonst immer allein.
»Da sitzt er, der Kerl. Er macht bestimmt gerade Frühstückspause. Es sei ihm gegönnt. Der Mann schuftet wie ein Brauereipferd. Hat gerade erst die riesige Fichte gefällt.«
Johannes Fisch nahm eine Hand vom Lenkrad, um auf die einsame Gestalt zu zeigen, die auf dem Baumstumpf saß.
»Wie heißt er noch mal?«, fragte der Mann auf dem Beifahrersitz.
»Dragos … Aber nach dem Vornamen darfst du mich nicht fragen. Den hab ich vergessen.«
»Dragos? Aus Rumänien?«
»Ja.«
»Wie Dracula.«
»Wieso sagst du das?«
»Weil Dracula auch aus Rumänien war, Fisch. So viel weiß ich gerade noch. Dragos oder Dracula.«
»Ich sag dir jetzt mal was, Bette – Dragos ist in Ordnung.«
»Wer ist er und was will er hier?«
»Er ist einfach ein Rumäne mit Motorsäge.«
Johannes Fisch zögerte, während er bremste und den Pick-up langsam durch die Baumstümpfe manövrierte.
»Kannst du ein Geheimnis für dich behalten, Bette Mathiessen?«, fragte er schließlich.
Der korpulente Mann neben ihm seufzte tief. Er war fast so massig wie diese japanischen Ringer, die bei ihren Kämpfen nicht mehr als eine weiße Windel am Leib haben, um ihre Kronjuwelen an Ort und Stelle zu halten.
»Jaja, das weißt du doch.«
»Dragos hat mir das Leben gerettet. Aber kein Wort darüber, hörst du? Ich will nicht, dass das Kreise zieht. Und er will es auch nicht.«
Mathiessen schüttelte träge den Kopf.
»Also, das war an Silvester … Ich war schon längst im Bett, du weißt ja, ich war allein zu Hause, wie sonst auch …«
Nachdem Johannes Fisch seinen dramatischen Bericht beendet hatte, zog er den Zündschlüssel ab. Das letzte Stück mussten sie zu Fuß gehen.
»Ich fasse es nicht«, sagte Mathiessen. »Echt, ich fasse es nicht. Ein einzelner Mann? Und er hat die Banditen einfach fertiggemacht?«
Fisch nickte und stieg aus.
»Und seitdem ist er hier?«
Fisch nickte noch einmal, während Mathiessen seinen Körper unter dem lauten Knarren der Karosserie aus dem Sitz wuchtete.
»Hat er keine Frau? Keine Kinder? Niemanden, den er besucht? Was macht er denn, wenn er freihat? Was zur Hölle … Der hat ja einen Pferdeschwanz!« Eingehend musterte Mathiessen die Gestalt auf dem Baumstumpf.
»Frei? Er nimmt sich nie frei«, gluckste Fisch. »Ich hab ihn gefragt, ob er mit nach Brande oder Herning will, aber nein. Nicht mal nach Skarrild … Am liebsten will er einfach nur hier sein. Ich erledige alle Einkäufe für ihn. Nein, halt, er hatte tatsächlich ganze drei Tage frei, wenn ich mich recht erinnere. Beim ersten Mal hat er sich mein Auto geliehen, da wollte er irgendwelches Material für sein Haus kaufen. Die beiden anderen Male habe ich ihn mit einem von meinen alten Kanus nach Brande gefahren und ihn dann in Sønder Felding wieder abgeholt. Er liebt es, auf dem Fluss zu sein, sagt er. Und er angelt gern. Und nein, keine Frau und keine Kinder, hat er erzählt. Jetzt komm, Bette, sagen wir ihm Hallo. Er wird dich schon nicht beißen … Hello, Dragos! How are you?« Fisch hob eine Hand und winkte.
Der Mann, der Fisch hinterherstapfte, war so groß und dick, dass er an einen Zeppelin mit Beinen erinnerte. Und er sah nicht so aus, als würde ihm der kurze Spaziergang auf dem unebenen Waldboden Spaß machen.
Die Hand, die in Griffnähe der Pistole auf dem Rucksack ruhte, hatte er längst zurückgezogen. Fischs Kumpel war harmlos, trotz all seiner Masse. Doch es ärgerte ihn, dass er dem Mann jetzt offenbar Guten Tag sagen musste. Im Idealfall gab es nur Fisch und ihn – und niemanden sonst, der von seiner Existenz als Helfer des alten Fischzüchters wusste. Warum musste Fisch diesen schwitzenden Fleischberg hier anschleppen?
Oxen hob die Hand und erwiderte Fischs Gruß. Noch vor wenigen Minuten war es so herrlich still hier gewesen. Jetzt musste er seinen besten rumänischen Akzent ausgraben. Nicht, dass ihm das Probleme bereitete, er hatte sich mittlerweile daran gewöhnt. Aber er hätte viel lieber seine Ruhe gehabt.
»Hello, Dragos, meet my good friend Mathiessen.«
Er lächelte und nickte dem riesigen Mann zu.
»Beer?«, fragte der Gast, schob die Hände in seine Jackentasche und zog drei Dosenbiere heraus.
»No, thanks.«
Er schüttelte den Kopf. Alkohol zu dieser Tageszeit machte stumpf und träge.
Johannes Fisch stand da und trippelte von einem Fuß auf den anderen, wie er es oft tat, wenn er nach den richtigen Vokabeln suchte, um ein etwas tiefgründigeres Gespräch zu führen, das über ein paar kurze Sätze hinausging.
»You see, Dragos, I am going to Brugsen … to buy things … Do you want anything?«
Er nickte langsam. Ja, er brauchte wirklich ein paar Sachen. Und es war viel besser, das jetzt zu besprechen, als zu warten, bis Fisch am Haus aufkreuzte. Er war nicht scharf darauf, dass Fisch zu ihm kam. Nicht weil an diesem liebenswerten Menschen irgendwas falsch gewesen wäre. Es gab nur so viele Dinge, in denen der Alte besser nicht herumschnüffeln sollte. Deshalb hatte er ihn auch nie hereingebeten.
5.
Ehrfurcht. Dieses Gefühl überkam ihn jedes Mal, wenn er sich dem geschichtsträchtigen Schloss der Stadt näherte.
Es lag nicht daran, dass das mittelalterliche Gebäude besonders malerisch oder spektakulär ausgesehen hätte, mit Schießscharten, Toren oder Türmen und Zinnen. Natürlich war es früher Teil einer Festungsanlage gewesen, doch heute war nur noch der riesige gemauerte Kasten davon übrig.
Was ihn wirklich beeindruckte, war die historische Bedeutung dieses Schlosses. Als echter Nyborger Junge war er stolz darauf, dass seine Stadt einst Sitz der Könige gewesen war. Es gab eine Menge Kopenhagener, denen es nicht schaden würde, mehr darüber zu erfahren. Ja, und den Jütländern übrigens auch nicht. Die meisten wussten gerade mal, dass es in Nyborg ein berüchtigtes Gefängnis gab. Das war wirklich bedauerlich und geradezu eine Schande.
Er hatte das Schloss im Ortskern unzählige Male besucht. Früher als Kind mit seinen Eltern, später als Erwachsener – und jetzt als Familienvater mit seinen eigenen Kindern an der Hand. Sie sollten etwas über die Blütezeit Nyborgs lernen, wie es war, als der König hier residierte und als sich der machtvolle Danehof mit den wichtigsten und einflussreichsten Männern des Landes hier versammelte, um die Reichsangelegenheiten zu regeln und den König an der kurzen Leine zu halten. Oder die Königin. Margrethe I. hatte Nyborg Slot mit ihren Ausbauten und Änderungen wohl am meisten von allen geprägt.
Er kannte sich trotz seines einfachen Volksschulabschlusses in diesem Teil der dänischen Geschichte aus, als wäre er dabei gewesen, auf Augenhöhe mit den Monarchen.
Niemals hätte er gedacht, dass er mal einer von denen sein würde, die nachts den Kulturschatz der Stadt bewachen durften.
Er parkte unten am Rathaus, schloss den Wagen ab und ging hoch zum Schloss, um seinen Rundgang zu machen. Seit vier Jahren arbeitete er für die Nyborg Security.
Seine Aufgaben beschränkten sich auf das, was in der Fachsprache Außensicherung hieß. Also die Sicherung der Außengrenzen eines Objekts, der Check sämtlicher Türen sowie ein wachsames Auge auf die Fenster und alles andere. In der Praxis handelte es sich dabei um das Verwaltungsgebäude, in dem die Museumsmitarbeiter ihre Büros hatten, das Café und den Eingang zum Schloss, eine breite Tür an der Treppe. Die Bibliothek auf der linken Seite der Anlage würde er auf dem Rückweg überprüfen.
Der Juli konnte manchmal sprunghaft sein. Am späten Nachmittag war das Wetter umgeschlagen. Es hatte fast den ganzen Abend geregnet, und jetzt fing es schon wieder an zu tröpfeln. Weder Mond noch Sterne waren zu sehen. Vermutlich hing die Wolkendecke blauschwarz und schwer über seinem Kopf, aber hier in der Innenstadt war es dank der Straßenlaternen zu hell, um das beurteilen zu können.
Der Kies knirschte unter seinen festen Schuhen. Er hatte eben auf die Uhr geschaut. Er war auf die Sekunde genau im Zeitplan. Wie immer.
Als er den Blick zum ersten Mal hob und noch aus der Ferne über das große Schlossgebäude gleiten ließ, fiel es ihm sofort auf. Da oben war etwas anders, als es sein sollte.
Die Fassade des Schlosses wurde von einigen kleinen Strahlern beleuchtet. Trotzdem konnte er den schwachen Lichtschein sehen, der aus einem der hohen Fenster im zweiten Stock fiel. Genauer gesagt, aus dem mittleren Raum, dem Danehof-Saal. Es kam ab und zu vor, dass jemand vergaß, das Licht auszuschalten, aber dann hätte der Lichtschein dort oben viel heller sein müssen.
War es etwa die Taschenlampe eines Einbrechers?
Sein Herz klopfte schneller. Ein Hund wäre jetzt gut gewesen, aber er hatte als Wachmann noch nie mit Hund gearbeitet. Nervös eilte er zum Schloss und stieg leise die Treppe zum Eingang hoch. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Die Tür war nur angelehnt.
Vorsichtig schob er sie so weit auf, dass er sich durch den Spalt zwängen konnte. Gleich würde er die Kollegen und die Polizei informieren, aber zuerst wollte er sich selbst einen Überblick verschaffen. In einem früheren Job hatte er in einer schwarzen Nacht einmal beim Rundgang auf einem Fabrikgelände die Polizei gerufen. Als die Ordnungshüter eintrafen und zwei Jungs im Alter von elf und zwölf bei ihrem Einbruch ertappten, fühlte er sich bis ins Mark blamiert. So ein Anfängerfehler passierte ihm bestimmt kein zweites Mal.
Er kannte das Innere des Schlosses gut genug, um die Taschenlampe im Gürtel zu lassen. Ihr Licht hätte ihn womöglich verraten.
Er schenkte den beiden glänzenden Rüstungen links vom Eingang keine Beachtung, und anders als sonst ignorierte er auch die dramatischen Szenen auf den riesigen Gemälden im großen Rittersaal, den man als Erstes betrat.
Vorsichtig schlich er über den Klinkerboden in den nächsten Raum.
Das Licht drang aus dem Danehof-Saal, genau wie er vermutet hatte. Er schlüpfte durch die Tür und presste sich sofort dicht an die dicke Mauer. An der Schmalseite stand der Thron aus dunklem Holz, ansonsten befanden sich nur ein paar Tische und Stühle im Raum, und die kleinen Holzpulte mit Informationen über die Geschichte dieses Saals.
Die schlichten Wandornamente aus schwarz-weißen symmetrischen Quadraten wurden von einem schwachen Lichtschein erhellt. Von seinem Platz neben der Tür konnte er immer noch nicht genau erkennen, woher das Licht kam. Er machte ein paar Schritte in den Raum. Dann hatte er Gewissheit.
Das Erste, was er sah, war ein Paar weiße Turnschuhe. Genauer gesagt, knöchelhohe Sneakers, wie sein Sohn sie auch immer trug.
Wenige Meter weiter rechts lag neben einem umgeworfenen Stuhl eine Taschenlampe auf dem Boden und leuchtete schräg nach oben. Ihr Lichtkegel fiel auf die weißen Schuhe und das Fenster darüber.
Sofort zog er seine eigene Taschenlampe aus dem Gürtel und schaltete sie an. Da lag jemand. Leblos. Auf dem Rücken. Er richtete den Lichtstrahl auf das Gesicht. Es war ein Mann. Blutüberströmt. Sein Anblick war grauenhaft. In der Mitte der Stirn klaffte ein runder blutiger Fleck, und von der linken Augenhöhle war nur noch eine unappetitliche Masse aus zerfetztem Gewebe und Blut übrig. Eine große dunkle, glänzende Lache hatte sich auf dem Boden ausgebreitet.
Eine Leiche. Ein Mann. Nicht nur ein Schuss. Nein, ein Schuss in die Stirn und einer ins Auge. Das war kein Zufall, das war eine regelrechte Hinrichtung. Ausgerechnet im Herzen des Schlosses.
Er schnappte nach Luft. Seine Anspannung war so groß, dass er die ganze Zeit den Atem angehalten hatte.
Was jetzt? Er versuchte, den Überblick zu bewahren. Sich an das zu erinnern, was er gelernt hatte. Die allererste Aufgabe war immer, Kranke und Verletzte zu untersuchen. Konnte man noch einen Puls fühlen? Atmeten sie noch? Dann in die stabile Seitenlage bringen oder wiederbeleben.
Aber eine Leiche? Das Opfer eines vorsätzlichen Mordes? Sein Magen krampfte sich zusammen und er stieß sauer auf. Er wich ein paar Schritte zurück, schluckte, was er im Mund hatte, und griff nach seinem Handy. Er wählte die 112.
Nachdem er dem Mann in der Einsatzzentrale der Polizei in Odense alle notwendigen Informationen durchgegeben hatte, steckte er das Handy wieder in den Gürtel – und zog sich vorsichtig zurück. Jeder Depp wusste, dass man an einem Tatort nicht kreuz und quer herumlatschte. Und das hier war ein Tatort, und was für einer.
Nicht mal in seinen wildesten Fantasien hätte er sich vorstellen können, dass Nyborgs altes Schloss im Hier und Jetzt Schauplatz eines Verbrechens werden könnte. Und schon gar nicht, dass er dabei als erster Zeuge vor Ort sein würde.
Während er den Lichtkegel über den Boden gleiten ließ, streifte ihn der Gedanke, dass ihm der Tote irgendwie bekannt vorkam. Er nahm allen Mut zusammen, machte noch einmal ein paar Schritte vorwärts und leuchtete in das grausam entstellte Gesicht.
Verdammt … Das war der Museumsdirektor, oder nicht? Sein Magen schickte eine neue Ladung nach oben. Doch … ganz sicher. Malte Bulbjerg hieß der Mann. Ein netter Kerl und in der ganzen Stadt bekannt. Ermordet im Allerheiligsten seines eigenen Schlosses. Das war doch Irrsinn!
Jetzt würde die Polizei ihn befragen. Bestimmt nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Vor ihm lagen garantiert ein paar heftige Stunden oder sogar Tage. Er musste das Ganze im Kopf durchgehen, sich jedes Detail einprägen, damit er so genau wie möglich antworten konnte. Die Uhrzeit! Die Uhrzeit war immer wichtig. Er leuchtete auf seine Armbanduhr. Es war 01:25 Uhr.
6.
Der Alarm wurde um 01:25 Uhr ausgelöst. Mit einem Ruck setzte er sich im Bett auf, drückte auf den Knopf seiner Armbanduhr, rannte zum Schrank und riss die Türen auf.
Die beiden großen Flachbildschirme in dem alten Kleiderschrank leuchteten ihm schwarz-weiß entgegen. Beide Monitore waren in sechs Fenster unterteilt, eins für jede Überwachungskamera.
Die Sirene erfüllte den Raum mit einem schrillen und doch gedämpften Signalton. Auf dem Display sah er, dass Kamera sieben den Alarm ausgelöst hatte. Ein Klick mit der Maus, die mit dem Computer im untersten Regalfach verbunden war, und die Sirene erstarb und er konnte sich konzentrieren. Er rieb sich die Augen und sah sich die Sieben genauer an.
Die IP-Kamera war an einer großen Kiefer westlich des Hauses montiert, in der Nähe eines schmalen Pfads, der sich durch den Fichtenwald schlängelte. Die Schwarz-Weiß-Bilder mit Infrarotlicht waren zwar deutlich, aber ohne große Tiefenschärfe. Am rechten Rand des Monitors sah er ihn trotzdem – den Hintern eines Rehs.
Es gab keinen Zweifel. Diese Rückansicht mit dem weißen Fleck kannte er inzwischen nur zu gut. Es war keineswegs das erste Mal, dass er falschen Alarm auf der Sieben hatte, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als an dieser Kameraposition festzuhalten. Gerade dieser Pfad musste unbedingt abgedeckt sein, denn er war perfekt geeignet, wenn man sich in der Dunkelheit an sein Haus heranschleichen wollte.
Aber nicht einmal eine Ameise im Tarnanzug konnte sich seinem Unterschlupf unbemerkt nähern. Er hatte eine full perimeter safety zone rundherum eingerichtet.
Nach so vielen Jahren, in denen Englisch seine Arbeitssprache gewesen war, gab es Fachausdrücke, die ihm auf Dänisch gar nicht mehr einfielen. Doch die Sache war ganz einfach: Die zwölf kabellosen Überwachungskameras bildeten einen geschlossenen Überwachungszirkel mit einem Radius von hundertfünf bis hundertzehn Metern rund um das gesamte Haus. Das verschaffte ihm ausreichend Zeit, um zu reagieren.
Er nahm jedes Kamerafenster sorgfältig in Augenschein, aber draußen in der Nacht war nichts Verdächtiges zu sehen, und auch das Reh hatte sich mittlerweile aus dem Blickfeld von Kamera sieben zurückgezogen. Er checkte noch kurz die Mails auf dem Computer. Es war eine automatische Erinnerung für ihn gekommen, die ihn darauf aufmerksam machte, dass morgen der 18. war. Das war ihm mehr als bewusst. Er würde tun, was zu tun war, gleich nach dem Aufstehen.
Die Überwachungsausrüstung, die den kompletten Schrank füllte, hatte er in einem Spezialgeschäft in Vejle gekauft. Nachdem er ein paar Wochen bei Fisch gearbeitet hatte, hatte er sich einen Tag freigenommen und sich unter dem Vorwand, Material für das Haus besorgen zu wollen, das Auto des Alten geliehen.
Er klappte die Schranktüren zu und setzte sich auf die Bettkante. Er war sich nicht sicher, ob er noch einmal versuchen sollte einzuschlafen – oder einfach kapitulieren und aufstehen.
In letzter Zeit waren die Sieben einer nach dem anderen zurückgekehrt. Seine ganz persönliche Serie von Albträumen, die sich darin abwechselten, ihn aufzuschlitzen und den Geiern seines Unterbewusstseins zum Fraß vorzuwerfen. Kurz bevor das Reh den Alarm aktiviert und ihn erlöst hatte, hatte der Kuhmann seine Spielchen mit ihm getrieben.
Der Kuhmann, der jedes Mal langsam aus dem Nebel am Fluss trat. Er zog eine Kuh hinter sich her, die Hauptstraße des Dorfes entlang, das aus zerstörten und niedergebrannten Häusern bestand. Der Greis mit dem faltigen Gesicht kam immer näher. Er steuerte auf das einzige unversehrte Haus zu.
Oxen erinnerte sich daran, als wäre es gestern gewesen. Ein hellgelbes Haus mit Blumenkästen vor den Fenstern und einem grünen Tor, das zu einem Hinterhof führte. Neben dem Tor hatte jemand ein Kreuz mit vier C rundherum auf die Mauer gemalt. Nur dass die vier kyrillischen Buchstaben keine C waren, sondern S und für Samo sloga Srbina spasava standen: Nur Eintracht rettet den Serben. Das Mantra, das überall in diesem vom Krieg zerstörten Land zu hören war.
Der Kuhmann symbolisierte die ethnische Säuberung. Die vier C am Türstock waren wie das Lämmerblut, das den Todesengel auf seiner Suche nach den Erstgeborenen der Israeliten an den Häusern vorbeigehen ließ.
Es war die Stimmung dieser Szenerie, die ihn nachts heimsuchte. Das Wüten des Todes, die Zerstörung, die Leere und Stille im Nebel. Er wachte immer an derselben Stelle auf: wenn sich das Gesicht des Alten in eine Fratze verwandelte. Während er direkt vor ihnen auf der Straße stand, verzog sich sein Mund zum heimtückischen Lächeln eines Wolfes mit spitzen, fauligen Zähnen. Seine Augen wurden schmal und gelb und sein Gesicht ganz kantig.
Dann schreckte Oxen jedes Mal hoch. In der Realität hatte er nie herausgefunden, ob der Kuhmann bloß grinste – oder ob er ihm in der nächsten Sekunde an die Kehle gegangen wäre.
Er war zum dritten Mal in nur anderthalb Wochen aufgetaucht. Eine Zeit lang hatte Oxen gehofft, das Ganze würde abklingen. Die Abstände zwischen seinen Albträumen waren erfreulich groß geworden, aber inzwischen entwickelte es sich in die entgegengesetzte Richtung. Wann würde das alles endlich aufhören? Würden die Sieben ihn jemals verlassen?
Hätte er doch einfach ein Lamm schlachten und sein Blut an den Türstock schmieren können, damit sie an seinem Haus vorbeigingen.
Er legte sich wieder hin und zog die Decke hoch. Hatte er nicht gerade noch auf einem Baumstumpf gesessen und sich eingeredet, Zeit sei eine bedeutungslose Größe? Dabei gab es sehr wohl ein festes Datum in seinem zeitlosen Leben: den 18. jedes Monats.
Der 18. war als Datum fest mit seinem Alarmschrank verbunden. Der 18. konnte über Leben und Tod entscheiden.
Jeden Monat, an diesem einen Tag, loggte er sich in einen Server ein, der – wenn er sich richtig erinnerte – an einem so exotischen Ort wie Singapur stand. Das Prozedere war einfach: Er musste drei kleine Kästchen anklicken, sich dann wieder ausloggen und bis zum nächsten 18. warten.
Vergaß er, die Kreuze zu setzen, oder wurde er daran gehindert, würde das eine gewaltige Lawine auslösen. Innerhalb weniger Stunden hätte Dänemark einen neuen Justizminister, und im selben Atemzug würde eine groß angelegte Jagd auf ihn selbst beginnen. Eine Jagd, die erst mit seinem Tod zu Ende wäre.
Jetzt war er hellwach. Er wusste, was ihn erwartete, sobald der 18. näher rückte. Dann wurde das letzte Jahr seines Lebens unweigerlich zurückgespult, und der Film in seinem Kopf fing einfach wieder von vorn an, egal wie sehr er sich auch dagegen wehrte.
Was die letzten zwölf Monate ihm gegeben und genommen hatten, gehörte nicht zu den Dingen, über die er unbedingt nachdenken wollte. Im Gegenteil, er hatte sich nur deshalb bei Johannes Fisch niedergelassen, um für eine Weile die Pausetaste zu drücken und einfach Zeit verstreichen zu lassen. Vielleicht würden auf diese Weise ein paar Wunden heilen, falls die Zeit solche Wunder tatsächlich bewirken konnte.
Aber eine schmerzhafte Erkenntnis ließ sich nicht verdrängen: Er hatte seinen besten Freund und Partner verloren. Dieser Verlust warf lange Schatten über alles, was sonst positiv hätte erscheinen können.
Wäre er im Nordwestquartier Kopenhagens geblieben, in dem dunklen, feuchten Kellerzimmer im Rentemestervej, wo er sich seine Mahlzeiten in den Müllcontainern des Fakta-Marktes zusammengesucht hatte, würde Mr White noch leben. Dann hätte der freundliche Samojede ihn jetzt vielleicht angestupst und ihm die Schnauze in die Handfläche gedrückt, aber seine hohle Hand hielt nichts anderes umschlossen als den Phantomschmerz.
An dem Tag, als er mit Mr White in Skørping aus dem Zug gestiegen war, um Frühjahr und Sommer im mächtigen Rold Skov in Nordjütland zu verbringen, hatte er Whiteys Schicksal besiegelt.
An diesem Tag hatte er sich und seinen vierbeinigen Partner zur falschen Zeit an den falschen Ort verfrachtet. Ein Manöver, das ihn später in die außerordentlich komplexen Ermittlungen im Fall der gehängten Hunde verwickelt hatte, einer Mordserie an einflussreichen Männern – und ihren Hunden.
Vor seinem inneren Auge sah er immer noch messerscharf vor sich, wie auch Mr Whites Leben geendet hatte, obwohl sein Besitzer kein Mensch mit Macht und Einfluss, sondern nur ein Kriegsveteran war.
Nachdem er das Seil durchtrennt und seinen toten Hund vom Baum geholt hatte, war er lange auf dem Boden sitzen geblieben und hatte ihn im Arm gehalten. Als er ihn schließlich im Tal des Lindeborg Å begraben hatte, war er völlig zusammengebrochen.
Seitdem war er nicht einmal mehr in die Nähe eines Hundes gegangen.
Von unten aus der Küche drang ein Rascheln und Klappern nach oben. Er stand auf, zog sich ein T-Shirt über, knipste die Taschenlampe an und schlich barfuß die schmale Treppe hinunter.
Das Rollo in der Küche war nicht heruntergelassen. Für jeden, der sich womöglich dort draußen in der Dunkelheit befand, wäre er eine gut beleuchtete Zielscheibe gewesen, hätte er jetzt das Licht angemacht. Aber die Taschenlampe reichte vollkommen aus, und er verzichtete darauf, das Rollo zu schließen, das er als Erstes hier angebracht hatte. Die Geräusche kamen natürlich aus dem Pappkarton in der Ecke der Küche. Er leuchtete hinein.
Das kleine schwarze Vogelküken duckte sich ins Heu, als es plötzlich hell wurde. Es war eine junge Rabenkrähe. Er hatte sie vor ein paar Tagen im Wald gefunden, wo sie aus dem Nest gefallen war. Auf dem Waldboden hätte sie vermutlich keinen Tag überlebt, also hatte er sie mit nach Hause genommen. Wenn sie ein Fighter war, würde sie sich eingewöhnen und sich groß und stark fressen, bis er sie wieder freilassen konnte. Die Alternative ergab sich wie immer von selbst.
Rabenkrähen, Saatkrähen und die seltenen Raben tauchten in keiner Beliebtheitsstatistik auf, aber diese großen Vögel übernahmen eine wichtige Aufgabe im Gefüge der Natur. Außerdem hatte man nachgewiesen, dass Krähen und Raben zu den intelligentesten Vögeln gehörten. Wenn das Küken in der Pappschachtel auch so clever war, würde es seine Hilfe annehmen.
Er machte die Taschenlampe aus, setzte sich auf den wackeligen Küchenstuhl und drückte den Knopf seiner Armbanduhr. 02:11, viel zu früh, um aufzustehen. Viel zu spät, um etwas an der Tatsache zu ändern, dass er sich hellwach fühlte – und wie gerädert.
Das Wiedersehen mit dem Kuhmann im Nebel hatte ihn in Panik versetzt, das Reh in Alarmbereitschaft. Jetzt musste der Adrenalinspiegel erst mal wieder sinken.
Einer der Vorteile seines Aufenthaltes bei Johannes Fisch war bisher gewesen, dass er die Sieben nur selten zu Gast gehabt hatte. Seiner persönlichen Theorie zufolge lag das an der harten physischen Arbeit, weil sein Körper – und damit auch sein Kopf – danach total erschöpft war und sich ausruhen musste.
Die grellen Flashbacks, die ihn jederzeit und überall treffen konnten, wenn irgendwer oder irgendetwas sie triggerte, kamen immer noch, aber er hatte das Gefühl, dass auch sie seltener geworden waren. Vielleicht weil die Welt hier bei Fisch so überschaubar und von täglicher Routine geprägt war.
Er ließ die Muskeln seines rechten Oberarms spielen. Der Bizeps war inzwischen groß und fest geworden. Das hatte im Keller im Rentemestervej noch ganz anders ausgesehen. Er hatte sich zwischen Regenbogenforellen und Baumstämmen in eine gute physische Verfassung geschuftet.
Johannes Fisch hatte verlegen ausgesehen, als er ihm fünfundzwanzig Kronen pro Stunde angeboten hatte. Mühsam hatte er seinem rumänischen Retter auf Englisch erklärt, dass die Fischzucht veraltet sei und nicht viel abwerfe, weshalb er einem Mitarbeiter leider nicht mehr zahlen könne.
Fünfundzwanzig Kronen war nicht viel. Aber dafür bekam er das Geld bar auf die Hand. Es kursierten eine Menge Geschichten darüber, wie osteuropäische Hilfskräfte in Dänemark für Arbeitgeber ackern mussten, die ihnen, ohne dabei rot zu werden, miserable Löhne rüberschoben. Was Johannes Fisch betraf, hatte er keinen Zweifel: Der Alte war wirklich nicht in der Lage, mehr zu zahlen, wenn er selbst überleben wollte. Aber im Grunde war das auch egal. Oxen brauchte kein Geld.
Die Krähe hatte aufgehört zu rascheln. Vielleicht spürte sie, dass er hier im Dunkeln saß und ihr Gesellschaft leistete.
Die Wahrheit war, dass die ganze Sache rund um die gehängten Hunde sein bescheidenes Dasein zerstört hatte, wie eine Granate, die alles im Umkreis in Stücke reißt. Nichts war mehr so wie zuvor.
Irgendwann, wenn er sich dazu in der Lage fühlte, würde er die Bruchstücke aufsammeln, sie sortieren und wieder zusammenbauen, bis er ein Fundament hätte, das ihn tragen konnte. Aber vorläufig war er bei Fisch im Stand-by-Modus. Auf unbestimmte Zeit.
Margrethe Franck … Manchmal musste er an sie denken, an die einbeinige Frau vom PET, mit der man ihn gezwungen hatte zusammenzuarbeiten. Wenn sie ihn jetzt sehen könnte … In ausgeleierter Unterhose und löchrigem T-Shirt, auf einem wackeligen Stuhl in einer vergammelten Küche, wo die Ratten hinter der Wandverkleidung rumorten, in einem abbruchreifen Haus – und in der Gesellschaft eines Krähenkükens … Was würde Margrethe Franck da sagen?
»Manchmal« war gelogen. Sie war sein einziger erfreulicher Flashback. Im allerletzten Moment hatte er sie im Stich gelassen. Er erinnerte sich, wie er versucht hatte, die richtigen Worte zu Papier zu bringen. Dreimal hatte er sich verzweifelt bemüht, ihr zu erklären, warum, aber jedes Mal endete es damit, dass er das Blatt zerknüllte. Die richtigen Worte wollten einfach nicht kommen. Und die, die ihm einfielen, klangen falsch. Schließlich hatte er sich mit einem »Liebe Margrethe. Es tut mir leid.« begnügt.
Diese Nachricht hatte er im Hotelzimmer liegen lassen – und war dann mit seinem Rucksack über die Landstraßen losgezogen.
An dem Tag, als er aus dem Rold Storkro verschwunden und vor Margrethe Franck und allen anderen geflüchtet war, an dem Tag hatte seine lange Reise ins Ungewisse begonnen, die in der Silvesternacht bei Johannes Fisch ein Ende gefunden hatte.
Die grausamen Albträume waren seine schlimmsten Gegner, aber da draußen existierte auch eine konkrete Bedrohung. Die alte Fischzucht war ein guter Rückzugsort, doch die Umstände sorgten dafür, dass er sich niemals in Sicherheit wiegen konnte.
Genau aus diesem Grund würde er sich morgen früh wieder in den Server in Singapur einloggen und mit der Maus drei Kreuze setzen, als würde er jeden Monat am 18. eine Lebensversicherung unterschreiben. So konnte er die, die ihm an den Kragen wollten, in Schach halten.
Wenn er dem Computer keinen Befehl gab, würde die Hölle losbrechen, noch bevor das Datum auf den 19. umgesprungen war. Der Server in Singapur würde eine E-Mail mit Anhang freigeben und automatisch an die Nachrichtenredaktionen von DR, TV2 und den fünf größten dänischen Tageszeitungen verschicken. Im Anhang würde sich ein Video von vierundzwanzig Sekunden Dauer befinden.
Der kurze Clip zeigte den dänischen Justizminister, Ulrik Rosborg, der von vielen klugen Köpfen bereits als heißer Kandidat für den Posten des Staatsministers gehandelt wurde. Den Mann, der es geradezu ikonisch fertigbrachte, drei unvereinbare Größen in sich zu vereinen: Gesundheit, Moral und Politik.
Ulrik Rosborg war der Inbegriff des gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Ein Sportler, der am Ironman auf Hawaii teilgenommen hatte. Einer, der die Nation zu sich nach Hause in die offene Wohnküche eingeladen hatte, zu einem vitaminreichen Low Fat-Frühstück, das er vor laufenden Fernsehkameras für seine beiden bildhübschen Kinder und seine gepflegte Innenarchitektinnen-Ehefrau gezaubert hatte.
Das war so gut und gesund gewesen, dass gleich eine ganze Serie aus der ballaststoffreichen Botschaft auf dem idyllischen Landsitz in Nødebo entstanden war. Seither präsentierte Rosborg sich bereitwillig in jedem gesunden Zusammenhang.
Der Videomitschnitt, der von der Überwachungsanlage auf Nørlund Slot im Rold Skov aufgezeichnet worden war, zeigte dagegen einen Justizminister, der vollkommen enthemmt eine Frau von hinten vergewaltigte und dabei wie besessen an dem Halsband zerrte, das sie trug. Er zog es immer enger und hörte erst auf, als sie längst erstickt war.
Der kurze Film war mit einem Datum und einer Jahreszahl versehen und wurde von einem kurzen Text begleitet: »Justizminister Ulrik Rosborg und Virginija Zakalskyte (Vilnius, Litauen) auf Nørlund Slot.«
Diese Szene genügte, um die Furcht einflößenden Kräfte, mit denen Margrethe Franck und er zwischenzeitlich Bekanntschaft gemacht hatten, im Zaum zu halten. Tatsächlich käme es aus deren Sicht einer Katastrophe gleich, sollte er aus irgendeinem Grund sterben – und sich nicht mehr in den Server einloggen können.
Ihm war bewusst, dass Franck und er bei ihren Ermittlungen ins Innerste vorgedrungen, dass sie mit dem Kern einer Machtsphäre von ungeahnter Dimension in Berührung gekommen waren. Einer Macht, die auf das mittelalterliche dänische Parlament zurückging, den Danehof. Dieser hatte sich einst auf Nyborg Slot versammelt und war jahrhundertelang im Verborgenen weitergeführt und in der Gegenwart unter anderem in den äußerst renommierten Thinktank namens Consilium überführt worden.
Die Dokumente, die er auf Nørlund Slot gestohlen hatte, enthielten Namenslisten und Tagebucheinträge. Eine minutiöse und überaus beunruhigende chronologische Darstellung verschiedener Vorgänge, die offenbarte, dass Liquidierung als probates Mittel betrachtet wurde, wenn sich die dunklen Männer der Macht verteidigen mussten.
Einige der Dokumente, die besonders kompromittierenden, hatte er für sich behalten. Er hatte sie zunächst seinem Freund L. T. Fritsen zur Aufbewahrung geschickt, sie aber später zurückbekommen und unzählige Male durchgeackert. Jetzt waren sie sorgfältig versteckt, vergraben in einer Plastikbox am Fuße einer großen Lärche.
Den Rest der Schriftstücke hatte er kopiert und per Post an den Museumsdirektor von Nyborg Slot weitergeleitet, mit dem Margrethe und er sich im Rahmen der Ermittlungen damals getroffen hatten. Der junge Historiker war Experte für den Danehof und gerade dabei, eine wissenschaftliche Abhandlung darüber zu schreiben. Oxen hatte ihm die Dokumente anonym zugesandt. Hoffentlich würden sie dem enthusiastischen Museumsmann bei seinen Forschungsarbeiten nutzen.
7.
Eisige Schauer liefen ihm über den Rücken, und er zuckte mit den Schultern, um die Kälte abzuschütteln.
Er war vierundfünfzig Jahre alt, stellvertretender Polizeidirektor und Leiter des Morddezernats. Und dieser Mord war wahrlich nicht der erste in seiner langjährigen Karriere. Dass er trotzdem so reagierte, lag an zwei besonderen Umständen:
1. Der Schauplatz … Der Fundort des Opfers war kein geringerer als der Danehof-Saal, von dem aus Dänemark einst regiert worden war. Er hatte das Gefühl, in die Vergangenheit katapultiert worden zu sein. Würde als Nächstes womöglich Königin Margrethe I. mit ihrem Gefolge durch den Saal schreiten? Und was müsste ein heutiger Chefermittler dann an Untertänigkeit an den Tag legen?
2. Die Presse … Ein Szenario wie dieses war ganz nach ihrem Geschmack. Die Kamerablitze der Polizeitechniker waren die bösen Vorboten des Blitzlichtgewitters, das ihm noch bevorstand. Genau wie er selbst sich gerade ins Mittelalter zurückversetzt fühlte, würde auch die Presse ein Drama ohnegleichen entwerfen. Das hier war spektakulär. Wie hungrige Hyänen würde sich die Pressemeute auf diesen Fall stürzen. Und wenn er etwas abgrundtief hasste, dann waren es Journalisten, die seine Ermittlungen behinderten.
Er hieß Hans Peter Andersen, wurde aber H. P. Andersen genannt. Wenn man so wollte, unterschied ihn nur sein zweiter Vorname von der berühmtesten Persönlichkeit, die je in diesem Land gelebt hatte, dem Märchendichter Hans Christian Andersen. Abgesehen von ihrem Namen und der Tatsache, dass sie beide in Odense aufgewachsen waren, hätten sie allerdings nicht unterschiedlicher sein können.
An der Arbeit eines Polizisten war in dieser Welt voller Verbrechen gar nichts märchenhaft. Hier ging es ausschließlich um Fakten, und weder die Königin noch irgendwelche adligen Herren oder Ritter würden diese Bühne betreten.
Der andere Andersen dagegen hätte vielleicht eine tolle Geschichte aus dem Durcheinander hier gemacht. Genau wie die verfluchte Presse.
»Und Sie sind sich ganz sicher, Bromann? Ist er es wirklich?«
Er war mit Plastiktüten an den Füßen in der Tür stehen geblieben und drängte ungeduldig auf eine Bestätigung durch den Mann im weißen Overall. Dabei gehörte er selbst auch zu der Sorte Mensch, die sich am Tatort nicht festlegen wollte.
»Ja, ja, ja, wollen Sie es vielleicht auch gleich schriftlich, H. P.?«
»Sie wissen doch, wie das ist. Ich muss einfach ganz sicher sein. Das hier ist Mist, ganz großer Mist.« Der Chefermittler hob abwehrend eine Hand und versuchte zu lächeln.
Aufgebracht, wie er war, fügte er seiner Liste noch einen dritten Punkt hinzu:
3. Das Opfer, das in einer Blutlache lag, hatte keinen Ausweis bei sich, aber es bestand nicht der geringste Zweifel daran, dass es sich um Museumsdirektor Malte Bulbjerg handelte, den Chef des Schlosses. Bromann wusste das besser als jeder andere. Er wohnte schließlich selbst in Nyborg.
Und um dem ganzen Durcheinander noch ein weiteres spektakuläres Detail hinzuzufügen: Der Museumsdirektor war nicht einfach umgebracht, sondern ganz offensichtlich kaltblütig hingerichtet worden. Ein tödlicher Schuss in die Stirn des Mannes und ein weiterer in sein linkes Auge. Es wirkte, als ob der Museumsmann mit einer Art Signatur versehen worden wäre. Weshalb sollte man sonst eine Kugel ins Auge platzieren?
Bromann, der erfahrenste Rechtsmediziner von allen, auf den er große Stücke hielt, hatte natürlich Vorbehalte geäußert. Er wollte den Mann zuerst bei sich auf dem Obduktionstisch haben, um sich einen Überblick über die Einzelheiten zu verschaffen, bevor er eine vernünftige Theorie über die beiden Schüsse äußerte. Aber in der Praxis … Eine Kugel in die Stirn war nun mal tödlich. Von den genaueren Erkenntnissen über die Schüsse würde die Presse nichts erfahren. Dafür würde er schon sorgen.
»Oha …« Bromann, der neben der Leiche kniete, beugte sich nach vorn.
»Was ist?«