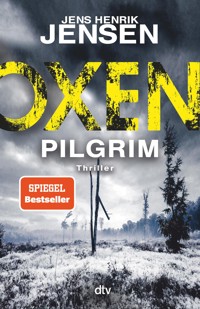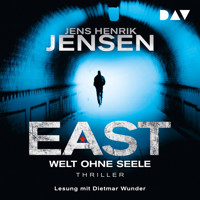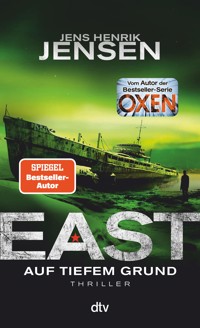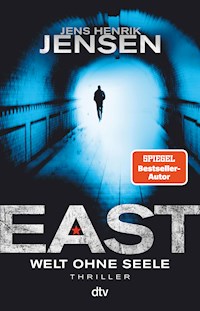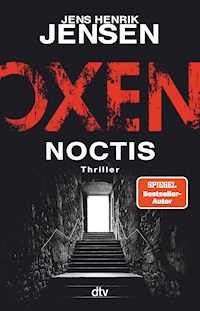
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Niels-Oxen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Über Niels Oxen bricht die Nacht herein … Niels Oxen kämpft um das, was ihn ausmacht: seine Menschlichkeit. Sein dunkelster Fall. Teil fünf der furiosen Oxen-Serie Alles könnte gut werden: Flashbacks und Albträume quälen Niels Oxen seltener und er denkt darüber nach, was ihm in seinem Leben fehlt: Beziehungen. Und Liebe. Da bittet Ex-PET-Chef Mossmann ihn um Unterstützung. In einer verlassenen Kiesgrube sind die Leichen ermordeter Veteranen gefunden worden. Bedroht das Land ein Sniper? Unachtsam geworden, wird Oxen verschleppt – und dort, wo er erwacht, gibt es nur Dunkelheit … Für Leser:innen von Jussi Adler-Olsen, Stieg Larsson und Fans von skandinavischen Krimis und Thrillern. »Die Oxen-Serie von Jens Henrik Jensen ist einfach großartig!« Saarländischer Rundfunk »Oxen hat über die Jahre immer mehr an Charakter gewonnen. In vielerlei Hinsicht ist Oxen inzwischen bedeutsamer als Jensen. Aber das nehme ich ihm nicht übel – im Gegenteil, es ist das schönste Kompliment für mich.« Jens Henrik Jensen Alle Bände der Niels-Oxen-Reihe: Band 1: OXEN. Das erste Opfer Band 2: OXEN. Der dunkle Mann Band 3: OXEN. Gefrorene Flammen Band 4: OXEN. Lupus Band 5: OXEN. Noctis Band 6: OXEN. Pilgrim Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem die skandinavischen Thriller-Serien SØG und EAST erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
»Lagerplatz. Schutzhütten. Kriegsveteranen. Das waren unbehagliche Parallelen zwischen seinem eigenen Gefühl einer latenten Bedrohung draußen im Gribskov und den Ereignissen, die sich offenbar tatsächlich in Ostjütland abgespielt hatten.«
Niels Oxen träumt von einem Leben ohne Angst. Die Sitzungen bei Trauma-Therapeutin Leyla Damjanovic geben ihm Kraft. Flashbacks quälen ihn seltener, und das Verhältnis zu seinem Sohn Magnus entspannt sich zusehends.
Ausgerechnet jetzt bittet Ex-PET-Chef Mossman ihn um Unterstützung in einem Fall, der weite Kreise zieht. Auf dem Gelände einer verlassenen Kiesgrube und an einer geschützten Stelle im Wald sind die Leichen von sieben Veteranen gefunden worden. Die Männer wurden aus einiger Entfernung erschossen. Wird das Land von einem Sniper bedroht? Und was hat es mit der gemeinsamen Militärvergangenheit der Opfer auf sich? Als Ex-Elitesoldat fühlt Niels Oxen sich verantwortlich und gibt Mossmans Drängen nach. Immerhin wird Margrethe Franck an seiner Seite sein, die schon mit ihm den Danehof zerschlug. Doch ist er wirklich stark genug?
Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem erschienen:
OXEN – Das erste Opfer
OXEN – Der dunkle Mann
OXEN – Gefrorene Flammen
OXEN – Lupus
OXEN – Noctis
OXEN – Pilgrim
SØG – Dunkel liegt die See
SØG – Schwarzer Himmel
SØG – Land ohne Licht
EAST – Welt ohne Seele
EAST – Auf tiefem Grund
Jens Henrik Jensen
Oxen
Noctis
Thriller
Aus dem Dänischen von Friederike Buchinger
Teil I
Die Welt
1.
Sein winziges Universum war rund und genauso grauenhaft wie das große. Die Aussicht war begrenzt und grenzenlos zugleich. Er konnte alles heranzoomen und schwenken. Dinge und Lebewesen zu sich heranholen oder von sich wegstoßen. Konnte sie ins Jenseits befördern und ihrer Existenz ein Ende bereiten.
Alles geschah immer in diesem kreisförmigen Querschnitt des Augenblicks, geformt und skalierbar gemacht mithilfe der besten Prismen im Zielfernglas der Firma Schmidt & Bender aus Wetzlar, dem Herzen der deutschen optischen Industrie, wo auch so berühmte Namen wie Leica und Zeiss zu Hause waren. Er dagegen hatte schon immer auf S&B geschworen.
Er hatte das Gefühl, sein halbes Leben in dieser speziellen Dimension der Wirklichkeit verbracht zu haben. Hier bestimmte nur er, mit dem uneingeschränkten Mandat, das der 601 Millimeter lange Gewehrlauf seiner finnischen Tikka T3CTR ihm verlieh.
Er entschied über Leben. Und Tod.
Mit dem rechten Auge immer auf der Hut – und mit dem linken auf Stand-by.
Er zog das Tarnnetz ein wenig zurecht und konzentrierte sich dann wieder auf die vier Männer, die unbeirrt weiterwanderten und es doch nicht schafften, das dünne Fadenkreuz mit den winzigen dots abzuschütteln, das fast wie angeboren vor seiner Iris lag.
Gerade befanden sich die Gestalten mit ihrer militärischen Ausrüstung auf offenem Feld. In Reih und Glied marschierten sie durch die verwehten Schneereste das letzte Stück auf den Waldrand zu.
Der Abstand zu ihnen betrug rund dreihundert Meter.
Vorweg ging der Größte, energisch und mit auffallend geschmeidigen Bewegungen. Hinter ihm folgte der kleine Dicke und als Dritter kam der Stämmige mit den breiten Schultern. Die Nachhut bildete ein hagerer Typ mit schwarzem Käppi.
Jetzt sagte – oder besser gesagt rief – der Fette irgendetwas, vermutlich war es an den Gruppenführer ganz vorn gerichtet, und rieb sich dabei mit einem breiten Grinsen den Bauch.
Aber die Entscheidung war schon lange gefallen:
Noch bevor dieser Tag zu Ende ging, würde das Leben dieser Männer Geschichte sein.
2.
Der gellende Ruf von hinten ertönte, während er gerade die Stille und die leisen Geräusche genoss, die die kleine Gruppe auf dem gefrorenen Boden verursachte. Das Keuchen im Rücken war zwar lauter, als er es gewöhnt war, aber wenigstens ging es vorwärts. Die einzige Richtung, die es gab.
»Oxen! Wann gibt’s endlich was zu essen, Mann? Ich könnte einen ganzen … Ochsen verdrücken!«
Der Ausbruch wurde mit vereinzeltem Gelächter quittiert. Er lächelte, aber als er antwortete, war sein Gesicht wieder ernst.
»Immer mit der Ruhe, Skram. Gegessen wird erst, wenn wir den Shelterplatz erreicht haben. Ich schlage vor, dass du ein paar Fallen aufstellst und uns was Leckeres besorgst, einen Hasen oder von mir aus auch ein Eichhörnchen.«
»Eichhörnchen? Hast du sie noch alle, Chef? Ich habe eine Lunchbox mit Roastbeef, Remoulade und Röstzwiebeln dabei, ganz zu schweigen von den zwei Schweinerippchen mit Rotkohl«, gluckste der kräftige Mann.
Ihre kleine Truppe sah auf den ersten Blick vielleicht aus wie eine Militäreinheit im Einsatz, war aber absolut zivil und verfolgte ausschließlich soziale Zwecke.
Man hatte ihm den gut gemeinten Rat gegeben, dass sich innerhalb der Gruppe alle mit Vornamen ansprechen sollten, um den zivilen Charakter des Projektes und die Gleichrangigkeit untereinander zu betonen. Er hatte den Rat ignoriert. Wo diese Männer herkamen, war nur der Nachname üblich, und er selbst würde sich sowieso niemals daran gewöhnen, Menschen, die er kaum kannte, beim Vornamen zu nennen.
Der Einfachheit halber – oder war es ein Reflex? – bezeichnete er die Teilnehmer gedanklich nach ihrer Funktion, wenn er ihre Handlungsmuster reflektierte oder sie insgeheim beobachtete. In seiner Vorstellung bildeten sie die kleine Einheit, die ihm am vertrautesten war: eine Jägerpatrouille. Er war der Patrouillenführer und dazu kamen, wie es sich gehörte, ein Späher, ein Funker, ein Sprengmeister und ein Sanitäter, der sein Flickzeug dabeihatte.
Trotz seiner Abneigung gegen Vornamen wusste er natürlich, dass der hungrige Skram mit der Remoulade tatsächlich Peter hieß, und er kannte auch die Geschichte, warum aus dem Peter vor einer halben Ewigkeit ein »Peder« mit weichem »d« geworden war. Angeblich war das seinem ausgesprochen ungeschickten Verhältnis zu Schusswaffen geschuldet. Denn mit dem Konsonantenwechsel trug er nun denselben Namen wie die dänische Fregatte »Peder Skram«, die sich 1982 weltweit in die Schlagzeilen geschossen hatte, als sie bei einer Übung versehentlich eine Harpoon-Rakete auf ein Ferienhausgebiet in Lumsås auf Seeland abfeuerte – zum Glück ohne dass Menschen zu Schaden kamen, da gerade keine Urlaubssaison war.
Es gab keine dumme Bemerkung über den gut gepolsterten, ewig hungrigen Peter, Peder Skram, die nicht schon gemacht worden war. Deshalb beließ er es bei einer kurzen Antwort.
»Okay. Aber die Proviantpakete reichen nur für den Lunch, Skram. Deshalb ernenne ich dich hiermit zum Verantwortlichen für das Abendessen.«
Im Gefolge hinter seinem Rücken wurde gefeixt.
»Wie weit ist es bis zum nächsten Supermarkt, Oxen? Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Skram unser Küchenchef sein soll.«
Es war der Sprengmeister, der aus dem Hintergrund kommentierte.
»Supermarkt? Hier gibt es im Umkreis von zehn Kilometern keine Geschäfte. Unser Hoflieferant ist die Natur. Wenn Skram völlig versagt, müssen wir Rinde nagen«, antwortete er.
Der Sprengmeister schnaubte.
»Rinde nagen? Jetzt dreht er endgültig durch … Wir stimmen ab. Wer ist dafür, dass wir Oxen als Mentor und Expeditionsführer absetzen und uns auf der Stelle zur nächsten Kneipe durchschlagen?«
Mentor?
Er ließ sich das Wort einen Moment lang auf der Zunge zergehen. Es schmeckte irgendwie komisch. Hmm. Mentor … Aber auch wenn er sich von Anfang an nicht so richtig mit dieser Rolle hatte identifizieren können, war er genau das – ein Mentor.
In die Ecke gedrängt, hatte er schließlich zugestimmt, Teil dieses sogenannten Mentorenprogramms für Kriegsveteranen zu werden. Für Leute, die eine helfende Hand brauchten. Leute, die aus unterschiedlichen Gründen in Schwierigkeiten steckten. Die Mühe hatten, sich wieder in eine Gesellschaft einzugliedern, in der die Menschen sich über eine geregelte Erwerbsarbeit definierten, der keiner von ihnen nachging …
Also für Leute wie ihn.
Mit dem kleinen Unterschied, dass er früher zur Elite gehört hatte, zu der Truppe mit den bordeauxroten Baretts und dem nahezu unerreichbaren Schulterabzeichen, auf dem »Jäger« stand.
Die Männer, die in einer Reihe hinter ihm gingen, seine Mentees, waren ganz normale Zeitsoldaten gewesen. Und jetzt hatten sie ausgedient.
Er hatte ihren Respekt von der ersten Sekunde an gespürt. Bei ihrem ersten Treffen in der Svanemøllens Kaserne hatte er sich mit vollem Namen, Alter und seiner Jägernummer vorgestellt. Mehr war nicht nötig gewesen.
Sie kannten seine Geschichte und einige seiner Missionen. Sie kannten die Hintergründe für die Verleihung der diversen Ehrenabzeichen, und sie konnten detailgetreu den Handlungsverlauf nacherzählen, der ihm als Einzigem im Königreich das Tapferkeitskreuz eingebracht hatte. Natürlich wussten sie aus den Medien auch, was er in den letzten Jahren durchgemacht hatte und dass er zu einem gewissen Zeitpunkt von allen und jedem gejagt worden war, sogar von der dänischen Polizei, weil er unschuldig unter dem Verdacht gestanden hatte, ein Mörder zu sein.
Wenn er »Deckung« befahl, würden seine Veteranen sich auf der Stelle auf den Bauch werfen.
Wenn er »Bellt!« befahl, würden sie bellen.
»Rinde? Ehrlich? Was denn für Rinde, Oxen?«
Der Sprengmeister klang trotzdem neugierig, jetzt wo er den Gedanken einen Moment hatte sacken lassen.
»Birkenrinde zum Beispiel. Daraus kann man Birkenspaghetti machen oder von mir aus auch Birkennudelsuppe. Aber nur aus dem Kambium, das ist die weiche Schicht unter der äußeren Rinde. Die äußere Rinde hat zu viel Gerbsäure und würde dir den Magen kaputtmachen. Man schneidet das Kambium in dünne Streifen und kocht es fünfzehn bis zwanzig Minuten. Die meisten Nährstoffe landen dabei im Wasser, deshalb sollte man auch die Brühe schlürfen. Im Frühjahr, kurz bevor die Birken ausschlagen, ist der Kohlenhydratgehalt am höchsten. Dann sind ungefähr fünf Prozent von dem, was du einsammelst, Kohlenhydrate. Im Winter ist es etwas weniger. Hier draußen ist eine Menge essbar … und bevor man verhungert …«
»Hast du das ausprobiert, Oxen?«, fragte der Sprengmeister.
»Ja.«
»Wie hat es geschmeckt?«
»Zum Kotzen.«
»Skram, ich will meine al dente, sonst setzt’s was«, brummte der Gruppenälteste, der Sanitäter.
»Haben wir Ketchup? Ich meine, falls es nachher doch Eichhörnchen gibt …«
Der Späher grinste. Er redete nicht oft und es war nicht leicht, ihm ein Lächeln zu entlocken. Aber der Mann hatte in den letzten Jahren auch nicht viel zu lachen gehabt. Er war in Afghanistan gewesen und hatte mitansehen müssen, wie sein bester Freund von einer Bombe zerfetzt wurde, die zwischen Steinen am Wegrand versteckt gewesen war. Das hatte ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Komplett.
»Wie weit ist es noch?«, rief der Sanitäter.
Sprengfallen und all die anderen selbstgebastelten, todbringenden Drecksdinger, USBV, Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, zeichneten sich dadurch aus, dass sie viele in den Abgrund rissen.
Ganz einfach formuliert, bestand seine Aufgabe darin, die Männer wieder aufzurichten. Sie im besten Fall in die Lage zu versetzen, die ersten vorsichtigen Schritte auf dem Arbeitsmarkt zu unternehmen. Er sollte Vorbild sein, sie inspirieren und seine Erfahrungen und Kompetenzen mit ihnen teilen.
Diese Beschreibung stammte nicht von ihm. Er konnte sich nicht daran erinnern, sich an irgendeinem Punkt seines Lebens eingebildet zu haben, anderen etwas beibringen zu können. Schon gar nicht nach seiner Scheidung und dem nachfolgenden Absturz. Nein, die Worte stammten vom Leiter des Veteranenzentrums Kopenhagen, Leif Husum.
Husum, den er seit ihrer gemeinsamen Zeit auf dem Balkan gut kannte, war mittlerweile Oberst und hatte nach einigen Jahren in der Verwaltung des Veteranenzentrums in der Ringsted Kaserne die Leitung seines Standorts in Kopenhagen übernommen, und es fehlte ihm nur noch ein Jahr bis zum Ruhestand.
Husum hatte in seinem Büro gesessen, sich seine Pfeife angezündet, ihm eine Tasse Kaffee eingeschenkt, ihn durchdringend angesehen und dann auf seine stille, gelassene Art sein Anliegen vorgetragen, seine Herausforderung.
Mentor? Vorbild?
Oxen hatte seine eigene prompte Antwort noch deutlich im Ohr: »Danke, nein.«
»Warum nicht?«
»Wie soll ich anderen den Weg zeigen, wenn …«
In der kurzen Pause, in der er die richtige Wortwahl überdenken wollte, hatte der Oberst den Satz für ihn zu Ende geführt:
»… wenn du ihn nicht einmal selbst finden kannst?«
»Exakt.«
»Gerade deshalb, Oxen … Gerade deshalb.«
Der Leiter des Veteranenzentrums hatte seine kleine philosophische Saat in duftenden Tabakrauch gehüllt. Und dann hatten sie das restliche Gespräch darauf verwendet, über die guten alten Zeiten zu sinnieren, die mit wachsendem Abstand nur immer besser wurden.
In den Tagen nach ihrem gemütlichen Nachmittag in der Kaserne war er standhaft geblieben. Er wollte sich nicht als hochdekorierter Superheld zur Verfügung stellen, der den Verkehr aufhielt, damit die kleinen Entenküken wohlbehalten über die Straße kamen.
Er war dafür absolut ungeeignet. Und er war absolut unnachgiebig … Bis zu seinem nächsten Treffen mit Leyla.
Leyla verfügte nämlich über eine erstaunliche Fähigkeit. Leyla konnte ihn ins Wanken bringen. Mit Worten. Voller Vertrauen. Voller Vernunft. Genau wie eine dünne Hebestange etwas Schweres in Bewegung setzen konnte.
Leyla Damjanović war Psychologin und arbeitete für das Veteranenzentrum mit seinen Standorten in landesweit acht verschiedenen Kasernen. Bei ihr hatte er das begonnen, was als »langfristiger Therapieverlauf« vereinbart worden war. Oder anders gesagt: Wann Schluss war, stand in den Sternen.
Darüber hinaus stammte Leyla Damjanović ursprünglich aus Bosnien. Sie war als Kind mit ihrer Familie im Strom muslimischer Flüchtlinge vom Balkan nach Dänemark gekommen.
Leyla war …
»Hallo, Oxen, ist bei dir noch jemand zu Hause?«
Es war der Sanitäter, der von hinten rief.
Er drehte sich um.
»Was ist?«
»Na, was ich dich gerade gefragt habe. Wie lang dauert es noch?«
Oxen war unkonzentriert und in Gedanken weit weg gewesen. Hatte ihn jemand etwas gefragt?
»Wenn du den Weg bis zum Shelterplatz meinst: eine knappe Stunde.«
Sie setzten den Marsch über den leicht gefrorenen Boden fort. Der Wind hatte den Schnee fast überall weggeweht, das Gras knirschte unter ihren Stiefeln.
Selbst jetzt bezweifelte er noch, dass er für diesen Job der geeignete Mann war. Er wusste nur, dass er alles tun würde, was in seiner Macht stand, um den Männern einen Anstoß in die richtige Richtung zu geben.
Das hatte er sich selbst versprochen. Und Leyla.
Sie steuerten auf den Wald zu. Dort im Schatten lag immer noch ziemlich viel Schnee. Jenseits des Waldes würde sich die Landschaft wieder öffnen.
Die Luft war kalt. Er hatte das Gefühl, sie riechen zu können. Es war nur ein schwacher Hauch. Leyla trug immer dasselbe Parfüm, schwer und würzig, und trotzdem leicht und flüchtig. Und so fühlte es sich ja irgendwie auch an. Nah. Und fern. Es sei denn …
»Gehen wir durch den Wald, Chef?«, kam die Frage vom Funker Skram.
»Ja, in einer Reihe«, antwortete er. »Auf der anderen Seite liegt ein Tal. Dort ist das Lager.«
3.
Eine Kunstpause leitete zu dem effektvollen Abschluss über, den die mehr als sechshundert Zuhörer in der Europahalle des Aalborger Kongress- & Kulturzentrums bereits kommen sahen.
Sozialministerin Lis Laugesen war eine scharfsinnige Frau. Nicht ein einziges Mal hatte sie sich verhaspelt oder in irgendeiner Form gezögert.
Sie saß erst seit sieben Monaten auf dem Ministerposten, aber schon jetzt hatte sie sich mit ihrer Professionalität und Sachkenntnis, die sie als ehemalige Leitern des Sozialamts der Kommune Odense mitbrachte, im Ministerium großen Respekt verschafft. An so etwas war man hier nicht unbedingt gewöhnt. Ebenso wenig wie in den restlichen Ministerien des Landes, denn ein Chef mit Berufserfahrung war in der Politik ungefähr so selten wie Tau in der Sonne der Atacama-Wüste.
Die Konferenz für die oberste Führungsebene sozialer Einrichtungen aus allen achtundneunzig Kommunen des Landes war die Idee der Ministerin gewesen. Die Teilnehmer sollten das gewonnene Wissen mit nach Hause nehmen und ihre Institutionen am neuen Kurs der Regierung ausrichten, der an die jüngste, umfassende Sozialreform angelehnt war.
Die Sozialministerin blickte über den Rand ihrer Brille auf die große Versammlung hinunter. Sie hatte genug Selbstbewusstsein, um die Kunstpause in die Stille hinein zu verlängern. Dann blätterte sie die letzte Seite ihres Manuskriptes um.
»Ein langer und spannender Tag neigt sich dem Ende zu. Nehmen Sie die Inspirationen mit in Ihren Alltag, geben Sie die Ideen weiter und sorgen Sie dafür, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen. Dort draußen sind eine Menge Menschen, die auf uns bauen. Vielen Dank …«
Der Applaus war wie eine große Welle, die erst nach einer ganzen Weile die Küste erreichte und dort langsam verebbte.
Die Moderatorin, die durch den Tag führte und als Bindeglied zwischen den verschiedenen Beiträgen fungierte, war ein bekanntes Fernsehgesicht des Senders TV2 und vom Sozialministerium für diesen Anlass engagiert worden. Als Lis Laugesen ihr Honorar erfahren hatte, war sie ausgeflippt und hatte auf den Tisch gehauen, aber das war einen Mailwechsel zu spät gewesen.
»Und nun …«, sagte das Fernsehgesicht und wedelte launig mit einem weißen Umschlag in Richtung Podium, wo inzwischen eine kleine Bronzeskulptur ins grelle Scheinwerferlicht gestellt worden war, »… zum letzten Programmpunkt dieses Nachmittags – der Verleihung des neu gestifteten Preises unseres Sozialministeriums, des Danish Social Work of the Year Award.«
Der Preis, der in den Medien mit großem Interesse zur Kenntnis genommen worden war, trug natürlich einen schicken englischen Namen, ganz wie es sich gehörte.
»Die Nominierten sind …« Wieder hielt die Moderatorin mitten im Satz mit angehaltenem Atem inne, als ginge es um den perfekten Tortenboden bei Das große Backen. Dann fuhr sie fort: »Das Obdachlosenprojekt Heimatlose Herzen, Kopenhagen. Das neue Zentrum für von Gewalt betroffene Frauen in Aarhus. Und … eine soziale Einrichtung in freier Trägerschaft, der Shelter Fonds.«
Mit diesem Preis war Vater Staat über die Schwelle des einzigartigen Award-Universums getreten, wo jeder jedem huldigte – aber vor allem sich selbst – und wo der nächste Schritt unweigerlich The Award for the Best Award of the Year sein würde. Wahrscheinlich musste man demnächst sogar beim Bäcker auf der Shortlist stehen, damit man am Sonntagmorgen nicht leer ausging und seine vier Brötchen und eine Zimtschnecke bekam.
»Und … gewonnen hat …«
Die Fernsehmoderatorin hob den Umschlag, brach das Siegel und zog eine goldene Karte heraus.
»Gewonnen hat … der Shelter Fonds! Darf ich Martin Smed auf die Bühne bitten?«
Ihre Aufforderung ging in dem tosenden Applaus beinahe unter. Es erhob sich zwar nicht Al Pacino und winkte in alle Richtungen, aber der Mann war mit seinem dunkelblauen Anzug und der himmelblauen Krawatte mindestens so gut gekleidet. Martin Smed beschränkte sich darauf, zu lächeln und ein paarmal freundlich zu nicken.
Die geladenen Journalisten ganz hinten im Saal machten große Augen. Ein Gewinner, der nicht aus den eigenen, staatlich geförderten Reihen stammte, war eine richtig gute Geschichte. Und einer mit seinem Hintergrund war sogar noch besser.
Der sechsundfünfzigjährige Martin Smed, Vorstand und Gründer des Shelter Fonds, strahlte Freundlichkeit und Würde aus, als er über das Parkett schritt und ruhig die Bühne betrat, während das Publikum immer noch begeistert klatschte und die Kameras der Pressefotografen blitzten. Er entsprach offenbar genau den Erwartungen und Vorstellungen, die man von einem Mann mit seinen in diesem Zusammenhang ungewöhnlichen Qualifikationen hatte.
Er war studierter Psychotherapeut und verfügte über mehrere Zusatztitel als Coach. Aber weit aufsehenerregender war, dass er als ehemaliger Elitesoldat der sagenumwobenen Spezialeinheit des dänischen Heers, dem Jägerkorps, angehört hatte.
Nur rund vierhundert Männer waren seit 1961 ausgebildet und in physischer wie auch psychischer Hinsicht für uneingeschränkt tauglich befunden worden, dort ihren Dienst zu leisten. Alle wurden sorgfältig ausgewählt, mit den feinsten Gewichten gewogen, und als geeignet erachtet, unter dem höchstmöglichen Druck zu agieren, dem man einen Menschen aussetzen konnte.
Viele träumten davon, sich eines Tages das berühmte bordeauxrote Barett der Jäger auf den Kopf setzen zu dürfen. Die meisten brachen sich auf halber Strecke dorthin das Genick.
Die Sozialministerin erschien mit einem üppigen Blumenstrauß und einem überdimensionierten Scheck über 100 000 Kronen auf dem roten Bühnenteppich.
Mit vollen Händen umarmte sie den Gewinner. Es blitzte erneut, als Blumen, Scheck und zuletzt die Bronzeskulptur überreicht wurden.
Der Beifall erstarb, als die Ministerin ans Mikrofon trat.
»Es ist mir eine große Ehre, dem Shelter Fonds und Martin Smed zu diesem Preis zu gratulieren. Und ich freue mich, Ihnen die Begründung der Jury zu übermitteln. Sie lautet wie folgt: ›Die Jury hat sich einstimmig für den Shelter Fonds entschieden, für das fachlich fundierte Engagement zum Wohle der Schwächsten in unserer Gesellschaft, aber vor allem für eine Bevölkerungsgruppe, um die wir uns als Land in den letzten Jahren nicht gut genug gekümmert haben, auch weil wir, anders als beispielsweise die USA, nicht dieselbe langjährige Tradition auf diesem Gebiet haben – und zwar für unsere Kriegsveteranen … Menschen, die an einer Vielzahl internationaler Missionen mitgewirkt haben, beginnend mit Dänemarks Einsatz während des Bürgerkriegs in Ex-Jugoslawien Anfang der Neunzigerjahre, und die seitdem Narben an Körper und Seele tragen. Wie sonst keine andere Institution erzielt der Shelter Fonds bei seiner Arbeit mit Kriegsveteranen, die von posttraumatischem Stress oder von anderen schwerwiegenden Auswirkungen betroffen sind, wunderbare Erfolge. Die Jury hofft, den Shelter Fondsdurch die Verleihung des neu gestifteten Preises unseres Sozialministeriums, des Danish Social Work of the Year Awards, auch in seinem zukünftigen Wirken zu bestärken und zu inspirieren.«
Die Ministerin machte eine kurze Pause. Dann fuhr sie mit strahlendem Lächeln fort: »Und lassen Sie mich persönlich hinzufügen: Dem schließe ich mich von ganzem Herzen an! Sie haben diesen Preis so sehr verdient. Meine Damen und Herren, Applaus für den Shelter Fonds und Martin Smed!«
Nachdem sich der Beifall gelegt und man den Vorstand und Gründer des Fonds von Scheck und Blumen befreit hatte, trat er ans Mikrofon und hielt die kleine Bronzeskulptur gut sichtbar vor sich hoch.
»Ist sie nicht schön? Ein Herz zwischen zwei Händen … Tausend Dank. Ich widme sie unserem ganzen Team, das an jedem einzelnen Tag einen so herausragenden Einsatz zeigt, das ganze Jahr über. Danke …«
Der ehemalige Jägersoldat drückte die Skulptur an seine Brust und nickte zum Publikum. Es sah aus, als würde er kurz nach den richtigen Worten suchen müssen.
»Ich möchte Ihnen hier und heute auf dieser Bühne nur dieses eine kleine Versprechen geben: Wir werden unsere Arbeit für die Schwächsten der Gesellschaft fortsetzen. Und wir werden uns Mühe geben. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Denn dort draußen sind leider viele, die keine Kraft und keine Mittel haben. Die ihren Alltag nicht allein bewältigen können. Die es nicht schaffen, jeden Tag aufs Neue aufzustehen. Und dabei sind die Kriegsveteranen ja nur eine kleine Gruppe. Sie haben viel gegeben – und so wenig zurückbekommen.«
Martin Smed runzelte die Stirn, als müsste er über etwas nachdenken. Dann fuhr er fort: »Nur eins noch zum Schluss. Der Shelter Fonds ist, wie Sie vielleicht wissen, an einer Reihe von Projekten im Ausland beteiligt. Daher freue ich mich, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass wir bei der nächsten Vorstandssitzung den offiziellen Beschluss fassen werden, unseren Namen in The Shelter Foundation zu ändern – ein Name, der im täglichen Gebrauch wohl etwas besser zu unserer Arbeit über die Landesgrenzen hinaus passt. Da wir bekanntermaßen eine Non-Profit-Organisation sind, gibt es keine Eigentümer oder Aktionäre, die gewisse Gewinnausschüttungen erwarten. Und dafür kann man sehr dankbar sein … Denn schließlich verfolgen wir nur ein einziges Ziel: Wir wollen uns um die Leben kümmern, die vielleicht anders verlaufen sind als meines oder Ihres, die aber dennoch voller Möglichkeiten stecken. Ich danke Ihnen …«
Der Stifter des Shelter Fonds verbeugte sich tief und verließ, von lautem Beifall begleitet, die Bühne, die kleine Bronzeskulptur hoch über den Kopf gehoben. Dann setzte er sich wieder neben seine Sekretärin in die erste Reihe und gab ihr das Kunstwerk, damit sie es auch bewundern konnte.
4.
Das Fadenkreuz in seinem Zielfernrohr heftete sich hartnäckig an die Rücken der Männer, bis zu dem Moment, in dem die Gruppe den Waldrand am Ende des Feldes erreichte.
Der große Durchtrainierte, der die ganze Zeit vorausgegangen war, blieb stehen, um seinen Leuten mit ausladenden Gesten offenbar den weiteren Weg zu erklären.
Anschließend wartete der Mann, wahrscheinlich um dafür zu sorgen, dass auch wirklich alle wohlbehalten durch das Brombeergestrüpp gelangten, bevor sie nacheinander ins Unterholz des Waldes eintauchten.
Ehe er ihnen folgte, drehte er sich um und stand einen Moment reglos da, spähte über Felder und Windschutzhecken, als wollte er sichergehen, dass sie nicht verfolgt wurden. Dann verschwand auch der Gruppenführer im dunklen Dickicht.
Nachdem er selbst den Waldrand gründlich abgesucht hatte, der gesamten Länge nach und in beiden Richtungen, drückte er sich auf die Knie hoch und fing hastig an zu packen. Er rollte die Isomatte, auf der er bis eben gelegen hatte, so fest es ging zusammen und spannte sie mit dem Tarnnetz und dem kleinen, dreibeinigen Schießstock, dem Tripod, auf seinen Rucksack.
Auch wenn es mittlerweile einige Jahre her war, dass er als Scharfschütze auf der Gehaltsliste des Heeres gestanden hatte, vermisste er instinktiv seinen zweiten Mann, seinen Späher – oder wie es an jedem Einsatzort der Welt hieß, seinen Spotter. Dabei ging es ihm einfach darum, einen anderen kompetenten Menschen an seiner Seite zu haben, mit dem er Risiken und Möglichkeiten diskutieren konnte. Denn es verhielt sich exakt andersherum, als die Menschen normalerweise dachten. Der Spotter war der erfahrenere Scharfschütze in diesem Zwei-Mann-Trupp. Der Spotter war der Meister, der Shooter nur der Lehrling. Er selbst hatte unzählige Male als Spotter fungiert.
Seine Aufgabe hier war im Voraus klar umrissen worden und unterschied sich schon allein dadurch vom normalen Modus Operandi eines solchen Zweierteams.
Im Feld ging es in der Regel um Observationen. Man musste sich ein differenziertes Bild vom Normalzustand einer konkreten Örtlichkeit verschaffen. Mehr nicht. Das fing bei banalen Dingen an, wie beispielsweise die Anzahl der Bewohner – oder potenziellen Feinde – in einem Nest aus lehmverputzten Häusern festzustellen, ihnen zu folgen und sich die Männer, Frauen und Kinder einzuprägen, und ging bis zur Überwachung ihrer täglichen Verrichtungen.
Und eines Tages wusste man dann plötzlich, dass etwas im Busch war. Weil ein Detail im Normalbild fehlte. Weil an diesem Tag die spielenden Kinder verschwunden waren und der staubige Fußballplatz verlassen in der Sonne lag. Solche Dinge waren ein klarer combat indicator, ein Hinweis darauf, dass Kampfhandlungen vorbereitet wurden.
Er selbst hatte es in der Helmand-Provinz zweimal erlebt. Beim ersten Mal hatte er noch länger als ein paar Sekunden gebraucht, um die Gefahrensignale zu erkennen. Die Kinder, die nicht da waren.
Ohne grenzenlose Geduld war man hier vollkommen fehl am Platz. Wie oft hatten er und sein Partner nicht über mehrere Tage hinweg an ein und demselben Ort festgesessen? Manchmal stundenlang reglos auf der Lauer gelegen. Und die einzige Abwechslung war der Moment gewesen, wenn die Dosis Imodium versagte und man sich zum Scheißen notgedrungen auf die Seite rollen und die eigenen Hinterlassenschaften danach mit einer Tüte aufsammeln musste, genau wie der Nachbar zu Hause, wenn er seinen Hund Gassi führte.
Diese Aufgabe hier war anders.
Sie war im Vorfeld genau definiert worden. Ohne seine Geduld nennenswert auf die Probe zu stellen oder das Risiko einer Fehleinschätzung: Alle Objekte mussten eliminiert werden. Eine überschaubare Operation aus überschaubarer Entfernung, kaum mehr als fünfhundert Meter, vermutlich weniger.
Er griff in seine Tasche und zog eine seiner kleinen speziellen Feldrationen heraus, einen Frucht-Nuss-Riegel. Mittlerweile hatte er immer mindestens einen davon dabei. Seit er vor ein paar Jahren das Rauchen aufgegeben hatte, war er zu einem Großkonsumenten geworden. Und jetzt, mit steigendem Alter, musste er auch mehr auf seinen Blutzuckerspiegel achten.
Der gesunde Snack bestand im Wesentlichen aus Mandeln, Cashewnüssen und Datteln. Mit dieser Mischung hielt er lange durch. Er hatte seine Favoriten: die roten Riegel mit Apfel-Zimt-Geschmack, die cremefarbenen mit Kokos oder die limettengrünen, die nach … Limette schmeckten. Wenn er eine Sorte überhatte, wechselte er einfach die Farbe. Es gab neun verschiedene. Die Lilablauen mit Vanille und Beeren zum Beispiel hatten sich über den Winter immer mehr zu seinen neuen Lieblingen entwickelt.
Das war zweifellos ein Unterschied zu damals, als er locker auf vierzig Kippen am Tag gekommen war und seine Klamotten immer nach Rauch gestunken hatten.
Bei dem Gedanken rümpfte er die Nase, biss herzhaft in den Limetten-Riegel und machte sich dann daran, die Windschutzhecke hinunterzuschleichen.
Das Gebüsch bestand unter anderem aus Pfaffenhütchen und Apfelbeeren. Er konnte vor sich sehen, wie sie die Hecke im Herbst mit ihrem orangeroten Laub in Flammen gesetzt hatten. Jetzt standen sie mit kahlen Ästen auf der Brandstätte und warteten auf das Frühjahr.
Auf dem Weg fielen ihm die klassischen, robusten Ammenbäume ins Auge, Schwarzerle, Spitzahorn und Eberesche. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, das Unkraut in Schach zu halten und den jungen Bestandsbäumen, vor allem der Traubeneiche, dem Weißdorn und der Vogelkirsche, Schatten zu spenden und Schutz zu gewähren.
Nach ein paar Minuten machte er halt. Hier endete die Hecke. Vor ihm lag das offene, rechteckige Feld. Hundertfünfzig Meter bis zum Wald, ohne Deckung, wie eine Schildkröte ohne Panzer. Auch in solchen Situationen ergänzten zwei Partner einander. Derjenige, der in der Rolle des Spotters war, trug in der Regel auch die Verantwortung für eine M/10, die mit einer Kadenz von achthundertneunzig Schuss pro Minute ziemlich souverän in der Lage war, feindliches Feuer zu erwidern.
Er sah auf die Uhr. Die Gruppe hatte jetzt einen Vorsprung von dreizehn Minuten. Ihm blieb keine Zeit für einen Umweg. Er zurrte seine Ausrüstung fest und machte sich für einen langen Spurt bereit.
Ammenbäume waren das Proletariat der Natur. Nach zehn, fünfzehn Jahren hatten sie ihr Soll erfüllt, wurden gefällt und zu Kleinholz verarbeitet.
Er hatte keine Ahnung, warum die Männer der Gruppe, die sich gerade ihren Weg durch den Wald bahnte, ebenso entbehrlich waren. Und er machte sich auch keine Gedanken darüber. Er schrieb ihnen keine menschlichen Züge und Eigenschaften zu. So war es am einfachsten. Für ihn waren sie nur Dinge auf seinem Weg, die beseitigt werden mussten …
Er duckte sich und rannte los, lief im Zickzack über das offene Feld auf den weißen Streifen Schnee am Waldrand zu.
5.
Sie waren gerade aus dem Wald mit seiner beschwerlichen Schicht aus welkem Laub herausgetreten. Jetzt hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen und bewunderten die Landschaft, die sich unter ihnen ausbreitete.
Eine Sekunde zuvor hatte er seiner Gruppe mit erhobener Hand und einem scharfen Kommando den Befehl gegeben stehen zu bleiben. Er konnte es nicht riskieren, dass die Müdesten unter ihnen einfach gedankenlos und mit gesenktem Blick weitermarschierten und den Abhang hinunterstürzten.
»Wow … ist das schön hier.«
Der Funker war schwer außer Atem und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn.
»Ich bin vor einer halben Ewigkeit mal über diesem Gebiet mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug geworfen worden«, sagte Oxen. »Das ist ein sogenanntes Tunneltal. Es ist in der letzten Eiszeit vom Schmelzwasser eines Gletschers gegraben worden. Die Eiszeit davor ist nicht bis hierher vorgedrungen.«
»Du meintest die vorläufig letzte Eiszeit, oder? Es kann ja gut sein, dass wir noch mal eine bekommen«, sagte der Sprengmeister und zündete sich eine Zigarette an. »Ich meine wegen dem CO2 und dem ganzen Scheiß.«
»Fuck, ich friere doch jetzt schon … Aber wenn schon Eiszeit, dann bitte Häagen-Dazs oder notfalls auch Carte D’Or«, sagte der Sanitäter, ohne eine Miene zu verziehen.
»Und das da unten ist also unser Lager? Für die nächsten drei Tage?«
Der Späher nickte skeptisch zu einer kleinen Handvoll Schutzhütten im Tal, die jenseits eines kleinen Flusslaufs standen, windgeschützt hinter Bäumen und Büschen.
»Schau mal, Skram, da drüben sind Spaghettibäume.«
»Halleluja, wir sind gerettet«, brummte der Sprengmeister.
»Lasst uns runtergehen.« Oxen machte den ersten Schritt die steile Böschung hinunter, trat dann zur Seite und winkte seine Leute vorwärts. »Tut mir den Gefallen und verstaucht oder brecht euch nichts. Ich habe keine Lust, euch nach Hause zu tragen. Und sobald wir unten sind, bilden wir wieder eine Reihe. In dieser Jahreszeit ist der Boden sumpfig.«
Er reichte dem Sanitäter eine helfende Hand.
»Danke, Oxen. Zum Teufel mit dem verdammten Knie …«
»Schon okay. Lass dich vom Sand nach unten tragen.«
Mit seinen siebenundfünfzig Jahren und mit Beinen, die mindestens so zerbrechlich waren wie seine geschundene Seele, hatte der Gruppenälteste allen Grund, sich über den Abstieg Sorgen zu machen.
Als sie sich wenig später wieder sammelten und den Sand von den Stiefeln traten, blieb Oxen einen Moment lang reglos stehen und sah sich nach allen Seiten um.
Die Luft war feuchtkalt, knapp um den Gefrierpunkt, und es wehte nur ein schwacher Wind. Er würde zwei Mann abstellen, die ein ordentliches Lagerfeuer machen sollten. Das würden sie dann am Brennen halten, bis es Zeit für den Heimweg war. Die Feuerstelle befand sich in der Mitte des Shelterplatzes zwischen den vier Schutzhütten. Mit ausreichend Brennholz musste also niemand frieren.
»Schaut.«
Er zeigte in den grauen Himmel, wo eine beeindruckende Silhouette ihre weiten Kreise zog. Die Gespräche der anderen verstummten.
»Oh, der ist groß. Mäusebussard, oder?« Der Späher sah ihn fragend an.
Er schüttelte den Kopf. »Ein Mäusebussard ist kleiner. Achtet auf den gegabelten Schwanz und die schmalen Flügel. Das ist ein Rotmilan. Kite auf Englisch, man erkennt sofort, woher der Name kommt, oder? Er sieht wirklich aus wie ein Drachen.«
Sie konnten den auf- und absteigenden klagenden Ruf des Vogels hoch über ihren Köpfen hören und kurz darauf das heisere Schreien von Krähen oder Dohlen aus dem kleinen Waldstück, das sich im Westen um den Wasserlauf schloss.
Die kahle Landschaft, die Schneewehen, die Feuchtigkeit, die Kälte, das Ur-Echo der Schreie vom ewigen Kampf auf Leben und Tod, all das vereinigte sich in einem Schauer, der ihn eiskalt durchfuhr.
Er gab den Männern das Signal zum Aufbruch und merkte, wie sich jede Faser seines Körpers anspannte.
»Erst das mit der Eiszeit und jetzt auch noch Ornithologe … Der Chef ist ein wandelndes Lexikon«, murmelte der Sprengmeister feixend.
»Lexikon? Ich dachte, das wäre zusammen mit dem Telefonbuch ausgestorben«, sagte der Sanitäter.
»Und mit der Kassette und den Heißwicklern meiner Mutter«, ergänzte der Funker Skram.
»Ihr seid echt nicht auszuhalten. Der Mann ist Jäger. Die kann man mit uns doch gar nicht vergleichen … Die lernen so was. Die sind dazu ausgebildet, alles zu wissen, was um sie herum passiert. Die können auf sich selbst aufpassen. Stimmt doch, Oxen, oder?«
Er hatte das gut gelaunte Gerede der Männer ignoriert, und jetzt ignorierte er auch die Frage des Spähers.
Er sah sich ein weiteres Mal um und versuchte, die Bedrohung zu identifizieren, die er instinktiv spürte.
6.
Sein geübtes Auge folgte jeder Bewegung der Männer unten im Shelterlager. Sie scherzten und amüsierten sich offenbar. Nicht ahnend, dass ihr Leben bereits in die finale Phase eingetreten war.
Er lag ideal. Ziemlich weit oben, am Rand eines Gebüschs, wo die Übergänge flimmerten und dem Tarnnetz entsprachen, das er zu diesem Zweck ausgesucht und um eine Handvoll helles trockenes Gras ergänzt hatte.
Wie ein Chamäleon, das seine Zunge blitzschnell herausschießen ließ, um sich ein Insekt zu schnappen, lauerte er reglos auf seiner Matte und wartete den perfekten Augenblick ab.
Der war gekommen, wenn alle Gegebenheiten nach seinem Geschmack waren. Nicht früher. Nicht später. Und zwar genau dann, wenn er sämtliche Männer in seinem Zirkel versammelt hatte. Wenn mit vier Schuss und dreimal Durchladen alle abgedeckt waren.
Wenn der Zielpunkt ruhig vom einen zum Nächsten gleiten konnte, ohne zu rucken. Und wenn sie sich nicht in unmittelbarer Nähe in Deckung bringen konnten oder die Möglichkeit hatten zu fliehen.
Dieser Augenblick konnte in der nächsten Sekunde eintreffen, in einer Stunde oder auch erst in drei. Aber am späten Nachmittag würde es dunkel werden, und dann würde er genau hier übernachten und morgen wieder auf seine Gelegenheit warten.
Jetzt gerade fehlte nur ein einziger Teil seiner Kalkulation: Der groß gewachsene, geschmeidige Anführer der Truppe war seit knapp zehn Minuten in dem Waldstück verschwunden, das an die Lichtung mit den mit Gras bewachsenen Shelterhütten angrenzte. Ohne ihn gab es keine Ordnung im Universum.
Er legte den Griff des Gewehrs auf dem Dreibein ab. Es war vernünftig, das Auge von Zeit zu Zeit auszuruhen und die Konzentration ein bisschen zu lockern. Stattdessen nahm er das Fernglas.
Diese Stelle war nicht nur wegen der freien Sicht hervorragend geeignet. Auch der Abstand war optimal. Die Berechnung beherrschte er im Schlaf. Selbst wenn er irgendwann in hoffentlich ferner Zukunft tot und zu Asche verbrannt sein würde, wäre seine Seele – sofern er eine hatte – noch in der Lage, mithilfe des Mildot-Fadenkreuzes jeden Abstand zu bestimmen. Die Größe des Ziels geteilt durch die Anzahl der Punkte im Fadenkreuz ergab die Entfernung in Kilometern.
Vierhundert Meter.
Ach ja.
Und sogar leichter Wind.
Eine ziemlich bescheidene Herausforderung, aber das würde ihn nicht dazu verleiten, die Sorgfalt schleifen zu lassen.
Es wurde Zeit für die letzten Vorbereitungen. Er holte seine Kestrell 5700 aus dem Rucksack. Eine handliche kleine meteorologische und ballistische Messstation, die einem, wenn man sie im Vorfeld mit allen nötigen Daten über die Munition gefüttert hatte, eine zuverlässige Prognose der Flugbahn des Projektils lieferte.
Der Wind wehte mit vier Metern pro Sekunde aus nördlicher Richtung. Er schoss nach Westen. Ergo musste er das Zielfernrohr zwölf clics nach oben korrigieren. Tat er das nicht, würde er das Objekt um einen halben Meter verfehlen.
Zwischen den Bäumen flimmerte etwas. Er nahm das Gewehr wieder auf, legte den Kolben an die Schulter und schloss das linke Auge.
Es war der Große, der Patrouillenführer, der aus dem Wald kam und auf den Shelterplatz zuging.
Das Fadenkreuz wanderte fast automatisch in die Mitte des Torsos.
Sein Finger glitt nach unten und legte sich vorsichtig auf den Abzug.
7.
Die vier Shelterhütten standen in einem Halbkreis, mit der offenen Seite zur Feuerstelle. Sie waren solide in Blockbauweise errichtet, hatten Dächer, die mit Gras bewachsen waren, und die typischen, tief nach unten gezogenen Überstände, die selbst bei schlechtester Witterung Schutz boten. Hier ließ es sich problemlos ein paar Tage aushalten.
Genau wie versprochen lag hinter einer der Schutzhütten unter einer Plane ein kleiner Stapel trockenes Brennholz. Trotzdem hatte er seinen Männern den Auftrag gegeben, noch mehr zu sammeln. Viel mehr.
Es war keine überraschende Erkenntnis: Der Homo sapiens konnte nun mal nicht ohne Feuer überleben. Mit Tagestemperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und bei minus sieben, acht Grad in der Nacht würden sie reichlich Holz brauchen, um ihr Feuer zweiundsiebzig Stunden lang am Leben zu halten.
Er war zwar der Mentor der kleinen Gruppe von Kriegsveteranen, aber er hatte kein Programm für die kommenden Tage geplant. Sie sollten einfach Zeit zusammen verbringen und – wenn sie Lust dazu hatten – große und kleine Sorgen miteinander teilen. Auch das war eine Form von Therapie, hatte Leyla gesagt.
Vielleicht würde er ihnen beibringen, wie man Fallen baute und wie man das Vorfach mit dem Senkblei an der richtigen Stelle in einem Wasserlauf platzierte. Sie könnten auch eine Portion Birkenspaghetti kochen, wenn die Männer das wollten, aber die Wahrheit war, dass er reichlich gefriergetrocknete Feldrationen in seinem Rucksack dabeihatte. Das wussten die anderen nur noch nicht.
Eine Bürokraft der Svanemøllens Kaserne hatte die Tour in einem Facebook-Beitrag als »Survival-Trip mit N. Oxen, Dänemarks höchstdekoriertem Soldaten aller Zeiten« beschrieben.
Die Nachricht hatte sich offenbar in Windeseile in Soldaten- und Veteranenkreisen verbreitet. Das Zentrum konnte sich jedenfalls kaum vor Anrufen retten, weil sich aus allen Ecken des Landes Leute für die Tour anmelden wollten. Knapp dreihundert Anfragen. Das war allerdings ein großes Missverständnis. Es gab keine offene Einladung für diese Tour. Sie fand nur für die vier statt, die jetzt unter seinem Kommando standen. Wobei das mit dem Kommando lediglich seine persönliche Auslegung der Situation war, denn natürlich waren sie alle schon lange Zivilisten.
Darüber hinaus war es irreführend, das Ganze als »Survival-Trip« zu bezeichnen. Für Menschen, die Narben auf der Seele hatten wie die, mit denen seine Leute gebrandmarkt waren, bedeutete jeder Tag einen Kampf ums Überleben. Sieben Tage die Woche, dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr. Sie hatten es nicht nötig, hier die Naturburschen zu spielen und für ein Wochenende die Zivilisation hinter sich zu lassen, um zu überleben.
Er beobachtete die vier Männer, die vollauf damit beschäftigt waren, das Lager bewohnbar zu machen. Mit sichtlicher Freude widmeten sie sich ihren Aufgaben.
In Wahrheit waren sie hierhergekommen, um zu leben, mit neuer Intensität, unter den denkbar einfachsten Bedingungen, mitten in der Natur.
Das galt auch für ihn selbst. Wie er jederzeit überleben konnte, wusste er – aber jetzt musste er lernen, die andere Dimension zu meistern: das Leben. Sonst würde er wie schon in Vangede erneut in alte Muster zurückfallen.
Er würde sich isolieren. Sich einfach wieder von der Dunkelheit verschlucken lassen und nachtaktiv werden, wie die wilden Tiere, die er sich tagsüber im Fernsehen ansah.
Nachdem ihn die Wölfe aus seiner Wohnung in der Dalstrøget gelockt hatten und er in der jütländischen Heide gestrandet war, hatte Margrethe Franck ihm zu der Erkenntnis verholfen, dass es keinen Grund für ihn gab, nach Vangede zurückzukehren.
Franck, die den Großteil ihrer Zeit mit ihrer Arbeit in der operativen Abteilung des polizeilichen Nachrichtendienstes, des PET, verbrachte, war die Person, die ihn am besten kannte. Ihre Freundschaft reichte zurück bis zu dem Fall mit den gehängten Hunden und hatte tatsächlich als Feindschaft begonnen. Franck las ihn mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der er selbst topografische Kurven, Linien und Symbole dekodierte.
Sie hatte es ihm unmissverständlich klargemacht: Er konnte kein guter Vater für seinen fünfzehnjährigen Jungen sein, wenn er sein Einsiedlerdasein nur jedes zweite Wochenende unterbrach und sonst nie ans Tageslicht kam.
Leyla Damjanović hatte nur wenige Minuten gebraucht, um zu demselben Schluss zu kommen. Sie hatte es mit den überzeugenden Fachwörtern einer Psychologin formuliert, aber die Aussage war die gleiche gewesen: Verlass die alten Pfade, Niels Oxen – oder stirb einen langsamen Tod.
Und hier stand er nun, von zwei Frauen mit einem kräftigen Stoß nach draußen befördert, und hütete wie ein Hirte seine gebrechliche Herde. Wachsam ließ er den Blick über die Umgebung wandern.
Es war immer noch da – dieses Gefühl, dass sie etwas bedrohte.
8.
Das Fadenkreuz des Zielfernrohrs heftete sich auf die Männer wie eine Klette an einen Wollpullover. Unmöglich abzustreifen, selbst wenn man wusste, dass sie da war.
Wenn das Kreuz wie jetzt langsam über die Körper der Männer glitt, war es ein sicheres – aber unsichtbares – Zeichen für die Anwesenheit des Todes. Und wenn sie es nicht sehen konnten, wie sollten sie da irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Zumindest was diesen Aspekt betraf, waren die Arbeitsbedingungen eines Scharfschützen ausgesprochen günstig.
Das Projektil kam immer überraschend …
Mit dem Eintritt des Patrouillenführers in den Zirkel war die Gruppe nun vollständig. Die durchtrainierte Gestalt lehnte jetzt an einer der Hütten. Schon bei der kleinsten Irritation konnte er sofort in Deckung gehen. Ergo war der Gruppenführer sein Objekt Nummer eins.
Ein headshot gehörte ins Reich der Filme und war ausgeschlossen, obwohl der Abstand relativ gering war. Seine Aufgabe lag darin, das Risiko bei jedem abgegebenen Schuss so gering wie möglich zu halten. Er ließ das Fadenkreuz nach oben klettern, bis es mittig auf dem Brustkorb des Mannes lag.
Seine Atmung hatte ganz von allein ihren altvertrauten Rhythmus gefunden, seit der Anführer aus dem Wald getreten war.
Ruhiges Einatmen, kurze Pause, ruhiges Ausatmen.
Sein rechter Zeigefinger betätigte den weichen Teil des two-stage-Abzugs. Jetzt fehlte nur noch ein leichter Druck. Ein einziger Druck zwischen Leben und Tod.
Sein Körper war im Gleichklang mit seinem Atem. Ein Organismus, aus dem die Luft ungehindert ein- und ausströmte.
Man schoss beim Ausatmen, wenn die Sauerstoffmenge im Blut und die Konzentration am höchsten war. Und der Körper ganz entspannt.
Er wartete.
Spürte, wie sich die Ruhe einstellte.
Dann krümmte sich sein Finger.
Der Ase-Utra-Schalldämpfer erstickte den Knall an der Mündung. Der Rückstoß kam sofort, aber er hatte sein Zielfernrohr genauso schnell wieder stabilisiert und überprüfte das Resultat.
Der Patrouillenführer stürzte in die Schneewehe neben der Shelterhütte.
Er lud nach und nahm mit einer schnellen, gleitenden Bewegung das nächste Ziel ins Visier. Eine neue Patrone klickte in die Kammer des Magazins mit zehn Schuss.
Objekt zwei saß wenige Meter weiter auf einem Stein am Lagerfeuer und hob den Kopf. Vermutlich aufgeschreckt durch den Überschallknall des Projektils, das gerade dicht an ihm vorbeigeflogen war.
Mehr als den Blick zu heben, schaffte Objekt zwei nicht mehr.
Der Schuss saß perfekt, leicht schräg in der Herzregion, von links nach rechts. Der Mann sackte zusammen und kippte lautlos zur Seite, er fiel vom Stein und Kopf voraus in die Flammen des Lagerfeuers.
Blitzschnell justierte er die Einstellungen laut seinen vorausgegangenen Berechnungen. Objekt drei und vier trugen jeweils ein Bündel Feuerholz vor sich her. Sie waren ein Stück weiter weg und befanden sich in einem etwas anderen Winkel zum Wind.
Objekt drei war breit und übergewichtig und stolperte, als das Geschoss es in den Brustkorb traf, das Holz immer noch im Arm. Dass ein Projektil in der Lage war, einen menschlichen Körper mehrere Meter nach hinten zu schleudern, kam höchstens im Märchen vor. Objekt drei legte sich stattdessen ins Gras, als wäre es ein weiches Lager, das zum Nickerchen einlud.
Objekt vier folgte gleich danach. Ihm blieben fünf, sechs Meter Zeit, um zu reagieren, plus der Überschallknall natürlich.
Der hagere Mann schöpfte Verdacht, bevor die Patronenhülse ausgeworfen war. Aber Objekt vier handelte irrational und ließ das Feuerholz fallen, machte auf dem Absatz kehrt und rannte Richtung Wald, statt die Flucht nach vorn zu ergreifen und im nächsten Shelter in Deckung zu gehen.
Das war sein Todesurteil.
Er blickte durch das Zielfernrohr und verharrte einen Moment bei Objekt vier. Danach bei drei. Beide lagen reglos am Boden. Dann bewegte er das Visier zurück zum Lagerplatz und zu Objekt zwei. Flammen loderten um den Oberkörper des Mannes.
Zuletzt richtete er den Fokus wieder auf Objekt eins – den Anführer, der sein erstes Ziel gewesen war. Der große, durchtrainierte Mann lag unnatürlich verdreht im Schnee.
Blut sickerte aus seinem Mund und bildete einen harten Kontrast zu all dem Weiß.
Früher hätte er jetzt auf die Meldung seines Spotters gewartet: Treffer, Fehlschuss oder besiegt.
Keiner der vier rührte sich. Also »besiegt«. Er hatte eine perfekte Arbeit abgeliefert und den Objekten und sich selbst die Demütigung erspart, mehr Schüsse als nötig dafür zu brauchen. Er hatte noch nie verstanden, was lustig daran sein sollte, extra Kugeln in einen Kadaver zu pumpen.
Er ließ das Fernrohr zurück zu vier und drei gleiten, und von dort zu zwei und eins. So würde er noch eine Weile hier liegen bleiben und den Blick ruhelos wandern lassen, bis er wirklich sicher war. Er hatte nicht die Absicht, ins Shelterlager hinunterzugehen und die Leichen zu untersuchen. Das gehörte nicht zu seinem Job.
Seine Aufgabe war erledigt.
Wieder einmal hatte er im Stummfilm des Todes Regie geführt.
9.
Die Prothese nervte, und irgendwo drückte etwas, als sie den Flur hinunterhastete. An jedem einzelnen Tag kämpfte sie darum, so zu gehen, dass man ihr nicht ansah, dass ihr die Hälfte des rechten Beins fehlte.
Es herrschte jetzt schon eine ganze Weile Frostwetter und es war wirklich schweinekalt. Lag es an der Kälte? Jedenfalls kam es ihr so vor, als hätte sie im Frühjahr und im Sommer nicht so oft Schmerzen. Aber sagten solche Sätze nicht nur alte, gichtgeplagte Menschen?
Sie jammerte nie über ihr Bein. Und sie wollte auch nie damit anfangen. Never ever. Nunca. Niemals.
»Kommen Sie in mein Büro. Jetzt.« Der Wortlaut dieser SMS war der Grund für ihre Eile. Erstens wurde man normalerweise nicht per SMS zu einer Besprechung gerufen. Und zweitens schon gar nicht von Ove Worre, dem operativen Leiter des Geheimdienstes. Sie konnte sich nicht erinnern, überhaupt schon mal bei ihm zu einem Gespräch gewesen zu sein, zumindest nicht allein. Worre, der den Posten von Rytter übernommen hatte, war ein Mann der alten Schule. Sehr förmlich und ausgesprochen präzise. Immerhin konnte er ein Handy bedienen und hatte keine Brieftaube losgeschickt …
Sie klopfte an und betrat sein Büro. Worre saß hinter seinem Schreibtisch, auf dem sich etliche, ordentlich gestapelte Aktenberge türmten.
»Franck … setzen Sie sich«, sagte er und legte seine Lesebrille ab.
Für einen kurzen Moment schauten sie sich an.
»So eilig, und noch dazu per SMS?«, sagte sie, während sie ihm in die Augen sah. »Worum geht es?«
»Ich hielt es für den diskretesten Weg. Womit sind Sie gerade beschäftigt?«
Genau genommen sollte der Mann das ja eigentlich wissen, aber er war wahrlich nicht der erste Chef, der keinen blassen Schimmer davon hatte, was seine Mitarbeiter trieben. Das galt für das Hauptquartier des PET in Søborg und vermutlich auch für den ganzen Rest der Welt.
»Mit den drei syrischen Rückkehrern im Kopenhagener Westen, die wir für Dschihadisten halten.«
»Ach ja, natürlich. Geben Sie den Fall ab. Sie müssen etwas für mich übernehmen. Umgehend.«
Sie sah ihn fragend an.
»Wenn Sie mein Büro verlassen haben, setzen Sie sich sofort in Ihr Auto, Franck. Und dann fahren Sie nach Holbæk. Nördlich des Fjords, an der Ostküste von Tuse Næs, wird gerade alles für die Bergung einer Wasserleiche vorbereitet. Sie werden in …«
Worre schob den Ärmel seines Sakkos mit dem Zeigefinger ein Stück zurück, sodass seine Armbanduhr sichtbar wurde.
»… zehn Minuten dort erwartet«, fuhr er fort, wohl wissend, dass die Fahrt nach Holbæk mindestens eine Stunde dauerte.
»Eine Wasserleiche?« Sie beugte sich auf dem Stuhl nach vorn. »Seit wann ist der PET zuständig, wenn …?«
Der operative Chef stoppte sie mit erhobener Hand.
»Ich sehe keinen Grund für ausufernde Erklärungen, Franck. Tun Sie einfach, was ich sage.«
»Okay. Und was soll ich vor Ort machen, wenn ich in … zehn Minuten da bin?«
»Sie sollen meine Augen und Ohren sein. Von der Sekunde an, wenn der Bursche aus dem Wasser gezogen wird, bis sie ihn in den Leichenwagen verfrachten – und vielleicht auch noch darüber hinaus.«
»Der Bursche?«
»Angeblich ist es ein Mann.«
»Darüber hinaus?«
»Warten wir es ab … Vielleicht im Rechtsmedizinischen Institut.«
»Aber warum?«
»Es bringt nichts, Fragen zu stellen. Sie werden keine Antworten bekommen. Tun Sie einfach, was ich Ihnen gesagt habe, danke.«
»Verraten Sie mir wenigstens noch, ob der Verdacht besteht, dass es sich um ein Verbrechen handelt.«
»Der Verdacht besteht, ja …«
Sie nickte, zuckte mit den Schultern und machte Anstalten aufzustehen.
»Und behandeln Sie das Ganze mit einer gewissen … Diskretion, ja?«
Sie sah ihn skeptisch an. Einen Fremdkörper des PET aus Søborg in die lokale Szene nach Holbæk zu schicken – noch dazu bei einem reinen Routineeinsatz – war ungefähr so diskret, wie den Weihnachtsmann zu bitten, mit seinem Schlitten auf dem Rådhusplads in Kopenhagen zu landen. Und zwar mitten im August.
»Hmm. Mit Diskretion … Aber, hören Sie …«, wandte sie ein und stand auf. »Bis ich da ankomme, werden die doch längst fertig sein. Ich brauche mindestens eine Stunde … Ich meine, die sind doch mit Sicherheit schon in vollem Gange. Die ganzen Standardabläufe. Die von der Bereitschaft, die Kripo, die Rechtsmedizin und so weiter.«
»Nein. Ich habe alles auf Stand-by gesetzt. Die wissen, dass sie auf das Eintreffen einer gewissen Margrethe Franck aus meinem Haus zu warten haben, bevor sie auch nur mit der Nase zucken. Und jetzt raus hier!«
Das war genau das, was ihr jetzt noch fehlte. Ein Haufen Kollegen und andere Leute, die herumsaßen und Däumchen drehten, während sie auf die Königin aus Søborg warteten.
Das klang nach einem richtigen Scheißjob.
10.
Der Himmel sah aus, als hätte irgendein Trottel erst Tinte verschüttet und dann versucht, die Pfütze aufzuwischen, und der Horizont, der eine feine Trennlinie zwischen den Elementen bildete, war so schief, dass es an ein Wunder grenzte, dass das Meerwasser nicht links aus dem Bild herausgelaufen war oder aus dem mystischen weißgelben Streifen zwischen dem ganzen Blau, der eher an die Pissrinne auf einer Männertoilette erinnerte, als an das Aufeinandertreffen von Skagerrak und Kattegat an Skagens Gren, dem nördlichsten Punkt Dänemarks.
»Dammit, dammit, dammit!«
Er schleuderte den Pinsel mit Schwung in die Dünen. Es war hoffnungslos. Er war hoffnungslos.
Frustriert schlug er den Mantelkragen hoch und studierte ein letztes Mal das Ergebnis seiner stundenlangen Bemühungen. Es war so erbärmlich, dass es ihn zumindest von jeglichen Überlegungen befreite, ob oder wie er es signieren sollte.
Er hatte über »A. M.« nachgedacht, mit geschwungenen Buchstaben in der rechten unteren Ecke. »Axel Mossman« zu schreiben kam jedenfalls nicht infrage, denn natürlich malte er, der über ein Jahrzehnt lang den polizeilichen Nachrichtendienst regiert hatte, hier in Skagen inkognito.
Da ihm die Vorstellung wenig verlockend erschien, die Aufmerksamkeit der anderen Teilnehmer auf sich zu ziehen, hatte er sich unter dem Namen Anders Møller für den Malkurs angemeldet, nachdem er den Provokationen und unermüdlichen Sticheleien seiner Frau schließlich nachgegeben hatte. Und das alles nur, weil er ihr in einem Moment des Größenwahns seine drei letzten Angelköder-Kreationen gezeigt hatte: eine Durham Ranger, eine Jock Scott und eine Silver Grey, drei der schönsten Lachsfliegen, die es überhaupt gab, jeweils in einer besonderen Mossman-Version auf Mustad-Haken mit Bronzefinish gebunden und dadurch auf spirituelle Weise Teil einer stolzen einhundertsiebzigjährigen norwegischen Handwerkstradition.
Er hatte ihr ausufernd erklärt, dass diese drei Fliegen sein innerstes Wesen widerspiegelten, durch das eine künstlerische Ader fließe, die so kraftvoll sei wie ein vierzig Jahre alter Tawny Port von Graham’s.
Hätte er an dieser Stelle einen Punkt gemacht, dann hätte er die Scherben vielleicht noch rechtzeitig auffegen können, aber es war einfach mit ihm durchgegangen.
»Im Grunde ist die Malerei wahrscheinlich die einzige Kunst, die mich noch angemessen herausfordern würde, in der ich mich entfalten könnte und die meinem Talent gerecht werden würde.«
Nach diesem Abend hatte sie nicht mehr lockergelassen.
Und Wochen später war sie über einen Malkurs in Skagen gestolpert, unter der Leitung der anerkannten Künstlerin Zitta Junger. Eine Woche in luxuriösem Ambiente. Sie meinte, es bestehe eine winzige Chance, dass der Kurs seinem Talent entspreche.
Das alles war natürlich völliger Unsinn, der ganz gewöhnliche rubbish eines alten Mannes, dessen größte Herausforderung darin bestand, mit dem Hund spazieren zu gehen und hübsche Fischköder zu basteln, während er von Lachsen träumte, die er nie fangen würde.
Sie waren acht Teilnehmer in dem Kurs. Sieben Damen, die ebenso talentlos wie wohlhabend waren. Und dann er selbst … Ein Mann, der vielleicht nicht knietief im Mist, aber bis zum Hals in Acrylfarbe steckte.
Dabei waren die unerträglichen Gespräche der Damen nicht einmal das Schlimmste. Nein, das Schlimmste war, dass … niemand … niemand auch nur ansatzweise den mächtigen früheren Herrscher des polizeilichen Nachrichtendienstes in ihm erkannte. Den Mann, der dafür gesorgt hatte, dass sie jeden Abend ihre kleinen leeren Köpfe beruhigt auf ihre Kissen betten konnten. Wie war es möglich, dass jemand so ahnungslos durchs Leben ging?
Wie konnte man nicht wissen, wer er war?
Es waren noch vier Kurstage übrig und er konnte nicht vorzeitig nach Hause fahren. Das war schlicht und ergreifend unmöglich. Aber vielleicht konnte er sich krankmelden, im Bett bleiben und lesen?
Er war hier ja nicht nur von Ignoranten umgeben, sondern es war außerdem noch beißend kalt.
Er beschloss, für diesen Tag abzubrechen. Er würde in Ruths Hotel zurückkehren, sich einen schönen Single Malt bestellen, am liebsten einen schottischen, und das Glas mit in seine bescheidene Künstlerkammer nehmen. Dann würde er sich ausziehen und seinen Körper ins Vergessen sinken lassen – und in etwa vierzig Grad warmes Wasser.
Er betrachtete ein letztes Mal sein meisterhaftes Machwerk. Dann nahm er die kleine Leinwand von der Staffelei und schleuderte sie wie einen Frisbee entschlossen in den Wind.
Wehe dem, der es unverhofft fand. Hoffentlich trug er keine bleibenden Schäden davon …
11.
Die Frau in der moosgrünen Outdoor-Jacke schien sich auszukennen. Es gab keine sichtbaren Pfade oder Wege, aber sie stapfte zielstrebig über den Waldboden, den der anhaltende leichte Frost mit einer dünnen Eishaut überzogen hatte. Ein paarmal brach sie ein und versank bis zum Rand ihrer Gummistiefel in der dicken Schicht aus braunem Laub. Trotzdem bewegte sie sich leicht und mühelos vorwärts und blieb erst stehen, als sie den höchsten Punkt erreicht hatte.
Vielleicht hatte sie die Sorge, die deutlich an ihrem Gesicht abzulesen war, dazu veranlasst, das schnelle Tempo anzuschlagen. Jetzt war sie jedenfalls außer Atem.
Sie nahm die dunkelgrüne Strickmütze ab mit der Kante in Orange, der Signalfarbe der Jäger, und wischte sich mit dem Jackenärmel den Schweiß von der Stirn. Um ihren Hals hing eine robuste Lederleine, aber von einem Hund war weit und breit nichts zu sehen.
»Wiiilsooon!«
Sie wiederholte ihren Ruf einige Male und griff dann zur Pfeife. Aber Wilson, der seinem Namen zum Trotz ein Deutsch Drahthaar war, kam nicht angerannt. Normalerweise tat er das äußerst bereitwillig. Deshalb hatte die Frau auch allen Grund, ihre Stirn zu runzeln, während sie ganz still dastand, konzentriert lauschte und sich Vorwürfe machte.
Sie wusste ja, warum Wilson seine Chance genutzt hatte und abgehauen war. Sie war abgelenkt und in Gedanken bei ihren Enkelkindern Anna und Mikkel gewesen. Sie und ihr Mann sollten das ganze Wochenende auf die beiden aufpassen, und sie freute sich wahnsinnig darauf, die Kinder so lange bei sich zu haben, noch dazu allein.
Nach ein paar Minuten war sie sich ziemlich sicher. Es war tatsächlich Hundegebell, was sie da schwach in der Ferne hörte, von den Wiesen her, die sich braun und verschneit durch das Tal zogen.
Sie hob ihr kleines Fernglas und suchte das Gelände, das sich vor ihr erstreckte, gründlich ab. Ohne Erfolg.
Sie hatte Pläne für das Wochenende geschmiedet und sich überlegt, dass sie mit den Kindern, die ganz verrückt nach Wilson waren, auf jeden Fall in den Wald gehen würden. Am Freitagabend durften sie sich im Supermarkt Süßigkeiten aussuchen, sie würden den Kamin anfeuern und es sich dann vor dem Fernseher gemütlich machen. Am Samstagvormittag wollte sie mit ihnen backen.
Sie traf eine Entscheidung und nahm den direkten Weg den Hang hinunter, innerlich fluchend, dass sie Wilson von der Leine gelassen hatte. Sie war Jägerin und fand es unmöglich, wenn die Leute ihre Hunde wie wild durch den Wald stürmen ließen, denn das stresste das Wild und schreckte auch alle anderen Tiere und Vögel auf. Deshalb fuhr sie auch immer so weit hinaus, um Wilson heimlich ein bisschen laufen zu lassen – was er liebte. Aber natürlich achtete sie darauf, dass er in Sichtweite blieb, und sie rief ihn in regelmäßigen Abständen zu sich zurück und belohnte seinen Gehorsam mit einem Leckerli aus der Jackentasche.
In der Regel funktionierte das wie am Schnürchen, nur heute nicht … Anna und Mikkel, Cupcakes und Cookies hatten sie zu sehr abgelenkt.
Sie blieb stehen und lauschte wieder. Ja. Der Hund klang genau wie Wilson. Aber ein schmaler Streifen aus Bäumen und Büschen in der Talsenke versperrte ihr die Sicht. Sie musste erst zu der kleinen Brücke ganz am Ende des Waldstücks laufen, um den Bach zu überqueren, bevor sie darauf hoffen konnte, das laute Bellen genauer orten oder gar Wilson finden zu können.
Zehn Minuten später machte sie wieder halt. Das Bellen war jetzt deutlicher. Eine hohe Schneewehe zwischen den wilden Brombeerranken machte es ihr nicht gerade leicht, aber schließlich hatte sie sich ein Stück weiter oben am Hang durch das Dickicht gekämpft, von wo aus sie einen besseren Blick über das Tal hatte.
Hastig zog sie das Fernglas aus der großen Außentasche. Ja, kein Zweifel …
Ein paar hundert Meter weiter sah sie den braungefleckten Wilson, der lauthals bellte. Er stand unten auf dem kleinen Shelterplatz, dem idyllischsten Fleckchen der ganzen …
Stopp!
Was war das?
Sie stellte das Fernglas scharf, ohne es von den Augen zu nehmen. Das sah aus wie … Nein. War das möglich?
Sie erstarrte und merkte, wie ein Gefühl von Panik in ihr aufstieg.
Dann fing sie an zu rennen, so schnell, wie es in ihren schweren Gummistiefeln möglich war.
Und während sie rannte, spürte sie ihr Herz rasen, es machte sie seltsam kurzatmig, aber sie hatte keine andere Wahl, sie musste weiterrennen …
12.
Das letzte Stück von den wenigen Häusern und Höfen Løserups bis zum Wald führte auf einer Schotterstraße über offenes Gelände, und der Wind rüttelte wie verrückt an ihrem Mini.
Rechts von ihr, am Fuß der Felder, lag eine Bucht mit stahlgrauem Wasser. Das musste die Udby Vig sein, wenn sie die Karte richtig im Gedächtnis hatte.
Niemand konnte daran zweifeln: »Hønsehals Skov« – Hühnerhals-Wald – stand auf einem blauen Schild, dort, wo die Straße endete und der Wald anfing. Es sah fast aus wie ein großes Tor, das zwischen die Bäume führte. Dahinter befand sich ein matschiger Parkplatz – und Windschatten. Hier standen ein SUV und ein Streifenwagen, und ein einzelner Weg führte weiter in den Wald hinein, aber der war mit einer soliden Eisenkette abgesperrt, die zwischen zwei Holzpfosten baumelte, gestrichen im traditionellen Rotbraun der Naturschutzbehörde.
Sie fuhr bis zur Absperrung vor, und sofort stieg ein Mann in grüner Jacke aus dem SUV und auch die Fahrertür des Streifenwagens öffnete sich. Sie drückte auf den Knopf und ließ die Scheibe auf der Beifahrerseite herunter.
»Margrethe Franck, PET«, sagte sie und zeigte mit ausgestrecktem Arm ihren Dienstausweis vor.
Der blonde Kopf des Polizisten tauchte am Fenster auf.
»Sie werden schon erwartet«, sagte er mit einem Nicken.
Der Mann mit der Jägerjacke steckte einen Schlüssel in das Vorhängeschloss, machte die Kette los und ließ sie auf den Boden fallen. Langsam rollte der Mini vorwärts.
»Und wo muss ich hin?«
Der Mann in Zivil beugte sich nach unten.
»Folgen Sie einfach der Fahrspur. Sie können es nicht verfehlen«, sagte er.
»Ist der Untergrund fest?«
»Ja, Schotter und Kiesel, kein Problem.«
»Und zwischen den Spuren? Ich habe keine Lust, mit dem Auspuff hängen zu bleiben oder mir die Ölwanne an einem Stein aufzuschlagen.«
Der Mann grinste.
»Das passt selbst mit Ihrer niedrigen Flughöhe. Wir nutzen den Weg ganzjährig. Sie können ruhig fahren«, antwortete er und gab dem Auto einen Klaps aufs Dach.
Sie konnte es nicht ausstehen, wenn jemand ihren Mini tätschelte. Das war ein Auto und kein Hund.