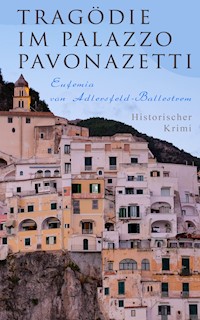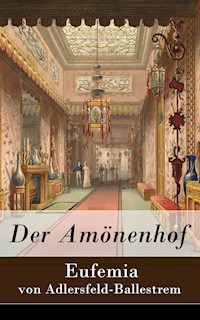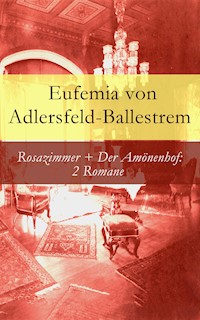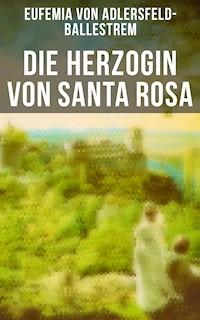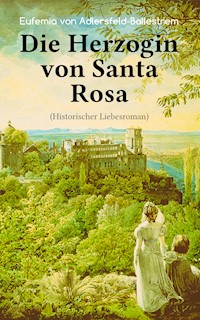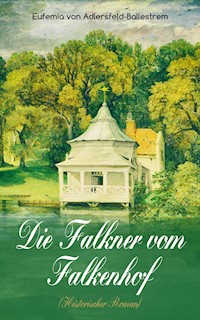Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Eufemia von Adlersfeld-Ballestrems 'Palazzo Iran' entführt die Leser in das prächtige Italien des 19. Jahrhunderts. Das Buch erzählt die Geschichte von Anna, einer jungen deutschen Adligen, die sich in den geheimnisvollen Palazzo Iran verliebt. Von Adlersfeld-Ballestrems literarischer Stil zeichnet sich durch detaillierte Beschreibungen der Umgebung und der Charaktere aus, die den Leser in die Welt des Palazzo Iran eintauchen lassen. Der Roman verbindet Elemente des historischen Romans mit einem Hauch von Romantik und Mystik, was ihn zu einem fesselnden Leseerlebnis macht. Der historische Hintergrund und die beschriebenen gesellschaftlichen Normen geben dem Leser einen Einblick in das Leben des Adels im 19. Jahrhundert. Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem war selbst eine Adlige und ihre eigenen Erfahrungen spiegeln sich in ihren Werken wider. Als Autorin von zahlreichen historischen Romanen und Erzählungen versteht sie es, den Leser mit faszinierenden Geschichten und gut recherchierten Details zu begeistern. 'Palazzo Iran' ist ein Buch für Liebhaber historischer Romane, die sich nach einer packenden und atmosphärischen Lektüre sehnen. Mit einer fesselnden Handlung, interessanten Charakteren und einem reichen historischen Hintergrund ist dieses Buch ein Muss für alle, die sich für die Adelswelt des 19. Jahrhunderts begeistern lassen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Palazzo Iran
Inhaltsverzeichnis
Es ist kein leeres Wort, daß die Steine reden. Ganz abgesehen von den Edelsteinen, deren Feuer auf besonders empfindliche Naturen direkt beeinflussend wirkt, sind es die ganz gemeinen, einfachen Mauersteine, die, den meisten Menschen unbewußt, die Gabe des Redens besitzen, und wer sich die Mühe gibt, darüber nachzudenken, dem wird es vielleicht zum Bewußtsein kommen, wie merkwürdig eindringlich manch ein Gebäude schon zu ihm gesprochen hat. Nicht alle, denn es sprechen ja auch nicht alle Menschen zu uns, das heißt ihre Gesichter sagen uns nichts. Wie unter den Menschen, so gibt es auch unter den Häusern nüchterne, nichtssagende, alltägliche, hausbackene, deren Interesse mit der Küche anfängt und mit dem Keller aufhört. Dann nach außen herausgeputzte, innerlich fürchterlich ungemütliche Häuser, in denen nichts echt ist, nichts gediegen: dünne Mauern, dünne Balken, billige Tapeten, pappener Stuck und unsolide, prahlerische Vergoldungen. Und dann wieder einfache, stille, graue Häuser, anspruchslos, mit Spuren von Wind und Wetter und doch so eindringlich zu uns sprechend wie eine Ballade, die uns in Mark und Bein erschauern macht. Und je älter das Haus, desto deutlicher redet es, ja, es gibt Häuser, die einen geradezu anrufen, zum Stillstehen zwingen und einem etwas sagen, das vage Empfindungen in einem weckt, weil wir die Sprache nicht verstehen, sondern nur den Ausdruck auf uns wirken lassen. So ging's mir vor Jahren mit einem Haus in Venedig. Zwar haben in dieser wunderbaren Stadt die Gebäude ganz besonders die Gabe des Redens – die Steine von Venedig besitzen eine Beredsamkeit wie nirgends andere in der ganzen Welt, und die Ruhe, die über diesem Orte ohne Wagen, Pferde und Automobile thront, macht wahrscheinlich, daß diese Stimmen so ganz besonders deutlich hörbar sind. Freilich, von Hundert hören sie Neunzig vielleicht trotzdem nicht, aber das liegt nicht an den Steinen, gewiß nicht.
Damals, in der Zeit, von der ich rede, war ich noch jung und noch nicht so feinhörig für solche lautlose Stimmen, wie man es später im Leben erst wird, denn im Gegensatz dazu, wie der physische Mensch seine Fakultäten mit den Jahren abnutzt, werden gewisse geistige Organe der Empfindung zugänglicher. Trotzdem war damals die Wirkung der Sprache der Steine auf mich eine so packende, daß die Jahre es nicht vermochten, sie abzuschwächen oder gar sie verklingen zu machen, und ich ertappte mich oft darauf, daß ich darüber nachsann, was die Bedeutung dieses Eindrucks sein mochte, denn ich hatte wohl gehört, aber nicht verstanden, nur leise fühlend, daß es etwas ganz Außergewöhnliches war, was diese Mauern mir erzählen wollten.
Sechzehn Jahre sollten darüber hingehen, ehe mir klar wurde, daß es eine Warnung war. Damals war ich achtzehn Jahre alt und mein lange verwitwet gewesener Vater hatte mich aus dem Pensionat, in dem ich erzogen wurde, abgeholt, um mir das Vaterhaus zurückzugeben, in dem eine neue Hausfrau waltete und ein nun zweijähriges Halbschwesterchen Leben brachte. Er bekleidete damals den Gesandtschaftsposten in Rom, und auf dem Weg dahin ließ er mich Venedig sehen, wie es eben die meisten Fremden sehen: den Markusplatz mit Basilika und Dogenpalast und ein paar andere Sehenswürdigkeiten, zu denen die Gondel uns brachte: also ein Stückchen von dem Venedig der Fremden, die von dem Venedig der Venezianer keine blasse Ahnung haben und sich trotzdem einbilden, daß sie die Meereskönigin »kennen«. Die Gondel hatte uns denn auch eines Tages zur Kirche Santa Maria Formosa mit der herrlichen heiligen Barbara des Palma Vecchio gebracht, trotzdem man zu Fuß vom Markusplatz in zehn Minuten dahin gelangen kann, und als wir die Kirche wieder verließen, kam meinem Vater die Erinnerung an ein Gemälde von Tintoretto: die heilige Agnes, das er früher einmal in der Kirche der Madonna del Orto bewundert hatte, und das er mir zu zeigen wünschte, weil auf diesem Bild eine Innigkeit und Zartheit der Auffassung in der Figur der Heiligen ganz besonders zu dem deutschen Gemüt spräche, die bei einem Maler wie Tintoretto doppelt überraschend wirkte. Wir stiegen also wieder in unsere Gondel und glitten in ihr durch ein Gewirr von Kanälen, in dem wir beide weder aus noch ein gewußt hätten, wäre uns die Richtung überlassen worden. Wie viel Ecken der blitzende, hellebardenartige Schnabel unserer Gondel haarscharf umschiffte, unter wie viel Brücken wir hindurchschlüpften, das habe ich mir erst viel später einmal auf einer Karte klar gemacht: damals war es einfach ein unentwirrbares Labyrinth, durch das wir uns wanden. Dann bog die Gondel einem Garten gegenüber links – das weiß ich noch genau – in einen schmalen Kanal, und ich setzte mich mit einem gewissen Gefühl der Erwartung aufrecht aus meiner bequem lehnenden Stellung auf; dunkelgrüne, hohe Säulenzypressen, mattgrüne Weiden und schönblättrige hohe Ahornbäume sahen über eine mit arabischen Zinnen gekrönte Backsteinmauer aus sattgrünem Gebüsch von Kirschlorbeer herüber, und an den Garten schloß sich die Wasserfront eines imposanten Palastes mit den marmoreingefaßten Spitzbogenfenstern byzantinisch-arabischer Baukunst, die eine Spezialität Venedigs ist. Die mit vergoldeten Gittern versehenen Fenster in der Höhe des Portals, die gleichfalls vergitterte Fensterreihe des Entresols, dann die Hauptetage mit den Balkons und die darüberliegende zweite Etage mit den Schlafräumen; diese Anordnung entsprach ganz dem orthodoxen venezianischen Palast, der durchaus keinen Eindruck der Vernachlässigung machte. Die Fremden halten die Patina, mit der das Venedig eigentümliche Klima den weißen Marmor der Paläste und Kirchen überzieht, einfach für Schmutz und reden mit großer Überlegenheit von Scheuerbürste und Seife; der Venezianer aber hütet sich, diese Patina zu entfernen, ob mit Recht oder Unrecht, mag dahingestellt bleiben, aber ohne sie verlöre Venedig sicher viel von seiner Eigenart. Je älter das Haus, je dunkler die Patina daraus.
»Vierzehntes Jahrhundert,« hörte ich meinen Vater murmeln und sah seinen Blick interessiert die Front des Palastes überfliegen. Gern hätte ich gefragt, wie dieser Palast hieße, aber ein merkwürdiges Gefühl wie von einer halben Betäubung machte, daß ich das Wort nicht herausbrachte; es schnürte mir etwas die Kehle zu, eine Beklemmung, die wie eine vage Furcht wirkte, hatte mich gepackt und lastete auf mir mit einer solchen Intensität, daß ich darunter willenlos wurde. Doch das alles war nur das Werk von Minuten, nein, Sekunden, denn es verschwand, als die Gondel die Front des Palastes entlang gerudert, unter einem Brückenbogen hinweg den Kanal verfolgte. Die Brücke hinter uns, wendete ich mich noch einmal um, sah in der Seitenfront des Palastes, nach der ziemlich breiten Halle gelegen, ein wundervoll verziertes, arabisches Portal mit einem Balkon darüber, der wie von weißen Spitzen gemacht schien, sah noch säulengetragene Spitzbogenloggien dahinter, und dann schob sich mit der dahinschießenden Gondel die entschwindende Wasserfront immer enger zusammen und war bald ganz meinen Blicken entschwunden.
»Das war ein merkwürdiger Palast,« sagte ich aufatmend.
»Sehr merkwürdig«. bestätigte mein Vater mit Nachdruck und setzte im selben Atem hinzu: »Ja, warum denn merkwürdig? Interessant, architektonisch interessant. Ein Gebäude, das sicher seine Geschichte hat.«
»Ist dir das auch so vorgekommen?« fragte ich eifrig.
»Nun,« meinte mein Vater lächelnd, »man darf schon annehmen, daß ein Haus dieses Alters manches erlebt hat in seinen Mauern – in einer Stadt wie Venedig obendrein. Denn eines Patriziers Sitz ist das sicher oder war doch einer in jenen Tagen der dritten Republik, als die Namen des Goldenen Buches die Geschichte Venedigs machen halfen. Welches dieser alten Geschlechter hätte nicht zum mindesten seine 'Commedia' aufzuweisen? Was ist nicht allein intrigiert worden, um in den Rat der Zehn zu gelangen, einer der 'Capi' zu werden und endlich im Rat der Drei zu sitzen! Das war die Macht, deren ohnmächtiger Schatten den Namen 'Doge' führte. Und doch riß man sich auch darum, dieser Schatten zu sein. Wer weiß, wie viele solcher Schatten aus dem Hause hervorgegangen sind, das du eben noch so merkwürdig gefunden.«
»Mir kam es vor, als ob die Schatten noch darin wären,« meinte ich mit einem nachträglichen leisen Schauer. Mein Vater antwortete darauf nichts, aber ich las in seinen Augen, die er auf mich heftete, daß er gefühlt wie ich. Und doch – was gingen uns die Schatten eines Hauses an, das wir beide heute zum erstenmal sahen und vielleicht auch zum letztenmal, nach dessen Namen zu erkundigen wir sogar unterließen, trotzdem unsere Gondeliere uns sicher die weitestgehende Auskunft über den Palazzo geben konnten, denn ein venezianischer Gondelier kennt nicht nur jedes Haus, sondern auch seinen vergangenen und gegenwärtigen Besitzer samt der gesamten Chronik ihrer Familien von A bis Z.
Unsere baldige Abreise von Venedig und das recht bewegte Leben im Hause meines Vaters in Rom, ja die ganze darauffolgende Epoche vermochten nicht, das Bild des Hauses abzuschwächen oder auszulöschen, und wenn es mir auch im Lauf der Tage nicht einfiel, so war ich sicher, von Zeit zu Zeit davon zu träumen. Dann sah ich es vor mir wie an jenem Morgen, als wir, mein Vater und ich, zur Kirche der Madonna del Orto fuhren, aber was mir sonst noch im Zusammenhang mit dem Palast träumte, dessen konnte ich mich am Morgen niemals mehr erinnern; es blieb eine nebelhafte Reihe von Bildern, die ich nicht um die Welt festhalten konnte.
Später, Jahre später, als ich noch einmal Venedig besuchte, gab ich mir Mühe, den Palast wiederzufinden, aber es gelang mir nicht. Meine Beschreibung paßte auf so viele andere venezianische Paläste, daß ohne das Wissen des Namens damit nichts auszurichten war. Ich ließ mich wiederum von Santa Maria Formosa zur Madonna del Orto rudern, aber es mochten wohl dahin mehrere Wege, beziehungsweise Kanäle führen, denn trotzdem ich dem Gondelier das gesuchte Haus genau beschrieb, und er mir versicherte, daß er schon wüßte, welches ich einzig und allein meinen könnte, so brachte er mich doch nur triumphierend zum Palazzo Giovanelli, der wohl freilich den gleichen Stil aufwies und doch so grundverschieden von dem gesuchten war.
Und bei jenem Aufenthalt in Venedig war es, daß Elfe ihre erste Eroberung machte, über die wir uns mit der Kurzsichtigkeit, nein, mit der Blindheit der Menschen, die nur das in ihrem Gesichtskreis Liegende sehen können, königlich amüsierten.
Ja so – ich habe ja noch gar nicht gesagt, wer Elfe ist – war!
Es wird mir heute noch schwer, von ihr zu sprechen, trotzdem so viele Jahre schon darüber hingegangen sind, daß wir sie verloren haben. Der Schmerz verjährt eben nicht; er wird wohl milder, aber er ist da, und wenn ein noch so leiser Finger die alte, lange vernarbte Wunde berührt, dann wacht er auf und raubt dem Tag die Ruhe und der Nacht den Schlaf.
Elfe war meine Halbschwester aus meines Vaters zweiter Ehe, und weil sie ihre liebe, schöne Mutter in so zartem Alter wieder verlor, so trat ich an deren Stelle und zog dieses Kind auf, das wir so abgöttisch fast geliebt, und das all dieser Liebe so wert war. Eigentlich hieß sie Elfriede, aber weil sie so zierlich und fein war und eine so märchenhafte Fülle welligen, flachsblonden Haares besaß und eine so durchsichtige, weiße Hautfarbe und ein Paar Augen wie ein Paar hellblaue Saphire, so kam ich darauf, diesen Namen nicht mit dem üblichen, breitgetretenen »Frieda« abzukürzen, sondern »Elfe« daraus zu machen, welche Abkürzung die Eltern sogleich mit Enthusiasmus adoptierten. Schwer wie es meiner Stiefmutter wurde, von diesem liebenswürdigen, schönen und hochbegabten Kind zu scheiden, so wurde es ihr doch sichtlich leichter, als ich ihr das heilige Versprechen gab, Elfe zu behüten und zu beschützen wie meinen Augapfel. Sie wußte, daß ich nicht leicht heilige Zusicherungen machte, aber daß ich hielt, was ich versprach. Ich war ja selbst noch sehr jung, als ich dieses Versprechen gab, aber es beruhigte die Sterbende trotzdem. Zuerst wurde es mir leicht gemacht, es zu erfüllen, weil ja mein Vater noch da war, dem ich den Haushalt führte und die Hausfrau vertrat, wenn er bei sich empfing. Ich soll das ganz gut und würdig gemacht haben. Aber nach wenigen Jahren starb auch mein Vater, und er bestimmte mich in seinem Testament zum höchsten Zeichen seines Vertrauens zur Vormünderin meiner Schwester und ernannte als Gegenvormund und männlichen Berater einen Freund, den ich damals noch gar nicht kannte, doch von dem ich durch meinen Vater wußte, daß er, wie man so sagt, »große Stücke« von ihm hielt als Mensch wie als Gelehrter. Ich trat dann natürlich in Briefwechsel mit Herrn v. Buchwald, der damals als Professor der Geschichte an der Universität Heidelberg wirkte, und er billigte es vollkommen, daß ich zunächst mit unserem Mündel in Rom blieb und ihren Unterricht durch erlesene Lehrer nicht unterbrach. Den italienischen Vorurteilen Rechnung tragend, nahm ich eine ältere Dame ins Haus zu uns, eine Deutsche und entfernte Verwandte von uns, die nach Rom gekommen war, um sich dort eine Existenz irgendwelcher Art zu gründen durch Unterricht oder Fremdenführung oder was sonst der Zufall ergab. Sie war eine tapfere, tätige Frau, diese Baronin Grabow, und ich habe es nie bereut, sie zu unserer Duenja erwählt zu haben, denn sie besaß das feinste Taktgefühl von der Welt und eine unversiegbare, unverwüstliche gute Laune, große Herzenswärme und jene Liebenswürdigkeit, die ihres Sieges allemal gewiß ist. So lebten wir drei erst sehr zurückgezogen, dann etwas geselliger in der schönsten Eintracht, bis Elfe fünfzehn Jahre alt war, und dann glaubte Professor v. Buchwald, mit dem der Verkehr ein brieflicher geblieben war, daß es nun an der Zeit sei, die Erziehung unseres Mündels in einem deutschen Institut zu vollenden, und er hatte wohl recht, denn wenn Elfe auch ganz nach deutschen Prinzipien erzogen worden war, so hatte sie italienischen Boden doch kaum jemals verlassen, meist nur mit italienischen Gespielen verkehrt und vom Deutschtum nur so viel verspürt, als Rom mit seiner deutschen Kolonie zu bieten vermag. Trotzdem aber war sie ihrer Erscheinung und ihrem Wesen nach das Inkarnat einer Deutschen, dafür hatten wir, »Tante« Grabow und ich, redlich gesorgt. Trotzdem mußten wir aber dem Vorschlag Herrn v. Buchwalds recht geben, und nicht ohne tiefes Bedauern brachen wir in Rom unsere Zelte ab, um nordwärts zu ziehen.
Auf dem Wege dorthin war es, daß wir Venedig besuchten, für das Elfe sich von meinem Enthusiasmus anstecken ließ, und dort machte sie, wie schon erwähnt, ihre erste Eroberung, über die Tante Grabow und ich uns in unserer Blindheit königlich amüsierten. Das geschah, als wir einen Ausflug nach Murano machten, nicht um unsere Zeit damit zu vergeuden, die Glasfabriken zu besuchen, sondern um Bellinis lieblichste Madonna und seinen entzückendsten Engel in der Kirche San Pietro Martyr zu sehen. Wir hatten, da die Dampferverbindung nur unbequem zu erreichen ist, eine Gondel genommen, und offen gesagt, es lag mir auch nichts daran, Elfe auf die stets überfüllten »Vaporetti« zu bringen, da sie dort immer Aufsehen erregte mit ihrer lichten Erscheinung. Ich ließ sie damals noch das Haar lang tragen, und jeder, der ihr begegnete, drehte sich sicher noch einmal nach ihr um, die flachsblonde, silberschimmernde, wellige Fülle dieses wunderbaren Haares zu bewundern, um dann auch dem einzig schönen Gesicht den Tribut zu spenden, dem das Schönheitsgefühl des Italieners einen so ungeheuchelt naiven Ausdruck zu geben versteht. In Rom war es ja nicht anders gewesen, aber da kannte man uns, und wer zu unseren Kreisen gehörte, sorgte dafür, daß die Bewunderung der Bewunderten diskret verhüllt blieb. Elfe selbst war sich ihres Zaubers ganz unbewußt; wenn die Leute sie ansahen, schob sie das auf ihr ungewöhnliches Haar und lachte herzlich über das unleugbare Aufsehen, das sie damit machte. Nun hätte man die Pracht ja wohl auch in einen oder zwei dicke Zöpfe zwingen können, aber unter dem Vorwand, daß lose getragenes Haar für dessen Wachstum vorteilhafter sei, gönnte ich mir die gewiß verzeihliche Eitelkeit, mit diesem köstlichen Besitz meiner Schwester prahlen zu können, und Tante Grabow unterstützte schmunzelnd dieses »Laster«. wie sie es scherzend nannte.
Wir fuhren also mit der Gondel nach Murano und mußten uns erst durch eine Menge der schmaleren Kanäle durchwinden, ehe wir das offene Wasser an der Fondamenta Nuova erreichen konnten. Da passierte es uns, daß in einem ganz schmalen Kanal oder Rio, wie der Venezianer diese Wasserstraßen nennt, ein breiter Lastkahn den Weg versperrte, und eine uns entgegenkommende Gondel keilte uns obendrein noch völlig ein. Hoffnungslos sind ja dergleichen oft vorkommende Zufälle nicht, denn die Geschicklichkeit der Barkenführer und Gondeliers entwirrt sicher den Knäuel, aber man muß Geduld haben, schon um den Redestrom der dazu heftig gestikulierenden Ruderer sich ergießen zu lassen, denn so etwas stumm und still abzumachen, wäre einem Italiener unmöglich. Der Deutsche schimpft ja in solchen Fällen auch. Die uns entgegen gekommene Gondel lag so dicht neben der unseren, daß die Bordränder aneinander rieben; – wir hätten dem einzelnen Herrn, der darin saß, die Hand geben können, ohne uns auch nur aus unserer bequemen Stellung aufzurichten. Der Herr in der Gondel gehörte sicher den besten Gesellschaftskreisen an; seine Erscheinung war eine sogenannte aristokratische, und sein Kopf mit dem farblosen Teint und dem hochgebürsteten, langspitzigen dunklen Schnurrbart, den tiefliegenden, sehr glänzenden dunklen Augen unter starken, über der Nase zusammengewachsenen Brauen war sicher kein gewöhnlicher, wenn auch für meinen Geschmack nicht gerade sympathisch. Er hatte den »naso tipico della nobilitá Veneziana«. das heißt die eigentümlich hakenförmig gebogene Nase mit großen, sensitiven Nüstern, die mageren Gesichtern leicht etwas Raubtierartiges gibt, die man immer wieder auf den Bildern der alten venezianischen Meister sehen kann, und gerade einen solchen Ausdruck hatte der Kopf des Herrn in der Gondel neben uns. Er hatte Elfe kaum erblickt, als er, der ziemlich apathisch dagesessen, sich aufrichtete und meine Schwester ansah, wie ich es für absolut unverträglich mit dem guten Ton halte, selbst wenn man die gewohnte naive Bewunderung der Südländer für die weibliche Schönheit davon abrechnet: was zuviel ist, das ist zuviel, und es dauerte noch obendrein so unerhört lange, bis die Gondoliere imstande waren, ihre Fahrzeuge zunächst rückwärts zu bewegen, um der Lastbarke Raum zu geben, sich weniger breitzumachen. Und diese ganze Zeit stierte der Mann mit dem »naso tipico« auf Elfe, bis diese trotz ihrer Harmlosigkeit wirklich verlegen wurde und sich mit dem Rücken gegen ihren Bewunderer auf das Seitenbänkchen setzte, das ihrem bisherigen Platz gegenüberlag. Und als die Bahn frei war und die beiden Gondeln hart aneinander vorüberglitten, da beugte sich der Herr nicht nur aus der seinen, um die Nummer der unseren zu erkennen, sondern er glitt auch mit der Hand wie von ungefähr über die schimmernde Masse von Elfes Blondhaar, das über den Bord der Gondel herabhing – eine Bewegung, die sie selbst zum Glück nicht sah und kaum merkte, Tante Grabow und mich aber in eine Empörung versetzte, die aber nicht groß genug war, um sich später nicht unter uns in Lachen aufzulösen.
Und wir hätten doch weinen sollen!
Unsere beiden Gondeliere sahen sich lachend an, als wir vorbei waren.
»Il persico,« riefen sie sich zu.
»War das ein gräßlicher Mensch,« sagte Elfe halb lachend, halb empört. »Wißt ihr, wie er aussieht? Genau wie der schwarze Kater unserer Hausmeisterin in Rom, vor dem ich immer ein bißchen Angst hatte, weil er einen mit solch funkelnden Augen ansah. Ich hätte dem unverschämten Menschen am liebsten eine Nase gedreht.«
»Den Rücken gedreht war wirksamer und mehr Ladylike,« meinte Tante Grabow trocken.
Elfe lachte hell auf.
»Ich glaub's auch,« gab sie lustig zu. »Was für ein Glück, daß ihr beide mich so gut erzogen habt!«
»Anerkennung tut immer wohl,« lächelte Tante Grabow, und Elfe versicherte ihr mit einer Verbeugung, »es wäre gern geschehen.« So neckten sich die beiden eigentlich den ganzen Tag, weil sie sich eben sehr liebhatten. Es war ja auch ganz unmöglich, Elfe nicht liebzuhaben – sie brachte den Sonnenschein dahin, wo sie grade ging und stand, und es war etwas ganz Unwiderstehliches in ihrer Art und Weise.
Mit ihrem Vergleich des »schwarzen Katers« hatte sie auch gleich und gründlich den Bann gelöst, den die Person dieses »zufällig« Begegneten über uns verhängt, und er wurde in der Folge noch oft zum Gegenstand harmlosen Gelächters für uns. »Il Persico« der Perser, hatten ihn unsere Gondeliere genannt. Gern hätte ich gefragt, wer der Herr war, aber die Neugier schien mir zu gewöhnlich, um sie befriedigen zu dürfen, und stolz unterdrückte ich die Frage; das war das zweite Glied in der Kette, der wir dann noch hätten entrinnen können, aber man ist ja so blind, so blind! Wenn er ein Perser war, so reflektierte ich, sodann konnte er kein Italiener und speziell kein Venezianer sein, und wir würden ihm gottlob nie wieder begegnen.
Wir Menschen sind mit dem »nie« immer so rasch zur Hand, und doch liegt eine Überhebung in dieser bestimmten Form, für die wir eigentlich gar keinen Grund haben. Drei Jahre kamen nun, die meinem »nie« aber recht zu geben schienen. Wir hatten uns auf den Rat von Elfes Gegenvormund in Heidelberg niedergelassen, wo meine Schwester die Selekta eines nach modernen Prinzipien geleiteten Instituts besuchte und dabei immer schöner heranblühte. Professor v. Buchwald trat in den freundschaftlichsten Verkehr zu unserem Haushalt, ja, er war uns allen bald genug ganz unentbehrlich geworden. Er war auch einer unter Tausenden, und ich verstand bald genug die Wertschätzung meines Vaters für diesen Freund, an dem er so treu gehangen – ich liebte ihn mit demselben gläubigen Vertrauen, das ihm mit mir die Sorge um unseren Liebling anvertraut. Elfe selbst hatte an dem Tag keine Ruhe, an dem sie »den süßen Onkel« nicht sah, ja, es wollte mich manchmal fast eine eifersüchtige Regung überschleichen, wenn das Kind ihn mir vorzuziehen schien. Aber das war Torheit, denn mir ging's wie ihr, und Tante Grabow erklärte feierlich, daß, wenn Herr v. Buchwald nicht bald um ihre Hand anhielte, sie selbst die Initiative ergreifen würde, und es ihr egal wäre, ob ich eifersüchtig würde oder nicht. Damit brachte Tante Grabow das grünäugige Ungeheuer in meiner Seele gründlich zum Schweigen, und das war ja auch ihre Absicht. Herr v. Buchwald war jünger wie mein Vater, aber als Nachbarskinder hatten sie schon miteinander gespielt, als sie noch schürzentragende Buben waren. Da Herr v. Buchwald aber weniger bemittelt war, so verbot es sich für ihn, mit meinem Vater die diplomatische Karriere einzuschlagen, und seine Vorliebe für die Geschichte wies ihm dann dieses Fach für die Universitätslaufbahn, in der er es nun zum ordinierten Professor gebracht, als welcher er seit fast zehn Jahren an der gleichen Stelle wirkte, gekannt und geachtet von jedermann, geliebt von seinen Studenten. Er besaß auch eine äußere Erscheinung, die man nicht leicht übersah: groß, kräftig, von guter, aufrechter, freier Haltung, hatte er einen höchst bedeutenden Kopf, der dadurch auffiel, daß sein breitgetragener langer Vollbart genau in der Mitte in einem breiten Strich ergraut, korrekter gesagt, schneeweiß war, wie die weiße Lage in einem Onyx. Diese Eigentümlichkeit wirkte sehr frappierend und gab dem an sich schon markanten Kopf mit dem wundervollen Profil eine Originalität, die eine ganz zufällige, ungesuchte war. Aber die Schönheit dieses Kopfes waren seine Augen, graue, dunkelumrandete Augen von einer solchen Güte und Treue des Ausdrucks, daß man dem Mann gut sein mußte, ehe man noch mit ihm gesprochen. Er lebte, ein einsamer Mann, von einem alten Drachen von Haushälterin schlecht und recht versorgt, ein stilles Leben für sich und suchte nur wenig von der Geselligkeit der Universitätsstadt auf, aber er kam gern zu uns und brachte den größten Teil seiner Abende bei uns zu, und seine abgeklärte Lebensweisheit, seine ruhige, ungezwungene Heiterkeit, die so recht der Spiegel seiner Seele war, regte uns an und tat uns so recht von Herzen wohl. Und es kam eine Zeit, in der ich Törin mir einbildete, er käme meinetwegen.
Tante Grabow war nicht ohne Schuld daran.
»Ich weiß gar nicht, was du immer mit deinem Alter zu kokettieren hast,« sagte sie oft. »Mit dreiunddreißig Jahren ist man doch noch kein Methusalem, besonders wenn man so aussieht wie du. Na, tu' man nicht so, als ob du das nicht wüßtest! Hast du einen normalen Spiegel oder nicht? Du bist eine riesig vornehme, jugendliche Erscheinung und wirst dich mit deinem brünetten Teint noch sehr lange so erhalten. Du und Elfe, ihr seht wie Tag und Nacht aus. Na, insofern doch nur, als sie so licht und du so dunkel bist. Es gibt sehr schöne Nächte, meine liebe Hedwig, und du bist eine solche für viele Geschmäcker. Ich will dir nicht etwa schmeicheln oder dich gar anborgen, weil ich das sage: es ist meine volle Überzeugung, die ich, scheint's mir, mit denen zu teilen scheine, denen du mit diesen schlanken weißen Händen Körbe geflochten hast. Na natürlich, du hast dir aus diesen Leuten allen nichts gemacht, folglich hast du sie auch abgewiesen. Elfe war dazu der sehr willkommene Vorwand – nein, rede nicht, Hedwig, das weiß ich besser wie du, denn Elfe konntest du auch als verheiratete Frau erziehen. Es ist Unsinn, das Gegenteil zu behaupten. Ja, und was ich eigentlich hatte sagen wollen: unser lieber Professor ist sicher meiner Ansicht. Ich werde ihn mal darüber befragen. Das gibt ihm vielleicht Mut – diese überständigen Junggesellen wissen ja meist nicht, wie sie es anfangen sollen, und darüber vergeht die Zeit und mit ihr das Leben.«
Ich mußte die gute Tante Grabow bei allem, was ihr heilig war, beschwören, von ihrem gutgemeinten Vorhaben abzustehen, obgleich ich ganz sicher hätte sein können, daß sie das Gewollte mit ihrem unfehlbaren Takt zur Sprache gebracht hätte, dem Takt, der mich bestimmt nie kompromittiert hätte. Wahrscheinlich hatte sie überhaupt nur in ihrer Weise gescherzt; jedenfalls war sie genau so mit Blindheit geschlagen wie ich, und was ich mir auch immer einbildete, kein Wort unseres Freundes fiel, das mich darin hätte bestätigen können.
Eines schönen Tages – die drei Jahre, von denen ich oben gesprochen, gingen ihrem Ende zu – kam er in sichtlicher Aufregung zu uns: es war ihm, völlig unerwartet, der Besitz eines Majorats zugefallen, dessen Agnat er wohl gewesen, auf das er aber nie gerechnet hatte, noch auch rechnen konnte nach menschlichem Ermessen, da zwei junge, blühende, direkte Anwärter darauf da waren, Vater und Sohn, Neffe und Großneffe des Professors. Sie waren beide auf einer Wasserfahrt verunglückt, und die Erbfolge sprang nun um eine Generation zurück. Daß der Verlust lieber Anverwandter dem Professor nahe ging, begriff ich bei seiner liebevollen Gemütsart, aber es befremdete mich ein klein wenig, daß der reiche Besitz ihn zu erregen schien, daß er berauschend auf ihn wirkte!
»Werden Sie auf das Gut gehen?« fragte ich ziemlich lahm.