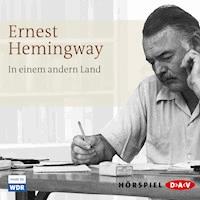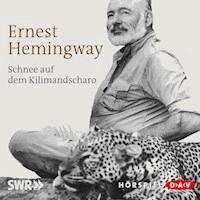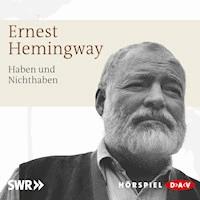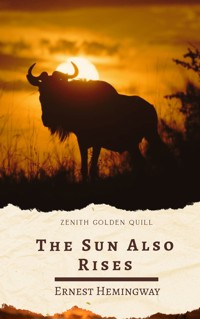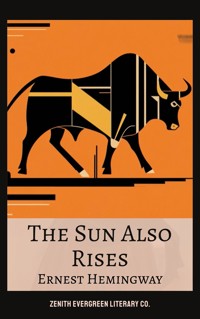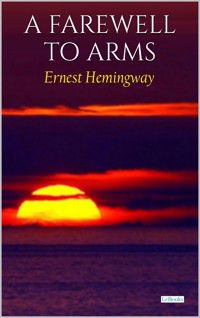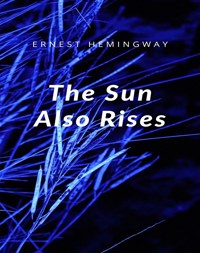9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Hemingway 1956 nach Paris zurückkehrte, ließ er sich aus dem Keller des Hotels Ritz seine alten Koffer bringen. Sie enthielten Tagebücher und Aufzeichnungen aus den Zwanzigern, seiner Zeit als Auslandskorrespondent. Aus diesen frühen Notizen formte Hemingway den Roman seiner Pariser Jahre. Für ihn war es eine glückliche, prägende Zeit, als er an der Seine angelte, bescheidene Gewinne beim Pferderennen in Champagner umsetzte, mit Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound und F. Scott Fitzgerald zusammentraf. Hemingways letztes Buch führt zu seinen Anfängen zurück: Es ist eine Feier des Lebens und des Schreibens, ein Erinnerungsbuch voll jugendlicher Kraft und melancholischem Humor, das nun, neu übersetzt, erstmals in der vom Autor hinterlassenen Fassung vorliegt. «Das ist bester Hemingway; niemand hat das Paris der zwanziger Jahre eindrucksvoller beschrieben als er.» (The New York Times) «Vom Glück, vom reinen, kindlichen Glück handelt dieses Buch, und es teilt sich jedem Leser mit, der mit dem jungen Autor in einem noch nicht fashionablen Viertel aufwacht, wenn die Sonne die nassen Fassaden der Häuser trocknet.» (Süddeutsche Zeitung) «Dieses Buch ist nicht nur ein herausragendes literarisches Werk, sondern auch ein Schlüsseltext zur Kulturgeschichte der Moderne. Das legendäre Paris der zwanziger Jahre ist in dieser Prosa wie in klaren Bernstein gebannt. Und es ist ein grandioses Porträt des Künstlers als junger Mann.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Ernest Hemingway
PARIS,EIN FEST FÜRS LEBEN
A MOVEABLE FEAST. DIE URFASSUNG
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Inhaltsverzeichnis
PARIS, EIN FEST FÜRS LEBEN
A MOVEABLE FEAST. DIE URFASSUNG
1 Ein gutes Café an der Place Saint-Michel
2 Miss Stein doziert
3 Shakespeare & Company
4 Menschen an der Seine
5 Ein falscher Frühling
6 Das Ende einer Nebenbeschäftigung
7 «Une Génération Perdue»
8 Hungern war eine gute Schule
9 Ford Madox Ford und der Teufelsschüler
10 Mit Pascin im Dôme
11 Ezra Pound und die Spannerraupe
12 Ein etwas seltsames Ende
13 Der Mann, der zum Sterben bestimmt war
14 Evan Shipman in der Closerie des Lilas
15 Ein Werkzeug des Bösen
16 Winter in Schruns
17 Scott Fitzgerald
18 Falken teilen nicht
19 Eine Frage der Maße
ZUSÄTZLICHE PARISER SKIZZEN
Geburt einer neuen Schule
Ezra Pound und sein Bel Esprit
Über das Schreiben in der ersten Person
Heimliche Freuden
Ein seltsamer Kampf-Club
Der scharfe Geruch von Lügen
Die Erziehung von Mr. Bumby
Scott und sein Pariser Chauffeur
Der Lotsenfisch und die Reichen
Nada y Pues Nada
FRAGMENTE
ANHANG
Nachweise
Nachwort
Zu dieser Ausgabe
Anmerkungen
Dank
PARIS,
EIN FEST FÜRS LEBEN
A MOVEABLE FEAST.
DIE URFASSUNG
I
EIN GUTES CAFÉ AN DER PLACE SAINT-MICHEL
Dann begann das schlechte Wetter. Es kam eines Tages, als der Herbst vorbei war. Nachts musstest du wegen des Regens die Fenster geschlossen halten, und der kalte Wind streifte das Laub von den Bäumen auf der Place Contrescarpe. Die Blätter lagen durchnässt im Regen, und der Wind trieb den Regen gegen den großen grünen Autobus an der Endstation, und das Café des Amateurs war überfüllt, und drinnen beschlugen die Fenster von Wärme und Rauch. Es war ein trauriges, schlechtgeführtes Café, Sammelplatz der Trinker des Viertels, und da es dort nach schmutzigen Leibern und den säuerlichen Ausdünstungen der Trunkenheit roch, hielt ich mich fern davon. Die Männer und Frauen, die regelmäßig ins Amateurs kamen, waren immer betrunken, oder jedenfalls immer, wenn sie es sich leisten konnten; hauptsächlich von Wein, den sie halbliter- oder literweise kauften. Viele Aperitifs mit seltsamen Namen wurden angepriesen, aber die konnten sich nur wenige Leute leisten, höchstens als Fundament, auf das sie ihren Weinrausch bauten. Die Trinkerinnen nannte man poivrottes, was so viel wie weibliche Schnapsnasen bedeutet.
Das Café des Amateurs war die Senkgrube der rue Mouffetard, jener wunderbaren, schmalen, bevölkerten Marktgasse, die auf die Place Contrescarpe führte. Die Hockklosetts der alten Mietshäuser, eins auf jedem Treppenabsatz, mit zwei geriffelten, schuhgroßen Erhöhungen aus Zement links und rechts der Öffnung im Boden, damit der locataire nicht ausrutschte, entleerten sich in Senkgruben, deren Inhalt nachts in von Pferden gezogene Tankwagen gepumpt wurde. Im Sommer, wenn alle Fenster offen standen, hörtest du die Pumpen, und der Gestank war enorm. Die Tankwagen waren braun und safrangelb gestrichen, und wenn sie sich bei Mondschein die rue Cardinal Lemoine hinunterarbeiteten, sahen die Zylinder auf den Pferdekarren aus wie Gemälde von Braque. Niemand jedoch leerte das Café des Amateurs, und sein vergilbter Aushang mit den gesetzlichen Bestimmungen und Strafen für Trunkenheit in der Öffentlichkeit war so verschmutzt und unbeachtet, wie seine Kundschaft ausdauernd und übelriechend war.
Mit dem ersten kalten Regen des Winters brach die ganze Traurigkeit der Stadt herein, und die hohen weißen Häuser hatten keine Dachstühle mehr, und beim Gehen sahst du nur das nasse Schwarz der Straße und die geschlossenen Türen der kleinen Läden, der Kräuterhändler, der Schreibwaren- und Zeitungshändler, der Hebamme – zweiter Klasse – und des Hotels, in dem Verlaine gestorben war und wo du im obersten Stockwerk ein Zimmer zum Arbeiten hattest.
Bis hinauf ins oberste Stockwerk waren es sechs oder acht Treppen, und es war sehr kalt, und ich wusste, was ein Bündel kleiner Zweige und drei mit Draht umwickelte Päckchen halb bleistiftlanger Kiefernspäne kosteten, die mit den Zweigen angezündet wurden, und dann das Bündel kurzer Holzscheite, die ich kaufen musste, um ein Feuer zu machen, das mein Zimmer erwärmen würde. Also ging ich auf die andere Straßenseite und sah mir das Dach im Regen an, ob dort irgendwelche Schornsteine in Betrieb waren und wie der Rauch aufstieg. Es war kein Rauch da, und ich überlegte, dass der Kamin kalt wäre und nicht richtig ziehen würde, dass sich das Zimmer mit Rauch füllen würde und das Brennholz und damit auch das Geld dafür vergeudet wäre, und so ging ich im Regen weiter. Ich ging am Lycée Henri Quatre und der alten Kirche Saint-Étienne-du-Mont vorbei, überquerte die windgepeitschte Place du Panthéon, bog schutzsuchend nach rechts ein, gelangte schließlich auf die Leeseite des Boulevard Saint-Michel und kämpfte mich dort weiter voran, vorbei am Cluny und dem Boulevard Saint-Germain, bis ich an der Place Saint-Michel ein gutes Café erreichte, das ich kannte.
Es war ein angenehmes Café, warm und sauber und freundlich, und ich hängte meinen alten Regenmantel zum Trocknen an die Garderobe, legte meinen abgewetzten verwitterten Filzhut auf die Ablage über der Bank und bestellte einen café au lait. Der Kellner brachte ihn, und ich nahm ein Notizbuch aus der Manteltasche und einen Bleistift und begann zu schreiben. Ich schrieb über die Gegend oben in Michigan, und da der Tag wild und kalt und stürmisch war, war auch in der Geschichte so ein Tag. Das Ende des Herbstes hatte ich bereits als Kind, Jugendlicher und junger Mann kommen sehen, und an einem Ort konnte man besser darüber schreiben als an einem anderen. Sich verpflanzen nennt man das, dachte ich, und das kann bei Menschen genauso notwendig sein wie bei anderen wachsenden Dingen. Doch in der Geschichte tranken die Jungen, und davon bekam ich Durst, und so bestellte ich mir einen Rum St. James. Der schmeckte herrlich an diesem kalten Tag, und ich schrieb weiter, fühlte mich prächtig und spürte, wie der gute Rum aus Martinique meinen Körper und Geist durchwärmte.
Ein Mädchen kam ins Café und setzte sich allein an einen Tisch beim Fenster. Sie war sehr hübsch, ihr Gesicht so frisch wie eine neugeprägte Münze, falls man Münzen in weiches Fleisch auf von Regen erfrischte Haut prägt, und ihr Haar war schwarz wie ein Krähenflügel und an der Wange entlang schräg geschnitten.
Ich sah sie an, sie brachte mich durcheinander und machte mich ganz aufgeregt. Ich wünschte, ich könnte sie in der Geschichte unterbringen, oder sonst irgendwo, aber sie hatte sich so gesetzt, dass sie die Straße und den Eingang beobachten konnte, und ich wusste, sie wartete auf jemanden. Also schrieb ich weiter.
Die Geschichte schrieb sich selbst, und ich hatte große Schwierigkeiten, mit ihr mitzuhalten. Ich bestellte noch einen Rum St. James und beobachtete das Mädchen, wenn ich einmal aufblickte oder wenn ich den Bleistift mit einem Spitzer anspitzte und die aufgerollten Späne in den Unterteller unter meinem Glas rieselten.
Ich habe dich gesehen, Schöne, und jetzt gehörst du mir, auf wen auch immer du wartest, selbst wenn ich dich niemals wiedersehe, dachte ich. Du gehörst mir, und ganz Paris gehört mir, und ich gehöre diesem Notizbuch und diesem Bleistift.
Dann schrieb ich weiter und geriet tief in die Geschichte hinein und verlor mich darin. Ich schrieb sie jetzt, sie schrieb sich nicht mehr selbst, und ich blickte nicht auf und dachte weder an die Zeit noch den Ort, an dem ich war, und bestellte auch keinen Rum St. James mehr. Ich hatte genug von Rum St. James, ohne darüber nachzudenken. Dann war die Geschichte fertig, und ich war sehr müde. Ich las den letzten Absatz, dann blickte ich auf und sah nach dem Mädchen, und sie war fort. Hoffentlich ist sie mit einem guten Mann gegangen, dachte ich. Aber ich war traurig.
Ich schloss die Geschichte ab und steckte das Notizbuch in meine Innentasche und bat den Kellner um ein Dutzend portugaises und eine halbe Karaffe des Weißweins, den es dort gab. Wenn ich eine Geschichte geschrieben hatte, war ich immer leer und traurig und glücklich zugleich, als hätte ich mit einer Frau geschlafen, und ich war mir sicher, dass es eine sehr gute Geschichte war, aber wie gut, würde ich erst wissen, wenn ich sie am nächsten Tag noch einmal durchlas.
Als ich die Austern mit ihrem strengen Meergeschmack und dem leicht metallischen Geschmack aß, den der kalte Weißwein fortspülte, sodass nur der Meergeschmack und die fleischige Konsistenz blieben, und als ich die kühle Flüssigkeit aus jeder Schale trank und mit dem frischen Geschmack des Weins hinunterspülte, verließ mich das Gefühl der Leere, und ich begann, mich glücklich zu fühlen und Pläne zu machen.
Nachdem das schlechte Wetter gekommen war, konnten wir Paris für eine Weile mit einem Ort vertauschen, an dem dieser Regen als Schnee durch die Kiefern fiele und die Straße und die hohen Berghänge bedeckte, in einer Höhe, wo wir ihn abends auf dem Heimweg knirschen hörten. Unterhalb von Les Avants gab es ein Chalet, in dem Unterkunft und Verpflegung wunderbar waren, wo wir zusammen wären und unsere Bücher hätten und nachts bei offenen Fenstern und hellen Sternen im warmen Bett lägen. Dorthin könnten wir fahren.
Ich würde das Hotelzimmer aufgeben, in dem ich schrieb, dann blieb nur noch die äußerst geringe Miete für die rue Cardinal Leomine 74 zu zahlen. Ich hatte Artikel für Toronto geschrieben, und die Schecks dafür sollten bald kommen. So etwas konnte ich überall und unter allen Umständen schreiben, und Geld für die Reise hatten wir.
Vielleicht konnte ich fern von Paris über Paris schreiben, wie ich in Paris über Michigan schreiben konnte. Ich wusste nicht, dass es dafür zu früh war, weil ich Paris noch nicht gut genug kannte. Aber so sollte es sich am Ende ergeben. Jedenfalls würden wir fahren, wenn meine Frau es wollte, und ich aß die Austern auf und trank den Wein aus, bezahlte meine Rechnung im Café und ging auf kürzestem Weg durch den Regen, der jetzt nur das örtliche Wetter war und nichts, was dein Leben veränderte, die Montagne Sainte-Geneviève hinauf zur Wohnung auf der Kuppe des Hügels.
«Das wäre wunderbar, Tatie», sagte meine Frau. Sie hatte ein reizend geformtes Gesicht, und ihre Augen und ihr Lächeln leuchteten bei Entschlüssen auf, als seien es kostbare Geschenke. «Wann sollen wir aufbrechen?»
«Wann immer du willst.»
«Oh, am liebsten sofort. Wusstest du das nicht?»
«Vielleicht ist es schön und klar, wenn wir zurückkommen. Es kann sehr schön sein, wenn es klar und kalt ist.»
«Das wird es ganz bestimmt», sagte sie. «Wie lieb von dir, dass du auch ans Verreisen gedacht hast.»
2
MISS STEIN DOZIERT
Als wir nach Paris zurückkamen, war es klar und kalt und schön. Die Stadt hatte sich mit dem Winter arrangiert, in dem Holz- und Kohlegeschäft auf der anderen Straßenseite gab es gutes Holz zu kaufen, und vor vielen der guten Cafés waren Kohlenbecken aufgestellt, sodass man draußen sitzen und es warm haben konnte. Unsere Wohnung war warm und freundlich. Auf dem Holzfeuer verbrannten wir boulets, in Eiform gepresste Klumpen aus Kohlenstaub, und das Winterlicht in den Straßen war wunderbar. Jetzt warst du an den Anblick der kahlen Bäume vor dem Himmel gewöhnt und gingst auf den frischgewaschenen Kieswegen im klaren scharfen Wind durch den Jardin du Luxembourg. Die Bäume waren schön ohne ihr Laub, wenn du dich mit ihnen ausgesöhnt hattest, und der Winterwind blies über die Teiche, und die Fontänen stiegen in das helle Licht. Alle Entfernungen hatten sich für uns verkürzt, seit wir in den Bergen gewesen waren.
Wegen der Höhenveränderung bemerkte ich die Steigung der Hügel allenfalls mit Vergnügen, und auch der Aufstieg ins oberste Stockwerk des Hotels, wo ich in einem Zimmer mit Ausblick über sämtliche Dächer und Schornsteine des hoch auf dem Hügel gelegenen Viertels arbeitete, war mir ein Vergnügen. Der Kamin in dem Zimmer zog gut, und es war warm und angenehm zum Arbeiten. Ich nahm mandarines und geröstete Kastanien in Papiertüten mit aufs Zimmer, und wenn ich hungrig war, aß ich die gerösteten Kastanien, schälte und aß die kleinen Orangen und warf die Schalen und spuckte die Kerne ins Feuer. Vom Gehen und Arbeiten und der Kälte war ich immer hungrig. Oben im Zimmer hatte ich eine Flasche Kirsch, die wir aus den Bergen mitgebracht hatten, und wenn ich ans Ende einer Geschichte oder ans Ende des Tagwerks kam, trank ich ein Glas davon. Wenn ich mit der Arbeit für den Tag fertig war, legte ich das Notizbuch oder die einzelnen Blätter in die Tischschublade und steckte die noch übrigen mandarines in die Tasche. Sie gefroren, wenn ich sie über Nacht im Zimmer liegen ließ.
Es war wunderbar, die vielen Treppen in dem Bewusstsein hinunterzusteigen, dass ich mit der Arbeit gut vorangekommen war. Ich arbeitete immer, bis ich etwas geschafft hatte, und hörte immer auf, wenn ich wusste, wie es weitergehen würde. Auf die Weise konnte ich sicher sein, am nächsten Tag weiterzukommen. Aber manchmal, wenn ich eine neue Geschichte anfing und nicht in Schwung kam, saß ich vor dem Kamin und quetschte die Schalen der kleinen Orangen über der Flamme aus und sah ihrem blauen Funkenstieben zu. Oder ich stand auf und schaute über die Dächer von Paris und dachte: «Keine Sorge. Du hast immer geschrieben und wirst auch jetzt schreiben. Du brauchst nur einen einzigen wahren Satz zu schreiben. Schreib den wahrsten Satz, den du kennst.» Schließlich gelang mir ein wahrer Satz, und von dort ging es weiter. Damals war es einfach, denn es gab immer einen wahren Satz, den du kanntest oder gelesen oder von jemandem gehört hattest. Wenn ich anfing, kompliziert zu schreiben oder wie einer, der etwas bekanntmachen oder vorführen will, erkannte ich, dass ich die Schnörkel oder Ornamente ausmerzen und wegwerfen und mit dem ersten wahren einfachen Aussagesatz anfangen konnte, den ich geschrieben hatte. Oben in diesem Zimmer fasste ich den Entschluss, über alles, worin ich mich auskannte, eine Geschichte zu schreiben. Darum habe ich mich beim Schreiben immer bemüht, und das war eine gute und harte Schule für mich.
In diesem Zimmer lernte ich auch, von dem Augenblick an, da ich zu schreiben aufhörte, nicht an das zu denken, was ich schrieb, bis ich am nächsten Tag weitermachte. Auf die Weise arbeitete mein Unterbewusstsein daran, und gleichzeitig hörte ich anderen Leuten zu und merkte mir alles, hoffte ich; lernte, hoffte ich; und ich las, um nicht an meine Arbeit zu denken und nicht die Kraft dafür zu verlieren. Die Treppe hinunterzugehen, wenn du gut gearbeitet hattest, wozu es außer Disziplin auch Glück brauchte, war ein wunderbares Gefühl, und mir stand es frei, durch ganz Paris zu streifen.
Wenn ich nachmittags auf unterschiedlichen Straßen zum Jardin du Luxembourg ging, konnte ich durch den Park zum Musée du Luxembourg gehen, in dem die großartigen Gemälde hingen, die jetzt zum großen Teil vom Louvre oder Jeu de Paume übernommen worden sind. Fast täglich war ich dort, um mir die Cézannes und Manets und Monets und die anderen Impressionisten anzusehen, von denen ich zuerst im Art Institute of Chicago erfahren hatte. Die Malerei Cézannes lehrte mich, dass das Schreiben einfacher wahrer Sätze bei weitem nicht ausreichte, um den Geschichten die Dimensionen zu verleihen, die ich ihnen geben wollte. Ich lernte sehr viel von ihm, war aber nicht wortgewandt genug, das irgendjemandem zu erklären. Außerdem war es ein Geheimnis. War aber im Luxembourg das Licht schon gelöscht, ging ich durch den Park zur Atelierwohnung von Gertrude Stein in der rue de Fleurus 27.
Meine Frau und ich hatten bei Miss Stein vorgesprochen, und sie und die Freundin, die bei ihr wohnte, hatten uns sehr herzlich und freundlich aufgenommen, und das große Atelier mit den großartigen Bildern gefiel uns sehr. Es glich einem der besten Säle im schönsten Museum, nur dass es hier einen großen Kamin gab und es warm und gemütlich war und sie dir gute Sachen zu essen und zu trinken gaben, Tee und unverfälschte Schnäpse, die aus Pflaumen oder Mirabellen oder wilden Himbeeren destilliert wurden. Das waren duftende, farblose alkoholische Getränke, die aus Kristallkaraffen in kleine Gläser ausgeschenkt wurden, und ob es sich um quetsche, mirabelle oder framboise handelte, sie alle schmeckten wie die Früchte, aus denen sie gemacht waren, und wurden auf deiner Zunge zu einem kontrollierten Feuer, das dich wärmte und dir die Zunge löste.
Miss Stein war sehr dick, aber nicht groß, und kräftig gebaut wie eine Bäuerin. Sie hatte schöne Augen und ein energisches deutsch-jüdisches Gesicht, das auch aus dem Friaul hätte stammen können, und mit ihren Kleidern, ihrem Mienenspiel und ihrem herrlichen, dichten, lebendigen Einwandererhaar, das sie auf dieselbe Weise hochgesteckt trug, wie sie es früher am College getragen haben mochte, erinnerte sie mich an eine norditalienische Bauersfrau. Sie redete unaufhörlich, anfangs vor allem über Leute und Orte.
Ihre Gefährtin besaß eine angenehme Stimme, war klein und sehr dunkel und hatte eine Frisur wie Jeanne d’Arc auf den Bildern von Boutet de Monvel und eine stark gekrümmte Nase. Bei unserem ersten Besuch arbeitete sie an einer Stickerei, sie stickte, versah uns mit Essen und Trinken und sprach mit meiner Frau. Während sie ein Gespräch führte, hörte sie bei zwei anderen zu und schaltete sich oft in eines ein, das sie nicht führte. Später erklärte sie mir, dass sie immer mit den Ehefrauen sprach. Die Ehefrauen, erkannten meine Frau und ich, wurden toleriert. Aber wir mochten Miss Stein und ihre Freundin, wenngleich die Freundin einem Angst machen konnte, und die Bilder und Kuchen und das eau-de-vie waren wirklich wunderbar. Auch sie schienen uns zu mögen und behandelten uns, als seien wir sehr brave, wohlerzogene und vielversprechende Kinder, und ich hatte das Gefühl, sie verziehen es uns, dass wir verliebt und verheiratet waren – dem würde die Zeit schon abhelfen –, und als meine Frau sie zum Tee einlud, nahmen sie an.
Als sie in unsere Wohnung kamen, schienen sie uns noch mehr zu mögen; aber das kam vielleicht daher, dass die Wohnung so klein war und wir enger zusammenrücken mussten. Miss Stein saß auf dem Bett, das auf dem Boden lag, und verlangte die Geschichten zu sehen, die ich geschrieben hatte, und sie sagte, einige gefielen ihr, bis auf eine, die «Oben in Michigan» hieß.
«Die ist gut», sagte sie. «Das ist gar keine Frage. Aber sie ist inaccrochable. Das heißt, sie gleicht einem Bild, das ein Maler malt und dann in keiner Ausstellung aufhängen kann und das keiner kaufen wird, weil man es bei sich zu Hause auch nicht aufhängen kann.»
«Aber was, wenn die Geschichte nicht schmutzig ist, wenn man nur Wörter zu benutzen versucht, die von den Leuten tatsächlich benutzt werden? Die einzigen Wörter, die die Geschichte wahrhaftig machen und die man deshalb benutzen muss? Dann muss man sie benutzen.»
«Aber Sie verstehen mich nicht», sagte sie. «Sie dürfen nichts schreiben, was inaccrochable ist. Das hat keinen Sinn. Es ist falsch, es ist töricht.»
«Ich verstehe», sagte ich. Ich war ganz und gar nicht ihrer Meinung, doch das war Ansichtssache, und ich hielt nichts davon, mich mit Leuten zu streiten, die älter waren als ich. Viel lieber hörte ich ihnen zu, und vieles von dem, was Gertrude Stein sagte, war überaus klug. Sie erklärte mir, früher oder später müsse ich den Journalismus aufgeben, und das sah ich ganz genauso. Sie selbst wolle im Atlantic Monthly veröffentlicht werden, erzählte sie mir, und das würde sie auch. Sie sagte, ich sei als Schriftsteller nicht gut genug für diese Zeitschrift oder die Saturday Evening Post, aber möglicherweise sei ich ja eine neue Art von Schriftsteller, solle jedoch stets daran denken, keine Geschichten zu schreiben, die inaccrochable seien. Ich widersprach ihr nicht und versuchte auch nicht, noch einmal zu erklären, wie ich mit Dialogen umzugehen versuchte. Das war meine Sache, und es war viel interessanter, ihr zuzuhören. An diesem Nachmittag erklärte sie uns auch, wie man Bilder kauft.
«Sie können entweder Kleider kaufen oder Bilder», sagte sie. «So einfach ist das. Niemand, der nicht sehr reich ist, kann sich beides leisten. Achten Sie nicht auf Ihre Kleidung, achten Sie nicht auf die Mode, kaufen Sie Kleidung, die bequem und haltbar ist, dann haben Sie etwas anzuziehen und auch noch Geld, um Bilder zu kaufen.»
«Aber auch wenn ich mir niemals mehr etwas zum Anziehen kaufe», sagte ich, «hätte ich nicht genug Geld für die Picassos, die ich haben will.»
«Richtig. An den kommen Sie nicht ran. Sie müssen Leute in Ihrem Alter kaufen – Leute aus Ihrem Jahrgang beim Militär. Sie werden sie kennenlernen. Sie werden ihnen im Viertel begegnen. Es gibt immer gute, neue, ernsthafte Maler. Aber nicht Sie sind es, der so viel Kleidung kauft. Das ist immer Ihre Frau. Und Frauenkleider sind teuer.»
Ich bemerkte, dass sich meine Frau Mühe gab, nicht auf die seltsamen Zwischendeckskleider zu starren, die Miss Stein trug, was ihr auch gelang. Als sie gingen, mochten sie uns immer noch, schien mir, und luden uns ein, sie wieder in der rue de Fleurus 27 zu besuchen.
Später bekam ich die Einladung, im Winter jederzeit nach fünf ins Atelier zu kommen. Ich hatte Miss Stein im Luxembourg getroffen. Ich weiß nicht mehr, ob sie ihren Hund ausführte oder nicht oder ob sie damals überhaupt einen Hund hatte. Ich weiß nur, dass ich mich selbst ausführte, da wir uns damals weder einen Hund noch eine Katze leisten konnten, und die einzigen Katzen, die ich kannte, waren die in den Cafés und kleinen Restaurants oder die großen Katzen, die ich in den Fenstern der Concierges bewunderte. Später traf ich Miss Stein oft mit ihrem Hund im Jardin du Luxembourg; aber bei dieser Gelegenheit hatte sie wohl noch keinen.
Hund oder kein Hund, jedenfalls nahm ich ihre Einladung an und ging regelmäßig im Atelier vorbei, und sie gab mir immer das unverfälschte eau-de-vie und schenkte mir unablässig nach, und ich sah mir die Bilder an und sprach mit ihr. Die Bilder waren wunderbar und die Gespräche sehr gut. Hauptsächlich redete sie, erzählte von modernen Bildern und Malern – mehr über sie als Menschen denn als Maler –, und sie sprach über ihre Arbeit. Sie zeigte mir die Unmengen an Manuskripten, die sie geschrieben hatte und die ihre Gefährtin täglich abtippte. Täglich schreiben machte sie glücklich, doch als ich sie besser kennenlernte, wurde mir klar, für ihr Glück war es auch notwendig, dass dieser stetige tägliche Ertrag, der zwar mit ihren Kräften schwankte, aber regelmäßig war und daher gewaltige Ausmaße annahm, gedruckt erschien und sie offizielle Anerkennung erlangte.
Als ich sie kennenlernte, war das noch kein brennendes Problem, denn sie hatte drei Geschichten veröffentlicht, die für jedermann verständlich waren. Eine dieser Geschichten, «Melanctha», war sehr gut, und gute Proben ihrer experimentellen Texte waren in Buchform erschienen und von Kritikern, die sie kannten, sehr gelobt worden. Sie besaß eine solche Persönlichkeit, dass man ihr, wenn sie jemanden für sich einnehmen wollte, nicht widerstehen konnte, und Kritiker, die sie kennenlernten und ihre Bilder sahen, gaben ihren Texten, die sie nicht verstanden, einen Vertrauensvorschuss, weil sie von ihr als Mensch so begeistert und von ihrem Urteilsvermögen überzeugt waren. Sie hatte auch viel Stichhaltiges und Wertvolles über Rhythmus und den Gebrauch von Wiederholungen entdeckt und sprach sehr gut darüber.
Aber damit sie weiterhin täglich schreiben konnte, ohne die Plackerei des Überarbeitens und ohne die Verpflichtung, ihre Texte verständlich zu machen, damit sie also weiterhin das wahre Glück des schöpferischen Akts genießen konnte, wurde es allmählich notwendig, dass sie veröffentlicht und offiziell anerkannt wurde, insbesondere für ihr unglaublich umfangreiches Buch The Making of Americans.
Dieses Buch fing großartig an, ging über eine lange Strecke sehr gut weiter, stellenweise geradezu brillant, und erging sich dann in endlosen Wiederholungen, die ein gewissenhafter und weniger fauler Schriftsteller in den Papierkorb geworfen hätte. Ich lernte das Buch sehr gut kennen, als ich Ford Madox Ford dafür gewann – ihn dazu zwang, sollte ich vielleicht sagen –, es in Fortsetzungen in der Transatlantic Review zu veröffentlichen, wobei schon klar war, dass es die Lebensdauer der Zeitschrift überschreiten würde. Ich war allzu vertraut mit der finanziellen Situation der Zeitschrift, und ich musste für Miss Stein sämtliche Fahnen lesen, da dies eine Arbeit war, die sie nicht glücklich machte.
Als ich an diesem Nachmittag an der Concierge vorbei und über den kalten Hof in die Wärme des Ateliers gekommen war, lag das alles noch weit in der Zukunft; und an diesem Tag dozierte Miss Stein über Sex. Inzwischen mochten wir einander sehr, und ich hatte schon vor einiger Zeit gelernt, dass an allem, was ich nicht verstand, wahrscheinlich doch etwas dran war. Miss Stein dachte, ich sei in Sachen Sex das, was wir heute vielleicht einen Spießer nennen würden, und ich muss zugeben, ich hatte gewisse Vorurteile gegen Homosexualität, da ich deren eher primitive Seiten kannte. Ich wusste, dass du deshalb ein Messer bei dir trugst und bereit warst, es zu gebrauchen, wenn du als Junge unter Landstreichern warst, damals, als «Wolf» noch kein Slangausdruck für Männer war, die ständig auf Frauen Jagd machen. Ich kannte viele inaccrochable Ausdrücke und Redewendungen aus meiner Zeit in Kansas City und die Sitten in verschiedenen Vierteln dieser Stadt und auch in Chicago und auf den Schiffen dort. Von ihr befragt, versuchte ich Miss Stein zu erklären, man müsse, wenn man sich als Junge in Gesellschaft von Männern bewegt, bereit sein, einen Mann zu töten, müsse wissen, wie man das macht, und wirklich wissen, dass man es tun würde, um nicht belästigt zu werden. Dieser Ausdruck war accrochable. Wenn du wusstest, dass du töten würdest, spürten das andere Leute sehr schnell, und du wurdest in Ruhe gelassen; aber es gab gewisse Situationen, in die du dich einfach nicht hineinlocken lassen durftest. Ich hätte mich deutlicher ausdrücken und eine inaccrochable Redensart zitieren können, die bei den Wölfen auf den Schiffen gebräuchlich war: «Die Weiber von vorn, die Kerle von achtern.» Aber bei Miss Stein achtete ich immer auf meine Ausdrucksweise, auch wenn authentische Redensarten ein Vorurteil vielleicht verdeutlicht oder besser ausgedrückt hätten.
«Ja, ja, Hemingway», sagte sie. «Aber Sie haben unter Kriminellen und Perversen gelebt.»
Dem wollte ich nicht widersprechen, auch wenn ich glaubte, in einer Welt gelebt zu haben, wie sie eben war, und dass es dort alle möglichen Leute gegeben hatte und ich versucht hatte, sie zu verstehen; doch manche von ihnen konnte ich nicht mögen, und manche hasste ich immer noch.
«Aber was ist mit dem alten Mann, der so gute Umgangsformen und einen großen Namen hatte und der mich in Italien im Lazarett besuchte und mir eine Flasche Marsala oder Campari mitbrachte und sich perfekt benahm, und dann musste ich der Schwester eines Tages sagen, sie dürfe diesen Mann nie mehr zu mir ins Zimmer lassen?», fragte ich.
«Diese Leute sind krank und können nicht anders, und Sie sollten Mitleid mit ihnen haben.»
«Soll ich auch mit Soundso Mitleid haben?», fragte ich. Ich nannte seinen Namen, aber er gefällt sich so sehr darin, ihn selbst zu nennen, dass ich ihn hier nicht zu nennen brauche.
«Nein. Der ist lasterhaft. Der verdirbt die Leute und ist wirklich lasterhaft.»
«Aber er soll ein guter Schriftsteller sein.»
«Das ist er nicht», sagte sie. «Der ist bloß ein Schauspieler, und er verdirbt die Leute, weil er Spaß daran hat, und er führt sie auch in andere Laster ein. Rauschgift, zum Beispiel.»
«Und der Mann in Mailand, den ich bemitleiden soll, hat nicht versucht, mich zu verderben?»
«Seien Sie nicht albern. Wie konnte er hoffen, Sie zu verderben? Verdirbt man einen Jungen wie Sie, der Alkohol trinkt, mit einer Flasche Marsala? Nein, das war ein bedauernswerter alter Mann, der nicht anders konnte. Er war krank, er kam nicht dagegen an, und Sie sollten ihn bemitleiden.»
«Das habe ich damals auch getan», sagte ich. «Aber ich war enttäuscht, weil er so gute Umgangsformen hatte.»
Ich nahm noch einen Schluck von dem eau-de-vie und bemitleidete den alten Mann und sah mir Picassos Akt von dem Mädchen mit dem Blumenkorb an. Ich hatte das Gespräch nicht angefangen und fand, dass es allmählich ein wenig gefährlich wurde. Bei einer Unterhaltung mit Miss Stein trat fast nie eine Pause ein, aber jetzt geschah es doch, und ich merkte, sie wollte mir etwas sagen, und ich schenkte mir nach.
«Sie haben von all dem doch gar keine Ahnung, Hemingway», sagte sie. «Sie haben bekannte Verbrecher und kranke und lasterhafte Leute kennengelernt. Der springende Punkt ist, dass der homosexuelle Akt zwischen Männern hässlich und abstoßend ist und sie sich hinterher vor sich selber ekeln. Sie trinken, nehmen Rauschgift, um darüber hinwegzukommen, aber der Akt ekelt sie an, und sie wechseln ständig die Partner und können nicht wirklich glücklich sein.»
«Ich verstehe.»
«Bei Frauen ist es das Gegenteil. Sie tun nichts, was sie anekelt, und nichts, was abstoßend ist, und hinterher sind sie glücklich und können zusammen ein glückliches Leben führen.»
«Ich verstehe», sagte ich. «Aber was ist mit Soundso?»
«Die ist lasterhaft», sagte Miss Stein. «Die ist zutiefst lasterhaft, daher kann sie nur mit immer neuen Leuten glücklich sein. Sie verdirbt die Leute.»
«Ich verstehe.»
«Sind Sie sicher, dass Sie das verstehen?»
Es gab in diesen Tagen so viel zu verstehen, und ich war froh, als wir schließlich von etwas anderem sprachen. Der Park war geschlossen, also musste ich an ihm entlang zur rue de Vaugirard hinunter und um das untere Ende des Parks herumgehen. Es war schade, dass der Park geschlossen und abgesperrt war, und ich war traurig, weil ich außen herum musste und nicht hindurchgehen konnte und es eilig hatte, nach Hause in die rue Cardinal Lemoine zu kommen. Der Tag hatte sehr heiter angefangen. Morgen würde ich hart arbeiten müssen. Arbeit konnte fast alles heilen, glaubte ich damals, und das glaube ich auch heute. Damals glaubte ich, Miss Stein nehme an, ich müsse lediglich davon geheilt werden, jung zu sein und meine Frau zu lieben. Ich war ganz und gar nicht traurig, als ich nach Hause in die rue Cardinal Lemoine kam und meiner Frau von meinem frischerworbenen Wissen erzählte, und in der Nacht waren wir glücklich mit unserem eigenen Wissen, das wir schon hatten, und anderem neuen Wissen, das wir in den Bergen erworben hatten.
3
SHAKESPEARE & COMPANY
In jenen Tagen gab es kein Geld für Bücher. Bücher lieh man sich in der Leihbibliothek Shakespeare & Company, das war die Bibliothek und Buchhandlung von Sylvia Beach in der rue de l’Odéon 12. In einer kalten, windgepeitschten Straße war dies im Winter ein reizender, warmer, heiterer Ort mit einem großen Ofen, Tischen und Regalen voller Bücher, neuen Büchern im Schaufenster und Fotografien von bekannten toten und lebenden Schriftstellern an der Wand. Die Fotografien sahen alle aus wie Schnappschüsse, und sogar die toten Schriftsteller sahen aus, als hätten sie wirklich gelebt. Sylvia hatte ein lebhaftes, sehr scharf geschnittenes Gesicht, braune Augen, so lebendig wie die eines kleinen Tieres und so munter wie die eines jungen Mädchens, und gewelltes braunes Haar, das von ihrer feinen Stirn nach hinten gebürstet und unter den Ohren und an der Kragenkante ihrer braunen Samtjacke stumpf abgeschnitten war. Sie hatte hübsche Beine, und sie war freundlich, fröhlich und interessiert und scherzte und tratschte gern. Niemand, den ich je gekannt habe, war netter zu mir.
Als ich zum ersten Mal in die Buchhandlung kam, war ich sehr schüchtern und hatte nicht genug Geld für den Beitritt zur Leihbücherei dabei. Sie sagte, ich könne die Kaution jederzeit hinterlegen, wenn ich das Geld hätte, und stellte mir eine Karte aus und sagte, ich könne so viele Bücher mitnehmen, wie ich wolle.
Sie hatte keinen Grund, mir zu trauen. Sie kannte mich nicht, und die Adresse, die ich ihr nannte, rue Cardinal Lemoine 74, hätte in keiner ärmeren Gegend sein können. Aber sie war entzückend und charmant und entgegenkommend, und hinter ihr, bis unter die Decke und ins Hinterzimmer hinein, das auf den Innenhof des Gebäudes ging, erstreckte sich Regal um Regal mit den Reichtümern der Bibliothek.
Ich begann mit Turgenjew und nahm die zwei Bände mit den Aufzeichnungen eines Jägers und ein frühes Buch von D. H. Lawrence, ich glaube, es war Söhne und Liebhaber, und Sylvia meinte, ich könne noch mehr Bücher nehmen, wenn ich wolle. Ich entschied mich für die Constance-Garnett-Ausgabe von Krieg und Frieden und Dostojewskis Der Spieler und andere Erzählungen.
«Sie werden nicht so bald wiederkommen, wenn Sie das alles lesen», sagte Sylvia.
«Ich komme wieder, um zu bezahlen», sagte ich. «Zu Hause habe ich etwas Geld.»
«So habe ich das nicht gemeint», sagte sie. «Bezahlen Sie, wann immer es Ihnen passt.»
«Wann kommt Joyce hierher?», fragte ich.
«Wenn er kommt, dann meist sehr spät am Nachmittag», sagte sie. «Haben Sie ihn noch nie gesehen?»
«Wir haben ihn bei Michaud mit seiner Familie essen sehen», sagte ich. «Aber es ist unhöflich, Leute beim Essen anzustarren, und Michaud ist teuer.»
«Essen Sie zu Hause?»
«Inzwischen fast nur noch», sagte ich. «Wir haben eine gute Köchin.»
«Bei Ihnen in der Nähe gibt es keine Restaurants, oder?»
«Nein. Woher wissen Sie das?»
«Weil Larbaud dort gewohnt hat», sagte sie. «Es hat ihm sehr gefallen, nur das eben nicht.»
«Das nächste gute billige Lokal ist erst beim Panthéon.»
«Ich kenne dieses Viertel nicht. Wir essen zu Hause. Sie und Ihre Frau müssen uns mal besuchen.»
«Warten Sie, ob ich zum Bezahlen wiederkomme», sagte ich. «Aber ich danke Ihnen sehr.»
«Lesen Sie nicht zu schnell», sagte sie.
Zu Hause in unserer Zweizimmerwohnung, die kein warmes Wasser und keine Toilette hatte außer einem tragbaren antiseptischen Behälter, der für jemanden, der an ein Außenklo in Michigan gewöhnt war, keine Unbequemlichkeit darstellte, in unserer Wohnung, in der es dennoch vergnügt und heiter zuging und wir eine schöne Aussicht und eine gute Matratze samt Sprungfedern und geschmackvoller Zudecke als Bett auf dem Boden liegen und Bilder an den Wänden hatten, die uns gefielen, erzählte ich meiner Frau von dem wunderbaren Ort, den ich entdeckt hatte.
«Aber, Tatie, du musst noch heute Nachmittag zurück und bezahlen», sagte sie.
«Selbstverständlich», sagte ich. «Wir gehen beide. Und danach machen wir einen Spaziergang am Fluss und an den Kais entlang.»
«Gehen wir lieber in die rue de Seine und sehen uns die Galerien und die Schaufenster an.»
«Gut. Wir können überall hin, und wir können irgendein neues Café besuchen, in dem wir keinen kennen und keiner uns kennt, und uns einen Drink genehmigen.»
«Wir können uns zwei Drinks genehmigen.»
«Und dann gehen wir essen.»
«Nein. Vergiss nicht, dass wir die Leihgebühr für die Bücher bezahlen müssen.»
«Wir gehen nach Hause und essen hier, etwas Gutes, und trinken Beaune aus dem Genossenschaftsladen, den man von dem Fenster da sieht, mit dem Preis für den Beaune auf dem Schaufenster. Und danach lesen wir, dann gehen wir ins Bett und lieben uns.»
«Und wir werden niemals jemand anderen lieben als uns.»
«Nein. Niemals.»
«Das wird ein schöner Nachmittag und Abend. Jetzt sollten wir erst einmal zu Mittag essen.»
«Ich habe großen Hunger», sagte ich. «Ich hatte beim Arbeiten im Café nur einen café crème.»
«Und wie ging es, Tatie?»
«Ganz gut, glaube ich. Hoffe ich. Was gibt es zu Mittag?»
«Radieschen und gute foie de veau mit Kartoffelbrei und Endiviensalat. Apfelkuchen.»
«Und wir haben alle Bücher der Welt zum Lesen, und wenn wir auf Reisen gehen, können wir sie mitnehmen.»
«Wäre das redlich?»
«Klar.»
«Hat sie auch Henry James?»
«Klar.»
«Was für ein Glück», sagte sie, «dass du das entdeckt hast.»
«Wir haben immer Glück», sagte ich und klopfte wie ein Narr nicht auf Holz. Dabei gab es in dieser Wohnung Holz genug, auf das man klopfen konnte.
4
MENSCHEN AN DER SEINE
Von unserer Wohnung an der rue Cardinal Lemoine führten viele Wege zum Fluss hinunter. Der kürzeste verlief schnurgerade die Straße hinab, war aber steil und brachte dich, nachdem du unten angekommen warst und den dichten Verkehr am Anfang des Boulevard Saint-Germain durchquert hattest, in eine langweilige Gegend an einem langweiligen, windigen Uferstück mit der Halle aux Vins zu deiner Rechten. Die war nicht wie die anderen Pariser Märkte, eher eine Art Zollspeicher, in dem Wein bis zur Zahlung der Steuern eingelagert wurde, und von außen sah das Ganze so freudlos aus wie ein Militärdepot oder ein Gefängnis.
Auf der anderen Seite des Nebenarms der Seine lag die Île Saint-Louis mit ihren schmalen Straßen und alten, großen, schönen Häusern, und du konntest dort rübergehen oder dich nach links wenden und an den Kais entlang spazieren, die Île Saint-Louis und dann Notre-Dame und die Île de la Cité immer zu deiner Rechten.
Manchmal konntest du in den Bücherständen an den Kais amerikanische Bücher finden, die gerade erst erschienen waren und sehr preisgünstig verkauft wurden. Das Restaurant Tour D’Argent hatte oben ein paar Zimmer, die damals vermietet wurden, und wer dort wohnte, bekam im Restaurant einen Rabatt, und wenn die Leute, die dort wohnten, bei der Abreise irgendwelche Bücher zurückließen, verkaufte der valet de chambre sie einem Stand in der Nähe, und du konntest sie bei der Inhaberin für ein paar Francs erwerben. Sie traute englisch geschriebenen Büchern nicht, bezahlte fast nichts dafür und verkaufte sie für einen kleinen raschen Profit.
«Taugen die denn was?», fragte sie mich, als wir Freunde geworden waren.
«Manchmal schon.»
«Woran erkennt man das?»
«Ich erkenne es, wenn ich sie lese.»
«Aber es bleibt doch ein Glücksspiel. Und wer kann schon Englisch lesen?»
«Legen Sie sie für mich zurück, ich sehe sie mir dann an.»
«Nein. Zurücklegen kann ich sie nicht. Sie kommen zu unregelmäßig. Manchmal kommen Sie lange Zeit gar nicht. Ich muss sie so schnell wie möglich verkaufen. Niemand kann sagen, ob sie nicht wertlos sind. Wenn sie sich als wertlos herausstellten, würde ich sie niemals verkaufen.»
«Woran erkennen Sie ein wertvolles französisches Buch?»
«Zunächst einmal an den Bildern. Dann kommt es auf die Qualität der Bilder an. Und wie die Bücher gebunden sind. Wenn ein Buch gut ist, wird der Besitzer es anständig binden lassen. Alle englisch geschriebenen Bücher sind gebunden, aber schlecht gebunden. Man kann sie einfach nicht einschätzen.»
Nach diesem Stand beim Tour D’Argent kamen keine anderen mehr, die amerikanische und englische Bücher verkauften, erst wieder am Quai des Grands Augustins. Von dort bis hinter den Quai Voltaire gab es einige, die Bücher verkauften, die sie von den Angestellten der Hotels am linken Ufer und vor allem des Hotels Voltaire bekamen, das wohlhabendere Gäste hatte als die meisten anderen. Eines Tages fragte ich dort eine Standbesitzerin, die eine Freundin von mir war, ob diese Bücher sich überhaupt verkaufen ließen.
«Nein», sagte sie. «Die werden alle fortgeworfen. Daran erkennt man, dass sie keinen Wert haben.»
«Freunde schenken sie ihnen, damit sie auf dem Schiff was zu lesen haben.»
«Zweifellos», sagte sie. «Auf den Schiffen werden bestimmt viele liegen gelassen.»
«Allerdings», sagte ich. «Die Reederei behält sie, lässt sie binden, und so entstehen die Schiffsbibliotheken.»
«Das ist klug», sagte sie. «Auf die Weise sind sie wenigstens anständig gebunden. Dann hätte ein solches Buch schon einen Wert.»
Ich spazierte oft an den Kais entlang, wenn ich mit der Arbeit fertig war oder über etwas nachzudenken versuchte. Das Nachdenken fiel mir leichter, wenn ich ging und etwas tat oder Leuten dabei zusah, wie sie etwas taten, von dem sie etwas verstanden. Am Ende der Île de la Cité unterhalb der Pont Neuf, wo die Statue von Henri Quatre stand und die Insel in einer scharfen Bugspitze auslief, lag ein kleiner Park mit schönen Kastanienbäumen, einige davon mit gewaltigen Kronen, und in den
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: