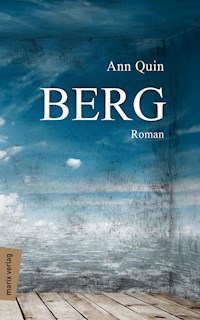Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MÄRZ Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder, der vielleicht gefoltert, eingesperrt oder gar getötet wurde. Sie ist in Begleitung ihres Liebhabers, der zugleich ihr männliches Spiegelbild ist. Stets auf der Suche nach sich selbst, immer in Bewegung, führen sie ihre ganz verschiedenen und doch ineinander verflochtenen Existenzen, stürzen sich auf nutzlose Hoffnungen, zögern aufzugeben, fürchten sich vor dem Ende. Ann Quins erfindungsreiche Verwendung von Wörtern besitzt eine fast musikalische Qualität, die in Verbindung mit der außergewöhnlichen Intensität ihres Erzählstils einen Roman hervorgebracht hat, der so bestechend wie schön ist. Zwischen erzählenden Teilen und Tagebuch wechselnd ist Quins dritter Roman zugleich erotisch und doch furchteinflößend, ja gilt gar als ihr betörendstes, poetischstes und geheimnisvollstes Werk. Ihre literarische Freiheit bahnte einen Weg, dem Autor:innen wie Eimear McBride, Chris Kraus und Anna Burns noch heute folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ann Quin
Passagen
Aus dem Englischen von Elisabeth Fetscher
Herausgegeben von Barbara Kalender und mit einem Vorwort von Claire-Louise Bennett, aus dem Englischen von Eva Bonné
MÄRZ
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Einleitung
In seiner Einleitung zu Ann Quins Debütroman Berg (1964) schrieb Giles Gordon: »Hier war eine Stimme aus der englischen Arbeiterklasse, und sie klang anders als alle anderen.« Quin hob sich vom Mainstream ab, weil sie jenen kernigen Realismus, wie er damals durch Autoren wie Arnold Wesker, John Braine oder John Osborne vertreten wurde, tunlichst mied. »Ehrlich gesagt«, schrieb Quin, »finde ich ihre tumbe 19.-Jahrhundert-Prosa unerträglich.« Von Schreibenden aus der Arbeiterklasse wird oft erwartet, dass sie authentische Berichte über den Alltag und den Überlebenskampf der Betroffenen abliefern, was natürlich geschieht und auch geschehen sollte, und nicht annähernd genug davon wird veröffentlicht. Was aber noch lange nicht bedeutet, dass eine Person, deren sozioökonomischer Status ihr Beschränkungen auferlegt, sich für nichts anderes interessieren würde und sich nichts anderes vorstellen kann; auch sie kann alternative Identitäten und Erfahrungen entwerfen. Glauben Sie mir – wer mit Ungleichheit und Benachteiligung aufgewachsen ist, wird Ungleichheit und Benachteiligung niemals übersehen und sich ebenso rasend wie ohnmächtig darüber ärgern. Die Herkunft aus dem Arbeitermilieu wird für immer prägen, wie man die Welt sieht und in ihr gesehen wird; doch möglicherweise erkennt man irgendwann, dass sie weder den eigenen Lebensweg noch die eigenen Themen vorgeben muss, und dass das Schreiben – die Erforschung der komplexen Wechselbeziehung von Sprache, Erleben und Wirklichkeit – im Laufe der Zeit eine nachhaltige Möglichkeit eröffnen kann, die Welt völlig unabhängig von so genannten Klassenunterschieden zu deuten und in ihr zu sein.
Vor einer Weile wurde mir bewusst, dass in einem Arbeiterumfeld aufzuwachsen, ein ästhetisches Verständnis fördert, das auf ganz natürlichem Wege zu idiosynkratischen, vielstimmigen und unverkennbar experimentellen Werken führt. Die Wände sind hauchdünn. Es gibt kaum Privatsphäre. Und auch keine Sicherheitsnetze, keine Schutzmechanismen, keine Filter und schon gar keine Türen, wie sie Menschen aus wohlhabenden Verhältnissen vom ersten Tag an offenstehen. Die eigene Haut ist ebenfalls hauchdünn. Wer sich von einem mageren Gehaltsscheck zum anderen hangelt und ohne eine klare Vorstellung von der Zukunft leben muss, erlebt den Alltag als prekär, willkürlich, fragmentiert, instabil und unkontrollierbar. Quins Essay »Ein Tag im Leben einer Schriftstellerin« (Originaltitel: »One Day in the Life of a Writer«) verzichtet auf die romantisierende Vorstellung von der ruhigen Gartenlaube, in der die Autorin in heiliger Abgeschiedenheit schreibt. Stattdessen ruft die Vermieterin etwas von Räucherhering und Lammeintopf durchs Treppenhaus, ein Fensterputzer späht von seiner Leiter ins Zimmer, auf der Promenade hängen Arbeitslose herum und spucken grummelnd aufs Pflaster, der Teppich und die Lampenschirme sind voller Brandlöcher. Alles ist viel zu rau und unmittelbar, um sich ausblenden zu lassen. An anderer Stelle erwähnt Quin die »Zwischenwand« am Bett, die »nachts vom Wälzen und Schnarchen meines anonymen Nachbarn erzitterte«.
Quins Prosa ist fragmentiert und kaleidoskopisch. Von ihrem Standpunkt aus verschwimmen die Grenzen zwischen Gegenständen und Lebewesen, zwischen dem Ich und dem Anderen, sodass die Welt als Gestalt und Geometrie, Gewebe und Geräusch wahrgenommen wird. Aus diesem Grund warfen einige zeitgenössische Kritiker Quin vor, sie habe sich beim Nouveau roman bedient. Für ihren brillanten Quin-Essay im Times Literary Supplement gräbt Julia Jordan einige dieser vorhersehbar geringschätzigen Rezensionen aus: »Ronald Hayman wirft ihr ›Anleihen‹ bei Nathalie Sarraute vor; sie sei mit einer ›idiosynkratischen Verachtung für Anführungszeichen‹ infiziert und das Opfer einer unbewussten Nachahmung. Robert Nye sieht Berg ›näher am Frühwerk von Graham Greene als bei den modischen französischen New-Wavers, welche die Autorin […] zu imitieren glaubt‹.« In meinen Augen ignorieren diese hämischen Einschätzungen – natürlich – den Einfluss des häuslichen Umfelds auf Inhalt und Form eines Textes. Angela Carter sagte über die Entstehung ihrer Kurzgeschichtensammlung Fireworks: »Mit den Geschichten habe ich angefangen, als ich in einem Zimmer lebte, das zu klein für einen Roman war.« Rumms! In Quins fahriger, forensisch genauer, vielstimmiger Prosa erkenne ich den kraftvollen und authentischen Ausdruck eines unerträglich anstrengenden Paradoxons, das den Alltag der Arbeiterklasse prägt: Einerseits ist das Umfeld rau und direkt, andererseits erscheint vieles darin fremdbestimmt und unendlich öde. Man wird pausenlos überwältigt und ist zugleich ständig unterfordert. Kein Wunder also, wenn dasselbe Paradoxon ein am Phänomenologischen ausgerichtetes, ebenso involviertes wie losgelöstes Gespür erzeugt.
Quin hat zweifellos ein Auge für Kleinigkeiten wie das »verschmierte Ei in den Mundwinkeln«, doch mit dem vielschichtigen Realismus, dem diese Art von Detail typischerweise dient, hält sie sich nicht lange auf. Sie wusste, dass das Leben und die Menschen mehr zu bieten haben als bloß das. In Passagen finden sich zwei Figuren auf einer Auslandsreise in einem totalitären Regime wieder, in der Gegenwart einer beunruhigenden, unberechenbaren Präsenz, die sie auf sich zurückwirft – »der Geist geht aus, um sich selbst zu begegnen«, schreibt Quin. Die Bewusstseinserweiterung hat eine lustvolle Selbstauflösung zur Folge. »Sie sagt, dass sie keine Grenzen in/für sich selbst kennt«, beschreibt der Mann die Frau. Sie lebe mit so »rasender Intensität«, weil sie sonst »von der Wirklichkeit aufgefressen« würde. Der Mann wiederum zieht zur Realitätsabwehr die Dunkelheit vor: »Es spricht etwas dafür«, sinniert er, »an einem weit entfernten Ort zu bleiben, ohne Namen, ohne Identität.« Quins außergewöhnliche, flirrende Prosa bildet den Auflösungsprozess und die sich daraus ergebenden existenziellen Fragen mit klarem Blick und atemberaubendem Geschick ab. Welcher Mensch kann, wenn ihm seine Identität aufgekündigt wurde, überhaupt noch individuell und intakt sein? »Ich habe keine Ahnung, wer ich gestern war«, erklärt der Mann. Er ist zum Geschöpf seiner Einbildungskraft geworden, und damit auch »immer unfähiger, eine Wahrheit zu erkennen, festzustellen, eine Erfahrung zu teilen«. Können zwei Menschen sein wie die Kreise von zwei in einen Teich geworfenen Steinen und »gleichmäßig wachsen, einer im andern, ohne den andern zu zerstören«?
Und überall in Quins Büchern wogt und wallt das heraufbeschworene Meer. In Passagen erscheint es als grenzenlos formbarer Körper: »Halb zylindrische Wellen behielten ihre Richtung bei, wenn sie einander schnitten. Durch die Berührung des Wassers entstandene Bewegungen durchdrangen einander, ohne ihre erste Form abzulegen.« In einer der fesselndsten Zeilen fragt der Mann: »Halte ich ihren Körper oder das Meer in meinen Armen?« Passagen enthält einige der wahrhaftigsten und anrührendsten Beschreibungen des Schiebens und Ziehens innerhalb der leidenschaftlichen Liebesbeziehung, ihrer Spannungen und Konflikte. Seit Sarah Kanes unerschrockenen Theaterstücken habe ich keinen Text mehr gelesen, der mit vergleichbarer Dringlichkeit vermittelt hätte, was es bedeutet, einen anderen Menschen zu begehren und seine »Träume, Bedürfnisse, Heimsuchungen, Forderungen, Wünsche« kennen zu wollen – wie die Frau den Wunsch zu verspüren, »seine Geschichte in sich aufzunehmen, während sie ihn in den Mund nahm« – und gleichzeitig wandelbar und frei zu bleiben und sich seine Geheimnisse und Schattenseiten zu bewahren: »Das Problem ist, herauszufinden, ob ich mit den Dämonen dieser Frau leben kann, ohne meine eigenen einzubüßen.«
Wie Quin zog es Kane zur brutalen Bildsprache und mitreißenden Energie der griechischen Mythologie hin, was sich vor allem in Phaidras Liebe niederschlug. In Passagen könnte man die Suche der Frau nach dem verstorbenen Bruder als Anspielung auf Antigone verstehen; das Tagebuch des Mannes ist mit Kommentaren zu Gewaltdarstellungen auf antiken griechischen Friesen gespickt. Die mythischen Bezüge erinnern an Thomas Manns tiefen Brunnen der Vergangenheit, an die Vorstellung, dass die vielen einzelnen Elemente, die einen Menschen ergeben, aus einem Universum »außerhalb und vor ihm« stammen. Mann spricht von einer »Lebensauffassung«, welche »die Aufgabe des individuellen Daseins darin erblickt, gegebene Formen, ein mythisches Schema, das von den Vätern gegründet wurde, mit Gegenwart auszufüllen und wieder Fleisch werden zu lassen« (aus: Joseph und seine Brüder). Quin stellt dieses Postulat sozusagen auf den Kopf (der Medusa), indem sie es in den Kontext weiblicher Erfahrung einordnet: »Die matriarchalischen Göttinnen reflektieren das Leben der Frauen, nicht Frauen das Leben der Göttinnen.« Passagen strotzt vor derlei Umkehrungen; das Innere befindet sich im Außen und aus oben wird unten, bis der Mann irgendwann erkennt: »Wir scheinen uns weder vorwärts noch zurück zu bewegen.« In der Tat schiebt sich in Passagen so viel übereinander, dass Vergangenheit und Zukunft nicht mehr existieren – »Zeit/Ordnung/Raum gefaltet« – und die Frau und der Mann aus einer Obsession auftauchen, »die sich bisher nicht selbst gerächt hat, und die tausendundein Jahre Leben nicht befriedigen würden«.
Passagen ist ein schmaler Band, aber sobald man einmal anfängt, seine Schichten freizulegen und seine Verknüpfungen zu entwirren, ergeben sich, ähnlich wie in einem antiken Puzzle, unbegrenzte Deutungsmöglichkeiten. Dieses Buch will am Stück gelesen werden, denn anders lässt es sich nicht erfahren. Es zwischendurch aus der Hand zu legen, wäre ein bisschen so, als wollte man eine Auster in kleinen Happen und mit langen Pausen essen – sinnlos, zutiefst irritierend und letztlich unbefriedigend. Trinken Sie es in einem Zug. Werden Sie zum Meer. Je mehr Aufmerksamkeit Sie ihm schenken, desto gründlicher wird es Sie, Ihre Träume und Obsessionen, Ihre Forderungen und Dämonen entwirren. Wenn Sie danach, um es mit Mann zu sagen, wieder Fleisch geworden sind, werden Sie sich erfrischt und verwandelt fühlen, und alle Mysterien wurden erweckt. »Zurück in meinem Körper das Gefühl«, schreibt der Mann am Ende, »dass ich vielleicht ein anderer sei, ein treibendes Etwas, das wenigstens einen Ort zum Wohnen gefunden hatte, keine Erinnerung an Glück – nur Neugier.« Neugier. Das ist es. Passagen haben in mir eine bestimmte Art von Neugier geweckt, wie ich sie schon lange nicht mehr empfunden hatte. Sie ist schwer zu beschreiben. Sie ähnelt der furchtlosen Neugier der Heranwachsenden, sie ist sexuell, solipsistisch, melancholisch, heftig, gierig, schmachtend – und grenzenlos.
Claire-Louise Bennett, Galway, im September 2020
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Ann Quin
Passagen
In Erinnerung an Ian
NICHT dass ich die Möglichkeit aufgegeben hätte, dass mein Bruder tot ist. Wir haben diskutiert, was möglich ist, was nicht. Sie sagen, dass es noch jede Chance gibt. Überhaupt keine Chance. Über tausend Verschleppte in dieser Gegend, vielleicht mehr. So ziehen wir also weiter. Dorthin. Weg von hier. Fordern einen andern auf, an seine Stelle zu treten, wie ich ihn ins Profil rücke. Umrisse, die meiner Fantasie entsprechen. Zimmer mit oder ohne Verbindungstüren. Er passt auf, wenn sie nicht da ist. Ein perverser Schutz, von dem er weiß, dass sie ihn braucht. Über seine Lage
macht er Notizen. Für ein Buch. Tagebuch. Bericht in irgendeinem Hotel. Ich frage nicht mehr. Teile von ihm will ich kennen, von andern erzählt er mir. Reisen, die er früher hierher gemacht hat. Das Meer. Früchte. Trockene Flussbetten. Betten, in denen geschlafen, nicht geschlafen wurde. Zurück von Inseln. Betoninseln. Kahl. Bebaut. Sonne vor Regen. Gewalt dieser Gedanken Tag um Tag. Stößt Finger auf Insekten bei Nacht. Ihre Spuren an weißen Wänden. Ihr Kopf, der sich im Nachmittagsschlaf herumrollt. Im halbdunklen Zimmer hörte er Musik. Ich lauschte auf Geräusche, wartete auf die, die nie kamen. Ich sah nicht auf. Ihre Körper drehten sich, sie obenauf. Beine, Arme, bewegten sich mit der Musik über ihm. Auf dem Boden, dem Bett. Sie machten ein Zelt aus dem Laken. Licht auf Hautflächen. So nahe Bewegungen, wenn ich meine Hand ins Freie streckte
hörte ich Zikaden, Wind, der in die Bäume stößt. Geräusch eines Ozeans in dem langgezogenen Zimmer. Ich öffnete die Läden.
Die Stadt zusammengeduckt über dem Meer. Schmale Schatten von Zypressen. Sie stand über ihm, er drückte sie herunter auf die Knie. Ich zog die Vorhänge zu. Ich konnte nichts sehen, sah aber, was als nächstes geschehen würde. Ich war durstig. Rauchschweres Wasser, Hitze, ein bitterer Geschmack. Die Härte des Glases, in dem sie sich selber sah. Das Sum Sum Summen eines Moskitos um eine Kerze. Wachs formte grüne Flüsse. Erstarrt. Ich versuchte ihn vom Boden aufzuheben. Gelächter. Später als mein eigenes erkannt. Das Meer eine schwache weiße Linie. Ein Verlangen
nach Regen. In der Sonne getrocknete Oliven keine Eindrücke mehr. Vom Staub geweißte Trauben. Sand, in Wasser getaucht. Er zog Seetang um das Bett, als mein Haar, mein Hals nicht mehr Teil des Seetangs waren. Sonne hinter Felsen. Schattensäulen von Feigenbäumen, wo ich schlief. Erwacht hing ich über dem Bett. Im nächsten Zimmer entdeckte ich ihr Lächeln, es schien größer, als das Gesicht es halten konnte. Sie hielt seinen Kopf. Er in Gebetshaltung, im Begriff emporzuschießen. Er bewegte sich zwischen Spiegeln, durchmaß die zwei Zimmer. Erschien nackt auf dem Balkon. Ah, da bist du ja, ich hab schon überlegt, wo du geblieben sein könntest. Er wandte sich murmelnd ab. Unerträgliche Hitze, wenn’s nur nicht so trocken wäre, wenn’s nur regnen wollte. Er gestikulierte, als ob er die Wolken öffnen wollte. In Hälften aufschlitzen. Er stellte die Klimaanlage stärker ein.
Wir tranken kleine Tassen mit schwarzem Kaffee, dick, süß. Und schlürften Halwa. Brot aus dem Ofen in einem anderen Teil des Hauses. Er stieg eine Wendeltreppe hinab. Sie blickte in den runden Spiegel. Spiegelwände. Kreise aus Wasser, Bäumen, Gesichtern, entrückt im vorübergleitenden Licht. Er rieb einen länglichen Stein. Eine Feige öffnete sich langsam. Dünne Lippen. Zusammengezogene Augen auf den tieferen Schichten. Aufblitzende Momente, gelb, blau, orange. Himmel, so blau, bestürzt die Augen. Im Liegen sah ich die See nicht mehr. Das Land eine Wüste. Möwen, nasses Papier, kreischten. Sie suchte nach ihrem Bruder vor Marmor-, Eisengeländern, Eingangshallen, Hotels. Ich erinnere mich an ein Museum, wo ich auf seine Unterschrift stieß, die vielleicht überhaupt nicht da war.
Vom Strand herauf hielten wir uns an den Händen, rannten quer durch die Dünen. Die niedrigeren Dünen, in denen wir lagen. Umgeben von hohem Gras, gewelltem Sand. Risse, von Meeren von Sand verschlungen. Der Strand langgezogen, schmal. Löcher, Flecken, Zeichen, wo andere begraben gewesen waren. Unter Wasser umkreisten wir Fische, einander. Schatten wuchsen, glitten vorüber, flachten sich ab. Machten Muster, aus denen sie sich herauslehnte. Unsere Schatten glitten über Sandhügel. Wir aßen Trauben, die wir ins Meer getaucht hatten, ihrer Süße Salz hinzugefügt. Wir holten sie aus ihrer Schale. Wespen ließen sich auf den Resten nieder. Schwärme von kleinen weißen Fischen am Rand des Wassers entfesselt. Seine Hände schöpften. Netzwerk der Finger über dem Meer. Wellen rollten zurück von Orten, die sie ausgehöhlt hatten. Hände fühlten die Trockenheit unter Schichten von Sand. Ein Hügel
im Dunkeln. Volleres Glockengeläut von Schafen und Ziegen, als wir näherkamen. Stadtlichter, herabgefallenes Nest von Leuchtkäfern, zwischen den Hügeln. Gruppen von Musikanten vor den Cafés. Männer spielten Würfel. Wir waren Fremde. Wir wurden akzeptiert, übersehen. Neugier zu Beginn. Sie kehrten zurück zu ihren Kugeln, Würfeln, Getränken. Männer tanzten mit Männern. Frauen beobachteten sie, suchten das zu verleugnen. Immer noch friedhofdurchwandernde Priester gingen lächelnd vorbei, erhoben die Hände, sammelten noch mehr Staub auf ihren Gewändern und Bärten. Ältere Männer fuhren fort zu spielen, sprachen von der politischen Lage, vom Fischen, vom Geld, dem Krieg. Von Ländern, die sie gesehen, nicht gesehen hatten, von denen sie hofften, dass ihre Söhne sie sehen würden. Manchmal sprachen sie in einem Dialekt, den wir nicht verstanden. Wir wurden missverstanden.
Man informierte uns im Tausch gegen Geld, Kleidung, Zigaretten, Getränke. Man informierte uns falsch. Er hat jetzt eingesehen, dass wir keine Wahl haben, darum bewegen wir uns vom Hotel zum Taxi, vom Taxi zum Zug. Vom Speisewagen zum Schlafwagen.
Halb herabgelassene Jalousien. Tupfenschwarz, ein Viertel weiß. Wasserflecken entlang der Küste. Regen wandert, entwirft seinen eigenen Schatten. Winde ziehen sich auf Gipfeln zusammen, an den Steilhängen der Berge. Von der See zerschnittene, schnelle Wolkenzüge. Über weite, tiefer gewordene Täler, wo die Flüsse ständig ihre Lage verändern. Die Sockel der Berge zurückweichend gegen den Flusslauf. Lichter, Signale von Städten, Dörfern, Orten, die ich nur aus Karten, aus Broschüren kenne. Lange leere Bahnhöfe. Sich kreuzende Gleise. Ein Mann ging daran entlang, schwang ein rotes Licht. Das Schweigen, wenn der Zug hält. Auf eine lange Wand geworfener Schatten. Er muss am Fenster gestanden haben. Ich schob die Türen auf. Er war nicht da. Der Zug setzte sich in Bewegung, hielt, zischte, zitterte. Gestalten wie Pferde
drängten sich zusammen, hoben die Köpfe. Das Wiehern wurde schwächer. Klang von Hufen auf trockener Erde. Marmor und Kalkstein. Eine Bewegung, als sähe ich sie nicht, vielleicht blind von Staub. Ich dachte, ich hörte seine Stimme aus einem anderen Abteil. Sie stand unter der Tür. Er sah nicht auf. Er benutzte eine neue Feder. Falten um seinen Mund, seine Augen. Falten in den Hosen. Die Hand tastete nach dem Tisch. Er fiel vornüber. Die Whiskyflasche leer. Tag um Tag glitten die Nächte vorbei, überrollt. Fenster zu. Wie spät ist es denn? Er drehte ihr Handgelenk um. Deine Uhr ist stehengeblieben, muss stehengeblieben sein. Hände zogen die Jalousien hoch, runter. Drücken an den Fensterläden, zwischen ihnen eine Leiste hoch. Finger im Haar, Rückgrat, Kratzer markieren die Konturen von Rippen. Notizpapier, bedeckt mit unleserlicher Schrift. Er arbeitet eine Route aus, eine Erklärung, einen Bericht. Er bedeckte das Papier mit der Hand, knüllt es zusammen, aus dem Fenster geworfen, unter den Zug. Er zog langsam an der Zigarre, Augen halb geschlossen. Die Hände ruhten zwischen den Beinen, Kopf zurückgelehnt, Finger vorgespreizt, bewegt, als ob sie irgendeinen Dialog unterstrichen.
Wir gingen etwas trinken. Ein anderer Teil des Zuges. Ein fetter Priester einer Nonne gegenüber. Sein Kruzifix pendelt gegen Haar, Bart, Brust, Haar. Die Nonne erhob sich in Streifen blauen Lichts. Wir saßen an der Bar, vermieden es, in den gegenüberliegenden Spiegel zu sehen. Er blickte gelegentlich zur Seite. Ein nasser Kreis auf poliertem Holz – sie machte viele Kreise daraus. Sein Kopf machte flinke Wendungen. Sie wusste, es war unmöglich. Sie blieb. Ihr Drink wurde zu warmem Wasser. Seine Knöchel rot, dunkle Haare glitten zwischen ihnen hindurch. Ich fühlte ihr Gewicht. Die schwereren Teile der Fensterrahmen, Räder, Metall. Ich beugte mich weiter vor. Sein Kopf schlug auf seine Arme. Aus Bäumen kam ihr Lachen, ging wieder. Der Korridor drehte sich von mir weg. Türen gingen rasselnd auf, schlossen sich. Schlossen dunklere Schatten ein. Vorüberziehendes Band von Vögeln. Im Staub, plötzlicher Aufruhr von Flügeln, aus Zweigen heraus.
Er lag auf trockenen Blättern, einen Strang gelbes Gras im Mund. Ein großes, verlassenes Nest, ihre Hand zog die Fasern nach, die raue Oberfläche von Gras und kleinen Zweigen. Er stand auf, stellte sich auf die Zehenspitzen, Brust herausgestreckt, Kopf zurückgeworfen, vorwärts. Frauen gingen vorbei, Wasserkrüge auf den Köpfen. Er kannte den Ort, hatte sie dahin gebracht. Er sprach von anderen Orten, von Frauen, die er gekannt hatte, die er kennenlernen wollte. Ich lachte, tanzte um ihn herum. Er tanzt nie. Seine Hände ertasten die Länge des Tisches. Dessen Härte. Weichheit. Die Knie darunter gingen zusammen, trennten sich. Die Ringe an ihren Fingern rauf und runter. Erdrunzeln entlang. Das Weiß seiner Augen, ehe er sie ganz schloss. Die Form seiner Mundwinkel formt seine Augenwinkel. Augenbrauen. Gedankenspuren. Träume