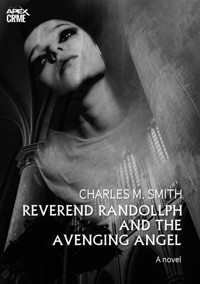6,99 €
Mehr erfahren.
Pater Randollph will wieder einmal den alten Johannes Humbrecht besuchen, um ihm eine Weile Gesellschaft zu leisten. Aber diesmal kommt es nicht zu einem gemütlichen Gespräch in der heruntergekommenen Wohnung des alten Mannes. Humbrecht ist tot - erschlagen von einem Einbrecher, wie es scheint. Anlass für den Mord war offensichtlich eine Gutenberg-Bibel, hinter der jetzt skrupellose Geschäftemacher her sind...
Der Roman Pater Randollph und die 6. Todsünde des US-amerikanischen Schriftstellers Charles M. Smith (* 1919; † 1986), der die Tradition von Chestertons Pater Brown fortsetzt, erschien erstmals im Jahr 1984; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im Jahr 1984.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CHARLES M. SMITH
Pater Randollph
und die 6. Todsünde
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
PATER RANDOLLPH UND DIE 6. TODSÜNDE
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Pater Randollph will wieder einmal den alten Johannes Humbrecht besuchen, um ihm eine Weile Gesellschaft zu leisten. Aber diesmal kommt es nicht zu einem gemütlichen Gespräch in der heruntergekommenen Wohnung des alten Mannes. Humbrecht ist tot - erschlagen von einem Einbrecher, wie es scheint. Anlass für den Mord war offensichtlich eine Gutenberg-Bibel, hinter der jetzt skrupellose Geschäftemacher her sind...
Der Roman Pater Randollph und die 6. Todsünde des US-amerikanischen Schriftstellers Charles M. Smith (* 1919; † 1986), der die Tradition von Chestertons Pater Brown fortsetzt, erschien erstmals im Jahr 1984; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im Jahr 1984.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
PATER RANDOLLPH UND DIE 6. TODSÜNDE
Erstes Kapitel
Nie zuvor hatte Randollph die noch warme Leiche eines Erschlagenen gesehen. Seine Erfahrung mit Toten beschränkte sich auf jene sorgfältig vom Leichenbestatter geschminkten und präparierten Exemplare, die stets in Begleitung von gedämpfter Orgelmusik dem Beschauer präsentiert wurden, um den Eindruck zu erwecken, all das wäre unwirklich und der Tod verliere alle Schrecken, wenn man nur professionell mit ihm umzugehen verstehe.
Johannes Humbrecht allerdings war außerordentlich wirklich. Und er war ganz zweifellos tot, wie er mit dem Oberkörper über jenen wackeligen Tisch ausgestreckt dalag, an dem Randollph so oft mit dem alten Mann gesessen und den starken, ungenießbaren Tee getrunken hatte, den dieser ihm gewöhnlich servierte. Im Todeskampf hatte Humbrecht seine Tasse mitsamt der Untertasse zu Boden gestoßen. Randollph registrierte diese Kleinigkeit wie nebenbei. Eine zweite Tasse stand noch gefüllt mit Tee am entgegengesetzten Tischende.
Humbrecht lag mit dem Gesicht nach unten auf der Tischplatte, sodass Randollph die Todesursache geradezu ins Auge stach. Der Hinterkopf des alten Mannes war nur noch eine blutige Masse aus zerschmetterten Knochen und Gehirn.
Randollph gab sich schließlich einen Ruck und sah sich nach einem Telefon um. Dann fiel ihm ein, dass es in Humbrechts altem, einst vornehmen Haus kein Telefon gab... wenigstens keines, das angeschlossen war. Möglicherweise stand irgendwo zwischen den Unmengen von altem unbrauchbarem Zeug, mit dem die Zimmer des Hauses vollgestopft waren, ein Telefonapparat, aber Randollph brauchte einen, der funktionierte. Daher blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach einer öffentlichen Telefonzelle zu machen. Randollph vermutete, dass diese erst vier Blocks weiter in der Nähe der teuren Boutiquen, Friseursalons und Restaurants zu finden war. Er musste die Mordkommission und vor allem Lieutenant Michael Casey anrufen... vorausgesetzt, Casey war überhaupt erreichbar.
Randollph griff nach dem Türknauf und zuckte im nächsten Augenblick davor zurück, als könne er sich daran die Finger verbrennen. Ihm war eingefallen, dass er den Knauf auf der Innenseite der Tür nicht berührt hatte und dass möglicherweise Fingerabdrücke darauf waren. Immerhin hatte er oft genug Lieutenant Casey bei der Arbeit beobachtet, um die Wichtigkeit von Fingerabdrücken zu kennen. Randollph benutzte sein Taschentuch als Schutz und drehte den Türknauf herum. Auf der Außenseite hatte er Seine Fingerabdrücke natürlich bereits hinterlassen. Als Humbrecht auf sein Klopfen nicht reagiert hatte, hatte er die Türklinke in die Hand genommen und die Tür aufgestoßen. Jetzt allerdings war mehr Vorsicht geboten, um keine weiteren Spuren zu verwischen. Randollph nahm erneut sein Taschentuch zu Hilfe und zog die Tür hinter sich zu.
Dann ging er schnell in Richtung jenes kleinen Geschäftsviertels davon, das darauf eingerichtet war, die anspruchsvollen Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, die es sich leisten konnten, am See zu wohnen. Nur im Unterbewusstsein registrierte Randollph, dass es ein schöner Septembertag war. Die Luft hatte sich zwar stärker abgekühlt, als um diese Jahreszeit üblich, doch die Sonne wärmte noch so, als mache der Sommer dem Herbst nur widerwillig Platz. Die Straße war mäßig belebt. Obwohl Randollph niemand persönlich kannte, hatte er doch den Eindruck, dass die meisten zur alltäglichen Szenerie dieses Viertels gehörten. Ein Herr im dunklen Anzug half einer in Nerz gehüllten Dame, in einen Rolls-Royce, während der Chauffeur in Uniform Päckchen im Kofferraum verstaute. Ein anderer Mann studierte kritisch die Speisekarte eines französischen Restaurants, als wolle er sich vergewissern, eine Dame dorthin ausführen zu können. Bei den Friseursalons gingen Kunden ein und aus. Eine füllige Dame in Cape und Kapuze hastete mit zwei verschieden großen Tüten, die zu schwer für sie zu sein schienen, auf die Hochbahnstation zu.
Randollph fragte sich, ob er diese alltäglichen Szenen nur deshalb so begierig in sich aufnahm, um den schrecklichen Anblick des alten Humbrecht zu verdrängen.
Dann sah er eine junge Frau mit einem frisch getrimmten Pudel an der Leine aus einer Telefonzelle kommen und steuerte darauf zu.
Bei der Suche nach einer Telefonzelle hatte Randollph die dunkle Buick-Limousine nicht bemerkt, die direkt gegenüber von Humbrechts Haus parkte und in der drei Männer saßen. Kaum war Randollph ungefähr einen Block weit entfernt, sagte einer der drei Männer, ein etwa sechzigjähriger grauhaariger Herr mit betont modischem Haarschnitt und in dunklem Anzug und Weste: »Gehen wir! Zieht eure Handschuhe an. Wir müssen bei dem alten Herrn vielleicht etwas nachhelfen, damit er unsere Fragen beantwortet. Aber keine harten Bandagen! Vergesst das nicht! Möglicherweise hat er ein schwaches Herz. Und tot nützt er mir gar nichts.«
»Weshalb hat der Bursche, der gerade das Haus verlassen hat, ein Taschentuch benutzt, um die Tür zuzumachen, Mr. Jones?«
»Woher zum Teufel soll ich das wissen?«, erwiderte der Ältere in scharfem Ton. »Vielleicht hat er Angst vor Bakterien. Spar dir deine dummen Fragen. Dafür bezahle ich dich nicht, Junior.«
»Schon gut, Mr. Jones«, beschwichtigte der vorlaute Junior den älteren Herrn. »Los, komm, Pack!« Pack war größer und jünger als Junior und hatte eine athletische Figur. Beide trugen Jeans und Pullover.
»Keine Glocke«, berichtete Junior, nachdem er Humbrechts Tür inspiziert hatte.
»Dann klopf gefälligst, Idiot!«, fuhr ihn der Ältere an.
Junior klopfte.
»Klopf lauter!«, befahl der Grauhaarige ärgerlich. Junior schlug mit der Faust gegen die Tür.
»Vielleicht ist die Tür offen«, bemerkte Mr. Jones. »Wenn’s sein muss, brechen wir sie auf. Er muss zu Hause sein. Schließlich hatte er gerade Besuch.«
Junior öffnete die Tür. »Sie sind der Boss«, sagte er, als er beiseitetrat, um den Älteren vorbeizulassen. Er lächelte selbstgefällig.
»Mann, hier stinkt’s vielleicht«, schnaubte Pack. »Seht euch das Chaos an! Das ist ja wie auf der Mülldeponie. Ist der Alte normal?«
»Großer Gott!«, rief Junior schrill. »Kommen Sie mal hierher, Mr. Jones!«
Doch der grauhaarige Mann hatte die sterblichen Überreste von Johannes Humbrecht bereits ebenfalls entdeckt. Er fluchte unterdrückt in einer fremden Sprache.
»Soll’n wir die Bude mal auf den Kopf stellen?«, erkundigte sich Junior. »Sie brauchen uns nur zu sagen, wonach wir suchen müssen.«
Der ältere Herr schlug Junior mit der flachen Hand ins Gesicht. »Idiot! Um das Haus zu durchsuchen, braucht man Monate. Wir müssen raus, bevor uns jemand hier findet.«
Lieutenant Michael Casey fasste sämtliche drei möglichen Sitzgelegenheiten ins Auge. Angesichts der Tatsache, dass alle drei Stühle wackelig und mit Schmutz unbekannter Herkunft verklebt waren, der mit Sicherheit Spuren auf seiner beigefarbenen Gabardinehose hinterlassen hätte, erklärte er energisch: »Hier stinkt’s. Setzen wir uns in meinen Wagen, während die Kollegen von der Spurensicherung an der Arbeit sind.«
»Gute Idee«, stimmte Randollph zu. Er hatte für diesen Tag genug von Humbrechts Haus.
Casey setzte sich hinter das Steuer des blauen Funkwagens Marke Pontiac, während Randollph auf dem Beifahrersitz Platz nahm.
»Also, Doktor... wie haben Sie den alten Mann überhaupt gefunden? Weshalb waren Sie bei ihm? Weshalb sind Sie reingegangen, nachdem niemand geöffnet hat? Wer war dieser alte...«
Randollph hob hastig die Hand. »Immer langsam, Lieutenant. Ich erzähle Ihnen gern, was Sie wissen wollen. Aber alles der Reihe nach.«
Casey lächelte. »Entschuldigen Sie. Wir Polizisten wollen immer alles möglichst schnell wissen. Das ist sozusagen eine Berufskrankheit. Also, schießen Sie los!«
Randollph fiel wieder einmal auf, dass Casey überhaupt nicht wie ein Polizist aussah. Er kleidete sich stets mit der dezenten Eleganz eines erfolgreichen jungen Geschäftsmannes. Randollph und Casey kannten sich bereits eine ganze Weile. Der Zufall hatte sie zusammengeführt. Casey war erst vor kurzem Trauzeuge bei Randollphs Hochzeit gewesen, weil Randollph noch nicht lange genug in Chicago war, um dort echte Freunde zu haben. Trotzdem redeten sie sich mit ihren Titeln an.
»Ich habe als Seelsorger bei ihm einen Besuch gemacht«, begann Randollph.
Casey sah Randollph überrascht an. »Bei dem alten kauzigen Knacker? Ich dachte, untere Gesellschaftsschichten hätten gar keinen Zugang zur Good-Shepherd-Kirche.«
»Aber ich bitte Sie, Lieutenant. Die Tatsache, dass sehr viele angesehene Familien Mitglieder unserer Kirche sind, bedeutet doch nicht, dass andere bei uns nicht aufgenommen werden. Wir sind eine Kirchengemeinde und kein Club.«
»War dieser Humbrecht Gemeindemitglied?«
»Er kam jeden Sonntag zum Gottesdienst.«
»Besuchen Sie denn sämtliche Gemeindemitglieder?«
»Nein. Das wäre nahezu unmöglich. Unsere Gemeinde ist über die ganze Stadt verstreut... und die meisten Mitglieder wohnen in den Vorstädten'. Unsere Kirche beschäftigt eine Gruppe von Geistlichen, die allein für die Seelsorge zuständig ist.«
»Dann begreife ich nicht, weshalb ausgerechnet Sie sich um Humbrecht gekümmert haben. Er kann doch kaum so wichtig gewesen sein, dass er den Einsatz der oberen Chargen Ihrer Kirche gerechtfertigt hätte, oder? Weshalb hat sich nicht einer Ihrer Handlanger... ich meine Ihrer Assistenten mit dem Alten befasst«, verbesserte Casey sich hastig. »Bei uns in der Kirche des Heiligen Aloysius wird das jedenfalls so gehandhabt. Unser Pfarrer hat eine ganze Schar von Assistenten. Und daran, wer einen besucht, kann man ablesen, welchen Ruf man genießt. Die unwichtigsten Gemeindemitglieder kriegen die unerfahrenen Neulinge geschickt.«
Randollph war nahe daran, zu fragen, welchen Rang der Geistliche bekleidete, der Casey besuchte, besann sich jedoch dann eines Besseren.
»So ungefähr funktioniert es bei uns wohl auch«, erwiderte er. »Obwohl das nicht direkt in unserer Absicht liegt.«
»Weshalb haben Sie sich dann um Humbrecht gekümmert?«
Randollph dachte eine Weile nach. »Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen das sagen kann.«
»Ob Sie es sagen können, oder ob Sie es sagen dürfen?« Caseys Ton war schärfer geworden.
»Sagen kann. Aber wenn Sie wollen, versuche ich’s.«
»Dann mal los!«
»Nun, weil meine Besuche bei Humbrecht sowohl eine schwierige Pflicht als auch eine ehrliche Freude waren.«
Casey schnaubte verächtlich. »Was soll das denn bedeuten?«
»Das versuche ich ja zu erklären. Vermutlich habe ich Schuldgefühle, weil ich der gutbezahlte Pfarrer einer angenehmen, wohlhabenden Gemeinde bin. Ich bewohne ein luxuriöses Penthaus, beschäftige einen Butler und werde als Geistlicher der Good-Shepherd-Kirche von Geschäftsleuten und Politikern der Stadt verhätschelt.«
»Es dürfte wohl auch kaum von Nachteil sein, dass Sie ein ehemaliger Football-Star der Profiliga sind«, warf Casey sarkastisch ein.
»Damit gehe ich nicht gerade hausieren«, entgegnete Randollph mit ärgerlichem Unterton.
»Entschuldigen Sie«, murmelte Casey.
»Also jedenfalls habe ich gelegentlich Gewissensbisse«, fuhr Randollph fort. »Flat der heilige Petrus mit dem Bürgermeister gesellschaftlich verkehrt? Nicht, dass das ein Vergnügen wäre! Was würde der heilige Paulus von meiner Pfarrwohnung im Penthaus halten? Solche Gedanken kommen mir ab und zu. Die Besuche beim armen Johannes Humbrecht, der sein Haus mit nutzlosem Zeug vollstopfte, um den sich niemand scherte und der weder Freunde noch Verwandte hatte, gaben mir wenigstens das Gefühl, ein richtiger Pfarrer zu sein. Von Geistlichen wird erwartet, dass sie für die Armen da sind. Johannes Humbrecht war wohl mein armes Gemeindemitglied schlechthin. Verstehen Sie das?«
»Ich glaube schon.«
»Meine Besuche bei ihm waren eine harte, mühselige Pflicht. Sie wissen, wie ausgesprochen übel es in diesem Haus riecht. Und er servierte mir immer diesen abscheulichen Tee. Aber einmal pro Monat nahm ich all meinen Mut zusammen und ging zu ihm. Und wenn ich dann nach Hause kam, fühlte ich mich seelisch und geistig geläutert.«
»Wieso denn das?«, fragte Casey verständnislos.
»Humbrecht war ein sehr gebildeter Mann«, erwiderte Randollph. »Und Menschen mit einem soliden, umfassenden Wissen sind heutzutage wirklich selten. Der alte Mann hatte viele Jahre lang an der Northwestern University Geschichte gelehrt, und Kirchengeschichte ist nun mal mein Spezialgebiet. Die Liebe zur Geschichte verband uns. Aber Humbrecht kannte sich auch in Philosophie und Theologie aus... eine weitere Gemeinsamkeit. Außerdem war er ein außerordentlich kunst- und musikverständiger Mann. Von beidem hatte ich wenig Ahnung. Er hat mir auf diesem Gebiet eine Menge beigebracht. Und er hatte viel für den Sport übrig.«
»Wirklich ein komischer Kauz. Und heute haben Sie ihn also besucht!« Casey wollte offenbar endlich weiterkommen. »Weshalb sind Sie ins Haus gegangen, obwohl auf Ihr Klopfen niemand reagiert hat?«
»Ganz einfach: Der alte Mann ging nachmittags selten aus, und außerdem stand die Tür offen. Das war ganz ungewöhnlich. Da konnte was nicht in Ordnung sein.«
»Wie recht Sie hatten. Und dann?«
»Dann habe ich nach einem Telefon gesucht. Als mir einfiel, dass Humbrecht gar kein Telefon hatte, bin ich zur nächsten Zelle gelaufen.«
»Wie lange hat das alles gedauert?«
Randollph dachte nach. »Schwer zu sagen. Bei Humbrechts Anblick war ich zuerst entsetzt... wie gelähmt. Ich habe bestimmt ein oder zwei Minuten gebraucht, bis ich mich wieder gefasst hatte. Danach war ich wenigstens so schlau, den Türknauf nur noch mit Hilfe meines Taschentuchs und dann auch nur an der Rosette zu berühren...«
»Wofür Ihnen die Polizei von Chicago natürlich sehr dankbar ist«, bemerkte Casey. »Vielleicht finden wir was auf dem Knauf.«
»Auf dem Knauf an der Außenseite der Haustür dürfte ich allerdings beim Betreten des Hauses meine Fingerabdrücke hinterlassen haben. Nachdem ich die Tür mit Hilfe des Taschentuchs wieder geschlossen hatte, bin ich zu dem kleinen Geschäftsviertel dort oben gelaufen.« Er deutete auf den Block am Ende der Straße.
»Sind Sie gerannt?«
»Nein, nur schnell gegangen.«
»Dann haben Sie mich ungefähr fünfzehn Minuten, nachdem Sie Humbrecht gefunden hatten, angerufen?«
»Ja, das könnte hinkommen.«
Casey machte die Autotür auf. »Sehen wir mal nach, was die Kollegen von der Spurensicherung gefunden haben. Sie müssten mittlerweile fertig sein. Sagen Sie, gibt Ihre schöne Frau nicht heute Abend eine Dinnerparty, zu der Liz und ich eingeladen sind?«
Randollph blieb abrupt stehen. »Ach du liebe Zeit, das hatte ich ja völlig vergessen.« Er lächelte. »Soviel ich weiß, soll es eine Party nur für ganz besonders liebe Gäste werden. Auf diese Weise nimmt ein ziemlich übler Tag dann doch noch ein angenehmes Ende.«
»Ich freue mich schon auf Clarence’ ausgezeichnete Küche und die Gesellschaft netter Leute«, erwiderte Casey. »Für mich ist das heute allerdings kein übler, sondern ein ganz normaler Arbeitstag.« Randollph glaubte fast so etwas wie Stolz in der Stimme des Lieutenants zu hören.
Als sie in Humbrechts Haus kamen, waren der Spezialist für Fingerabdrücke, der Polizeifotograph und die beiden Kriminalbeamten in Caseys Begleitung gerade dabei, ihre Sachen zusammenzupacken. Der Polizeiarzt, ein sympathisch aussehender junger Mann, der sein Universitätsexamen vor noch nicht allzu langer Zeit absolviert zu haben schien, war weiterhin mit Humbrechts Leiche beschäftigt. Dabei pfiff er leise die Melodie des Schlagers Welch entzückender Abend vor sich hin.
»Na, wie sieht’s aus, Al?«, erkundigte sich Casey.
»Der Tod dürfte vor höchstens zwei Stunden eingetreten sein.«
»Demnach müssen Sie kurz nach dem Mörder gekommen sein, Doktor«, sagte Casey.
»Wie bitte? Ich war nicht mal annähernd in der Gegend«, protestierte der Polizeiarzt.
»Verzeihung, ich habe auch Dr. Randollph gemeint. Er hat die Leiche entdeckt. Dr. Randollph, darf ich vorstellen? Das ist Dr. Al Emerson.«
»Angenehm«, erwiderte der Polizeiarzt. »Sie sind doch Tricky Randollph... So hat man Sie wenigstens genannt, als Sie noch bei den Rams gespielt haben. Ihr Spiel war schnell und trickreich. Haben Sie Ihren Spitznamen immer noch?«
»Hoffentlich nicht«, seufzte Randollph. »Es sei denn bei meinen alten Teamkameraden.«
»Er wäre Ihnen in Ihrer gegenwärtigen Stellung wohl kaum zuträglich«, bemerkte Dr. Emerson. »Auf ein paar dieser Bibeljünger hier bei uns würde er allerdings zutreffen.«
»Vielleicht unterbrechen Sie mal kurz Ihre theologischen Grundsatzerklärungen, Al, und sagen mir, ob die Mordwaffe schon gefunden worden ist«, mischte Casey sich ein.
»Na klar, Mike«, antwortete einer der beiden Kriminalbeamten. Er hielt eine Plastiktüte hoch, die einen blutbefleckten Baseballschläger enthielt.
»Ein Johnny-Mize-Modell«, stellte der Polizeiarzt fest.
»Wiegt glatte 42 Unzen«, erklärte Randollph. »Ted Williams hat das Ding mal ausprobiert und behauptet, es habe starke Ähnlichkeit mit einem Telefonmast.«
»Und woher wissen Sie das?«, erkundigte sich Dr. Emerson. »Ich dachte, Sie verstehen nur was vom Football.«
»Ich mag fast alle Sportarten. Während meiner College-Zeit bin ich als Fänger immerhin so gut gewesen, um ein paar Angebote von der Profiliga zu bekommen. Vielleicht hätte ich annehmen sollen. Baseball ist eigentlich viel interessanter als Football.«
»Hört auf«, befahl Casey. »Wir haben es hier mit Mord zu tun und halten kein Sportseminar ab. Al, braucht man mit diesem Schläger viel Kraft, um eine solche Verletzung wie bei Humbrecht hervorzurufen?«
»Kaum, Mike.«
»Diese Wunde könnte dem alten Mann also von jedem beigebracht worden sein, der nur über durchschnittliche Kräfte verfügt, oder?«
»Richtig. Wie Dr. Randollph schon gesagt hat, ist das ein verdammt schwerer Schläger. Man kann damit wahlweise einen Baseball in eine Erdumlaufbahn bringen oder Schädel einschlagen.« Dr. Emerson begann seine Instrumente einzupacken. »Ich bin fertig. Wollen Sie, dass wir eine Autopsie machen?«
»Selbstverständlich«, erwiderte Casey.
»Reine Zeitverschwendung. Ihr könnt die Leiche jetzt fortschaffen lassen.« Dr. Emerson pfiff erneut die Melodie von Welch entzückender Abend vor sich hin und ging.
Zweites Kapitel
Casey fuhr Randollph zu seiner Kirche zurück. Normalerweise war Randollph nach seinen Besuchen bei Humbrecht stets zu Fuß nach Hause gegangen, da er wenig an die frische Luft kam, wenn er keine Zeit hatte, im Chicago Athletic Club zu trainieren. Die Good-Shepherd-Kirche sorgte automatisch für die Mitgliedschaft ihres Geistlichen in diesem Club, ein Privileg, das auch weltliche Organisationen ihren Mitarbeitern in gehobenen Positionen gewährten. Randollph fragte sich sehr oft, ob überhaupt ein Unterschied zwischen dem Oberhaupt einer Kirchengemeinde und dem Präsidenten eines Wirtschaftsunternehmens bestand. Allerdings war das vom kirchlichen Standpunkt aus durchaus großzügige Gehalt eines Geistlichen im Vergleich mit dem Verdienst eines Firmendirektors lächerlich gering. Und die Art von Aktienoptionen, die ein Geistlicher erwarb, konnte er sowieso erst im Himmel einlösen. Allerdings war auch ein Geistlicher, ähnlich einem leitenden Angestellten eines Wirtschaftsunternehmens, der Kopf einer Firma, die zahlungsfähig bleiben musste. Aus diesem Grund beschloss Randollph wie ein guter Manager, noch einmal ins Büro zu sehen, bevor er Feierabend machte.
»Also bis heute Abend«, sagte Casey, als er Randollph absetzte. »Dunkle Krawatte und Abendanzug sind erwünscht, stimmt’s?«
»Ja. Sie tun Clarence damit einen großen Gefallen. Ich habe den Verdacht, ihm wär’s am liebsten, wir würden uns täglich zum Abendessen umziehen. Und Samy mag’s übrigens auch.«
»Mir macht das nichts aus«, erklärte Casey. »Ich habe sowieso nur selten Gelegenheit, meinen Smoking zu tragen.«
»Das ändert sich, wenn Sie erst Polizeichef sind«, prophezeite Randollph und ging zur Kirchentür.
An Wochentagen war das Portal hauptsächlich Eingang des Bürohochhauses, in dem das Gotteshaus der Kirche des Guten Hirten lag. Anwälte, Büroangestellte und Geschäftsleute gingen dort aus und ein. Gottesdienstbesucher waren in der Minderzahl, Selbstverständlich war die Flügeltür aus schwerem Messing und sah aus, als habe sie einst zu einem großen, gotischen Bauwerk gehört. Daneben war eine schlichte, aber vornehme Metallplatte in das Mauerwerk eingelassen, auf der zu lesen war, dass sich hier das Gotteshaus der Good-Shepherd-Gemeinde befand, und welche Geistlichen bei ihr beschäftigt waren, um die Welt, die Gelüste des Fleisches und den Teufel zu bekämpfen, die wohl allesamt mächtigen Einfluss im Loop, dem berühmten Geschäftszentrum von Chicago, besaßen.
Doch diese Flügeltür öffnete sich nicht zur gedämpften, von stummen Gebeten erfüllten Vorhalle eines Gotteshauses, sondern führte in einen Korridor mit je einer Batterie von Aufzügen an den Seiten. Dort herrschte ein ständiges Gedränge zwischen denen, die das Gebäude gerade betreten hatten, und jenen, die es verließen. Man musste schon bis zu einer zweiten Flügeltür aus Messing am Ende des Ganges Vordringen, um in die Kirche zu gelangen.
Die Idee, das Gotteshaus in einem kombinierten Büro- und Hotelgebäude – letzteres hatte einen separaten Eingang – unterzubringen, hatte unter einigen Gemeindemitgliedern Entsetzen ausgelöst, als sie Jahrzehnte zuvor vom Kirchenkuratorium präsentiert worden war. Immerhin hatte die Gemeinde eine durchaus ansprechende Kirche im pseudo-romanischen Baustil, die allerdings in jenem Viertel lag, das sich gerade zum Brennpunkt der Geschäftswelt des Loop entwickelte. Und an dieser Stelle nämlich hatte einst die Blockhütte der Mission gestanden, die die widerborstigen Indianer zum Christentum hatte bekehren sollen. Diese hatten jedoch nicht recht eingesehen, welchen Vorteil diese Religion gegenüber ihrer alten hatte. Vor allem predigten die Missionare gegen den Genuss des Feuerwassers, den die Indianer als den einzigen Fortschritt ansahen, den ihnen der Weiße Mann gebracht hatte.
Das Kuratorium argumentierte allerdings, dass man in diesem Zeitalter auch fortschrittlich denken und handeln müsse und schlugen vor, die alte Kirche abzureißen und sie in ein kombiniertes Geschäfts- und Hotelgebäude zu integrieren. Das Argument einiger Gemeindemitglieder, dies sei eine ungesunde Mischung aus Pietät und Kommerz, erwies sich jedoch in dem Augenblick als hinfällig, als man darauf hinweisen konnte, dass die Einnahmen aus den Mieten des Gebäudes so hoch sein würden, dass man die Gemeindemitglieder von der Last überhöhter Kirchenbeiträge befreien könne. Da sahen natürlich auch die hartnäckigsten Gegner ein, dass eine Kirche im Herzen der Geschäftswelt möglicherweise ein wirksameres Zeugnis des Glaubens liefern konnte als ein Gotteshaus, das streng getrennt von allem Kommerziellen existierte.
Um dem Gebäude pietätvollerweise jedoch wenigstens ein äußeres Zeichen seiner Bestimmung zu geben, wurde es mit einem Turm im neugotischen Stil ausgestattet, der, angefangen von Zinnen und Wasserspeiern, über sämtliche signifikanten christlichen Symbole verfügte. Das Gebäude sah daher im oberen Teil, wo die Geschäftswelt regierte, wie eine Kirche, unten dagegen wie ein Bürohaus aus. Ausgerechnet dort wurden die heiligen Sakramente erteilt und beteten die Gläubigen in dem beruhigenden Bewusstsein, einen Kirchturm über sich zu haben, der seine Spitze, lediglich durch einige Büroetagen von der Gemeinde getrennt, in den Himmel über Chicago reckte.
Über ein Vierteljahrhundert bevor Randollph sein Amt übernommen hatte, hatte sein Vorgänger, der Pater Dr. Arthur Hartshorne, den man zum Pfarrer gemacht hatte, weil seine Predigten aus lustigen, nostalgischen und herzerweichenden Geschichten bestanden, die von Bibelweisheiten unbelastet blieben, in seinem jugendlichen Übermut vorgeschlagen, die Kirche solle den großen, leeren Raum im Turm zu einer angemessenen Pfarrei für den Geistlichen der Kirchengemeinde ausbauen lassen. Hartshorne wies darauf hin, dass das einerseits den Vorteil habe, dass dem Geistlichen eine lange Anfahrt zum Büro erspart bliebe, und andererseits sehr wirtschaftlich sei, da der Turm der Kirche gehöre.
Das Kuratorium war einverstanden, war sich allerdings bezüglich der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens nicht mehr so sicher, als die ersten Rechnungen eintrafen. Matilda Hartshorne hatte gelinde gesagt einen ausgesprochen teuren Geschmack. Sie kaufte stets das Beste, und das in großen Mengen. So kam Randollph, der einem Herrn diente, der oft keinen Platz gehabt hatte, um sein müdes Haupt niederzulegen, zu einer Penthaus-Wohnung, die an Chicagos Goldküste ihresgleichen suchte.
Randollph fuhr mit dem Lift in den dritten Stock hinauf, wo die Büros der Pfarrei untergebracht waren. Als sich die Lifttür öffnete, betrat er einen großen Empfangsraum, der, wie Randollph sofort registrierte, glücklicherweise leer war. Da es kurz vor Büroschluss war, bezweifelte er, dass ihn an diesem Nachmittag noch jemand belästigen würde. Er ging in das Büro von Miss Adelaide Windfall. Miss Windfall war bereits vor Arthur Hartshornes Amtszeit Sekretärin der Pfarrei gewesen. Ihre Macht und ihr Einfluss in der Good-Shepherd-Gemeinde war mit den Jahren ebenso gewachsen wie ihr Körpergewicht. Sie war von Statur und Haltung eine respektgebietende Frau und besaß eine geradezu erdrückende Persönlichkeit.
Sie nickte Randollph nicht unfreundlich zu, doch der leichte Vorwurf in ihrem Blick angesichts seiner langen Abwesenheit vom Büro war nicht zu übersehen.
»Wir haben gerade ein wertvolles Mitglied unserer Gemeinde verloren«, verkündete Randollph. Das musste das alte Mädchen aufhorchen lassen. Wertvolles Mitglied hieß bei Miss Windfall eine wohlhabende, einflussreiche Persönlichkeit.
»Doch hoffentlich nicht Mr. Castle«, bemerkte sie besorgt. »Heute Morgen noch hat man mir gesagt, es gehe ihm gut.«
Mr. Castle war das einzige betuchte Gemeindemitglied, mit dessen Ableben man gegenwärtig rechnen musste.
»Nein, Mr. Johannes Humbrecht.«
Miss Windfalls Miene hellte sich sichtlich auf.
»Na, so was! Wie ist denn das passiert?« Die Frage war rein theoretischer Natur, denn für Miss Windfall war Johannes Humbrecht vom sozialen Standpunkt aus ein ausgesprochen unwichtiges Mitglied der Good-Shepherd-Kirche gewesen. Humbrecht hatte sich nicht gewaschen und daher übel gerochen. Und Leute mit Körpergeruch sollten ihrer Ansicht nach gar nicht erst in die Kirchengemeinde aufgenommen werden.
»Er ist ermordet worden«, klärte Randollph sie auf. »Jemand hat ihm den Schädel mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Ich habe ihn gefunden. Deshalb komme ich so spät.«
Miss Windfall war ehrlich entsetzt.
»Das ist aber keine gute Publicity für uns. Die Kirchengemeinde wird in eine unsaubere Geschichte hineingezogen. Ihr Name kommt bestimmt in die Zeitungen, oder?« Das war keine Frage, sondern ein Vorwurf. Die Good-Shepherd-Kirche sollte keine Schlagzeilen machen; es sei denn, sie habe ein prominentes junges Paar in den heiligen Stand der Ehe erhoben oder einen angesehenen Bürger beerdigt. Auf gar keinen Fall sollte ein Mitglied der Kirchengemeinde so tief sinken, sich ermorden zu lassen. Noch unpassender war es für den Pfarrer, die Leiche zu entdecken.
Miss Windfall bedauerte weder Mr. Humbrechts unschönes Ende, noch ließ sie sich von so etwas Unwichtigem wie Mord von ihren Pflichten ablenken.
»Hier ist die Liste der Leute, die angerufen haben.« Sie übergab Randollph ihre Notizen. »Diejenigen, die um Rückruf bitten, sind angekreuzt. Und hier ist die Tagesordnung der Monatssitzung des Kuratoriums.« Sie reichte Randollph ein Stück Papier. »Wenn Sie es sofort lesen und unterschreiben, können die Mädchen noch vor Büroschluss Kopien machen und sie verschicken.«
Randollph tat so, als würde er die Tagesordnung eingehend studieren und unterschrieb sie anschließend. Natürlich hatte er kein Wort davon gelesen und wusste, dass Miss Windfall es wusste. Die Tagesordnung der Kuratoriumssitzung hatte geradezu fossilen Wert. Randollph zweifelte, dass je ein Kuratoriumsmitglied sie gelesen hatte. Schließlich verlief die ganze Angelegenheit seit Jahren nach demselben Strickmuster. Gelegentlich beschwor ein Tagesordnungspunkt eine Debatte herauf, aber das hätte Randollph mit seiner Unterschrift auch nicht verhindern können. Er nahm einfach an, dass er als leitender Angestellter eben für solche Dinge bezahlt wurde. Randollph fragte sich, wie Manager wohl lebten, die ihre Tage damit verbrachten, Tagesordnungen, Berichte und Gutachten zu unterzeichnen, und Berichte für andere Manager zu verfassen, die diese lasen und unterschrieben, Sekretärinnen Briefe diktierten oder auf Band sprachen. Offenbar hatten einige Spaß an diesem Job, denn Millionen von Menschen taten nichts anderes. Wenn es ihnen gefiel, dann bitte! Man sollte das tun, was einem Spaß machte. Allerdings konnte Randollph beim besten Willen nicht begreifen, was einen Menschen veranlassen konnte, sein kostbares Leben auf diese Art und Weise zu verschwenden.
Manche taten es für Geld... andere um der Macht willen. Einige, weil es keine bequeme Möglichkeit gab, sich diesen Dingen zu entziehen... besonders, wenn jemand wie Adelaide Windfall ihnen im Nacken saß und dafür sorgte, dass faule Pfarrer den Papierkram erledigten, vor dem sie sich ständig zu drücken versuchten.
Miss Windfall nahm ihm die unterschriebene Tagesordnung aus der Hand. »Sie haben noch Zeit, die Anrufe zu beantworten, bevor wir für heute Schluss machen«, erinnerte sie ihn.
»Ja, natürlich.« Die Liste knisterte verdächtig in seiner Hand. »Ich erledige das lieber von meiner Wohnung aus«, log er.
Miss Windfall zog scharf die Luft ein und zeigte ihm auf diese Weise, was sie von seinem Versteckspiel hielt.
Drittes Kapitel
Randollph musste mit dem Lift wieder in das Parterre hinunterfahren, sich durch die Menge im Korridor kämpfen und die zehn Stufen zum Hoteleingang hinaufsteigen, da die Pfarrwohnung im Penthaus nur durch das Hotel zu erreichen war. Die Kirche hatte das Hotel an ein Unternehmen vermietet, das sich Luxury Inns of America nannte und mit der Organisation von Tagungen und dem Verkauf von Alkohol satte Gewinne machte. Lediglich der Hotellift Nummer 8 fuhr bis ins Penthaus hinauf. Vom Aufzug aus betrat man ein kleines Foyer. Von dort führten drei Stufen zur Tür der Penthaus-Wohnung. Randollph steckte den Schlüssel in das solide Schloss. Das Apartment war ziemlich einbruchsicher.
Jetzt, so überlegte Randollph, begann der Teil des Tages, der ihn immer wieder aufrichtete. Die Innenstadt von Chicago bestand wie jede andere Großstadt aus lauten, schmutzigen Straßen, in denen Leute Pflichten nachjagten, die am Gesamtsystem nichts änderten. Natürlich besaß diese Stadt eine Art Vitalität, die von Menschen, dem Verkehr und der ständigen Bautätigkeit erzeugt wurde. Und wenn Randollph durch Chicagos Straßen ging, dann war er auch nur einer von vielen, die einen, wenn auch geringen, Beitrag zur Geschäftigkeit, dem Chaos und dieser Vitalität leisteten.
Im Penthaus allerdings änderten sich seine Perspektiven.
Die Aussicht, die man von dort genoss, war faszinierend. Wegen des achteckigen Grundrisses des neugotischen Turms besaßen die Zimmer eine ungewöhnliche Form. Sie waren jedoch ausgesprochen geräumig, da Kosten beim Ausbau des Apartments keine Rolle gespielt hatten. Die Wohnung hatte zwei Etagen. Das erste Stockwerk umfasste ein Wohnzimmer, das Esszimmer und eine Küche, deren Größe und Einrichtung einem berühmten Küchenchef alle Ehre gemacht hätte, und ein Arbeitszimmer, in dem sich der Pfarrer in die Summa Theologica oder andere aufregende theologische Darstellungen vertiefen konnte. Im oberen Stock befanden sich die Schlafzimmer. Neben der Suite des Hausherrn gab es noch ein Gästezimmer und das etwas kleinere, jedoch ebenso großzügig ausgestattete Apartment, das gegenwärtig von Clarence Higbee bewohnt wurde. Sämtliche Außenwände waren verglast, sodass Randollph einen Rundblick über die Skyline der Stadt bis hin zum Lake Michigan, einem Binnensee mit großartigen, wechselnden Stimmungen und einer Vielzahl an Segelbooten, Motoryachten und Frachtern, hatte. Über dem See kreisten häufig Flugzeuge und Hubschrauber, die Randollph wie riesige Vögel auf der Jagd nach einer geeigneten Fischmahlzeit vorkamen.
Randollph wurde dieses Ausblicks nie überdrüssig. Er nahm sich stets nach getaner Tagesarbeit die Zeit, ihn zu genießen. Obwohl er das alles nicht geschaffen hatte, was er sah, glaubte er zu wissen, wie Gott sich bei Vollendung der Schöpfung gefühlt haben musste, als er gesehen hatte, dass es gut war.
Gefolgt von einem hübschen Wesen in Dienstmädchentracht, schob Clarence eine fahrbare Hausbar ins Wohnzimmer.
»Guten Abend, Dr. Randollph«, begrüßte Clarence ihn. »Das ist Annette. Sie hilft mir heute Abend.«
Obwohl Clarence stets jene höfliche Zurückhaltung an den Tag legte, die dem konservativen englischen Diener zu eigen ist, der sich des Unterschieds zwischen Herrn und Butler wohl bewusst ist, merkte Randollph, dass er ausgesprochen gut gelaunt war. Clarence liebte Dinnerpartys. Sie gaben ihm nämlich Gelegenheit, seine Kunst vor einem erweiterten Publikumskreis zu demonstrieren und seinen schwarzen Frack mit weißer Krawatte zu tragen. Ungeachtet der Tatsache, dass die Gäste im Smoking erschienen, servierte ein anständiger Butler bei einer Dinnerparty nur im Frack.
»Madam bittet Sie, so bald wie möglich nach oben zu kommen«, informierte Clarence Randollph. Letzterer wusste, dass Samy damit erreichen wollte, dass er sich rechtzeitig umzog.
Die private Suite des Hausherrn war ausschließlich in Grün-, Gold- und Weißtönen, den einstigen Lieblingsfarben von Matilda Hartshorne, gehalten. Sie bestand aus einem Wohnzimmer mit einer langen Couch, dem dazugehörigen, niederen Tisch, zwei tiefen Sesseln und mehreren Stühlen, dem Schlafzimmer mit einem breiten Doppelbett und zwei angrenzenden Ankleidezimmern. Das Bad besaß eine in den Fußboden eingelassene Badewanne und eine gläserne Duschkabine und war von einer Größe und einem Luxus, wie man sie selten in einer Privatwohnung fand. Dan Gantry behauptete, die Suite ähnele einem Luxusbordell.
»Hier bin ich«, kam Samys Stimme aus ihrem Ankleidezimmer.
»Die Nachricht tickte geradeüber den Fernschreiber, als ich im Studio fertig gewesen bin. Der arme, alte Mann! Hat es dich sehr mitgenommen, Randollph?«
»Ja, ziemlich. Aber ich unterhalte mich nur ungern mit Geisterstimmen. Warum kommst du da nicht raus?«
»Weil ich nackt bin.«
»Wir sind doch verheiratet. Es wäre nichts Neues für mich, dich nackt zu sehen.«
»Nein, aber du reagierst immer auf dieselbe Art und Weise.«
»Wie denn?«
»Lustvoll!«
»Stimmt auffällig. Aber weder die Bibel noch die christliche Lehre verbietet es einem Mann, für seine Frau Leidenschaft zu empfinden.«
»Wofür ich sehr dankbar bin.« Samy kam aus ihrem Ankleidezimmer und zog sich einen Slip über die Hüften. »Aber man kann schließlich auch nicht mit der eigenen Frau rumschmusen, wenn unten die Gäste warten. Also beeil dich, mein Junge.« Sie küsste ihn flüchtig, entwand sich geschickt seinem Griff und verschwand wieder im Ankleidezimmer.
Randollph dachte über das Wunder der Liebe nach. Er hatte viele schöne Frauen gekannt. Einige waren klug, andere charmant und etliche geistreich gewesen. Manche hatten sowohl sein Interesse als auch seine Leidenschaft erregt. Er hatte sogar mehrmals geglaubt, sich ehrlich verliebt zu haben.
Als er Samantha Stack zum ersten Mal begegnet war, war er keineswegs überwältigt gewesen. Dan Gantry, der sie gut kannte, hatte sie mitgebracht. Dan war seit seinem Examen Hilfspfarrer in der Kirchengemeinde und schien jeden zu kennen.
»Dr. Randollph, das ist Sam Stack. Ist sie nicht toll?«, hatte Dan sie vorgestellt.
Randollph hatte die große, elegante ungefähr dreißigjährige Frau höflich begrüßt. Sie hatte tizianrotes Haar und versuchte ihn sofort mit dem Geständnis zu schockieren, sie sei Atheistin.
»Atheist zu sein ist nichts Schlechtes«, antwortete Randollph darauf. »Nach klassischer Definition ist ein Atheist ein Bürger, der nicht dem allgemeinen Kult huldigt. Viele der ersten Christen sind aufgrund dieser Anklage hingerichtet worden.«
Randollph erinnerte sich noch gut an Samantha Stacks verblüfften Gesichtsausdruck. Sie hatte sich hilfesuchend an Dan Gantry gewandt: »Sagt er die Wahrheit, oder will er mich bloß auf den Arm nehmen?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Dan. »Aber er ist immerhin Professor für Kirchengeschichte und müsste es eigentlich wissen.«
»Schade! Jetzt macht es überhaupt keinen Spaß mehr, Atheist zu sein«, jammerte Sam Stack. Und nachdem sie die erste Runde verloren hatte, war sie erneut zum Angriff übergegangen: »Sie sind ein großer, kräftiger und gesund aussehender Mann... auch wenn Sie offenbar schon rapide auf die Vierzig zugehen. Oder sind die weißen Strähnen in Ihrem schönen, schwarzen Haar nur ein Zeichen vorzeitigen Alterns? Trotzdem behauptet Danny, dass Sie unverheiratet sind. Was ist mit Ihnen los? Leben Sie im freiwilligen Zölibat oder sind Sie schwul?«
Randollph erinnerte sich, mit einem liebevollen Lächeln erwidert zu haben: »Damit haben Sie meine Möglichkeiten noch längst nicht erschöpft, Mrs. Stack.«
Sie war geschlagen, doch es schien ihr zu gefallen. »Ihre Art, Konversation zu machen, gefällt mir, Doktor. Zufällig moderiere ich die beliebteste Talkshow in Chicago und möchte Sie gern als Gast gewinnen. Deshalb habe ich Danny auch gebeten, uns bekannt zu machen. Ich wollte unbedingt die erste sein, die Sie vor die Kamera holt.«
So hatte alles begonnen. Randollph war ein Mann, der eigentlich Blondinen bevorzugte, und Sam war rothaarig. Er hatte sich nie zu Frauen mit einem losen Mundwerk hingezogen gefühlt, aber Sam Stack hatte ein loses Mundwerk. Aus diesem Grund war es für ihn praktisch ein Schock gewesen, als er merkte, dass er mehr für Samantha empfand, als er je für eine andere Frau empfunden hatte. Er konnte nichts dafür. Und er konnte es sich nicht erklären. Hätte er je ein Bild von der Frau gezeichnet, die er sich als seine Ehefrau vorstellte, es hätte Samantha in keiner Weise geähnelt. Er wusste nur, dass sich in den wenigen Monaten seiner Ehe mit Sam sein Leben in einer Art und Weise vervollkommnet hatte, wie er das nie für möglich gehalten hatte.
Samy kam in einem weißen Crêpe-de-Chine-Kleid aus dem Nebenzimmer. Sie band einen Gürtel aus mehreren Reihen Silberperlen um die Taille.
»Los, beeil dich!« Sie schob Randollph in Richtung Badezimmer. »Dusch dich und versuch dann in neuer Rekordzeit deinen Smoking anzuziehen.«
Der Bischof und seine Frau Violet – übrigens ein altmodischer Name für eine sehr moderne Dame – waren die ersten Gäste, die Clarence hereinführte.
»Wenn man den Nachrichtensendungen glauben kann, dann müssen Sie einen aufregenden Tag hinter sich haben, Randollph«, begrüßte der Bischof den Hausherrn.
»Ich habe zwar die Nachrichten noch nicht gehört, Freddie...« Randollph nahm sich hastig vor, nicht zu vergessen, den Bischof vor den anderen Gästen nicht Freddie zu nennen, »... aber es passiert einem schließlich nicht alle Tage, dass man bei einem harmlosen Hausbesuch eines seiner Schäfchen mit eingeschlagenem Schädel vorfindet.«
»Das muss für Sie ja schrecklich gewesen sein!« Die Frau des Bischofs tätschelte Randollphs Hand.
Die restlichen Gäste kamen kurze Zeit später. Samy hatte es sich zur Regel gemacht, die Angestellten der Good-Shepherd-Kirche stets getrennt von den Leuten einzuladen, die sie mochte. Doch Dan Gantry war die löbliche Ausnahme. Sam war seit langem mit ihm befreundet, er hatte sie mit Randollph bekannt gemacht, und anders als die meisten Geistlichen der Good-Shepherd-Kirche war er für jede Party ein Gewinn. Er trug an diesem Abend ein schokoladenbraunes Smokingjackett im Stil des neunzehnten Jahrhunderts.
»Ich dachte, so was ist längst aus der Mode«, spottete Samy.
»Ist es auch«, erwiderte Dan. »Aber ich bin ein Mann mit exzellentem Geschmack, der sich nicht von den Launen der Schneider beeinflussen lässt. Die Mode des Edwardischen Zeitalters steht mir gut. Darf ich euch Leah Asinwall vorstellen? Leah, das sind Dr. und Mrs. C. P. Randollph.« Leah war eine kleine, selbstbewusste Brünette, die sofort zu Samy sagte: »Sie sind in natura noch hübscher als im Fernsehen.« Dann wandte sie sich an Randollph. »Wenn man Dan glauben darf, sind Sie eine der größten noch lebenden Persönlichkeiten unserer Zeit.«
»Ich bezahle sie dafür, dass sie solche Artigkeiten sagt«, bemerkte Dan. »Was gibt’s zu trinken?«
Lieutenant Michael Casey, der in seinem Smoking ebenso elegant aussah wie in seinem Straßenanzug, kam als nächster mit seiner lebhaften, blonden Frau Liz. Ihnen folgten Lamarr und Louise Henderson. Sticky Henderson, groß und schwarz, war Randollphs liebster Mitspieler und bester Freund bei den Rams gewesen. Sticky war vielleicht nicht mehr so schnell wie früher, hatte jedoch noch immer genügend Klasse, um in der Mannschaft der Chicago Bears zu spielen. Seine Frau Louise war eine große, schöne Mulattin mit einem Teint, der aussah, als würde sie ihn täglich unter der Höhensonne tönen.
Als letzte kamen Thea Mason und ein kleiner Mann mit braunem Haar und intelligenten Augen, der, wie Randollph schätzte, ungefähr sein Alter haben musste.
»Sie sind bestimmt Pater Richard Purdy«, begrüßte Randollph ihn. »Allerdings vermisse ich an Ihnen den weißen Stehkragen des katholischen Priesters. Ich bin C. P. Randollph.«
»Angenehm.« Purdy hatte für einen kleinen, hageren Mann einen erstaunlich kräftigen Händedruck. »Den Priesterkragen trage ich kaum. Das ist einer der Vorzüge, die meine Tätigkeit als Herausgeber einer Zeitung mit sich bringt. Ich kenne Ihre Frau, weil ich ein paarmal Gast in ihrer Show war. Und mit Miss Mason verbindet mich die Arbeit als Journalist.«
»Zwischen einer Klatschspalte und einer katholischen Zeitung besteht allerdings ein großer Unterschied«, bemerkte Thea Mason. Randollph registrierte erleichtert, dass Thea offenbar die Phase der mehr als schulterfreien Abendkleider überwunden hatte. Sie trug an diesem Abend ein schlichtes orangerot und weiß gemustertes Kleid. Ihre Haut war noch einen Ton dunkler als die von Louise Henderson. Allerdings hatte Thea ganz offenbar ihre Bräune unter jener Höhensonne erworben, die Louise nicht brauchte. Mit ihrem schwarzen Haar und den langen Ohrringen sah sie aus wie eine reiche Zigeunerin.
»Ich bin da anderer Meinung, Thea«, entgegnete Pater Purdy. »Der Chefredakteur einer katholischen Zeitung und eine Klatschkolumnistin haben doch vieles gemeinsam. Wir klatschen eben nur über unterschiedliche Themen.«
Randollph beschloss in diesem Augenblick, Pater Purdy zu mögen.
Nachdem die Gäste am Tisch Platz genommen hatten, trug Annette Platten mit dünngeschnittenem, rohem italienischen Schinken und Melonenvierteln auf.
»Diesmal brauche ich Sie wenigstens nicht zu fragen, welche Zutaten Sie für den Gang verwendet haben, Clarence«, seufzte der Bischof. »Prosciutto und Melone... meine Lieblingsvorspeise.«
»Es ist zufällig auch die Lieblingsvorspeise von Dr. Randollph, Mylord«, erwiderte Clarence. »Ich habe zufällig italienischen Schinken besonderer Qualität bei einem meiner Lebensmittelhändler bekommen. Die Melonen sind aus Spanien. Ich bin sicher, sie schmecken Ihnen.« Damit überließ er es Annette, die Vorspeise weiter zu servieren, und verschwand in der Küche.
»Ich habe so viele Fragen«, begann Leah Aspinwall. »Und möchte schrecklich gern einige loswerden. Oder ist das unhöflich?«
»Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden«, zitierte Dan Gantry.
»Sie müssen wissen, Dan hat mich auf das, was mich hier erwartet, überhaupt nicht vorbereitet. Er hat lediglich gesagt: Willst du mit mir zu einer Dinnerparty bei meinem Chef gehen? Zieh ein langes Abendkleid an. Seine Frau ist Sam Stack.« Leah sah Dan vorwurfsvoll an. »Natürlich wollte ich mir die Gelegenheit, die berühmte Sam Stack kennenzulernen, nicht entgehen lassen. Ich bin noch nicht oft mit Dan aus gewesen und weiß nur, dass er Geistlicher ist. Das ist praktisch alles. Obwohl ich gestehen muss, dass er nicht gerade den Vorstellungen entspricht, die ich mir von einem protestantischen Pfarrer gemacht habe. Er redet und benimmt sich nicht gerade wie...«
»Das genügt«, unterbrach Dan sie. »Keine intimen Enthüllungen, bitte!«
»Die allerdings würden mich interessieren«, warf Samy ein.
»Ich erzähle Ihnen mal einiges, wenn Dan nicht dabei ist. Ich bin Jüdin und hatte bisher eigentlich immer die Vorstellung, die Geistlichen der christlichen Kirchen seien arm. Dan bringt mich hier in ein luxuriöses Penthaus mit einer phantastischen Aussicht, einem Butler... oder Koch und einem Dienstmädchen... Das geht alles nicht recht in meinen Kopf.«
»Ich verstehe, dass Sie das verwirren muss«, erwiderte der Bischof freundlich. »Ihre Vorstellungen bezüglich der protestantischen
Geistlichkeit sind durchaus korrekt. Die meisten Geistlichen sind in Anbetracht ihrer schwierigen Aufgaben drastisch unterbezahlt. Allerdings ist die Good-Shepherd-Kirche tatsächlich eine Ausnahme. Sie ist bereits seit vielen Jahren hier ansässig, verfügt über ein Stiftungskapital von zehn Millionen Dollar und ist Eigentümerin des Büro- und Hotelkomplexes, in dem sie untergebracht ist. Das Penthaus hier, das gleichzeitig die Pfarrwohnung ist, gehört zu diesem Gebäudekomplex.«
»Aber weshalb verfügt der Pfarrer über einen Butler und Küchenchef? Ich gehöre einer großen jüdischen Gemeinde an, und unser Oberrabbi wird gut bezahlt. Aber das kann er sich nicht leisten. Und weshalb nennt dieser Clarence Sie Mylord?«
»Clarence ist Engländer«, erklärte der Bischof. »Und außerdem ein treuer Anhänger der Kirche von England. Bei den Anglikanern wird ein Bischof traditionsgemäß mit Your Lordship oder Mylord angeredet. Obwohl ich in Clarence’ Augen natürlich kein Bischof der einzig wahren Kirche bin. Aber er würde Pater Purdys Bischof ebenso anreden; auch wenn für ihn die römisch-katholische Kirche nur eine von vielen nonkonformistischen Sekten ist. Ich muss sagen, dass es meinem Ego guttut, als Mylord angesprochen zu werden.«
»Ich frage mich manchmal, ob wir nicht tatsächlich nur eine christliche Sekte sind«, warf Pater Purdy ein. »Mein Kardinal beschuldigt mich sowieso solcher und ähnlicher ketzerischer Gedanken.«
»Ich bin Baptist«, erklärte Sticky Henderson. »Natürlich habe ich in diesen Dingen keine Ahnung... aber es wird behauptet, dass Sie sich an das halten müssen, was Ihnen Ihr Bischof vorschreibt. Weshalb hat er Sie dann nicht schon längst gefeuert?«
»Donnerwetter, Sticky! Deine Diktion hat sich ja drastisch verändert. Was ist denn aus deinem schwarzen Straßenjargon geworden?«, erkundigte sich Randollph.
Sticky grinste. »Ich bereite mich darauf vor, in die Welt von Kultur und Geschäft einzusteigen. Vergiss bitte nicht, ich habe Collegebildung. Die Leute, mit denen ich in Zukunft zu tun habe, wüssten meine frühere Sprechweise kaum zu schätzen.«
»Er hat ganz allgemein seine Manieren ein bisschen aufpoliert«, bemerkte Louise Henderson.
»Und wo willst du einsteigen?«, fragte Randollph.
»Das erfahrt ihr später«, wehrte der großgewachsene Farbige ab. »Ich möchte jetzt erst mal wissen, weshalb der Bischof Pater Purdy nicht feuert. Selbst ein Baptist weiß, dass sein Kardinal die Diözese wie ein römischer Despot regiert.«
Purdy lachte. »Ich würde Sie liebend gern im The Catholic Reporter zitieren.«
»Aber bitte ohne Namensnennung«, seufzte Sticky. »Ich hoffe, ’ne Menge dieser Seelenfänger... entschuldigen Sie, Pater... C. P. als Kunden zu werben. Und deshalb möchte ich sie nicht gleich verprellen.«
»Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Mr. Henderson«, begann Pater Purdy. »Nur politisches Kalkül hält den Kardinal davon ab, mich in irgendeine katholische Gemeinde in Hinter-Sibirien zu schicken. The Catholic Reporter ist nämlich keine Diözesan-Zeitung, sondern unabhängig. Sie besitzt, ähnlich wie Dr. Randollphs Kirche, ein eigenes Stiftungsvermögen und hat einen Verwaltungsrat, der gemäß unserer Statuten allein ermächtigt ist, Einstellungen und Kündigungen vorzunehmen. Im Übrigen hat die Zeitung eine hohe Auflagezahl, was man, zu Recht oder Unrecht, mir zuschreibt. Unser Blatt ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegründet worden und versteht sich sozusagen als Sprachrohr der liberalen Katholiken. Für Seine Eminenz wäre es daher wesentlich unangenehmer zu versuchen, mich aus der Zeitung zu drängen, als mich zähneknirschend zu dulden. Er begnügt sich also damit, mir persönlich Rüffel zu erteilen und ansonsten den Chefredakteur der Diözesan-Zeitung zu veranlassen, fast in jeder Ausgabe seines Blattes etwas Negatives über mich zu schreiben. Dabei ist er viel zu verbohrt, um zu merken, dass ausgerechnet diese Angriffe unsere Auflagezahlen ständig steigen lassen.«
»Seine Eminenz scheint ein ganz schönes Miststück zu sein«, urteilte Sticky.
»Lamarr«, wies Louise ihn vorwurfsvoll zurecht. »Pass gefälligst auf, was du sagst!«
»Also gut. Seine Eminenz scheint mir eine autoritäre und rachsüchtige Person zu sein. Ist das jetzt besser?«
»Wesentlich besser«, stimmte Louise zu.
»Das ist eine sehr treffende Charakterisierung«, bestätigte Pater Purdy Henderson. »Die Hälfte unserer Priester probt den Aufstand gegen diesen Mann.«