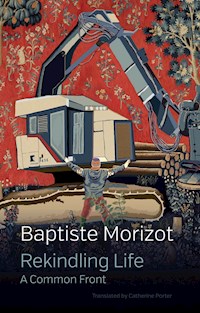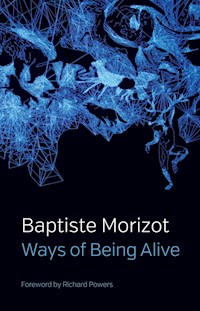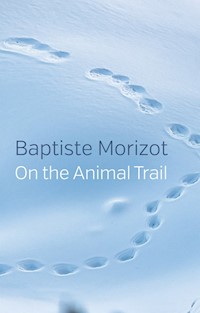9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Für moderne Menschen ist die Natur etwas, das man ausbeutet oder das Erholung bietet, aber kein Ort, an dem man wohnt und sich selbstverständlich bewegt. Baptiste Morizot lädt dazu ein, sich in die Perspektive wilder Tiere hineinzudenken und sensibler zu werden für die Welt, die uns umgibt. Seine Streifzüge führen ihn durch die Heimat der Wölfe, der Leoparden und der Bären, doch auch den Stadtvögeln lassen sich Geheimnisse entlocken. Die Wildnis ist überall. Wer ausgetretene Pfade verlässt und in die Natur eintaucht, wird verändert von seinem Abenteuer zurückkehren – als Grenzgänger zwischen zwei Welten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Ähnliche
Baptiste Morizot
Philosophie der Wildnis
oderDie Kunst, vom Weg abzukommen
Reclam
2020, 2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Die französische Originalausgabe erschien unter dem Titel:
Sur la Piste Animale bei Actes Sud, Arles.
© Actes Sud, 2018
Coverentwurf: zero-media.net
Coverabbildung: Mountain Spring (Landschaft), Trees in the winter (Wolf): CSA Images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961667-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020681-2
www.reclam.de
Inhalt
Sich einwalden
Die Zeichen des Wolfes
Ein einziger aufrechter Bär
Die Geduld des Schneeleoparden
Die diskrete Kunst der Spurensuche
Die Kosmologie des Regenwurms
Der Ursprung der Suche
»Wohin gehen wir morgen?«
Danksagung
Einleitung
Sich einwalden
»Wo gehen wir morgen hin?«
»In die Natur.«
Für meinen Freundeskreis und mich war diese Antwort lange Zeit selbstverständlich, weder heikel noch problematisch; wir hinterfragten sie nicht. Dann aber kam der Anthropologe Philippe Descola mit seinem Buch Jenseits von Natur und Kultur1 und lehrte uns, dass die Idee von der Natur ein seltsamer Glaube des Abendlandes sei. Es handle sich um einen Fetisch unserer Zivilisation, die ein schwieriges, konfliktreiches und zerstörerisches Verhältnis zu der Welt des Lebendigen habe, die sie »Natur« nenne.
Daraufhin konnten wir, wenn wir unsere Ausflüge organisierten, schlecht weiterhin zueinander sagen: »Morgen gehen wir in die Natur.« Uns fehlten die Worte, wir waren stumm und konnten die simpelsten Dinge nicht mehr ausdrücken. Das banale Problem, gemeinsam festzulegen, wo wir morgen hingehen wollten, führte zu einem philosophisch verunsicherten Gestammel: Wie sollte man denn künftig sagen, dass man ins Freie gehen will? Wie lässt sich benennen, wo man sich hinbegibt, wenn man mit Freunden, mit der Familie oder allein »in die Natur« aufbricht?
Das Wort »Natur« ist keineswegs unschuldig; es ist das Markenzeichen einer Zivilisation, die alles daransetzt, Territorien massiv auszubeuten, als seien sie unbelebte Materie. Allenfalls kleine Teilflächen werden für besondere Zwecke geschützt, etwa für Erholung, Sport oder geistige Regeneration – und all dies offenbart, dass unsere Einstellung zur Welt des Lebendigen armseliger ist, als wir uns bewusst machen. Unsere Weltauffassung nennt Descola »Naturalismus«: Damit meint er jene westliche Kosmologie, der zufolge es auf der einen Seite die Menschen gibt, die geschlossen in einer Gesellschaft leben, und auf der anderen Seite eine dingliche Natur, bestehend aus Materie, die den menschlichen Aktivitäten als passive Kulisse dient. Dieser Kosmologie zufolge ist offenkundig, dass die Natur »eben existiert«; sie ist all das, was sich da draußen befindet. Sie ist jenes Gebiet, das man ausbeutet oder das man als Wanderer durchschreitet, aber sie ist kein Ort, an dem man wohnt, auf keinen Fall, denn sie scheint ja immer »draußen« zu sein. Die Welt der Menschen hingegen zeichnet sich genau dadurch aus, dass sie sich drinnen befindet.
Descola macht uns bewusst, dass jeder, der von »Natur« spricht und das Wort somit gebraucht bzw. auf den Fetisch verweist, schon eine seltsame Form von Gewalt gegenüber diesen lebendigen Territorien anwendet. Dabei bilden sie doch unsere Existenzgrundlage, diese unzähligen Lebensformen, die mit uns die Erde bewohnen und die wir bald als Ressourcen, bald als Schädlinge, bald als uninteressantes Objekt und bald als hübsches Exemplar einstufen, dem wir mit dem Fernglas nachspähen; sie verdienen Besseres. Es hat schon seine Berechtigung, wenn Descola den Naturalismus als die »unfreundlichste« Kosmologie bezeichnet.2 Weder einem Individuum noch einer Zivilisation aber tut es auf Dauer gut, in der unfreundlichsten aller Kosmologien zu leben.
In seinem Buch Histoire des coureurs de bois (›Geschichte der Waldläufer‹, 2016) schreibt Gilles Havard, dass das amerindianische Volk der Algonquin spontan »soziale Beziehungen zum Wald« aufnehme.3 Eine merkwürdige Vorstellung, die uns vielleicht schockiert – und doch soll dieses Buch genau in die Richtung führen: Dieser Spur wollen wir folgen. Auf Umwegen, bei der philosophischen Spurensuche, anhand von Berichten darüber, wie man sich eine neue Empfänglichkeit gegenüber der lebendigen Welt aneignet, wollen wir uns dieser Vorstellung nähern. Warum versuchen wir nicht, eine freundlichere Kosmologie zu entwerfen, und zwar durch unsere Praktiken? Oder mehr noch, indem wir Praktiken, Sensibilität und Ideen zusammenbringen? Denn Ideen allein werden unser Leben wohl nicht so leicht ändern.
Doch bevor wir unseren Kompass in die Hand nehmen und diesem Kurs folgen, sollten wir zunächst ein anderes Wort dafür finden, »wohin wir morgen gehen«, und auch dafür, wo wir morgen wohnen werden – oder zumindest wo all jene wohnen werden, die aus den Städten wegziehen wollen.
Seit einigen Jahren drängt sich uns – einem Kreis von Freunden, der gern Expeditionen in die »Natur« unternimmt – ebendiese Frage auf. Wollten wir uns für unsere Unternehmungen verabreden, konnten wir nun nicht mehr sagen: Wir gehen »in die Natur«. Wir mussten neue Worte finden, um mit unseren sprachlichen Gewohnheiten zu brechen, Worte, die von innen her die Nähte der Kosmologie sprengen, in der wir leben. Diese Weltsicht verleitet uns dazu, unsere Umwelt wie ein großzügiges Energiereservoir oder einen Ort zur Regeneration unserer persönlichen Kräfte auszunutzen, und sie erzeugt eine Distanz zwischen uns und jenen lebendigen Territorien, die sich doch in Wahrheit unter unseren Füßen befinden und uns eine Grundlage geben.
Der erste Einfall, wie wir das Unterfangen neu benennen und auf andere Art sagen könnten, »wo wir morgen hingehen«, hieß: »nach draußen«. Morgen gehen wir nach draußen. »Essen und schlafen mit der Erde«, wie Walt Whitman sagt.4 Es war eine provisorische Lösung, aber wenigstens ließ sich so die alte Gewohnheit umgehen. Und die Unzufriedenheit mit der neuen Formulierung drängte uns, schnell eine andere zu finden.
Die Formel, die sich unserer Freundesgruppe als Nächstes aufdrängte, klang seltsam – kein Wunder bei der Eigenartigkeit unseres Zeitvertreibs. Sie lautete: »in den Busch«. Morgen gehen wir in den Busch. Dorthin also, wo es keine markierten Wanderwege gibt. Dorthin, wo wir, wenn es sie doch gibt, uns nicht nach ihren Vorgaben richten müssen. Denn wir wollen auf Spurensuche gehen (wir sind Sonntagsspurenleser). Darum durchstreifen wir das Unterholz, folgen den Pfaden der Wildschweine oder den Wildwechseln der Rehe; die Wege der Menschen interessieren uns nur, wenn sie die Fleischfresser dazu einladen, ihre Reviere dort zu markieren (Füchse, Wölfe, Luchse, Marder u. a.). Viele Tiere schätzen Menschenwege und nutzen sie auf ihre Weise: Ihre Markierungen – für sie Wappen und Fahnen – sind darauf besser sichtbar.
Spurenlesen heißt für uns, Fährten und Abdrücke zu entziffern, um die Perspektiven der Tiere kennenzulernen: jene Welt der Zeichen zu erforschen, die uns die Gewohnheiten der Fauna offenbaren, sowohl ihre Art und Weise, unter uns zu leben, als auch ihr Verhältnis zu anderen Wesen. Unser Auge, das unverstellte Sichtachsen und entgrenzte Horizonte gewohnt ist, tut sich zu Beginn noch schwer mit dieser Verlagerung des Untersuchungsgebiets in der Landschaft: Statt vor uns liegt es nun unter unseren Füßen. Der Boden ist unser neues Panorama, ein Ort voller Hinweise, der von nun an unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Spurenlesen in diesem neuen Sinne heißt auch, die Lebenskunst anderer Wesen verstehen zu lernen, die Gesellschaft der Pflanzen zu studieren oder die kosmopolitische Mikrofauna, die das Leben der Böden ausmacht, ihre Beziehungen zueinander und zu uns: ihre Konflikte und ihre Gemeinsamkeiten mit dem menschlichen Gebrauch der Territorien. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Wesen, sondern auf deren Beziehungen.
In den Busch gehen ist nicht dasselbe wie in die Natur gehen: Wir nehmen uns in der Landschaft als Ziel weder einen Gipfel vor, der zu bezwingen wäre, noch eine malerische Aussicht, die die Augen erfreuen soll, sondern uns interessiert der Grat, der uns den Durchgang des Wolfs meldet, die Flussau, in der bestimmt ein Hirsch gewesen ist, der Tannenwald, in dem man an einem Stamm die Krallenspuren des Luchses findet, das Blaubeerfeld, in dem man den Bären antrifft, der felsige Steilhang, an dem der weiße Kot des Adlers die Nähe seines Horstes verrät …
Bevor man losgeht, versucht man auf Karten und im Internet zu orten, was man erkunden will: den Waldstreifen, über den der Luchs möglicherweise die beiden Felsmassive erreicht, auf denen er sich am liebsten aufhält; die Steilküste, an der möglicherweise Wanderfalken nisten; den Bergpass, den sowohl Menschen als auch Wölfe benutzen, die einen bei Tag, die anderen bei Nacht.
Spaziergänge locken uns nicht mehr, auch nicht die Wegmarkierungen für Wanderer. Nach einer Weile sind wir, wenn wir zufällig welche sehen, eher erstaunt darüber, dass es so etwas gibt; ihre Zeichensprache ist uns nicht mehr recht geläufig. Wir werden langsam, wir fressen keine Kilometer mehr, sondern gehen im Kreis, um Spuren zu finden. Manchmal brauchen wir eine Stunde für 200 Meter. So war es jedenfalls, als wir einem Elch in Ontario nachgingen, der innerhalb eines Flussbetts im Kreis lief: eine Suche von einer Stunde, während der wir seine Spur mal verloren, mal wiederfanden, und nur spekulieren konnten, wo seine Trittsiegel als Nächstes erscheinen würden. Schließlich landeten wir wieder dort, wo wir losgegangen waren, neben dem Tannenwald, in dem der Elch, der bei Nacht besser sieht, wahrscheinlich seinen Mittagsschlaf hielt – seinen frischen Hinterlassenschaften nach zu urteilen. Wir gehen »in den Busch«, und schon ist das eine andere Art, über diese Dinge zu reden und mit ihnen umzugehen.
Es geht uns selbstverständlich nicht darum, ein neues Wort für »Natur« zu finden, das allen einleuchtet und alle künftig verwenden sollen. Wir wollten lediglich vielfältige und komplementäre Alternativen entwickeln, wie man unsere alleralltäglichsten Beziehungen zum Lebendigen anders benennen und leben könnte.
Die dritte Formulierung, die »in die Natur« ersetzen könnte, begegnete mir eines Morgens, als ich ein Gedicht las. Es handelt sich um eine Wendung, die nur noch wenig gebraucht wird, obwohl sie einen mächtigen Zauber birgt. Sie lautet au grand air (wörtlich: ›an die große Luft‹; entspricht der deutschen Wendung »an die frische Luft«, »unter freiem Himmel«, A. d. Ü.). Also: Morgen gehen wir an die frische Luft. An dieser Formulierung fasziniert mich, dass die Zwänge der französischen Semantik und Phonetik einen auf poetische Weise dazu bringen, etwas ganz anderes zu hören und zu verstehen, als die Worte besagen, wenn man sie ausspricht. Tatsächlich bewirkt der Gleichklang der Worte, dass man das der Luft am meisten entgegengesetzte und komplementärste Element zu hören glaubt: Denn terre (›Erde‹, ›Land‹) drängt sich dem Ohr auf, obwohl in au grand air gar kein t vorkommt. Man ruft sie praktisch an wie der Ausguck im Mastkorb eines Schiffes – Terre, terre! (›Land, Land!‹).
»An der frischen Luft« sein heißt auch auf der Erde sein; man wird wieder ein Erdbewohner oder ein »Terrestrischer«, wie der Philosoph Bruno Latour das nennt. Die frische Luft, die wir einatmen und die uns dank dem alten Wunder der Photosynthese umgibt, ist das Produkt der atmenden Kräfte der Wiesen und Wälder, durch die wir laufen, und die wiederum ein Geschenk des Bodens sind, den unsere Füße betreten: Die frische Luft ist der Stoffwechsel der Erde. Unsere atmosphärische Umwelt ist lebendig im Wortsinne: Sie ist sowohl die Wirkung des Lebendigen als auch das Milieu, das das Lebendige erzeugt – für sich und für uns.
In der Formulierung »an der frischen Luft«, au grand air, ist die Erde, terre, zwar dem Auge verborgen, doch sie offenbart sich dem Ohr. Hat man das einmal gehört, kann man es nicht mehr ignorieren. Die magische Formel evoziert dann eine andere Welt, die keine Trennung zwischen Himmlischem und Irdischem mehr kennt, denn die frische Luft des freien Himmels ist ja das, was die grüne Erde ausatmet. Kein Gegensatz besteht mehr zwischen Ätherischem und Materiellem, kein Himmel erstreckt sich mehr über uns, zu dem wir aufsteigen müssten, denn wir sind ja immer schon im Himmel, der nichts anderes ist als die Erde, sofern sie lebt. Sie wird geformt durch den Stoffwechsel alles Lebendigen, der es uns ermöglicht, zu existieren.5 An der frischen Luft zu leben, heißt eben nicht, in der Natur und fern der Zivilisation zu sein, denn sie gibt es ja überall, außer vielleicht in den Einkaufszentren. Es heißt gerade nicht, sich draußen zu befinden, sondern überall zu Hause zu sein, wo jene lebendigen Territorien sind, die unsere Existenz speisen, und wo jedes Lebewesen sich ins Dasein der anderen Lebewesen einfügt.
An der frischen Luft zu sein, ist allerdings nicht immer leicht zu haben. Wenn man ein ausschließlich städtisches Leben führt und abgekoppelt ist von den Wegen, auf denen die Biomasse zu uns gelangt, fern von den Elementen und anderen Lebensformen, ist es sehr schwierig, Zugang zur frischen Luft zu finden. Doch selbst mitten in der Großstadt hat man Möglichkeiten: Man kann den Zugvögeln nachspüren oder etwas für die Umwelt tun, indem man nachhaltige Gemüsegärten auf dem Balkon anlegt. Oder man erkundet, woher diese eine Tomate kommt, um herauszufinden, von welcher Sonne sie beschienen und auf welchem Stück Territorium, das ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, sie heranwuchs. Oder man geht Zweckbündnisse ein mit den Würmern des Wurmkompostierers, denen man Küchenabfälle und Haare zu fressen gibt, um das Wirken der Solarenergie zu sehen und ökologisch zu nutzen, statt seine Abfälle in leblosen Mülleimern zu verbergen. Es ist schwieriger, aber selbst in der Stadt kann man an der frischen Luft sein, mit etwas ökosensibler Achtsamkeit jedenfalls; das lebendige Territorium bringt sich uns schon in Erinnerung. Der Frühling etwa zeigt es uns: Faszinierend, wie sehr er uns beeinflusst, wie er in uns aufsteigt, wie er vordringt bis in die Herzen der großen Städte, mit tausend kleinen belebenden Zeichen.
An der frischen Luft profitieren wir gleichzeitig davon, dass uns ein lebendiger Raum umgibt, der uns dann auch in unserem Inneren erfüllt, und davon, dass unsere Füße fest auf dem Erdboden stehen. Auf diesem Erdboden ruhen wir wie auf einem phantastischen Tier, das uns trägt, ein riesiges Tier, das für uns nun wieder lebendig, reich an Zeichen und an feinen Verbindungen geworden ist. Wir erleben eine freigiebige Umwelt, deren Großzügigkeit wir endlich erkennen – sobald wir den Irrglauben überwunden haben, dem zufolge man die Erde tyrannisieren muss, damit sie uns ernährt.
An der frischen Luft sein heißt, sich in jener lebendigen Atmosphäre zu befinden, die die Atmung der Pflanzen erzeugt. Was sie ausstoßen, ist, was uns hervorbringt. Es bedeutet anzuerkennen, dass frische Luft und Erde von ein und demselben Gewebe sind. Es ist allumfassend, lebendig, von Lebewesen gemacht, und wir können aus ihm nicht heraus, ohne es und uns zu verletzen – vielleicht müssen wir uns ebendarum um diplomatischere Beziehungen bemühen? An die frische Luft – gleichzeitig eine belebende Öffnung und eine Rückkehr zur Erde.
Aber auch diese Formulierung war nicht unser letztes Wort. Auf den Begriff, der endlich alles Gemeinte in sich vereinte, stießen wir durch Zufall. Es ist ein altfranzösisches Wort, das sich erhalten hat durch den Sprachgebrauch der Waldläufer von Quebec. Wenn diese ihre Geschäfte in der Stadt erledigt hatten und sich anschickten, ihren Weg unter freiem Himmel fortzusetzen, sagten sie: »Morgen ziehe ich weiter, ich gehe mich einwalden [je vais m’enforester].«
»Sich einwalden« – ein semantischer Doppelschlag, ermöglicht durch das Reflexivverb: Man geht in den Wald, und zugleich zieht dieser in uns ein. Sich einzuwalden erfordert keinen Wald im Wortsinne, sondern schlicht eine neuartige Beziehung zu den lebendigen Territorien. Eine zweifache Bewegung sollte stattfinden: Erstens durchschreitet man die Landschaft anders, nimmt Verbindung zu ihr mithilfe anderer Formen der Achtsamkeit und anderer Praktiken auf; zweitens lässt man sich von ihr kolonisieren, durchdringen; man lässt sie bei sich einziehen. So wie die Pionierfronten der Tannen in den Cevennen auf die Dörfer zurücken und dabei ehemalige Weideflächen bewachsen, über die nun nicht mehr die Landwirtschaft bestimmt.
Eine philosophisch angereicherte Spurensuche hat uns auf den Geschmack des »Sich-Einwaldens« gebracht, das unseren Blick und unser Leben neu ausgerichtet hat. Zu solch einer Spurensuche gehören auch andere Praktiken, etwa das Sammeln von Wildpflanzen, das eine gesteigerte Sensibilität gegenüber den ökologischen Beziehungen erfordert, die uns in den lebendigen Territorien miteinander verbinden. Bei dieser ›ökosensiblen‹ Spurensuche finden wir ein anderes Verhältnis zur lebendigen Welt, die zugleich abenteuerlicher und freundlicher wird. Abenteuerlicher wird sie, weil wir jede Menge darin erleben. Alles zeigt ein bestimmtes Verhalten, alles ist ein wenig reicher an Eigenartigkeiten. Jegliche Beziehung mehrerer Erscheinungen zueinander, sogar in einem schlichten Garten, ist erforschenswert. Freundlicher hingegen wird sie, weil wir es jetzt nicht mehr mit einer stummen und reglosen Natur in einem absurden Kosmos zu tun haben, sondern mit Lebewesen, wie wir welche sind, die vitalen Logiken folgen – erkennbar, aber immer auch rätselhaft. Ein Teil des darin liegenden Mysteriums können wir niemals ergründen.
Es gibt eine Anekdote aus dem Zen, die etwas von jener Spur ahnen lässt, der wir gerade folgen, dem Weg hin zum Sich-Einwalden:
Ein Mönch steht im prasselnden Regen, den Rücken zum Tempel gewandt; sein Blick schweift über die Bergkette. Ein junger Bonze, in sein Gewand eingemummelt, steckt den Kopf durch die Tür des Tempels und sagt zu dem Mönch: »Kommt doch herein, Ihr holt Euch ja den Tod!« Nach einem kurzen Schweigen antwortet der Mönch: »Herein? Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich draußen bin.«
Irgendwie langweilte man sich früher »draußen« in der unbelebten Landschaft oft, wenn man dort Sport trieb oder schöne Aussichten suchte. Aber nun ist alles bevölkert, alles sendet Botschaften aus, und wir müssen in der großen Welt, die wir uns teilen, das Zusammenleben lernen. Wir, die Amateurspurensucher, wollen versuchen, wie Diplomaten mit den Lebensformen zu kommunizieren, die unter uns wohnen, aber in ihrer eigenen Welt. Wir könnten uns vornehmen, ein truchement gegenüber all diesen Lebendigen zu werden – eine Art Mediator und Dolmetscher zugleich. Truchement ist ein hübsches Wort des Altfranzösischen, das im 17. Jahrhundert erneut aufkam, um eine seltsame Personengruppe zu bezeichnen, nämlich die bereits erwähnten jungen französischen Waldläufer. Der Forschungsreisende und Kolonisator Samuel de Champlain sandte sie, nachdem er auf jenem algonquinischen Territorium gelandet war, das später Kanada werden sollte, zu den amerindianischen Stämmen und ließ sie dort überwintern, damit sie Sprache, Sitten und Gebräuche der sogenannten Wilden lernten. So wurden sie Diplomaten zwischen den Völkern; entsprechend trugen sie künftig Deckenmäntel und lange Haare mit Federn darin.
Wir sollten nun ebenfalls Waldläufer werden, aber unsere diplomatischen Fähigkeiten anderen »Wilden« widmen: Sich-Einwalden ist gewissermaßen ein Versuch, sich auf die andere Seite zu begeben und dort zu überwintern. Wir müssen uns in die Perspektive der wilden Tiere, der kommunizierenden Bäume, der lebenden und arbeitenden Böden, der miteinander harmonierenden Pflanzen im permakulturellen Gemüsegarten hineindenken; wir sollten durch ihre Augen sehen, uns für ihre Sitten und Gebräuche sensibilisieren. Kennen wir erst ihre unerschütterlichen Sichtweisen auf den Kosmos, können wir unsere Beziehungen zu ihnen verbessern.
Dafür ist Diplomatie gefragt, denn es geht um ein vielfältiges Volk, dessen Sprachen und Gebräuche wir kaum verstehen und das nicht unbedingt geneigt ist zu kommunizieren, obwohl die Möglichkeiten gegeben sind, allein wegen unserer gemeinsamen genealogischen Herkunft (wir stammen ja von denselben Vorfahren ab). Will man »sich einwalden«, wird das nicht gehen ohne Anstrengungen der Intelligenz und der Phantasie. Auch endloses feinfühliges Abwarten ist nötig, denn wir möchten ja versuchen zu übersetzen, was sie tun, was sie kommunizieren und wie sie leben.
Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss äußert sich in einem berühmten Interview zur Unmöglichkeit der Kommunikation zwischen den Menschen und den anderen Wesen, mit denen sie die Erde teilen. Er wertet sie als eine tragische Situation und einen Fluch. Gebeten zu erklären, was ein Mythos sei, antwortet er:
Wenn Sie sie einem amerikanischen Indianer stellten, dann würde er Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit antworten: eine Geschichte aus der Zeit, als die Menschen und die Tiere noch nicht voneinander geschieden waren. Diese Definition scheint mir sehr tief zu sein. Denn trotz der von der jüdisch-christlichen Tradition zu ihrer Bemäntelung verspritzten Tinte scheint keine Situation tragischer, verletzender für Herz und Geist als die einer Menschheit, die mit anderen, auf ein und derselben Erde lebenden Gattungen koexistiert, in deren Genuß sie sich teilen, und mit denen sie nicht kommunizieren kann. Man begreift, daß die Mythen es ablehnen, diesen Makel der Schöpfung für angestammt zu halten; daß sie in seinem Auftreten vielmehr das Ur-Ereignis der Entstehung eines »Wesens« des Menschen und seiner Hinfälligkeit erblicken.6
Ob tatsächlich ein »Makel der Schöpfung« vorliegt, hängt in gewisser Weise von unserer Geisteshaltung ab: Die Kommunikation ist ja möglich, auch wenn sie schwierig sein mag, da immer Missverständnisse um die Schöpfung hineinspielen und stets Geheimnisse damit verbunden sein werden. Sie hat auch nie aufgehört, möglich zu sein. Verhindert wird sie nur durch eine Zivilisation, die die anderen Lebewesen zu Maschinen degradiert hat, die sie als instinktgesteuerte Materie oder als gewalttätiges Anderes missversteht.
Wenn aber die Definition des Mythos, die Lévi-Strauss vorschlägt, richtig ist, erweist sich die Spurensuche auf rätselhafte Weise als eine von mehreren Möglichkeiten, in die Zeit des Mythos selbst zurückzugelangen und ihn zu ergründen.
Dieser Zustand, in dem es keinen Unterschied zwischen Tier und Mensch gibt, diese Erfahrung eines Übergangs zwischen dem Selbst und dem Anderen, ist bei der Spurensuche tatsächlich allgegenwärtig. Um die Laufroute des Tieres nachzuvollziehen, muss man sich an seine Stelle versetzen, mit seinen Augen sehen. Man muss die Schlüsselpunkte wiederfinden, die Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Arten des Lebendigseins, indem man der Spur des Tieres folgt. Dessen Überlebensstrategien kann man in sich wiederfinden (auch wenn sie dort anders beschaffen sein mögen). Um den Wolf zu finden, muss man in sich nach Fragen suchen, die man mit dem Wolf gemeinsam hat; man muss versuchen, aus der rein menschlichen Haltung herauszutreten, um anderswo Übereinstimmung zu finden. Indem man einem Trampelpfad folgt, zum Beispiel. Manche Tierpfade sind Orte, an denen zwischen Mensch und Tier nicht unterschieden werden kann, denn es lässt sich nicht auf den ersten Blick bestimmen, wer sie angelegt hat. Solche Pfade werden oft von mehreren Arten, unter denen auch der Homo sapiens sein kann, benutzt, geformt und unterschiedslos miteinander geteilt. Mensch und Tier wählen sie mit dem gleichen, auf das Ziel gerichteten Blick und aus den gleichen Gründen. Die Pfade des Hirsches sind ein Geschenk an alle übrigen Wanderer; die des Wildschweins erfordern hier und da schon mehr Anstrengung, wenn das Gesträuch dichter wird – diese Tiere sind ja nicht besonders hoch. Die Pfade der Gämse sind für Mitbenutzer oft zu steil, denn sie lebt wie der Vogel in drei Dimensionen; die Vertikale ist ihr ebenso zugänglich wie die Horizontale. Die Pfade des Wolfs wiederum sind optimal, um ein Gebiet zu durchkämmen.
Es gibt zwischen den großen Tieren Gemeinsamkeiten im Hinblick darauf, wie sie sich fortbewegen. Sie alle suchen den bereits gebahnten Weg, den optimalen Durchgang, den Bach, an dem sie ihren Durst stillen oder sich einfach am sprudelnden Wasser erfreuen können. Haben sie eine kalte Schlucht hinter sich, streben sie alle ins Sonnenlicht, um sich wieder aufzuwärmen, oder an den Aussichtspunkt, der Überblick über das Tal gewährt, um sich ein wenig zu orientieren und herauszufinden, ob vielleicht jemand kommt. Sie alle suchen in der Mittagshitze den Schatten, der Kühlung verschafft, oder den Umweg, der ihnen den Marsch über die Bergspitze erspart. Ein Wolfspfad ist immer der Weg des geringsten Widerstandes. Deshalb wird ein Mensch ganz selbstverständlich der Fährte eines Tieres folgen (sofern es einen gewissen Körperumfang hat), und deshalb kann die Fährte die Unterschiede zwischen diesem Menschen und diesem Tier überbrücken. Ebenjene vitale und häufig gemachte Erfahrung des Sich-Fortbewegens beweist ihre Nähe zueinander. Sie sehen den Pfad mit den gleichen Augen, all jene Säugetiere machen sich mit den gleichen Zielen auf den Weg und denken oder entscheiden sich auf die gleiche Art und Weise. Trotz der Unterschiede, trotz der unüberwindbaren Fremdheit zwischen den Lebensformen haben sie so manche Gemeinsamkeit, was ihre Strategien des Überlebens betrifft. Dies zeigt sich etwa, wenn ein Spurensucher im Wald eine verlorene Fährte wieder aufnehmen kann, weil er geahnt hat, dass das Tier zur wärmsten Tageszeit sicherlich an den Bach gehen wird, der da unten murmelt, oder wenn er schon vorher weiß, dass der Wolf, der wie alle Herrschenden den Wunsch verspürt, allen zu zeigen, wo sein Territorium ist, auf dem Pass da vorn bestimmt eine Markierung hinterlassen hat, die der Suchende dann auch prompt dort findet. So macht man en passant, ohne es zu wollen, die Erfahrung der mythischen Zeit: einer Zeit, in der die menschlichen und die nichtmenschlichen Tiere noch nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden waren.
Jeder gute Vermittler muss hoffen, dass ein Diplomat, der losgezogen ist, um sich bei anderen Lebewesen (und sei es nur für ein, zwei Tage) einzuwalden, verwandelt zurückkehrt – als ein friedlich verwildertes Wesen, keineswegs wild im Sinne jener phantasmatischen Bestialität, die man dem Anderen unterstellt. Möge derjenige, der sich einwalden lässt, verändert von seinem Abenteuer zurückkehren, als Grenzgänger zwischen zwei Welten nämlich. Weder erniedrigt noch geläutert möge er zurückkehren, nur als anderer Mensch und mit der Fähigkeit, ein wenig zwischen den Welten hin- und herzureisen und sie miteinander ins Gespräch zu bringen. So kann er seinen Beitrag dazu zu leisten, dass etwas Neues entsteht: eine gemeinsame Welt.
Die Erde; und das ist genug.
Ich brauche die Sternbilder nicht näher.
Ich weiß, sie sind, wo sie sind, an guter Stelle.
Ich weiß, sie genügen denen, die ihnen angehören.7
Kapitel 1
Die Zeichen des Wolfes
Es ist die Geschichte einer Nacht. Ein 24. Juli, glaube ich; eine Nacht bei der Herde. Wir sind zu zweit. Gemeinsam sind wir gekommen, um den Wolf von den Lämmern fernzuhalten und einen kritischen Moment zu verstehen. Es geht um das nächtliche Drama, wenn der Wolf in Konflikt mit der menschlichen Gesellschaft gerät – den Moment, in dem das wilde Tier das Nutztier angreift. Im Gespräch mit dem Schäfer kamen wir auf die Idee: warum nicht ein paar Nächte bei der Herde verbringen, um Präsenz zu zeigen, um etwas Sinnvolles zu tun und etwas mitzuerleben, das eine Kontroverse ausgelöst hat, die heute die gesamte Gesellschaft bewegt? Die Rede ist von der Rückkehr des Wolfes. Wir begleiten also eine Schafherde auf der Hochebene von Canjuers in der Provence. Dort leben ein oder mehrere Wolfsrudel, die sich gegenüber der Gattung Ovis sehr mörderisch verhalten. Die ökologischen, historischen und hütekulturellen Bedingungen dort kommen ihren Attacken noch zugute.
Canjuers ist ein Militärgelände, zu dem Zivilisten keinen Zutritt haben. Es fallen Bomben, und es rollen Panzer. Geht man dort vorbei, hört man Granaten detonieren, in einer menschenleeren Natur. Fernab liegen Geisterdörfer. Diese Einöde erobert sich die Fauna mit explosiver Kraft zurück.
Wir bleiben auf einem Gebirgskamm gegenüber dem Gipfel des Mièraure stehen. Es ist 22 Uhr. Wir bauen das Zelt ganz leise auf, verständigen uns nur mit den Zeichen der amerindianischen Sprache, nutzen die Lippen nur zum Lächeln. Optimale Disziplin. Ich bleibe bis ein Uhr draußen, in Gesellschaft eines rötlichen Mondes, oberhalb einer Herde von rund 1200 Schafen, robusten Tieren, die mit der Härte des Klimas zurechtkommen. Aufgrund des spärlich bewachsenen Bodens und der Hitze des Tages müssen die Schafe die ganze Nacht über weiden. Die großen Herden, beweglich wie Starenschwärme, sind währenddessen den Räubern ausgeliefert. Sporadisch bellen die Hütehunde – sieben Mischlinge aus der Pyrenäenrasse Patou und dem anatolischen Hirtenhund –, dann ist alles ruhig. Ich schlüpfe in meinen Schlafsack.
Um halb vier Uhr morgens trete ich wieder nach draußen, weil die Hütehunde anhaltend jaulen. Sie verteidigen sich. Sie wittern, dass er da ist. Rings um die Herde haben sie sich aufgestellt. Ich steige leise den Hang hinunter, auf die Tiere zu, die ausgeschaltete Lampe am Gürtel. Ich habe den Weg gewählt, der mich in den Windschatten der Herde bringt. Die Lavendelblüten duften stark, der Mond in meinem Rücken verbreitet ein schönes, klares Licht. Das Geheul der Hunde lässt eine gewisse Furcht in mir aufsteigen, gemischt mit Adrenalin. Ich bleibe ein paar hundert Meter oberhalb der Herde stehen, den Mund geöffnet, damit ich die Geräusche ringsum besser wahrnehme, unbeweglich und ohne Licht, mehrere Minuten lang.
Und da höre ich etwas, etwas, das sich aufwärts in meine Richtung bewegt. Es läuft über das Geröll auf der Hangschräge, kreuzt meine Strecke ein paar Dutzend Schritte vor mir. Ich erschauere, als ich mir einen Patou vorstelle, den der Konflikt in Aufregung versetzt hat. Ich kenne die Geschichten über Hütehunde, die den Arm eines mitfühlenden Tierarztes zerfleischen.
Ich sehe ihn zunächst auf der Schräge laufen, sechzig Schritt von mir entfernt. Er ist, im Lichte des Mondes, anthrazitgrau, fast einfarbig. Er hat einen kraftvollen wiegenden Gang, wie ich ihn noch bei keinem Hund gesehen habe. Er ist sehr lang; sein Schwanz hängt nach unten und ist ganz gerade. Er strahlt Stärke aus, die luzide Stärke des Wildtieres. Vierzig Schritt von mir entfernt bleibt er plötzlich stehen.
Er hat meine Anwesenheit gespürt. Er wendet den Kopf zu mir.
Er fixiert mich zwei lange Sekunden, genau die Zeit, die ich brauche, um die Lampe aus meinem Gürtel blankzuziehen. Ich will ihm einen Lichtkegel ins Gesicht jagen, aber er wendet sich ab, bevor die Strahlen ihn erreichen. Er schnellt auf ein Gehölz zu. Ich verfolge ihn, dann ändere ich meine Richtung, um ihm den Weg abzuschneiden. Ich will ihn, glaube ich, erschrecken, in die Flucht schlagen, von der Herde entfernen. Aber ich bin mir nicht sicher über den Zweck dieser Handlung, die doch sehr triebgesteuert ist. Vielleicht verfolge ich ihn nur, um keine Angst zu bekommen.
Hatte er meinen Geruch gewittert? Ich stand in seinem Windschatten, aber die Luft änderte gerade leicht die Richtung und bewegte sich nur schwach. Es war, glaube ich, meine Silhouette, die er am Rande seines Sichtfelds wahrgenommen und die ihn überrascht hat. Daraufhin hat er mich wie einen seinesgleichen gemustert. Auge in Auge.
Er verschwindet hinter einem freistehenden Gehölz am Rande des Waldes von Goudron. Ich gehe hinein. Das Dickicht ist schwer zu durchdringen. Ich zwänge mich unter dem Nadelwerk schwarzer Kiefern hindurch, die eine regelrechte Höhle bilden. Ich stöbere einige Minuten herum. Er hat sich in Luft aufgelöst.
Verstand und Vernunft haben vergeblich vorhergesagt, dass er dort sein müsse: Er ist nicht da.
Mir wird klar, dass mein Verhalten absurd ist und mich unnötig in Gefahr bringt. Wenn er sich dort verkrochen hat, hat es keinen Zweck, ihn zu stellen.
Also postiere ich mich wieder zwischen der Herde und dem Wald. Philippe, der Schäfer, sagte mir, dass der Wolf oft zurückkomme, um sich ein getötetes Tier zu holen (er wartet, bis die Herde sich ein wenig entfernt hat, wodurch dann auch die Hunde weiter weg sind) oder um sein Glück erneut zu versuchen. Aber er erscheint kein zweites Mal. Er könnte es auch nicht lautlos tun, denn das Geröll an dieser Stelle verhindert jede leise Fortbewegung. Was mich am meisten überraschte: der beträchtliche Lärm, den er beim Laufen gemacht hat. Er ist zwar ein Raubtier, aber eben keine Raubkatze.
Ich sitze inmitten des Lavendels und drehe mir eine Zigarette. Ich fürchte, ich bin zu spät gekommen. Er war wohl wieder bei der Herde. Wir werden den Tag abwarten müssen, um die Verluste festzustellen. Ich hätte früher kommen müssen. Die Absicht ist zwar lächerlich, bedenkt man die Intensität der dort üblichen Wolfsangriffe, aber ich würde mich freuen, wenn ich dazu beigetragen hätte, den Schafen eine friedliche Nacht zu bescheren.
Die Hunde beruhigen sich endlich; sie haben sich am äußersten Rand der Herde verteilt und werden nun ab und zu bellen, etwa alle fünf Minuten, um einander ihre Positionen zu signalisieren, um sich wachzuhalten, um sich gegenseitig Mut zu machen. Sie haben bewundernswerte Arbeit geleistet. Ich bin im Dunkeln tief gerührt von ihrer paradoxen Wächterloyalität. In dieser Nacht haben sie jenen Menschen so gut gedient, die sie großgezogen haben, indem sie ihre frühere Beute gegen ihren eigenen Vorfahren verteidigten, eben den Wolf – und dafür bekommen sie zur Belohnung das Fleisch ihrer neuen Schützlinge zu fressen (wenn die Schäfer die Überreste der gerissenen Tiere an sie verfüttern). Man möchte verrückt werden in diesem Spiel der Umkehrungen.
In der amerindianischen Zeichensprache ist das Zeichen für den Wolf ein V, gebildet mit dem Zeige- und dem Mittelfinger der rechten Hand; dabei wird diese von der Schulter her in schräger Linie nach oben geführt. Das Zeichen für ›Hund‹ ist das gleiche V, nur zeigen die Finger nun abwärts, und die Hand wird nicht nach vorn bewegt, sondern weicht nach hinten zurück.
Ich denke noch einmal über die Szene nach.
4 Uhr morgens, ich und ein Wolf auf vierzig Schritt, Mann gegen Mann, jedenfalls Mensch gegen Mensch.
Es klingt absurd, aber dies ist die erste und klarste Formulierung, die mir einfällt, um die Begegnung in Worte zu fassen. Ein Eindruck, der ein Rätsel wird, das es zu lösen gilt. Es handelt sich ganz und gar nicht um den virilen Showdown, den jene abgedroschene Formulierung evoziert, weshalb ich nicht verstehe, warum sie mir so spontan in den Sinn kommt. Es ist etwas anderes, das sich in diesen drei Worten andeutet, aber was?
Ich bekomme sein Gesicht nicht zu sehen, denn ich bin zu langsam beim Zücken der Lampe. (Lektion 1: Schnellstmögliches Zücken der Lampe trainieren. Lektion 2: Es braucht äußerste Disziplin, Askese, Stille und Heimtücke, um ihn zu überraschen.) Seine weiße Maske kann ich nicht erkennen, auch seine spitzen Ohren kaum, die ich zu erahnen glaube.
Aber er sieht mich an; nein, er betrachtet mein Gesicht; nein, er schaut mir in die Augen. »Plötzlich erinnerst du dich, daß du ein Gesicht hast.«8 Diese Erinnerung spielt eine besondere Rolle in der Empfindung, die die Begegnung ausgelöst hat. Eye contact mit dem Wolf: ein philosophisches Rätsel. Warum schauen bestimmte Tiere uns spontan in die Augen? Wenn sie dächten, dass wir Körper seien, die durch physische Kräfte bewegt werden, fallende Steine oder Bäume etwa, oder wenn sie überhaupt nicht dächten, dann würden sie ihren Blick ungerührt auf die ganze Oberfläche unseres Körpers richten, ohne dass sich unsere Blicke träfen. Gerade die Tatsache, dass sie uns in die Augen schauen, legt nahe, dass sie etwas wissen: Hinter unseren Augen verbirgt sich für sie ein Bewusstsein, als gäbe es dort wirklich etwas zu sehen, als hätten wir tatsächlich eine Seele, die sich in diesen Spiegeln verrät. Ich vermag es nicht zu sagen. Der eye contact offenbart, was jene Tiere von dem verstehen, was wir sind. Sie gestehen uns ein Innenleben zu, uns, die wir so große Mühe damit haben, ihnen dieselbe Höflichkeit zu erweisen. Und dabei verlangt ihre Geste förmlich danach: Ein Innenleben ist nur dazu da, ein anderes zu erkennen, sei es im Felsgebirge, im Wald oder in den Wolken.
Der Biologe Adolf Portmann, der sich mit der Tiergestalt beschäftigt hat, geht auf die wichtige Rolle des Kopfes bei der Begegnung von Mensch und Tier ein. Ihm zufolge besteht eine Korrelation zwischen dem Entwicklungsgrad des Gehirns und der Ausformung der äußeren Erscheinung. Je komplexer das Bewusstsein eines Tieres ist, meint Portmann, desto ausgeprägter ist seine Gestalt. Das Aussehen des Kopfes bestimmter Tierarten passt dazu: Als eminent sichtbares Organ ist er durch eine ganze Reihe von Ornamenten, Kontrasten und Symmetrien im Körperbau als wichtigster Punkt gekennzeichnet. Portmann fügt hinzu, beim Tier stehe der höchste Grad der individuellen Existenz, die Möglichkeit, innere Zustände mitzuteilen, im Dienste der Begegnung.9
Einer hypnotischen Begegnung freilich, wenn sie in einer anderen Dimension stattfindet, nämlich in der Nacht, die nicht für den Menschen geschaffen ist. Schließlich erschweren ihm die verschwimmenden Formen die Identifikation anderer Wesen und die Beherrschung des Raumes. Die Nacht ist ein Reich der Empfindungen, in dem der Körper vom Gehör und vom Geruch gesteuert wird – archaischen Sinnen, die nun wieder dominant werden. In der Nacht verschwindet die Klarheit des biologischen Fachwissens. Anatomie lässt sich nur bei gutem Licht betreiben. Man bräuchte eine andere Sprache dafür: Man sieht ›Wolf-Impressionen‹, Raum-Zeit-Komplexe, unvollständige Silhouetten, bei denen die Phantasie ergänzt, was das Auge nicht mehr erfasst. Nur zu verständlich, dass man Monster sieht – Werwölfe etwa.
Strenggenommen bin ich eher einem ›Wolfsartigen‹ begegnet als einem Canis lupus.
Aber kein Zweifel, es ist ein Wolf.
Wie kann ich das so genau wissen? Welche heimlichen Schlüsse sind da hinter meinen Augen gezogen worden, in den großen turbulenten Bewegungen meines Geistes, die zu lebhaft sind, als dass ich sie wahrnehmen könnte? Ich brauche mehrere Minuten, um die blitzschnelle Überlegung aufzuschlüsseln, indem ich ihre Prämissen auseinandernehme. Als ich losging, hörte ich die Hunde um die Herde herumjaulen, ganz außer sich vor Aufregung. Alle bellten und knurrten, um den Räuber in die Flucht zu schlagen, um ihre Position zu melden, um einander Mut zu machen. Jener jedoch, der über das Geröll auf mich zurennt, ist völlig stumm. Wie es Bösewichte zu sein pflegen. Ich höre die Belagerten, aber ich sehe den schweigsamen Belagerer, der die Herde umkreist.