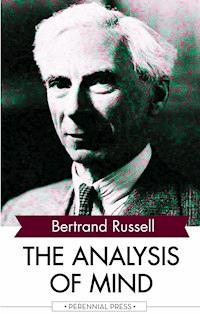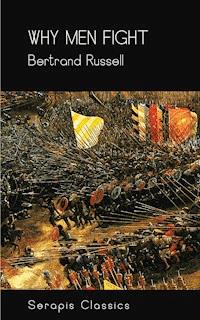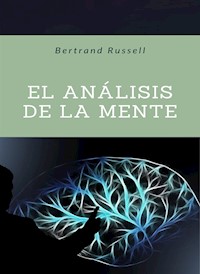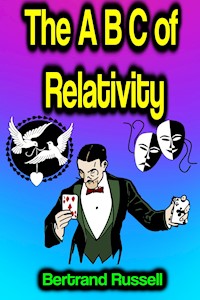Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die Philosophie des Abendlandes" wurde während des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Die Grundlagen dafür entstammten einer Vorlesungsreihe über die Geschichte der Philosophie, die Bertrand Russell zwischen 1941 und 1942 an der Barnes Foundation in Philadelphia hielt. Das berühmte Standardwerk des Nobelpreisträgers für Literatur bietet eine Einführung in die westliche Philosophie von den Vorsokratikern bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert. Es ist in drei Bücher unterteilt: die Philosophie der Antike, die katholische Philosophie und die Philosophie der der Neuzeit. Bertrand Russell hat es sich zum Ziel gesetzt die Philosophie des Abendlandes im Zusammenhang mit ihren politischen und gesellschaftlichen Grundlagen begreifbar zu machen. Seine Darstellungen der einzelnen Epochen sind immer mit der Reflexion ihrer politischen und gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen, mit eigenen Gedanken und Interpretationen verbunden; seine Schilderungen der großen Denker der abendländischen Kultur beziehen auch ihr Milieu, ihre Zeit- und Lebensumstände mit ein. Es war nicht zuletzt dieses Werk, das ihm dank seiner klassisch-schönen Sprache 1950 den Nobelpreis für Literatur eingebracht hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1693
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERTRAND RUSSELL
Philosophie des Abendlandes
Ihr Zusammenhang mit der politischen und der sozialen Entwicklung
Die Originalausgabe erschien 1945 im Verlag George Allen & Unwin, London, unter dem Titel A History of Western Philosophy.
Die Übertragung aus dem Englischen von Elisabeth Fischer-Wernecke und Ruth Gillischewski wurde für die Ausgabe 1992 von Rudolf Kaspar durchgesehen.
1. eBook-Ausgabe 2023
Unveränderte Nachauflage 2023
© der deutschsprachigen Rechte: 1950 by Europa Verlag, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München (vormals Europa Verlag AG, Zürich)
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von © Estate of Lotte Meitner-Graf.
All rights reserved 2023 / Bridgeman
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-463-7
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Vorwort
Einführung
ERSTES BUCH
DIE PHILOSOPHIE DER ANTIKE
I. Teil
Die Vorsokratiker
1.Der Aufschwung der griechischen Kultur
2.Die milesische Schule
3.Pythagoras
4.Heraklit
5.Parmenides
6.Empedokles
7.Athens kulturgeschichtliche Bedeutung
8.Anaxagoras
9.Die Atomisten
10.Protagoras
II. Teil
Sokrates, Plato und Aristoteles
11.Sokrates
12.Spartas Einfluß
13.Die Quellen der platonischen Anschauungen
14.Platos Utopie
15.Die Ideenlehre
16.Platos Unsterblichkeitslehre
17.Platos Kosmogonie
18.Erkenntnis und Wahrnehmung bei Plato
19.Die Metaphysik des Aristoteles
20.Aristoteles’ Ethik
21.Die Politik des Aristoteles
22.Die Logik des Aristoteles
23.Die Physik des Aristoteles
24.Die Anfänge der griechischen Mathematik und Astronomie
III. Teil
Antike Philosophie nach Aristoteles
25.Die hellenistische Welt
26.Kyniker und Skeptiker
27.Die Epikureer
28.Der Stoizismus
29.Die kulturgeschichtliche Bedeutung des römischen Reiches
30.Plotin
ZWEITES BUCH
DIE KATHOLISCHE PHILOSOPHIE
Einführung
I. Teil
Die Kirchenväter
1.Die religiöse Entwicklung der Juden
2.Das Christentum in den ersten vier Jahrhunderten
3.Drei Doctores Ecclesiae
4.Philosophie und Theologie Augustins
5.Das fünfte und sechste Jahrhundert
6.Benedikt und Gregor der Große
II. Teil
Die Scholastiker
7.Das Papsttum im dunklen Zeitalter
8.Johannes Scotus
9.Die Kirchenreform im elften Jahrhundert
10.Mohammedanische Kultur und Philosophie
11.Das zwölfte Jahrhundert
12.Das dreizehnte Jahrhundert
13.Thomas von Aquino
14.Franziskanische Scholastiker
15.Der Verfall des Papsttums
DRITTES BUCH
DIE PHILOSOPHIE DER NEUZEIT
I. Teil
Von der Renaissance bis Hume
1.Allgemeine Charakteristik
2.Die italienische Renaissance
3.Machiavelli
4.Erasmus und Morus
5.Reformation und Gegenreformation
6.Der Aufschwung der Naturwissenschaft
7.Francis Bacon
8.Hobbes’ Leviathan
9.Descartes
10.Spinoza
11.Leibniz
12.Der philosophische Liberalismus
13.Lockes Erkenntnistheorie
14.Lockes politische Philosophie
15.Lockes Einfluß
16.Berkeley
17.Hume
II. Teil
Von Rousseau bis zur Gegenwart
18.Die romantische Bewegung
19.Rousseau
20.Kant
21.Geistige Strömungen im neunzehnten Jahrhundert
22.Hegel
23.Byron
24.Schopenhauer
25.Nietzsche
26.Die Utilitarier
27.Karl Marx
28.Bergson
29.William James
30.John Dewey
31.Die Philosophie der logischen Analyse
Personenregister
Vorwort
Dieses Buch bedarf zu seiner Rechtfertigung einiger erklärender Worte, um nicht ganz so streng beurteilt zu werden, wie es das zweifellos verdient.
Rechtfertigen muß es sich vor denen, die eine Spezialkenntnis der verschiedenen Schulen und einzelnen Philosophen besitzen. Mancher andere wird über jeden Philosophen, mit dem ich mich beschäftige, Leibniz vielleicht ausgenommen, mehr wissen als ich. Wenn jedoch Bücher, die ein großes Gebiet umfassen, geschrieben werden sollen, läßt es sich, da unser Leben begrenzt ist, nicht vermeiden, daß die Autoren solcher Bücher jedem einzelnen Abschnitt weniger Zeit widmen können als jemand, der sich auf einen einzigen Schriftsteller oder eine kurze Epoche beschränkt. Gewisse Leute werden in unerbittlicher wissenschaftlicher Strenge daraus den Schluß ziehen, daß daher Bücher mit weitgezogenem Rahmen überhaupt nicht geschrieben werden oder anderenfalls aus wissenschaftlichen Einzelbeiträgen vieler Autoren bestehen sollten. Der Zusammenarbeit vieler Autoren haftet jedoch ein Mangel an. Geht man von irgendeiner einheitlichen geschichtlichen Entwicklung, einem inneren Zusammenhang zwischen dem Vorangegangenen und dem Nachfolgenden aus, so läßt sich das unbedingt nur darstellen, wenn sich die Synthese der früheren und späteren Perioden in einem einzigen Kopf vollzieht. Wer Rousseau studiert, wird möglicherweise nicht leicht seiner Beziehung zu dem spartanischen Staat Platos und Plutarchs gerecht werden können, der Geschichtsschreiber Spartas kann nicht schon vorahnend an Hobbes und Fichte und Lenin gedacht haben. Derartige Beziehungen aufzuzeigen gehört zu den Absichten dieses Buches, ein Zweck, den nur ein großer Überblick erfüllen kann.
Viele Bücher sind schon über die Geschichte der Philosophie geschrieben worden, keines jedoch, soweit mir bekannt, mit dem Ziel, das ich mir gesetzt habe. Philosophen sind sowohl Ergebnisse als auch Ursachen: Ergebnisse ihrer sozialen Umstände, der Politik und der Institutionen ihrer Zeit; Ursachen (wenn sie Glück haben) der Überzeugungen, die der Politik und den Institutionen späterer Zeitalter die Form geben. In den meisten philosophischen Geschichtswerken steht jeder Philosoph gleichsam im luftleeren Raum, seine Ansichten werden zusammenhanglos dargestellt, bestenfalls wird eine Beziehung zu früheren Philosophen zugestanden. Ich hingegen habe versucht, jeden Philosophen, soweit mit der Wahrheit vereinbar, als Ergebnis seines Milieus, seiner Zeit- und Lebensumstände zu zeigen, als Menschen, in dem sich die Gedanken und Empfindungen kristallisierten und verdichteten, die, wenn auch unklar und unkonzentriert, der menschlichen Gemeinschaft eigen waren, der er angehörte.
Daher war es nötig, einige rein sozialgeschichtliche Kapitel einzuschalten. Niemand kann die Stoiker und Epikureer ohne eine gewisse Kenntnis der hellenistischen Zeit, niemand die Scholastiker ohne ein wenig Verständnis für die zunehmende Macht der Kirche im fünften bis dreizehnten Jahrhundert verstehen. Ich habe daher an wichtigsten historischen Umrissen das kurz aufgezeigt, was mir das philosophische Denken am stärksten beeinflußt zu haben schien; ich bin dabei überall dort am ausführlichsten vorgegangen, wo, wie anzunehmen, die Geschichte manchem meiner Leser weniger vertraut ist – beispielsweise beim frühen Mittelalter. In diesen historischen Kapiteln habe ich jedoch unerbittlich alles ausgelassen, was mir von geringer oder gar keiner Bedeutung für die zeitgenössische oder nachfolgende Philosophie zu sein schien.
Die Auswahl ist in einem Buch wie dem vorliegenden ein sehr schwieriges Problem. Ohne Einzelheiten wird ein Buch trocken und uninteressant; durch Details gerät es in Gefahr, unerträglich lang zu werden. Ich habe einen Kompromiß angestrebt und nur die Philosophen behandelt, die ich für wirklich wichtig halte, und im Zusammenhang damit solche Einzelheiten angeführt, die, wenn vielleicht auch nicht grundlegend bedeutsam, doch insofern wertvoll sind, als sie die Darstellung anschaulich und lebendig zu machen vermögen.
Von alters her war die Philosophie nicht ausschließlich Sache der Schulen oder der Diskussion von einigen Gelehrten. Sie war ein wesentlicher Bestandteil des Lebens der Gemeinschaft, und so habe ich sie zu behandeln versucht. Sollte das Buch irgendein Verdienst haben, so ist es auf diese Betrachtungsweise zurückzuführen.
Das Buch verdankt Herrn Dr. Albert C. Barnes seine Entstehung, da es ursprünglich für Vorlesungen gedacht war, die zum Teil auch an der Barnes Foundation in Pennsylvanien gehalten worden sind.
Wie bei den meisten meiner Arbeiten seit 1932 hat mich meine Frau, Patricia Russell, im Quellenstudium und in mancher anderer Hinsicht weitgehend unterstützt.
Einführung
Die Begriffe vom Leben und von der Welt, die wir »philosophisch« nennen, sind das Ergebnis zweier Faktoren: überkommener religiöser und ethischer Vorstellungen und einer Forschungsweise, die man als »wissenschaftlich« im weitesten Sinne dieses Wortes bezeichnen kann. Die einzelnen Philosophen haben diesen beiden Faktoren in ihren Systemen stark unterschiedlichen Anteil eingeräumt, doch ist es für die Philosophie charakteristisch, daß bis zu einem gewissen Grade stets beide vorhanden sind.
»Philosophie« ist ein Wort, das in mannigfaltiger Weise verwendet worden ist, zuweilen umfassender, zuweilen enger begrenzt. Ich beabsichtige, es in sehr weitem Sinne zu gebrauchen, was zu erklären ich nun versuchen will.
Die Philosophie ist nach meiner Auffassung ein Mittelding zwischen Theologie und Wissenschaft. Gleich der Theologie besteht sie aus der Spekulation über Dinge, von denen sich bisher noch keine genaue Kenntnis gewinnen ließ; wie die Wissenschaft jedoch beruft sie sich weniger auf eine Autorität, etwa die der Tradition oder die der Offenbarung, als auf die menschliche Vernunft. Jede sichere Kenntnis, möchte ich sagen, gehört in das Gebiet der Wissenschaft; jedes Dogma in Fragen, die über die sichere Kenntnis hinausgehen, in das der Theologie. Zwischen der Theologie und der Wissenschaft liegt jedoch ein Niemandsland, das Angriffen von beiden Seiten ausgesetzt ist; dieses Niemandsland ist die Philosophie. Fast alle Fragen von größtem Interesse für spekulative Köpfe vermag die Wissenschaft nicht zu beantworten, und die zuversichtlichen Antworten der Theologen wirken nicht mehr so überzeugend wie in früheren Jahrhunderten. Besteht die Welt aus Geist und Materie, und wenn ja, was ist dann Geist und was Materie? Ist der Geist an die Materie gebunden, oder wird er von unabhängigen Kräften beherrscht? Liegt dem Universum etwas Einheitliches zugrunde? Wohnt ihm ein Zweck inne? Strebt es in seiner Entwicklung einem Ziel zu? Gibt es tatsächlich Naturgesetze, oder glauben wir nur dank der uns eingeborenen Ordnungsliebe daran? Ist der Mensch, wie die Astronomen meinen, nur eine Winzigkeit aus unreinem Kohlenstoff und Wasser, die ohnmächtig auf einem kleinen, unbedeutenden Planeten umherkriecht? Oder ist er das, was Hamlet in ihm sieht? Ist er vielleicht beides zugleich? Kann man ein edles oder ein minderwertiges Leben führen, oder ist es überhaupt belanglos, wie man lebt? Wenn es eine edle Lebensführung gibt, woraus besteht sie und wie können wir dazu kommen? Muß das Gute unvergänglich sein, um Wertschätzung zu verdienen, oder ist es erstrebenswert, selbst wenn das Universum sich unerbittlich seinem Untergange nähert? Gibt es so etwas wie Weisheit, oder ist das, was uns als Weisheit erscheint, nur letzte, höchste Torheit? Die Antwort auf derartige Fragen finden wir nicht im Laboratorium. Die Theologen haben behauptet, sie allesamt mehr als genau beantworten zu können; aber eben ihre Entschiedenheit veranlaßt moderne Köpfe, solche Antworten mißtrauisch zu betrachten. Die Untersuchung dieser Fragen, wenn schon nicht ihre Beantwortung, ist Sache der Philosophie.
Warum aber, wird der Leser vielleicht fragen, Zeit an derartige unlösbare Probleme verschwenden? Darauf kann man als Historiker antworten oder als Mensch, der sich in seinem entsetzlichen kosmischen Verlassensein sieht.
Was der Historiker darauf zu antworten hat, wird sich im Verlauf dieses Werkes zeigen, soweit ich eine solche Antwort zu geben vermag. Seit die Menschen fähig wurden, unabhängig zu denken, war ihr Handeln stets in zahllosen wichtigen Punkten durch ihre Welt- und Lebensanschauung, ihre Ansichten über Gut und Böse bedingt. Das gilt für die Gegenwart wie für die gesamte Vergangenheit. Um ein Zeitalter oder ein Volk verstehen zu können, müssen wir seine Philosophie verstehen, und um seine Philosophie zu begreifen, müssen wir selbst bis zu einem gewissen Grade Philosophen sein. Wir haben es hier mit einer wechselseitigen Ursächlichkeit zu tun: die Lebensumstände der Menschen bestimmen weitgehend ihre Philosophie, während umgekehrt auch ihre Philosophie in hohem Maße ihre Lebensumstände bedingt. Diese Wechselwirkung durch die Jahrhunderte zu verfolgen, ist das Thema der nächsten Seiten.
Es gibt jedoch auch eine persönliche Antwort. Durch die Wissenschaft erfahren wir, was wir wissen können, doch ist das nur wenig; wenn wir aber vergessen, wieviel wir nicht wissen können, werden wir unempfänglich für viele Dinge von sehr großer Bedeutung. Die Theologie andererseits vermittelt die dogmatische Überzeugung, daß wir wissen, wo wir in Wahrheit nicht wissen, und züchtet auf diese Weise so etwas wie eine unverschämte Anmaßung dem Universum gegenüber. Bei lebhaften Hoffnungen und Befürchtungen ist Ungewißheit qualvoll: sie muß jedoch ertragen werden, wenn wir ohne die Unterstützung tröstlicher Märchen leben wollen. Es tut weder gut, die von der Philosophie aufgeworfenen Fragen zu vergessen, noch uns selbst einzureden, wir hätten über jeden Zweifel erhabene Antworten darauf gefunden. Wie man ohne Gewißheit und doch auch ohne durch Unschlüssigkeit gelähmt zu werden, leben kann, das zu lehren ist vielleicht das Wichtigste, was die Philosophie heutzutage noch für diejenigen tun kann, die sich mit ihr beschäftigen.
Die Philosophie als eine von der Theologie unabhängige Disziplin hat ihren Ursprung im Griechenland des sechsten Jahrhunderts v. Chr. Nachdem sie sich in der Antike entwickelt hatte, ging sie wieder in der Theologie auf, als das Christentum entstand und Rom unterging. Ihre zweite große Epoche, vom elften bis zum vierzehnten Jahrhundert, stand unter der Herrschaft der katholischen Kirche, der sich nur einige große Rebellen, wie etwa Kaiser Friedrich II. (1195–1250), entzogen. Die Wirren, die in der Reformation gipfelten, führten zum Ende dieser Periode. Die dritte Epoche, vom siebzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart, wird stärker als alle früheren Epochen von der Wissenschaft beherrscht; traditionelle religiöse Überzeugungen behalten ihre Bedeutung, doch gewinnt man das Gefühl, sie bedürften der Rechtfertigung; und so werden sie umgewandelt, wann immer die Wissenschaft es zu gebieten scheint. Nur wenige Philosophen dieser Periode sind, vom katholischen Standpunkt aus gesehen, orthodox, und der weltliche Staat spielt in ihren Erwägungen eine wichtigere Rolle als die Kirche.
Wie Religion und Wissenschaft befinden sich während der ganzen Epoche die soziale Kohäsion und die individuelle Freiheit im Zustand des Konflikts oder eines unbefriedigenden Kompromisses. In Griechenland war der soziale Zusammenhalt durch Treue dem Stadtstaat gegenüber gewährleistet; selbst für Aristoteles gab es keine bessere Staatsform, obwohl Alexander gerade zu seiner Zeit den Stadtstaat außer Kurs setzte. Die Freiheit des einzelnen wurde durch seine Pflichten der Stadt gegenüber in unterschiedlichem Grade beschränkt. In Sparta besaß er so wenig Freiheit wie in Deutschland unter Hitler oder in Rußland; in Athen erfreuten sich die Bürger in der besten Zeit, trotz geleogentlicher Verfolgungen einer wahrhaft ungewöhnlichen Freiheit von staatlichen Beschränkungen. Bis zu Aristoteles wird das griechische Denken von religiöser und patriotischer Hingabe an die Stadt beherrscht; die ethischen Systeme sind auf die Lebensweise von Bürgern zugeschnitten und haben einen stark politischen Einschlag. Als die Griechen zuerst den Mazedoniern und dann den Römern untertan wurden, ließ sich mit den Begriffen aus den Tagen ihrer Unabhängigkeit nichts mehr anfangen. Daraus ergab sich einerseits durch den Bruch mit der Tradition eine Einbuße an Lebenskraft, andererseits eine individuellere und unsozialere Ethik. Die Stoiker sahen im tugendhaften Leben weniger eine Beziehung des Bürgers zum Staat als vielmehr eine Beziehung der Seele zu Gott. So bereiteten sie dem Christentum den Weg, das wie die Stoa ursprünglich unpolitisch war, weil seine Anhänger während der ersten drei Jahrhunderte keinen Einfluß auf die Regierung hatten. Während der sechseinhalb Jahrhunderte von Alexander bis Konstantin war der soziale Zusammenhalt weder durch die Philosophie noch auch durch die alte Loyalität gesichert, sondern durch Gewalt, zunächst durch Waffengewalt und dann durch gewaltsame Zivilverwaltung. Römische Legionen, römische Straßen, römische Gesetze und römische Beamte schufen zuerst einen mächtigen, zentralisierten Staat und hielten ihn dann aufrecht. Nichts davon ließ sich der römischen Philosophie zuschreiben, weil es keine gab.
Während dieses langen Zeitraums wandelten sich nach und nach die aus der Zeit der Freiheit überkommenen griechischen Vorstellungen. Manche alten Begriffe, vornehmlich diejenigen, die als spezifisch religiös gelten dürfen, gewannen an relativer Bedeutung; andere, rationalistischere, wurden verworfen, weil sie nicht mehr dem Geist der Zeit entsprachen. So stutzte das Spätheidentum die griechische Tradition zurecht, bis sie sich der christlichen Lehre einverleiben ließ.
Das Christentum machte eine wichtige Anschauung populär, die zwar bereits in den Lehren der Stoiker einbegriffen, im allgemeinen jedoch dem Geist der Antike fremd gewesen war – ich meine die Anschauung, daß der Mensch Gott gegenüber zwingendere Pflichten habe als gegen den Staat.1
Diese Auffassung, daß »wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen«, wie Sokrates und die Apostel sagten, überlebte die Bekehrung Konstantins, denn die frühen christlichen Kaiser waren Arianer oder neigten zum Arianismus. Als die Kaiser orthodox wurden, verlor sie ihre Bedeutung. Im byzantinischen Reich war sie latent vorhanden, desgleichen im späteren russischen Kaiserreich, das sein Christentum aus Konstantinopel herleitete.2 Im Westen jedoch, wo fast unverzüglich ketzerische, barbarische Eroberer an die Stelle der katholischen Kaiser traten (einige Teile Galliens ausgenommen), behaupteten die religiösen Pflichten ihre Vorrangstellung vor den politischen, und bis zu einem gewissen Grade verhält es sich noch heute so.
Der Einfall der Barbaren machte für sechs Jahrhunderte der westeuropäischen Kultur ein Ende. In Irland hielt sie sich noch eine Zeitlang, bis die Dänen sie im neunten Jahrhundert endgültig vernichteten; vor ihrem Erlöschen brachte sie noch eine bemerkenswerte Erscheinung hervor, Scotus Eriugena. Im östlichen Kaiserreich lebte die griechische Kultur mumifiziert wie in einem Museum bis zum Fall von Konstantinopel im Jahre 1453 fort; doch ging von Konstantinopel nichts von Bedeutung für die Welt aus, abgesehen von einer künstlerischen Tradition und Justinians Corpus Juris.
Während der dunklen Epoche vom Ende des fünften bis zur Mitte des elften Jahrhunderts machte die weströmische Welt einige sehr interessante Wandlungen durch. Der Konflikt zwischen der Pflicht gegen Gott und der Pflicht dem Staat gegenüber, den das Christentum hervorgerufen hatte, wuchs sich zu einem Konflikt zwischen Kirche und König aus. Die kirchliche Gerichtsbarkeit des Papstes erstreckte sich am Ende über Italien, Frankreich und Spanien, Großbritannien und Irland, Deutschland, Skandinavien und Polen. Anfangs war die Macht des Papstes über Bischöfe und Äbte außerhalb von Italien und Südfrankreich sehr unbedeutend; von der Zeit Gregors VII. (spätes elftes Jahrhundert) an trat sie jedoch fühlbar in Erscheinung. Seither bildete die Geistlichkeit in ganz Westeuropa eine einheitliche, von Rom aus geleitete Organisation, die klug und rücksichtslos nach Macht strebte und sich bis über das Jahr 1300 hinaus in ihren Streitigkeiten mit weltlichen Herrschern gewöhnlich siegreich durchsetzte. Der Konflikt zwischen Kirche und Staat war nicht allein ein Kampf zwischen dem Klerus und dem Laientum; in ihm lebte auch der alte Gegensatz zwischen der Mittelmeerwelt und den nordischen Barbaren wieder auf. Die Einheit der Kirche war der Einheit des römischen Reiches nachgebildet; die Kirche besaß eine lateinische Liturgie, und ihre führenden Männer waren meist Italiener, Spanier oder Südfranzosen. Sie hatten eine klassische Bildung, seit man auf Bildung wieder Wert legte; ihre Auffassung von Recht und Regierung wäre Marc Aurel weniger unverständlich gewesen als den Monarchen ihrer Epoche. In der Kirche verkörperten sich zugleich die ununterbrochene Tradition und die fortschrittlichste Kultur der Zeit.
Die weltliche Macht hingegen lag in den Händen von Königen und Baronen germanischer Abstammung, die sich nach Kräften bemühten, die Einrichtungen zu erhalten, die sie aus den germanischen Wäldern mitgebracht hatten. Absolute Macht war diesen Einrichtungen ebenso fremd wie Legalität, die diesen energischen Eroberern dumm und geistlos schien. Der König mußte seine Macht mit der Feudalaristokratie teilen, doch hielten sich alle gleichermaßen für berechtigt, sich gelegentliche Leidenschaftsausbrüche in Form von Krieg, Mord, Plünderung und Raub zu leisten. Die Monarchen konnten wohl Reue empfinden, denn sie waren aufrichtig fromm, und zudem war Reue ja auch eine Art von Leidenschaft. Doch gelang es der Kirche nicht, sie zu dem ruhigen, gleichmäßig guten Verhalten zu erziehen, wie es ein moderner Arbeitgeber in der Regel mit Erfolg von seinen Angestellten verlangt. Wozu die Welt erobern, wenn sie nicht nach Lust und Laune trinken, morden und lieben durften? Und warum sollten sie mit ihren stolzen Ritterheeren sich den Befehlen von Büchermenschen unterwerfen, die Keuschheit gelobt und keine bewaffnete Macht hinter sich hatten? Trotz kirchlicher Mißbilligung blieben sie bei ihren Zweikämpfen und Mutproben in der Schlacht und entwickelten das Turnier und die höfische Liebe. Gelegentlich kam es ihnen auch nicht darauf an, in einem Wutanfall hervorragende Geistliche umzubringen.
Die Könige verfügten über die gesamte bewaffnete Macht, und dennoch war die Kirche siegreich. Die Kirche siegte zum Teil, weil sie nahezu ein Monopol auf die Bildung besaß; zum Teil, weil die Könige unaufhörlich miteinander im Krieg lagen, hauptsächlich jedoch, weil Herrscher und Volk, mit sehr geringen Ausnahmen, tief davon durchdrungen waren, daß die Kirche die himmlische Schlüsselgewalt besaß. Die Kirche konnte entscheiden, ob ein König die Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle zu verbringen hätte; die Kirche vermochte die Menschen ihrer Untertanenpflichten zu entbinden und dadurch jede Auflehnung zu unterstützen. Überdies vertrat die Kirche die Ordnung im Gegensatz zur Anarchie und gewann infolgedessen den aufstrebenden Kaufmannsstand für sich. Besonders in Italien war dieser letzte Gesichtspunkt entscheidend.
Der germanische Versuch, zumindest teilweise die Unabhängigkeit von der Kirche zu wahren, kam nicht allein in der Politik, sondern auch in der Kunst, in der Dichtung, im Rittertum und im Krieg zum Ausdruck. In der Gedankenwelt trat er kaum in Erscheinung, da die Bildung fast ausschließlich auf die Geistlichkeit beschränkt blieb. Die eigentliche Philosophie des Mittelalters ist kein klares Spiegelbild der gesamten Zeit, vielmehr nur der Anschauungen einer Partei. Unter den Geistlichen jedoch – vornehmlich unter den Franziskaner-Mönchen – gab es eine ganze Anzahl, die aus verschiedenen Gründen in Widerspruch zum Papst standen. In Italien dehnte sich außerdem die Kultur einige Jahrhunderte eher als nördlich der Alpen auf das Laientum aus. Friedrich II., der eine neue Religion schaffen wollte, repräsentiert die extrem antipäpstliche Kultur; Thomas von Aquino, der im Königreich Neapel geboren wurde, wo Friedrich II. herrschte, ist hingegen bis heute der klassische Vertreter der päpstlichen Philosophie geblieben. Dante vollzog einige fünfzig Jahre später die Synthese und schenkte uns die einzige ausgewogene Darstellung der gesamten mittelalterlichen Gedankenwelt.
Nach Dante brach aus politischen wie intellektuellen Gründen die mittelalterliche philosophische Synthese zusammen. Sie hatte sich, solange sie gültig war, durch eine gewisse Sauberkeit und Vollkommenkeit im kleinen ausgezeichnet; was immer das System berücksichtigte, wurde peinlich genau in Beziehung zu dem übrigen Inhalt seines sehr begrenzten Kosmos eingeordnet. Die große Kirchenspaltung jedoch, die Konzil-Bewegung und das Papsttum der Renaissance leiteten zur Reformation über. Sie zerstörte die Einheit des Christentums und die scholastische Herrschaftstheorie, in deren Mittelpunkt der Papst stand. Während der Renaissance gewannen die Menschen neue Erkenntnisse über die Antike und die Erdoberfläche und wurden der Systeme überdrüssig, in denen sie sich nun geistig eingekerkert fühlten. Kopernikus wies mit seiner Astronomie der Erde und dem Menschen eine bescheidenere Stellung zu, als sie nach der ptolemäischen Theorie eingenommen hatten. Freude an neuen Tatsachen trat bei gescheiten Menschen an die Stelle der Freude am Folgern, Analysieren und Systematisieren. Obwohl die Renaissance in der Kunst das Gesetzmäßige beibehielt, bevorzugte sie im Denken eine große, fruchtbare Gesetzlosigkeit. Hierin ist Montaigne der typischste Exponent seiner Zeit.
In der politischen Theorie brach, wie auf allen Gebieten mit Ausnahme der Kunst, das Prinzip des Gesetzmäßigen zusammen. Das Mittelalter war, obwohl so turbulent in seinen äußeren Erscheinungsformen, in seinem Denken doch von leidenschaftlicher Liebe zur Legalität und von einer sehr präzisen Theorie der politischen Macht beherrscht. Alle Macht kommt letztlich von Gott, er hat dem Papst für geistliche und dem Kaiser für weltliche Angelegenheiten Macht übertragen. Doch büßten Papst und Kaiser gleichermaßen während des fünfzehnten Jahrhunderts ihre Bedeutung ein. Der Papst war nur mehr einer der vielen italienischen Fürsten, die in das unglaublich komplizierte und bedenkenlose Spiel der italienischen Machtpolitik verstrickt waren. Die neuen nationalen Monarchien in Frankreich, Spanien und England besaßen in ihren Gebieten eine Macht, auf die weder Papst noch Kaiser störend einzuwirken vermochten. Der Nationalstaat gewann, großenteils dank dem Schießpulver, auf das Denken und Fühlen der Menschen einen zuvor unerreichten Einfluß, der allmählich zerstörte, was noch von dem römischen Glauben an die Einheit der Kultur übrig war.
Diese politische Ungesetzlichkeit fand Ausdruck in Machiavellis Principe. Da jeder leitende Grundsatz fehlte, wurde die Politik zum unverhüllten Kampf um die Macht; Il Principe erteilt raffinierte Ratschläge, wie dieses Spiel erfolgreich zu spielen ist. Was sich in Griechenlands großer Zeit zugetragen hatte, begab sich aufs neue im Italien der Renaissance: herkömmliche moralische Bande lösten sich auf, weil sie mit Aberglauben verbunden schienen; die Befreiung von diesen Fesseln verlieh einzelnen Kraft und Schöpfertum und führte zu einem seltenen Aufblühen des Genialen; durch Anarchie und Verrat jedoch, die unvermeidlichen Folgen des moralischen Verfalls, büßten die Italiener im ganzen ihre Kraft ein; wie die Griechen gerieten sie in die Abhängigkeit von Völkern, die weniger kultiviert waren als sie selbst, dafür aber stärkeren sozialen Zusammenhalt besaßen.
Das Ergebnis war jedoch weniger verheerend als bei den Griechen, denn die neuen, mächtigen Völker erwiesen sich, mit Ausnahme der Spanier, als ebenso fähig zu großen Leistungen, wie es die Italiener gewesen waren.
Vom sechzehnten Jahrhundert an steht die Geschichte des europäischen Denkens im Zeichen der Reformation. Die Reformation war eine mannigfaltig zusammengesetzte Bewegung und verdankte ihren Erfolg einer ganzen Reihe von verschiedenen Ursachen. In erster Linie war sie eine Revolte der nordischen Völker gegen eine erneute Herrschaft Roms. Die Religion war die Macht gewesen, die den Norden bezwungen hatte, doch war sie in Italien in Verfall geraten; zwar hatte sich das Papsttum als Institution erhalten und zog ungeheuren Tribut aus Deutschland und England; obwohl diese Nationen noch fromm waren, vermochten sie doch keine Verehrung für die Borgia und Medici zu empfinden, die vermeintliche Seelenrettung vor dem Fegefeuer gegen Geld betrieben, das sie in Luxus und Sittenlosigkeit verschwendeten. Zu den nationalen traten wirtschaftliche und moralische Motive und vertieften gemeinsam die Empörung gegen Rom. Überdies erkannten die Fürsten bald, daß sie die Kirche beherrschen könnten, wenn sie in ihren Gebieten reine Landeskirchen daraus machten. Sie würden so in ihrem Bereich weit mächtiger werden, als sie es waren, solange sie sich mit dem Papst in die Herrschaft teilen mußten. Aus all diesen Gründen wurden Luthers theologische Neuerungen im überwiegenden Teil Nordeuropas von Herrschern und Völkern gleichermaßen begrüßt.
Die katholische Kirche wurde aus drei verschiedenen Quellen gespeist. Ihre heilige Geschichte war jüdisch, ihre Theologie griechisch, ihre Verfassung und ihr kanonisches Recht waren zumindest mittelbar römisch. Die Reformation verwarf die römischen Elemente, milderte die griechischen ab und betonte stark die jüdischen. So arbeitete sie Hand in Hand mit den nationalistischen Kräften, die im Begriff waren, das zunächst vom römischen Reich und dann von der römischen Kirche vollbrachte Werk des sozialen Zusammenhalts zu vernichten. Nach der katholischen Lehre endete die göttliche Offenbarung nicht mit der Heiligen Schrift; sie wird vielmehr weiterhin von Epoche zu Epoche durch die Kirche vermittelt, so daß es also Pflicht des einzelnen war, ihr seine Privatansichten unterzuordnen. Die Protestanten hingegen lehnten es ab, in der Kirche das Medium von Offenbarungen zu sehen; es galt, die Wahrheit allein in der Bibel zu suchen, die sich jeder selbst auslegen konnte. Wichen die Deutungen der Menschen voneinander ab, so gab es keine von Gott eingesetzte Autorität, um den Streit zu entscheiden. Praktisch beanspruchte nun der Staat das Recht, das zuvor der Kirche gehört hatte; das jedoch war unrechtmäßige Anmaßung. Nach der protestantischen Theorie sollte es keinen irdischen Vermittler zwischen Seele und Gott geben.
Dieser Wandel hatte folgenschwere Auswirkungen. Die Wahrheit wurde nicht mehr durch Befragen einer Autorität, sondern durch Meditation ermittelt. Rasch entwickelte sich daher in der Politik der Hang zum Anarchismus, in der Religion die Neigung zum Mystizismus, den in den Rahmen der katholischen Orthodoxie einzufügen stets schwierig gewesen war. So kam es, daß es schließlich nicht einen Protestantismus, sondern eine Vielzahl von Sekten gab; nicht eine Philosophie im Kampf gegen die Scholastik, sondern so viele Philosophien wie Philosophen; nicht wie im dreizehnten Jahrhundert einen Kaiser als Gegenspieler des Papstes, sondern zahlreiche ketzerische Könige. Daraus ergab sich im Denken wie in der Literatur ein fortgesetzt sich vertiefender Subjektivismus; er wurde anfangs als heilsame Befreiung von geistiger Sklaverei empfunden, entwickelte sich aber immer mehr zu einer Isolierung des einzelnen, die jede geistig gesunde Gemeinschaft schädigt.
Die moderne Philosophie beginnt mit Descartes; er baut auf der sicheren Erkenntnis seiner selbst und seines Denkens auf, woraus die äußere Welt abzuleiten ist. Von diesem Ausgangspunkt führte die Entwicklung über Berkeley und Kant zu Fichte, dem alles nur eine Ausstrahlung des Ichs ist. Das war Wahnsinn, und seither versuchte die Philosophie ständig, sich aus diesem Extrem in die Alltagswelt des gesunden Menschenverstandes hinüberzuretten.
Mit dem philosophischen Subjektivismus geht der politische Anarchismus Hand in Hand. Schon zu Luthers Lebzeiten hatten unerwünschte und von ihm nicht anerkannte Anhänger die Lehre der Wiedertaufe entwickelt, die eine Zeitlang die Stadt Münster beherrschte. Die Wiedertäufer lehnten jedes Gesetz ab in der Überzeugung, der gute Mensch werde allezeit vom Heiligen Geist geleitet, der sich nicht in Formeln zwängen läßt. Von dieser Voraussetzung aus kamen sie zum Kommunismus und zur Weibergemeinschaft; sie wurden daher nach heldenhaftem Widerstand ausgerottet. Ihre Lehre jedoch breitete sich in gemilderter Form über Holland, England und Amerika aus; historisch gesehen ist sie die Quelle des Quäkertums. Eine ungestümere Art von Anarchismus, die mit Religion nichts mehr zu tun hatte, entstand im neunzehnten Jahrhundert. In Rußland, in Spanien und in geringerem Ausmaß auch in Italien hatte sie beachtlichen Erfolg und ist noch heute das Schreckgespenst der amerikanischen Einwanderungsbehörden. In dieser modernen, wenngleich antireligiösen Form lebt noch viel vom Geist des ursprünglichen Protestantismus; der Unterschied liegt hauptsächlich darin, daß die Feindseligkeit, die sich bei Luther gegen die Päpste richtete, sich hier gegen die weltlichen Regierungen kehrt.
Die einmal entfesselte Subjektivität ließ sich nicht eindämmen, bevor sie nicht ihren Lauf genommen hatte. Auf die Moral hatte der emphatische protestantische Glaube an das individuelle Gewissen einen hochgradig anarchistischen Einfluß. Gewohnheit und Brauch wirkten zwar so stark fort, daß, von gelegentlichen Ausbrüchen wie in Münster abgesehen, die Jünger des ethischen Individualismus weiterhin so handelten, wie es den herkömmlichen Tugendbegriffen entsprach. Doch war dieser Gleichgewichtszustand stark gefährdet. Dem Kult, den das achtzehnte Jahrhundert mit der »Empfindsamkeit« trieb, konnte er nicht mehr standhalten: eine Tat wurde nicht wegen ihrer guten Auswirkungen oder wegen ihrer Übereinstimmung mit einem Moralgesetz bewundert, sondern um der Empfindung willen, der sie entsprungen war. Aus dieser Einstellung entwickelten sich die Heldenverehrung, wie sie bei Carlyle und Nietzsche Ausdruck fand, und der byronsche Kult mit der glühenden Leidenschaft jedweder Art.
Die romantische Bewegung in der Kunst, in der Literatur und in der Politik hängt eng zusammen mit dieser subjektiven Einstellung, die Menschen nicht als Mitglieder einer Gemeinschaft, sondern als ästhetisch erfreuliche Objekte der Kontemplation zu beurteilen. Tiger sind zwar schöner als Schafe, doch sehen wir sie lieber hinter Gittern. Der typische Romantiker jedoch beseitigt das Gitter und freut sich an den großartigen Sprüngen des Tigers, der das Schaf reißt. Er ermutigt die Menschen, sich als Tiger zu fühlen, und wenn es ihm gelingt, sind die Ergebnisse nicht durchaus vergnüglich.
Die schon eher als Irrsinn zu bezeichnenden Formen des Subjektivismus riefen in modernen Zeiten verschiedene Gegenströmungen hervor. Zunächst suchte eine Philosophie auf dem Mittelweg, durch die Doktrin des Liberalismus, eine Kompromißlösung, indem sie den Bereich der Regierung und die Sphäre des Einzelmenschen gegeneinander abgrenzte. Wir finden das in seiner neuzeitlichen Form zuerst bei Locke, der ein ebenso scharfer Gegner der »Schwärmerei« – des Individualismus der Wiedertäufer – wie der absoluten Autorität und der blinden Unterwürfigkeit gegenüber der Tradition ist. Aus tiefergehender Auflehnung entstand die Lehre von der Verherrlichung des Staates; sie billigte dem Staat die Stellung zu, die der Katholizismus der Kirche oder zuweilen sogar Gott einräumte. Hobbes, Rousseau und Hegel vertreten verschiedene Phasen dieser Theorie, ihre Doktrinen finden in Cromwell, Napoleon und im modernen Deutschland praktische Verkörperung. Theoretisch ist der Kommunismus weit entfernt von solchen Anschauungen; in der Praxis ist er jedoch in eine Gesellschaftsform hineingetrieben worden, die denen stark ähnelt, welche sich aus der Verherrlichung des Staates ergeben.
Während dieser ganzen, langen Entwicklung, von 600 v. Chr. bis zum heutigen Tage, unterschied man bei den Philosophen zwei Richtungen: die einen erstrebten festere soziale Bande, und die anderen wünschten sie zu lockern. Damit hingen noch andere Unterschiede zusammen. Die Disziplinarier setzten sich für irgendein altes oder neues System ein und waren daher notgedrungen in stärkerem oder schwächerem Maße der Wissenschaft feind, da sich ihre Dogmen empirisch nicht beweisen ließen. Fast übereinstimmend haben sie gelehrt, nicht das Glück sei das erstrebenswerte Gut, vorzuziehen seien vielmehr »Adel« oder »Heroismus«. Sie sympathisierten mit allem Irrationalen in der menschlichen Natur, weil sie ihre feindliche Einstellung dem sozialen Zusammenhalt gegenüber für begründet hielten. Die Verfechter der Willensfreiheit neigten andererseits mit Ausnahme der extremen Anarchisten zu einer wissenschaftlichen, nützlichkeitsbetonten, rationalistischen, leidenschaftsfeindlichen und allen ernsteren Religionsformen abgekehrten Einstellung. Dieser Gegensatz bestand in Griechenland bereits vor dem Aufkommen dessen, was wir als Philosophie erkennen, und kommt schon im griechischen Denken der frühesten Zeit klar zum Ausdruck. In wechselnder Gestalt hat er sich bis zum heutigen Tage erhalten und wird zweifellos noch lange weiterbestehen.
Natürlich hat in diesem Streitfall – wie in allen, auf lange Zeiträume ausgedehnten Kämpfen – jede Partei teils recht und teils unrecht. Soziale Kohäsion ist eine Notwendigkeit, und es ist der Menschheit noch nie gelungen, Zusammenhalt auf rein rationalem Wege zu erzwingen. Jeder Staat ist zwei gegensätzlichen Gefahren ausgesetzt: der Verknöcherung durch zuviel Disziplin und Ehrfurcht vor der Tradition einerseits; andererseits der Auflösung oder Niederlage durch Eroberung von außen, weil zunehmender Individualismus und wachsende persönliche Unabhängigkeit jede Zusammenarbeit unmöglich machen. Im allgemeinen setzen bedeutende Kulturen mit einem strengen, abergläubischen System ein, das sich allmählich lockert und in einem gewissen Stadium zu einer Periode höchster Genialität führt, während das Gute in der alten Tradition fortwirkt und das Schlechte, das der beginnenden Auflösung innewohnt, sich noch nicht entfaltet hat. Sobald das Schlechte jedoch zutage tritt, führt es zur Anarchie und damit unweigerlich zu neuer Tyrannis, die, gestützt auf ein neues dogmatisches System, eine neue Synthese vollzieht. Die Doktrin des Liberalismus ist ein Versuch, sich von dieser dauernden Pendelbewegung freizumachen. Der Liberalismus bemüht sich im wesentlichen, eine soziale Ordnung zu sichern, die nicht auf einem irrationalen Dogma aufbaut, und eine Stabilität mit dem Minimum an Zwang zu gewährleisten, der zur Erhaltung des Staates erforderlich ist. Ob dieser Versuch erfolgreich sein wird, kann nur die Zukunft lehren.
1Diese Ansicht war auch in früheren Zeiten nicht unbekannt; sie ist beispielsweise in der Antigone von Sophokles ausgesprochen. Vor den Stoikern hatte sie jedoch nur wenig Anhänger.
2Daher glauben die modernen Russen nicht, daß man dem dialektischen Materialismus eher gehorchen müsse als Stalin.
ERSTES BUCH
Die Philosophie der Antike
I. TEIL
Die Vorsokratiker
1. KAPITEL
Der Aufschwung der griechischen Kultur
In der ganzen Weltgeschichte ist nichts so überraschend oder so schwer erklärlich wie das plötzliche Aufblühen der Kultur in Griechenland. Vieles, was zum Begriff der Kultur gehört, hatte es schon Jahrtausende zuvor in Ägypten und Mesopotamien gegeben; seither hatte es sich in den benachbarten Ländern ausgebreitet. Aber gewisse, bislang fehlende Elemente trugen erst die Griechen dazu bei. Was sie im Reich der Kunst und Literatur geschaffen haben, ist allgemein bekannt; was sie jedoch auf dem Gebiet des reinen Denkens leisteten, ist ganz einzigartig. Sie erfanden die Mathematik1, die Naturwissenschaft und die Philosophie; sie schrieben zum erstenmal Geschichte anstelle bloßer Annalen; frei von überkommenen orthodoxen Anschauungen stellten sie Betrachtungen an über das Wesen der Welt und den Sinn des Lebens. Das Ergebnis war so verblüffend, daß sich die Menschen bis in die jüngste Zeit hinein damit begnügten, zu staunen und sich in mystischen Reden über den griechischen Genius zu ergehen. Es ist jedoch möglich, die Entwicklung Griechenlands in wissenschaftlichen Begriffen zu verstehen, und überdies ist es durchaus der Mühe wert.
Die Philosophie beginnt mit Thales; er ist glücklicherweise zeitlich zu bestimmen, weil er eine Mondfinsternis voraussagte, die nach Angabe der Astronomen in das Jahr 585 v. Chr. fiel. Philosophie und Wissenschaft – ursprünglich nicht voneinander getrennt – entstanden demnach gemeinsam zu Beginn des sechsten Jahrhunderts. Was hatte sich in Griechenland und den angrenzenden Ländern vor diesem Zeitpunkt zugetragen? Jede Antwort wird sich zumindest teilweise auf Mutmaßungen stützen; dank der Archäologie wissen wir jedoch im gegenwärtigen Jahrhundert bedeutend mehr davon als unsere Großväter.
Die Schreibkunst wurde in Ägypten um das Jahr 4000 v. Chr., in Mesopotamien wenig später erfunden. In beiden Ländern begann man zu schreiben, indem man bildlich darstellte, was es auszudrücken galt. Diese Zeichen wurden bald so gebräuchlich, daß Worte durch Ideogramme wiedergegeben wurden, wie es heute noch in China geschieht. Im Laufe von Jahrtausenden entwickelte sich dieses schwerfällige System zur alphabetischen Schrift.
Ägypten und Mesopotamien verdankten die frühe Entfaltung ihrer Kultur dem Nil, dem Tigris und Euphrat, die den Ackerbau sehr erleichterten und ertragreich machten. Die Kultur ähnelte in vieler Hinsicht der, welche die Spanier in Mexiko und Peru vorfanden. Da gab es einen göttlichen, mit despotischen Machtbefugnissen ausgestatteten König; in Ägypten gehörte ihm das ganze Land. Es gab eine polytheistische Religion mit einem höchsten Gott, zu dem der König in besonders enger Beziehung stand. Es gab eine Militär-Aristokratie und daneben eine Priester-Aristokratie. Diese Kaste maßte sich oftmals Eingriffe in die Rechte des Königs an, wenn der König schwach oder in einen schwierigen Krieg verwickelt war. Der Boden wurde von Sklaven bearbeitet, die Leibeigene des Königs, der Aristokratie oder der Priesterschaft waren.
Zwischen der ägyptischen und der babylonischen Religion bestand ein beachtlicher Unterschied. Bei den Ägyptern spielte der Tod eine ganz besondere Rolle; sie glaubten, die Seelen der Verstorbenen stiegen hinab in die Unterwelt, wo sie entsprechend ihrem Lebenswandel auf Erden von Osiris gerichtet wurden. Sie meinten, die Seele kehre schließlich zum Körper zurück; das führte zur Einbalsamierung und zum Bau der großartigen Grabmäler. Die Pyramiden wurden gegen Ende des vierten und zu Beginn des dritten Jahrtausends v. Chr. von verschiedenen Königen errichtet. Danach erstarrte die ägyptische Kultur mehr und mehr, und der religiöse Konservatismus verhinderte jeden Fortschritt. Um 1800 v. Chr. wurde Ägypten von den semitischen Hyksos erobert, die das Land etwa zweihundert Jahre lang beherrschten. Sie hinterließen keine bleibenden Spuren in Ägypten, ihre Anwesenheit muß jedoch dazu beigetragen haben, daß sich die ägyptische Kultur in Syrien und Palästina ausbreitete.
Babylonien hatte eine kriegerischere Entwicklung als Ägypten. Zunächst wurde es nicht von Semiten, sondern von den »Sumerern« beherrscht, deren Ursprung unbekannt ist. Sie erfanden die Keilschrift, die die semitischen Eroberer von ihnen übernahmen. Eine Zeitlang gab es verschiedene unabhängige Städte, die einander bekämpften; schließlich gewann jedoch Babylon die Oberhand und gründete ein Reich. Die Götter anderer Städte wurden untergeordnet, und Marduk, der Gott Babylons, errang eine Stellung, wie sie später Zeus im griechischen Pantheon einnahm. Das gleiche hatte sich in Ägypten abgespielt, jedoch weit früher.
Die ägyptische und die babylonische Religion waren wie andere antike Religionen ursprünglich Fruchtbarkeitskulte. Die Erde war weiblich, die Sonne männlich. Der Stier galt gewöhnlich als Verkörperung männlicher Fruchtbarkeit, und Stiergötter gab es allenthalben. In Babylon nahm Ishtar, die Erdgöttin, die Vorrangstellung unter den weiblichen Gottheiten ein. In ganz Westasien wurde die Große Mutter unter verschiedenen Namen angebetet. Als griechische Kolonisten in Kleinasien ihr geweihte Tempel vorfanden, nannten sie sie Artemis und übernahmen den bestehenden Kult. Das ist der Ursprung der »Diana der Epheser«.2 Das Christentum verwandelte sie in die Jungfrau Maria, und auf einem Konzil zu Ephesus wurde für sie die Bezeichnung »Mutter Gottes« rechtmäßig eingeführt.
Überall da, wo eine Religion eng mit der Regierung eines Reiches verbunden war, trugen politische Motive viel dazu bei, ihre ursprünglichen Züge zu verwandeln. Der Staat bekam seinen Gott oder seine Göttin; diese Gottheit hatte nicht nur für eine üppige Ernte, sondern auch im Kriegsfalle für den Sieg zu sorgen. Eine reiche Priesterkaste arbeitete das Ritual und die religiösen Lehren aus und vereinte die verschiedenen Gottheiten der einzelnen Teile des Reiches in einem Pantheon.
Da die Regierung so eng mit den Göttern verbunden war, ergaben sich daraus auch Beziehungen zwischen den Gottheiten und der Moral. Ein Gott schenkte dem Gesetzgeber den Kodex; daher wurde jeder Rechtsbruch zur Sünde gegen Gott. Das älteste, bislang bekannte Gesetzbuch ist das des Königs Hammurabi von Babylon, um 2100 v. Chr.; dieses Gesetzbuch, so versicherte der König, sei ihm von Marduk übergeben worden. Die Beziehung zwischen Religion und Moral wurde im Verlauf der Antike beständig enger.
Im Gegensatz zur ägyptischen Religion beschäftigte sich die babylonische mehr mit der Wohlfahrt auf dieser Welt als mit der Glückseligkeit in der nächsten. Magie, Weissagung und Astrologie waren nicht spezifisch babylonisch, jedoch in Babylon stärker entwickelt als anderwärts; ihren Einfluß auf die spätere Antike verdankten sie vornehmlich Babylon. Aus diesem Reich stammt auch einiges, das ins wissenschaftliche Gebiet gehört; die Einteilung des Tages in vierundzwanzig Stunden und des Kreises in 360 Grad; desgleichen die Entdeckung gewisser Zyklen bei Gestirnsverfinsterungen, so daß man imstande war, Mondfinsternisse mit Sicherheit und Sonnenfinsternisse mit gewisser Wahrscheinlichkeit vorauszusagen. Diese babylonischen Kenntnisse hatte sich, wie wir sehen werden, Thales zu eigen gemacht.
Ägypten und Mesopotamien hatten eine bäuerliche, die Nachbarstaaten zunächst eine Hirten-Kultur. Ein neues Element kam mit der Entwicklung des Handels hinzu, der anfänglich fast ganz auf dem Seewege betrieben wurde. Bis etwa 1000 v. Chr. fertigte man die Waffen aus Bronze an, und Völker, die das notwendige Metall nicht selbst besaßen, mußten es sich durch Handel oder Piraterie verschaffen. Die Piraterie war aber nur ein vorübergehender Notbehelf; bei einigermaßen beständigen sozialen und politischen Umständen erwies sich der Handel als vorteilhafter. Bahnbrechend im Handel scheint die Insel Kreta gewesen zu sein. Annähernd elfhundert Jahre lang, etwa von 2500 bis 1400 v. Chr., gab es auf Kreta eine künstlerisch hochstehende Kultur, die minoische. Was sich von kretischer Kultur erhalten hat, vermittelt den Eindruck von Heiterkeit und von fast dekadentem Luxus, der sich stark von dem erschreckenden Düster der ägyptischen Tempel unterscheidet.
Bis zu den Ausgrabungen von Sir Arthur Evans und anderen war von dieser bedeutenden Kultur fast nichts bekannt. Es war die Kultur eines Seevolkes, das in enger Verbindung mit Ägypten stand (allerdings nicht zur Zeit der Hyksos). Aus ägyptischen Darstellungen geht klar hervor, daß der sehr beachtliche Handel zwischen Ägypten und Kreta in Händen von kretischen Seeleuten lag; er erreichte um 1500 v. Chr. seinen Höhepunkt. Die kretische Religion scheint eine gewisse Verwandtschaft mit den Religionen Syriens und Kleinasiens gehabt zu haben; in der Kunst jedoch bestand eine stärkere Anlehnung an Ägypten, obwohl die kretische Kunst sehr ursprünglich und erstaunlich lebensvoll war. Mittelpunkt der kretischen Kultur war der sogenannte »Palast des Minos« auf Knossos; Erinnerungen daran leben in den Sagen des klassischen Griechenlands fort. Die Paläste auf Kreta waren sehr prächtig, wurden aber gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts v. Chr. zerstört, vermutlich durch einfallende Griechen. Man errechnet die Daten der kretischen Geschichte aus ägyptischen Funden auf Kreta und aus kretischen Funden in Ägypten; wir sind mit unserem Wissen ausschließlich auf archäologische Beweisstücke angewiesen.
Die Kreter verehrten eine Göttin, vielleicht auch mehrere Göttinnen. Man kann kaum daran zweifeln, daß es die »Herrin der Tiere«, eine Jägerin, gab, wahrscheinlich die Urform der klassischen Artemis.3 Offenbar war sie auch Mutter; die einzige männliche Gottheit ist neben dem »Herrn der Tiere« ihr kleiner Sohn. Es spricht einiges für den Glauben an ein Leben im Jenseits, wo, wie in der ägyptischen Religion, die irdischen Taten belohnt oder bestraft werden. Nach ihrer Kunst zu urteilen, scheinen die Kreter jedenfalls im großen und ganzen ein heiteres, von düsterem Aberglauben nicht allzu beschwertes Volk gewesen zu sein. Sie liebten Stiergefechte, wobei weibliche und männliche Toreadore erstaunliche akrobatische Kunststücke vollbrachten. Nach Sir Arthur Evans’ Ansicht waren die Stierkämpfe religiöse Schauspiele und die Darsteller Mitglieder des höchsten Adels, doch wird diese Auffassung nicht allgemein anerkannt. Die uns erhaltenen Bilder sind sehr lebendig und realistisch.
Die Kreter hatten eine Linearschrift, die jedoch nicht entziffert werden konnte. Daheim waren sie friedliebende Leute, ihre Städte waren nicht durch Wälle befestigt; zweifellos hatten sie auch eine Seemacht zu ihrem Schutz.
Vor ihrer Zerstörung breitete sich die minoische Kultur, um 1600 v. Chr., über das griechische Festland aus, wo sie sich in verschiedenen, allmählichen Abwandlungen bis etwa 900 v. Chr. erhielt. Diese Festlandkultur wird die mykenische genannt; sie ist bekannt durch die Königsgräber und Befestigungen auf Berggipfeln; offenbar hatte man hier mehr Furcht vor dem Krieg als auf Kreta. Gräber und Befestigungen, die erhalten blieben, wirkten noch auf die Phantasie des klassischen Griechenlands ein. Die älteren Kunsterzeugnisse in den Palästen sind entweder echte kretische Arbeit oder der kretischen nahe verwandt. Was uns Homer schildert, ist durch den Schleier der Legende gesehene mykenische Kultur.
Über die Mykener herrscht noch viel Unklarheit. Verdankten sie ihre Kultur der Unterwerfung durch die Kreter? Sprachen sie Griechisch oder waren sie eine ältere, bodenständige Rasse? Diese Fragen genau zu beantworten ist unmöglich; doch darf man als wahrscheinlich annehmen, daß sie Griechisch sprechende Eroberer waren, und daß zumindest die Aristokratie aus blonden Eindringlingen aus dem Norden bestand, die die griechische Sprache mitbrachten.4
Die Griechen kamen in drei aufeinanderfolgenden Wellen nach Griechenland, zuerst die Jonier, dann die Achäer und zuletzt die Dorer. Die Jonier scheinen, obwohl sie als Eroberer kamen, die kretische Kultur nahezu vollständig übernommen zu haben, wie später die Römer die griechische Kultur übernahmen. Doch wurden die Jonier von ihren Nachfolgern, den Achäern, gestört und weitgehend enteignet. Von den Achäern weiß man durch die hethitischen Tafeln, die in Bogastköi gefunden wurden, daß sie im vierzehnten Jahrhundert v. Chr. ein großes, organisiertes Reich besessen haben. Die mykenische Kultur, die schon durch die Kriege der Jonier und Achäer gelitten hatte, war schließlich durch die Dorer zerstört worden, die als letzte Griechenland eroberten. Während die früheren Eindringlinge meist die minoische Religion angenommen hatten, behielten die Dorer den ursprünglichen indo-europäischen Glauben ihrer Vorfahren bei. Die Religion der mykenischen Zeit aber lebte noch, vor allem in den unteren Schichten, schwach fort, und die Religion des klassischen Griechenlands war eine Mischung von beiden. Einige klassische Göttinnen sind tatsächlich mykenischen Ursprungs.
Obwohl die obige Darstellung wahrscheinlich klingt, muß doch daran erinnert werden, daß wir nicht wissen, ob die Mykener Griechen waren oder nicht. Wir wissen nur, daß ihre Kultur verfiel, daß etwa zur Zeit ihres Erlöschens das Eisen die Bronze verdrängte und daß für eine Weile die Vorherrschaft zur See auf die Phönizier überging.
Gegen Ende der Mykene-Zeit wie auch später wurden einige der Eindringlinge als Bauern seßhaft, andere drangen weiter vor, zunächst auf die Inseln und nach Kleinasien, dann nach Sizilien und Süditalien, wo sie Städte gründeten, die vom Handel zur See lebten. Gerade in diesen Küstenstädten begannen die Griechen etwas qualitativ Neues zur Kultur beizutragen; Athen errang sich erst später seine Vorrangstellung, die dann ebenfalls mit seiner Seegeltung zusammenhing.
Das griechische Festland ist gebirgig und großenteils unfruchtbar. Es gibt jedoch viele fruchtbare Täler mit bequemem Zugang zur See, die Berge verhindern jedoch den leichten Verkehr zu Lande. In diesen Tälern entstanden kleine, abgeschlossene Gemeinschaften, die von der Landwirtschaft lebten und sich um eine Stadt scharten, die gewöhnlich nahe der Küste lag. Wer auf dem Lande kein Auskommen mehr fand, weil die Bevölkerung einer Gemeinschaft im Verhältnis zu ihren inneren Versorgungsquellen zu stark angewachsen war, mußte sich natürlich unter solchen Umständen auf die Seefahrt verlegen. Die Städte des Festlandes gründeten oftmals Kolonien an Stellen, wo sich der Lebensunterhalt weit leichter verdienen ließ als daheim. So waren die Griechen in den frühesten Geschichtsperioden in Kleinasien, Sizilien und Italien viel reicher als die Griechen auf dem Festland.
Die Gesellschaftsordnungen wichen in den verschiedenen Teilen Griechenlands stark voneinander ab. In Sparta lebte eine kleine Schicht, die Aristokratie, von der Arbeit unterdrückter Leibeigener aus anderen Stämmen; in den ärmeren landwirtschaftlichen Gebieten bestand die Bevölkerung hauptsächlich aus Bauern, die mit Hilfe ihrer Familien eigenes Land bestellten. Wo aber Handel und Industrie blühten, wurden die freien Bürger reich, weil sie Sklaven arbeiten ließen – die Männer in den Gruben, die Frauen in der Textilindustrie. In Jonien stammten diese Sklaven aus den barbarischen Nachbarländern; man setzte sich in der Regel zunächst auf kriegerischem Wege in ihren Besitz. Zugleich mit dem zunehmenden Wohlstand wuchs auch die Isolierung der angesehenen Frauen, die in späterer Zeit, außer in Sparta und Lesbos, wenig Anteil am griechischen Kulturleben hatten.
Ganz allgemein verlief die Entwicklung so, daß zunächst auf die Monarchie die Aristokratie folgte; dann lösten Tyrannis und Demokratie einander wechselnd ab. Die Könige herrschten nicht absolut wie in Ägypten und Babylonien; sie wurden von einem Ältestenrat beraten und durften nicht ungestraft gegen das Gewohnheitsrecht verstoßen. »Tyrannis« bedeutete nicht unbedingt schlechte Regierung, vielmehr nur die Herrschaft eines Mannes, der keinen Erbanspruch auf die Macht besaß. Mit »Demokratie« bezeichnete man die Regierung aller Bürger, allerdings unter Ausschluß der Sklaven und Frauen. Wie die Medici gelangten die ersten Tyrannen zur Macht, weil sie die reichsten Mitglieder der jeweiligen Plutokratien waren. Die Quelle ihres Reichtums waren oftmals ihre Gold- und Silberminen, die noch einträglicher wurden, als man Münzen zu schlagen begann; das Münzsystem stammte aus Lydien, das an Jonien grenzte,5 und ist offenbar kurz vor 700 v. Chr. erfunden worden.
Für die Griechen war eines der wichtigsten Ergebnisse des Handels und des Piratentums – die sich anfangs kaum voneinander unterschieden –, daß sie schreiben lernten. Obwohl es seit Jahrtausenden in Ägypten und Babylonien eine Schrift gegeben hatte und auch die minoischen Kreter eine (noch nicht entzifferte) Schrift besaßen, ist nicht klar erwiesen, daß die Griechen schon vor dem zehnten Jahrhundert v. Chr. eine alphabetische Schrift kannten. Sie lernten diese Kunst von den Phöniziern, die wie andere Bewohner Syriens ägyptischen wie babylonischen Einflüssen ausgesetzt waren; sie waren im Seehandel führend bis zum Aufblühen der griechischen Städte in Jonien, Italien und Sizilien. Im vierzehnten Jahrhundert schrieben die Syrer an Echnaton (den ketzerischen König von Ägypten) noch in der babylonischen Keilschrift; Hiram von Tyrus (969–936) hingegen benützte das phönizische Alphabet, das sich wahrscheinlich aus der ägyptischen Schrift entwickelt hat. Die Ägypter verwendeten anfangs eine reine Bilderschrift; allmählich wurden diese Bilder immer konventioneller, dienten zur Bezeichnung von Silben (der ersten Silbe vom Namen der dargestellten Dinge) und entwickelten sich schließlich zu reinen Buchstaben.6 Dieser letzte Schritt, den zwar nicht die Ägypter selbst, wohl aber die Phönizier ganz konsequent vollzogen, ergab das Alphabet mit all seinen Vorzügen. Die Griechen entlehnten es von den Phöniziern und paßten es ihrer Sprache an; dabei führten sie als wichtige Neuerung die Vokale ein, während es zuvor nur Konsonanten gegeben hatte. Zweifellos hat die Einführung dieser bequemeren Schreibweise das Entstehen der griechischen Kultur stark beschleunigt.
Das erste bemerkenswerte Ergebnis der hellenischen Kulturentwicklung war Homer. Bei dem ganzen Homer ist man auf Vermutung angewiesen, doch ist die Ansicht, daß es sich hier um eine Reihe von Dichtern und nicht um einen einzigen handelt, weit verbreitet. Nach dieser Auffassung liegen zwischen der Vollendung der Ilias und der Odyssee etwa zweihundert Jahre, und zwar, wie vielfach behauptet wurde, die Jahre von 750–550 v. Chr.7; andere meinen, der »Homer« sei gegen Ende des achten Jahrhunderts nahezu abgeschlossen gewesen.8 Die homerischen Dichtungen wurden in ihrer jetzigen Form von Pisistratus nach Athen gebracht, der (mit Unterbrechungen) von 560–527 v. Chr. regierte. Seither lernte die Jugend Athens den Homer auswendig, worauf in ihrem Unterricht am meisten Wert gelegt wurde. In einigen Gebieten, vornehmlich in Sparta, gelangte Homer erst später zu dieser Bedeutung.
Homers Werke vertreten wie die höfischen Epen des späteren Mittelalters den geistigen Standpunkt einer kultivierten Aristokratie, die manchen im Volk noch wurzelnden Aberglauben als plebejisch ablehnte. In weit späterer Zeit trat vieles von diesem Aberglauben wieder zutage. Gestützt auf die Anthropologie kamen viele moderne Autoren zu der Überzeugung, daß Homer keineswegs primitiv war, daß er vielmehr etwa wie ein Aufklärer des achtzehnten Jahrhunderts die antiken Mythen reinigend bearbeitet habe und damit das Ideal einer Oberschicht vertrat, die gebildete Aufklärung. Die olympischen Götter, bei Homer Repräsentanten der Religion, waren weder zu seiner noch in späterer Zeit der ausschließliche Gegenstand der Verehrung der Griechen. Es gab auch andere, dunklere und wildere Elemente im volkstümlichen Glauben, die von der griechischen Intelligenz zwar nach Möglichkeit in Schach gehalten wurden, jedoch nur darauf lauerten, in Augenblicken der Schwäche oder Angst hervorzubrechen. Zur Zeit des Verfalls zeigte es sich, daß religiöse Überzeugungen, die Homer bereits aufgegeben hatte, die ganze klassische Epoche, halb verschüttet, überdauert hatten. Das erklärt manches, was andernfalls widerspruchsvoll und befremdend wirken würde.
Die primitive Religion war allenthalben immer mehr Sache des Stammes als der einzelnen. Bestimmte Riten wurden vollzogen in der Absicht, durch sympathetische Magie die Interessen des Stammes zu fördern, besonders die Fruchtbarkeit der Pflanzen, der Tiere und Menschen. Zur Wintersonnenwende galt es, die Sonne zu bewegen, nicht weiterhin an Kraft abzunehmen; Frühling und Herbst erforderten entsprechende Zeremonien. Sie bewirkten oft eine große Gemeinschaftsekstase, wobei die einzelnen ihr individualistisches Empfinden verloren und sich eins fühlten mit dem ganzen Stamm. Überall in der Welt wurden in einem gewissen Stadium der religiösen Entwicklung geweihte Tiere und Menschen feierlich geopfert und verzehrt. Die verschiedenen Länder traten zu ganz unterschiedlicher Zeit in dieses Stadium ein. Am Menschenopfer hielt man gewöhnlich länger fest als am Verspeisen der geopferten Menschen; in Griechenland war es zu Beginn der historischen Zeit noch nicht völlig abgeschafft. Fruchtbarkeitsriten ohne derartige grausame Vorzeichen waren in ganz Griechenland üblich; die eleusinischen Mysterien vor allem hatten im wesentlichen landwirtschaftliche Symbolik.
Man muß zugeben, daß die Religion bei Homer nicht sehr religiös ist. Die Götter sind durchaus menschlich und unterscheiden sich vom Menschen nur durch ihre Unsterblichkeit und ihre übermenschlichen Kräfte. Moralisch gesehen läßt sich nichts zu ihren Gunsten anführen, und es ist kaum zu verstehen, warum sie eigentlich so verehrt wurden. An manchen Stellen, vermutlich späteren Einschaltungen, werden sie mit voltairescher Respektlosigkeit behandelt. Das echte religiöse Gefühl bei Homer bezieht sich weniger auf die Götter des Olymps als auf schattenhaftere Wesen wie das Schicksal, die Notwendigkeit oder das Verhängnis, denen selbst ein Zeus unterworfen war. Das Schicksal übte auf das gesamte griechische Denken großen Einfluß aus – vielleicht leitete die Wissenschaft unter anderem hieraus ihren Glauben an ein Naturgesetz her.
Homers Götter waren die Gottheiten einer siegreichen Aristokratie, nicht nützliche Fruchtbarkeitsgötter von Menschen, die tatsächlich das Land bebauten. So sagt Gilbert Murray:9
»Die Götter der meisten Völker behaupten, die Welt erschaffen zu haben. Diesen Anspruch erheben die Olympier nicht. Sie haben die Welt höchstens erobert… Und was tun sie nun, nachdem sie ihr Reich erobert haben? Befassen sie sich mit der Regierung? Fördern sie den Ackerbau? Betreiben sie Handel und Industrie? Nichts von alledem. Warum sollten sie irgendwelche ehrliche Arbeit leisten? Sie halten es für viel bequemer, von ihren Einkünften zu leben und Leute, die nicht zahlen, mit ihrem Blitzstrahl zu treffen. Es sind siegreiche Räuberhäuptlinge, königliche Freibeuter. Sie kämpfen und schmausen und spielen und machen Musik; sie trinken gewaltig und brüllen vor Lachen über den lahmen Schmied, der sie bedient. Angst haben sie nur vor ihrem eigenen König; auch lügen sie nie, außer in der Liebe und im Krieg.«
Auch Homers menschliche Helden benehmen sich nicht besonders gut. Die führende Familie ist das Haus des Pelops, nicht gerade geeignet, für uns das Vorbild eines glücklichen Familienlebens abzugeben.
»Tantalos, der asiatische Begründer der Dynastie, leitete sie durch eine offene Beleidigung der Götter ein; er soll versucht haben, sie zu täuschen, indem er ihnen Menschenfleisch, nämlich das seines eigenen Sohnes Pelops, vorsetzte. Pelops, der auf geheimnisvolle Weise dem Leben wiedergegeben wurde, verging sich seinerseits. Er gewann das berühmte Wagenrennen gegen Oinomaos, den König von Pisa, dank dem stillschweigenden Einverständnis von Oinomaos’ Wagenlenker Myrtilos; später entledigte er sich dieses Bundesgenossen, den zu belohnen er versprochen hatte, indem er ihn ins Meer warf. Der Fluch vererbte sich auf seine Söhne, Atreus und Thyest, und zwar in Form der sogenannten Ate, eines starken, wenn nicht gar unwiderstehlichen Triebes zum Verbrechen. Thyest verführte die Frau seines Bruders und brachte es dabei zuwege, den ›Glücksbringer‹ der Familie zu stehlen, das berühmte goldene Vlies. Atreus hingegen sorgte dafür, daß der Bruder verbannt wurde, rief ihn zu einer angeblichen Versöhnung zurück und bewirtete ihn dabei mit dem Fleisch seiner eigenen Kinder. Nun vererbte sich der Fluch auf Atreus’ Sohn Agamemnon, der Artemis kränkte, indem er eine heilige Hirschkuh erlegte; er opferte seine Tochter Iphigenie, um die Göttin zu versöhnen und für seine Flotte sichere Überfahrt nach Troja zu erwirken; er seinerseits wurde von seinem treulosen Weib Klytemnästra und ihrem Liebhaber Ägisth, einem überlebenden Sohn des Thyest, ermordet. Orest, Agamemnons Sohn, rächte seinen Vater, indem er seine Mutter und Ägisth tötete.«10
Homers Gesamtwerk war ein Produkt Joniens, das heißt eines Teils des hellenischen Kleinasiens und der benachbarten Inseln. Irgendwann, spätestens während des sechsten Jahrhunderts, wurden Homers Dichtungen in ihrer gegenwärtigen Form aufgezeichnet. Im Laufe dieses Jahrhunderts entstanden auch die griechische Wissenschaft, Philosophie und Mathematik. Zur gleichen Zeit trugen sich in anderen Teilen der Welt Ereignisse von grundlegender Bedeutung zu. Konfuzius, Buddha und Zoroaster gehören, wenn sie wirklich gelebt haben, wahrscheinlich in dieses Jahrhundert.11 Mitte des sechsten Jahrhunderts gründete Cyrus das Perserreich; gegen Ende des Jahrhunderts erhoben sich die griechischen Städte in Jonien, denen die Perser eine begrenzte Autonomie gestattet hatten, zu einem ergebnislosen Aufstand, der von Darius niedergeschlagen wurde; ihre besten Männer wurden verbannt. Verschiedene Philosophen dieser Epoche waren Flüchtlinge, die in den noch nicht besetzten Teilen der hellenischen Welt von Stadt zu Stadt wanderten und die Kultur verbreiteten, die sich bislang hauptsächlich auf Jonien beschränkt hatte. Sie wurden auf ihrer Wanderschaft freundlich behandelt. Xenophanes, der, ebenfalls Flüchtling, Anfang des sechsten Jahrhunderts auf der Höhe seines Lebens stand, sagt: »Beim Feuer ziemt solch Gespräch zur Winterszeit, wenn man auf weichem Lager gesättigt daliegt und süßen Wein trinkt und Kichern (Erbsen) dazu knuspert. Wer und von wem bist du unter den Männern? Wieviel Jahre zählst du, mein Bester? Wie alt warst du, als der Meder ankam?«12 Das übrige Grichenland verteidigte erfolgreich seine Unabhängigkeit in den Schlachten von Salamis und Platää, wonach Jonien eine Zeitlang frei war.13
Griechenland setzte sich aus zahlreichen kleinen, unabhängigen Staaten zusammen; ein jeder bestand aus einer Stadt mit etwas Ackerland ringsum. Die verschiedenen Teile der griechischen Welt hatten ein ganz unterschiedliches Kulturniveau, und nur eine Minderzahl dieser Stadtstaaten trug etwas zur griechischen Gesamtleistung bei. Sparta, wovon später noch viel zu sagen sein wird, war militärisch, nicht aber kulturell bedeutend. Korinth, ein großes Handelszentrum, war reich und blühend, brachte jedoch nicht viele große Männer hervor.
Dann gab es reine ackerbautreibende Landstaaten, wie das sprichwörtliche Arkadien, das sich die Städter so idyllisch vorstellten; in Wirklichkeit steckte es aber noch voll greulicher antiker Barbarismen.
Die Bewohner verehrten Hermes und Pan und hatten eine Menge Fruchtbarkeitskulte, wobei häufig eine grob bearbeitete Säule die Statue des Gottes ersetzte. Die Ziege war das Symbol der Fruchtbarkeit, weil die Landleute zu arm waren, um sich Stiere leisten zu können. Wenn das Futter knapp war, bekam die Panstatue Prügel. (Etwas Ähnliches geschieht noch heute in entlegenen chinesischen Dörfern.) Es gab einen Clan von vermeintlichen Werwölfen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Menschenopfern und Kannibalismus. Man glaubte, wer einmal Fleisch von einem Menschenopfer kostete, der wurde zum Werwolf. Es gab auch eine dem Zeus Lykaios (Wolf-Zeus) geweihte Höhle; in dieser Höhle warf niemand einen Schatten, und wer sie betrat, starb binnen Jahresfrist. Dieser ganze Aberglaube stand noch zu klassischer Zeit in Blüte.14
Pan wurde ursprünglich (wie manche behaupten) »Paon« genannt, was soviel wie der Ernährer oder Hirt bedeutete; als Athen ihn im fünften Jahrhundert nach dem Perserkrieg ebenfalls zu verehren begann, kam er zu seinem uns geläufigeren Namen, der als »All-Gott« ausgelegt wird.15
Es gab jedoch auch im alten Griechenland vieles, was wir als Religion in unserem Sinne empfinden können. Das hing nicht mit den Olympiern, sondern mit Dionysos oder Bacchus zusammen, den wir uns meist als den etwas berüchtigten Gott des Weines und der Trunkenheit vorstellen. Es ist jedoch sehr bemerkenswert, wie sich aus der Verehrung dieses Gottes ein tiefer Mystizismus entwickelt hat, der viele Philosophen stark beeinflußte und sogar zum Entstehen der christlichen Religion beitrug; wer die Entwicklung des griechischen Denkens studieren möchte, muß das unbedingt erkennen.
Dionysos oder Bacchus war ursprünglich ein thrakischer Gott. Die Thraker waren weit weniger kultiviert als die Griechen, die in ihnen Barbaren sahen. Wie alle primitiven, ackerbautreibenden Völker hatten sie Fruchtbarkeitskulte und einen Gott, der die Fruchtbarkeit förderte. Er hieß Bacchus. Es ist nie ganz klar geworden, ob Bacchus die Gestalt eines Mannes oder eines Stieres gehabt hat. Als die Thraker die Kunst, Bier zu brauen, entdeckt hatten, hielten sie den Rausch für etwas Göttliches und verehrten Bacchus deswegen. Als sie später den Wein kennen und trinken lernten, begannen sie ihn nur noch höher zu schätzen. Jetzt sah man in ihm weniger den Förderer der Fruchtbarkeit im allgemeinen, als den Gott, dem man die Rebe und den göttlichen Rausch verdankte, wie ihn der Wein erzeugt.
Zu welchem Zeitpunkt die Bacchus-Verehrung von Thrakien auf Griechenland überging, ist unbekannt, doch scheint es kurz vor Beginn der historischen Zeitrechnung gewesen zu sein. Der Bacchus-Kult stieß bei den Orthodoxen auf Widerstand, setzte sich aber trotzdem durch. Er enthielt viele barbarische Elemente, z. B. wurden wilde Tiere in Stücke gerissen und roh aufgegessen. Auch haftete ihm ein seltsam femininer Zug an. Ehrbare Matronen und Mädchen pflegten in großem Kreis auf den Hügeln ganze Nächte in ekstatischen Tänzen zu verbringen; dieser Rausch war vielleicht teilweise alkoholischer, hauptsächlich jedoch mystischer Natur. Die Ehemänner schätzten diesen Brauch nicht, wagten aber in religiösen Angelegenheiten nicht zu widersprechen. Wie schön und grausam zugleich dieser Kult war, hat uns Euripides in seinen »Bacchen« gezeigt.