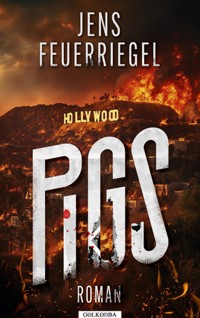
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Los Angeles 1969 und 1970: Rassismus, Hippiewahn, Ekelmorde und Bürgerkrieg – dieser fiktionale Episodenroman nimmt die Leserschaft mit auf eine Reise in die schwarze Seele eines amerikanischen Albtraums. Denn Charles Manson ist noch nicht fertig. Nach den real verübten, spektakulären Tate/LaBianca-Morden sendet er weitere Botschafter seiner Hippie-Kommune aus, um im verhassten weißen Establishment bluttriefende Massaker anzurichten und sie den Schwarzen in die Schuhe zu schieben. Seine schärfste Waffe dabei ist Kinky, eine 18-jährige Ausreißerin, die aufgrund ihres geschickten Umgangs mit dem Messer schnell in den Kreis von Mansons Lieblingen aufsteigt. Schließlich geht seine wahnhafte, herbeigesehnte Prophezeiung tatsächlich in Erfüllung: Weiße gehen auf Schwarze los, Schwarze schlagen zurück, ein fürchterlicher Bürgerkrieg entbrennt. Helter Skelter ist endlich da! Der schwarze Kriminalbeamte Bob Morris bekommt im Zuge seiner Ermittlungen einen bahnbrechenden Hinweis: Oben in Chatsworth, auf der Spahn Ranch, gebe es ein weißes Rumpelstilzchen, das diese Massaker inszeniere. Dort kommt es zum großen Showdown ... Hass, Gewalt, Rassismus, eine gespaltene Gesellschaft und die bedrohlich tief hängende dunkle Wolke eines Bürgerkriegs: Die Ereignisse dieses Romans liegen zwar 55 Jahre zurück – doch sie erzählen indirekt auch viel über das Amerika der Gegenwart, wo sich die Menschen gegenseitig kaum noch respektieren und das freiheitliche Gesellschaftsmodell auf der Kippe steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JENS FEUERRIEGEL
ROMAN
1. eBook-Ausgabe 2025
© 2025 Golkonda in der Europa Verlage GmbH, München
Lektorat: Silwen Randebrock
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie
Werbeagentur, Zürich
Layout & Satz: Margarita Maiseyeva
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-96509-077-4
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für Produktsicherheit
Europa Verlage GmbH
Monika Roleff
Johannisplatz 15
81667 München
Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0
E-Mail: [email protected]
www.golkonda-verlag.com
INHALT
VORWEG
FEUERHÖLLE
EKELPAKETE
»HACKFRESSE«
DRUNTER UND DRÜBER
OAKLAND
NEUER PLANET
HUFGETRAPPEL
SAN FRANCISCO
GEMETZEL
GERÄDERT
LABYRINTH DER GRAUSAMKEITEN
BONNIE & CLYDE
WATTS
COITUS INTERRUPTUS
VERSTÜMMELT
MONSTER
HOLLYWOOD
ERREGT AUF DEN PLANKEN
RAZZIA
SCHWARZER WEIHNACHTSMANN
»WHITE VICTIMS«
FIX UND FERTIG
SCHWEINEREIEN
»VERMON THE GERMAN«
»FIC-FAC«
GRUSELN AUF DEM PIER
SCHWARZE PANTHER
TIEF IN DER WÜSTE
BIESTER
TOUCHDOWN
TOTMACHER
TERROR
FRAU IN SCHWARZ
ABGEZOGEN
BÜRGERKRIEG
EKLIGE DETAILS
TROUBADOUR
PALOMINO
ATEMLOS
LOUISIANA
ERLÄUTERUNGEN
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält Elemente, die triggern können, siehe ggf. Seite 315.
VORWEG
Dies ist ein fiktionaler Roman. Die meisten Figuren und Situationen sind frei erfunden. Angelehnt sind sie allerdings an einige wahre Begebenheiten und reale Personen der Zeitgeschichte – unter anderem rund um die Tate-LaBianca-Morde 1969 in Los Angeles und an das Leben auf der Spahn Ranch, von wo aus Charles Manson die Morde seiner Hippiekommune inszenierte. Ein Anhang informiert über wesentliche reale Ereignisse und Personen.
An einigen Stellen ist das N-Wort in zwei Varianten ausgeschrieben, die als abwertend, rassistisch und diskriminierend gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert sind. Sie sind aber nötig, um dem historischen Kontext Rechnung zu tragen und den alltäglichen Rassismus auch in der Sprache kenntlich zu machen. An den entsprechenden Stellen ist das ausschließlich in zitierten Äußerungen und in der englischen Sprache geschehen.
FEUERHÖLLE
26. September 1970
Als Jesus Christus zum zweiten Mal starb, endete ein amerikanischer Albtraum.
Das Feuer hatte sich rasant durch die Büsche, Hölzer, Gräser und Bäume gefressen, wie ein Floh Straßen übersprungen und stand jetzt vor den Toren von Chatsworth. An der Santa Susana Pass Road nordwestlich von Los Angeles brach die Hölle los. Die Santa-Ana-Winde hatten die Flammen des Clampitt-Feuers in einem Wahnsinnstempo vorangepeitscht. Die fraßen sich jetzt in die jahrzehntealten Holzbaracken der etwas abgelegenen Spahn Movie Ranch. Innerhalb der nächsten zwei Stunden sollte alles erledigt sein. Jeder Feuerwehreinsatz wäre umsonst gewesen. Nur gut, dass der alte George Spahn das nicht mitansehen musste. Zwei Mädchen hatten ihn untergehakt. Und so stand er jetzt mit weißem Anzug, Stetson und seiner schwarz getönten Brille auf dem Hügel auf der anderen Straßenseite und wartete darauf, mit einem Pickup dem Glutofen zu entkommen.
Spahns etwas abseits gelegenes Haus war als erstes heruntergebrannt. Die Bande hatte die Pferde rechtzeitig von der Koppel gescheucht. Sie mussten sich jetzt allein durchschlagen. Wie all die Mädchen, jungen Frauen und Typen, die rechtzeitig das Hinterhaus, das Rock City Café und den Longhorn Saloon verlassen hatten. Speaky und Amy hatten den blinden Spahn im Griff. Die Hunde waren bereits auf den Ladeflächen. Marnie, Susu, Cindy, Fake, Cherry, Tex, Clem und die anderen hatten die Buggys und Pick-ups gestartet, auch den pissgelben Ford, den sie vor einigen Monaten belustigt in »Devil’s Arrow« umbenannt hatten. Ein Teufelspfeil, das traf es recht gut.
Schon am Abend zuvor hatte die Kommune damit begonnen, ihre Siebensachen zu packen, um die Ranch zu räumen. Die Rauchsäulen näherten sich vom Nordwesten immer bedrohlicher. Das Ende war absehbar. Doch wo war eigentlich Charlie? Tex ließ seine Frage sofort zerbröseln. Denn das war jetzt nicht der Zeitpunkt für Nebensächlichkeiten. Echt jetzt: Um Charlie musste sich keiner sorgen. Der hatte doch schon immer einen schmalen Fuß gemacht, wenn es brenzlig wurde. Hier galt jetzt für alle: Rette sich, wer kann!
Die Flammen hatten nun die ehemalige Frontkulisse der Filmranch erfasst, zunächst das Rock City Café. Gleich würde der Long Horn Saloon abbrennen. Feuer und Rauch hatten den Himmel in eine neblige Kulisse verwandelt, der die langsam im Westen sinkende Sonne einen surrealen Orangeton verlieh. Die Flüchtlinge mussten inzwischen die Augen zusammenkneifen, in die sich der immer mehr verdichtende Rauch stärker und stärker biss.
Als Tex in die Runde sah, blieb sein Blick bei Lady hängen. Sie hatte im Gegensatz zu den anderen ihre Glubschaugen weit aufgerissen. Mit einem bescheuerten Grinsen starrte sie in die Feuerbrunst. Tex hatte ein Déjà-vu. Diese Fratze kannte er von Lady: seit der Nacht, als sie die hochschwangere Sharon Tate an Schulter und Kopf festhielt und er die Klinge immer und immer wieder in deren weichen Körper hineinstieß. Lady war echt irre. »Kommt«, bellte Tex die anderen an. »Wir hauen ab!«
Doch im Hinterhaus der Ranch, vormals Schauplatz zahlreicher Sexorgien, kämpften derweil mitten im Inferno drei Menschen verzweifelt um ihr missratenes Leben. Und einer schaute dabei zu.
»HACKFRESSE«
21. Juli 1969
Natürlich hatte sie ihren Salinger gelesen. Alle Jugendlichen hatten seinen »Fänger im Roggen« in der Schule durchgehechelt. Ein Jungenbuch! Holden Caulfield irrt durchs Leben und durch New York. Pubertät, Pickel und Phoebe, seine Schwester – daran konnte sie sich neblig erinnern. Wirklich hängengeblieben war bei ihr aus dem ganzen Jugendroman allerdings nur ein Wort: »Phony« – unecht, falsch. Ja, das war sie, die Erwachsenenwelt: phony. Alles nur ein aufgeblasener Mist. Die Eltern lebten in einem dieser Mittelschichtshäuser in Los Angeles. Gerade mal genug Zimmer für zwei Erwachsene und zwei Kinder, kleiner Vorgarten, die Häuser der Nachbarschaft fast alle gleichgroß, gleich angepinselt, mit gleichen Inhalten gefüllt. Als wollte jeder dem anderen das Gleiche vormachen. Wie phony!
Ihr Vater war Immobilienmakler. Doch für mehr als diesen milchig-blauen Mittelklasse-Chevi, lebenslange Kreditzahlungen für das Haus und jedes Jahr zehn Tage Badeurlaub bei San Diego hatte es nicht gereicht. Na ja – und sonntagmorgens ging die ganze Familie im Denny’s frühstücken.
Ihre Mutter war wie all die anderen Mütter in der bürgerlichen Nachbarschaft vor allem eines: Hausfrau. Die beiden Kinder, sie und ihr Bruder, hatten den Eindruck, dass sie ihren Job ganz gut machte. Aber aus ihren Zimmern heraus mussten sie der keifenden Mutter abends oftmals zuhören, wie sie ihren Vater mal wieder zusammenstauchte: dass die Nachbarn sich mehr leisten könnten, dass es alles so langweilig und immer wieder das Gleiche sei, dass sie vom Leben doch noch etwas anderes erwarte. Doch was? Die Kinder schämten sich dann für beide. Und hatte sie ihren Vater nicht erst neulich dabei erwischt, wie er in ihrem (!) Denny’s eines Nachmittags mit einer unbekannten Frau saß und über dem Tisch ihre Hände hielt? Es war kein Sonntag. Es war ein Mittwoch. Phony!
Die Schule war der Horror. Superphony. Zwölf Jahre lang hatte sie sich zum Highschool-Abschluss gequält. Und was musste sie alles an Demütigungen über sich ergehen lassen. Es ging schon in der Grundschule los. Nur drei Zentimeter waren es, die sie von allen anderen unterschieden. Doch es waren drei Zentimeter, die Eindruck machten. »Hackfresse! Hackfresse«, schallte es ihr schon in der vierten Klasse entgegen. Reflexartig musste sie dann immer mit ihrer Zunge über die rechte Oberlippe fahren. Als wollte sie noch einmal bestätigt haben, was die anderen doch gerade festgestellt hatten: diese entstellende Narbe aus der Oberlippe heraus bis unter das Nasenloch. Ja, sie war ein geborenes Monster. Ihre Mutter hatte nach der Geburt fünf Tage und Nächte lang durchgeheult. Die Ärzte hatten zwar getan, was medizinisch möglich war. Doch all die Klammern und Fäden konnten den Makel nicht verschwinden lassen.
Ab dreizehn war’s ein Trip durch die Hölle. Denn die Hasenscharte war nicht nur eine Narbe, sondern regelrecht eine kleine Kerbe. Da war wirklich eine Delle! Also würde sie das nie wegschminken können. Es sei denn, sie würde zu einem Spachtel greifen. Es war die Zeit, als die Jungs plötzlich Interesse an den Mädchen signalisierten. Und sie gehörte selbstverständlich nicht zu denjenigen, die diese Signale erhielten. Das waren harte Erfahrungen. Irgendwann bekam sie heraus, dass die anderen zweitklassigen Girls sie zu Treffen mit Jungen nur mitnahmen, um im Vergleich zu ihr glänzen zu können: mit ihren fettigen Haaren, ihren breiten Ärschen, glitzernden Zahnspangen und den hochgepushten Brüsten. Aber sie alle hatten eben keine Hasenscharte. Und sie waren es, die die zweitklassigen Jungs abgriffen. Aus Miras Sicht waren das echte Schlampen.
Jetzt in der Highschool pöbelte sie zwar keiner mehr direkt an. Missgeburt, Hackfresse, Schlitzi – was hatte sie nicht alles zuvor zu hören bekommen. Die Demütigungen fielen nunmehr subtiler aus. In der ersten Liga mitspielen war sowieso nicht drin. All die siebzehnjährigen Football- und Leichtathletik-Asse konnten sich selbstverständlich nicht für sie erwärmen. Das taten sie dann doch eher für die erstklassigen blonden aufpolierten California-Girls, deren enormen Brüste unter den engen Pullovern die Kerle regelrecht ansprangen. Sie hasste das! Und wie sie das hasste.
Der absolute Tiefpunkt war der Abschlussball. Natürlich hatte sie keiner gefragt. Also hatte sie sich in ihrem Zimmer eingeschlossen, die Nacht durchgeheult. Am nächsten Morgen, als die anderen Mädchen nach einer Nacht voller Alkohol und schlechtem Sex noch verkatert in ihren Betten lagen, war sie schon früh auf, fühlte sich frisch, genoss die kalifornische Sonne und die ausnahmsweise kühle, klare Luft. Aufatmen. Sie hatte die Nacht der Demütigung geschafft.
Ihr Leben hätte bislang ohne die Kerbe ganz anders verlaufen können. Denn eigentlich war sie ein hübsches Ding: schlank, strahlend blaue Augen, ein einladendes Lächeln, wenn es für sie denn etwas zu lächeln gab, und: lange, etwas wellige blonde Haare. Hatten nicht die Beach Boys davon geschwärmt? »A bushy bushy blonde hairdo«? Oder aber Marilyn Monroe in »Gentlemen Prefer Blondes«? Den Blondinen stand die Welt doch angeblich offen. Von wegen. Phony! Die Wahrheit war: Auch für Blondinen gab’s mitunter nichts zu holen.
Also stand Mira Cooper jetzt in der Sommerhitze mit einem Seesack am Straßenrand des Highway 1 Richtung San Francisco, hielt ihren rechten Daumen ausgestreckt in die Fahrbahn und hatte ihre rechte Gesichtshälfte von der Straßenseite so weit wie möglich abgewandt. So machte sie in ihren hellblauen, ausgefransten Jeans, mit ihrem Pferdeschwanz und ihrem netten, hochgeknöpften rotschwarzen Karohemd aus Baumwolle zumindest von Weitem richtig etwas her.
Ein paar Wochen lang hatte sie nach ihrem mittelmäßigen Schulabschluss zu Hause rumgegammelt, jetzt wollte sie zu neuen Ufern aufbrechen. Da oben in Frisco hatten die Jugendlichen doch seit 1967 einen neuen Kult etabliert: Summer of Love, Dope und Essen umsonst, gemeinsam mit Gleichgesinnten in Kommunen leben, den ganzen Tag lang die Musik von »Grateful Dead« und »Jefferson Airplane« hören, der Konsumwelt entsagen und nicht ganz unwichtig: Sex für alle. Da würde doch auch für sie etwas abfallen. Und wenn es nur jemand wäre, mit dem oder mit der sie über ihre Probleme reden könnte. Denn so viel war einmal sicher: Im Hause Cooper war für Ekelthemen wie Hasenscharten kein Platz.
Darum hatte sie ihre wichtigsten Klamotten in den Seesack geworfen, einige hundert Dollar, die sie nebenbei bei einem Paketdienst verdient hatte, zusammengerollt und unter den BH zwischen ihre Brüste gestopft und ein paar Abschiedszeilen auf einen Zettel geschrieben. Sie war jetzt fast achtzehn. Als die Tür hinter ihr zuschnappte und sie den Schlüssel zuvor auf dem Küchentisch hatte klimpern lassen, gab es kein Zurück mehr. Sie war jetzt das, was Tausende vor allem junge Frauen auch waren: eine Ausreißerin, ein Runaway, ein Geist der Zeit.
Mira Cooper aus Anaheim, L. A., stand also an diesem heißen Julitag 1969 am Pacific Coast Highway an den dicht beieinanderliegenden Abfahrten Sunset- und Topanga Canyon Boulevard. Ein Ort wie eine Lebensgabel. Von hier aus führte der Weg zum einen weiter nach Norden, entlang des Pazifiks, durch Malibu vorbei an den berühmten Surfspots, die die Beach Boys besungen hatten, in Richtung San Francisco. Zum anderen führte ein zweiter Weg den Sunset Boulevard hoch in den Smog, in das pulsierende und gefährliche, mittlerweile recht dreckige und von Nutten überflutete Hollywood. Und die dritte Abfahrt ein bisschen weiter nördlich in die Wildnis außerhalb von Los Angeles, den Topanga Canyon hoch. Sie war das perfekte Opfer.
DRUNTER UND DRÜBER
8. August 1969
Es war der Nachmittag des 8. Augusts 1969, als Charles Manson seinen Leuten auf der Spahn Ranch eröffnete:
»Die Zeit für Helter Skelter ist jetzt!«
Allen war mit einem Schlag klar, dass sie es sein sollten, die die Apokalypse starten mussten. Weil die schwarzen Durchgeknallten in Watts einfach nicht in die Puschen kamen. Schon seit Monaten lag Charlie seinen Jüngern damit in den Ohren. Aber wenn Blackie nun mal einfach nicht losschlagen wollte, müssten sie, die Hippies von der Cowboyranch, dem schwarzen Mann vormachen, wie es geht. Es war der Startschuss einer Horrorshow der Extraklasse.
Charles Manson war ein kleines Rumpelstilzchen, das im doppelten Sinne zu kurz gekommen war. Zum einem maß er nur 1,57 Meter, zum anderen saß er bis 1967 die Hälfte seines Lebens im Knast oder in Erziehungsanstalten: Raub, Diebstahl, Zuhälterei. Als er wieder frei war, geriet er in San Francisco mitten in den Summer of Love. Er kam sich vor wie im Schlaraffenland: Essen und Dope gab es fast für umsonst, Sex war rund um die Uhr im und um den Golden Gate Park frei verfügbar, auch wenn man sich dabei gut einen wegholen konnte. Dann ging man eben in eines dieser kostenlosen medizinischen Center, um sich eine Salbe abzuholen.
Manson, jetzt dreiunddreißig Jahre alt und mithin allenfalls noch als Berufsjugendlicher tauglich, setzte sich in den Park, holte seine Gitarre raus und klampfte den bekifften Hippies seine kryptischen Songs vor. Es war die Zeit, als die Mädchen einen bärtigen Zausel mit Gitarrenmusik noch romantisch fanden.
Manson, diese bislang gescheiterte Existenz, schaffte es, mit Charisma, Drogen und Gehirnwäsche vor allem von zu Hause weggelaufene, entwurzelte junge Frauen mit wenig Selbstvertrauen um sich zu scharen, packte sie in einen alten Schulbus und kurvte durch Kalifornien, bis er 1968 vor den Toren von Los Angeles die Spahn Ranch okkupierte, eine ausgemusterte Western-Filmkulisse. Der ausschließlich weißen Hippiekommune, die sich »Family« nannte, gehörten zwischen 1968 und 1970 insgesamt etwa hundert Leute an, gleichzeitig immer so um die dreißig, deutlich mehr Frauen als Männer. Seit ein paar Tagen war auch dieses arme, entstellte Mädchen aus Anaheim dabei.
Der Oberguru Charles Manson hatte volle Kontrolle über den Laden. Die Mädchen und Frauen, die nicht selten von zu Hause ausgebüxt waren wegen ihrer autoritären Väter, waren in der Manson-Gang zur Drittklassigkeit degradiert – was ihnen nichts auszumachen schien: Sie mussten ihre Mahlzeiten immer zuletzt einnehmen, nach den Männern – und den Hunden! Sie waren dafür diejenigen, die in der Küche schuften durften und jederzeit für Sex zur Verfügung stehen mussten. Ja – wir reden hier über: Prostitution. Nur dass in diesem Fall nichts übrig blieb für die Mädchen außer einer Existenz in scheinbarer Freiheit, zugeteilten Rationen an LSD und teilweise widerlichem Sex mit Mitgliedern von Bikergangs, die sich Manson über diesen Weg gefügig zu machen glaubte. Wie in vielen anderen Kommunen waren die Frauen erniedrigt zu dem, wofür sie ihre demütigen Mütter noch verflucht hatten: Hausarbeit und Beine breit machen. Auf der Habenseite standen dafür die scheinbaren Errungenschaften von sexueller Befreiung und Nonkonformität. Im Schraubstock von drei schmierigen Bikern war die Perspektive auf diese angeblichen Errungenschaften allerdings eine äußerst begrenzte.
Charlie träumte derweil von einem Erfolg als klampfender Folksänger, bestimmte, wer mit wem in welcher Stellung Sex hatte, wer welche Mengen LSD einwerfen durfte und hämmerte seinen Jüngern tagtäglich diese seltsame Philosophie ein: Helter Skelter kommt!
Charlie hasste Frauen, hatte Angst vor dem schwarzen Mann und genoss seine Position als Oberguru und Zuhälter. Das alles entsprach so gar nicht den Idealen, um die es den Blumenkindern da oben in San Francisco ging. Und doch war er eine akzeptierte Anomalie der Gegenkultur, die ihn für einen Hippie hielt: der das Leben des weißen Establishments verabscheute, nur weil er nie dazugehören würde; der sich mit seinem Auftreten als Zottel als klassischer Gegenentwurf inszenierte; der dem Materiellen scheinbar abgeschworen hatte; der sich einen langen Aussteigerbart wachsen ließ; der sich vegetarisch von Müllresten ernährte; der eine eigene Kommune aus dem Boden stampfte mit all dem scheinheiligen Gruppensex; der der Jugendkultur mit ihrer Sprache, Kleidung und Musik zugewandt war, obwohl er doch schon Mitte dreißig war.
Doch es war eben nicht peace, love and happiness, was Charlie anstrebte. Sein Ding waren Gewalt, Krieg, Hass und Elend. Seit einigen Monaten hatte er diese irre Obsession entwickelt: die Prophezeiung, dass ein Rassenkrieg bevorstehe, dass die jahrhundertelang erniedrigten Schwarzen sich erheben und sich in einem blutigen Bürgerkrieg mit ihrer physischen Stärke gegen das weiße Establishment durchsetzen würden, danach aber nichts mit der Macht anfangen könnten – und dann ausgerechnet ihn, den 1,57 Meter kleinen Ex-Knacki, anbetteln sollten, die Herrschaft zu übernehmen. Es war die Vision eines Irren. Eines Größenwahnsinnigen. Für die er zunächst noch nicht einmal einen konkreten Namen hatte: »The shit is coming down«. Aber seine Bande hatte das gefressen. Das Gehirn matschig gemacht mit LSD, die Körper konditioniert auf Sex ohne Ende und die Aussicht, unter Charlie alias Jesus Christus zu einer Elite der Ausgewählten zu zählen – all das transformierte die jungen Leute zu willigen Robotern.
Dieser Rassenkrieg war für Manson der letzte große Krieg auf dem Planeten. Seiner Meinung nach habe schon die Bibel dieses Szenario gepredigt: Armageddon. Doch der richtige Kick-off waren die Beatles mit ihrem Weißen Album, das im Dezember 1968 erschienen war. Seitdem flippte Charlie völlig aus. Er hatte dazu ein regelrechtes Drehbuch entworfen. Der Aufstand sollte beginnen, indem »Blackie«, wie er die Schwarzen nannte, sich in die Häuser von Wohlhabenden in weißen Wohngegenden schlich und dort Blutbäder anrichtete. Er predigte seinen Jüngern ein Szenario, wie die Schwarzen das weiße Establishment in dessen eigenen vier Wänden mit Messern aufschlitzen und mit dem Blut ihrer Opfer Botschaften an den Wänden hinterlassen würden. Paranoia würde unter der weißen Bevölkerung ausbrechen. »Whitie« würde daraufhin aus Rache in die schwarzen Gettos gehen und einen Bürgerkrieg führen. Manson ging sogar so weit, einen weiß-weißen Bürgerkrieg herbeizufantasieren, in dem Liberale und Hippies auf der einen Seite und Konservative auf der anderen Seite aufeinander losgingen. Diese Vision hatte Manson bereits Ende 1968.
Während dieses Rassenkrieges auf den Straßen und all der Schlachtereien würde Manson sich zusammen mit seiner »Family« in der Wüste in einem angeblich bodenlosen Loch verstecken. Dafür hatte er sich im Death Valley bereits einen Zufluchtsort ausgesucht: die abgelegene Barker Ranch mitten im Nirgendwo. Er und seine »Family« wären die Auserwählten. Diejenigen, die Blackie, nachdem der sich wegen seiner körperlichen Überlegenheit gegen die Weißen durchgesetzt hätte und mit seiner Macht nichts würde anfangen können, anbetteln würde, ihm doch zu helfen. Dann würde er quasi als Jesus Christus mit seiner Bande an Auserwählten die Wüste verlassen und die Macht übernehmen. Mansons Gefolgschaft, teils berauscht von LSD, teils gefügig gemacht mit monatelanger Gehirnwäsche, teils weichgeklopft vom Zeitgeist, gemäß dem jede Verrücktheit immer noch besser wäre als die Lebensmodelle des Establishments, glaubte diesen Schwachsinn. Zumal da ja noch die Beatles als Verbündete waren.
»Halt’s Maul und hör dir das an«, herrschte Charlie irgendwann um Neujahr 1969 ein weiteres Mal Fake an. Sie war das jüngste Mitglied der »Family«, erst fünfzehn Jahre alt und diente dem Hippiezwerg nicht selten als Ventil für seine Aggressionen, wenn er mal wieder seine Impulse nicht kontrollieren konnte. Regelmäßig tobte sich Manson an ihr aus, weil sie sich angeblich immer noch nicht von ihrer tatsächlichen Familie entkonditioniert hatte und ihm widerborstig vorkam.
Die Nadel fiel in die Rille, es kratzte kurz, und die Vier aus Liverpool rockten los. Ihr Plan war es, den ultimativen Rocksong zu erschaffen. Es war die Antwort auf die britische Band The Who, die ihrerseits behauptet hatte, den härtesten und lautesten Rocksong überhaupt geschrieben zu haben. Hier also der Konter der Beatles: harte Riffs, laute Gitarren und Drums, Paul McCartney schrie mehr als dass er sang. Jetzt ließ »Helter Skelter« die hölzernen Wände des Longhorn Saloons in einem nachgebauten Westernstädtchen wackeln. Die Vier aus Liverpool gaben damit eine Visitenkarte für den noch entstehenden Hardrock ab. Einige sagten später, vom Weißen Album habe ein Hauch von Punk geweht. Davon wusste Charlie natürlich noch nichts, als er die Schallplatte mit dem Apfel-Logo mittendrin Ende 1968 in die Finger bekam. Was er aber zu wissen glaubte: Die Beatles hätten dort eine Botschaft für seine wirre Philosophie verpackt. Sie sprachen angeblich zu ihm.
Tatsächlich war »Helter Skelter« der Song über eine Wasserrutsche in einem Vergnügungspark. Kaum habe man eine amüsierende Fahrt nach unten gehabt, gehe man schon wieder nach oben, um es zu wiederholen. Holterdiepolter oder auch Drunter und Drüber – so lässt sich der Name dieser Rutsche in etwa übersetzen. Was der bärtige Zottel daraus ableitete, sollte für ewig in die Kriminalgeschichte eingehen: Das absolute Chaos, Helter Skelter, der Krieg zwischen Schwarz und Weiß, wäre zu erwarten – und zwar schnell. John, Paul, Ringo und George wären absolute Propheten. Sie hätten den Soundtrack für seine wahnsinnige Vision erschaffen: Helter Skelter stünde dafür, dass sich die Schwarzen erheben und die Städte in Schutt und Asche legen würden.
Zumal da ja auch noch mehr war. Im Song »Blackbird« soll eine Amsel ihre gebrochenen Flügel nehmen und fliegen lernen, sich erheben. »Blackbird« war in Mansons Interpretation natürlich ein Synonym für die Schwarzen, die sich von der weißen Macht loslösen sollten. Der Songtest enthielt für ihn eine klare Botschaft: Die Schwarzen hätten nur auf diesen Moment gewartet, um sich zu erheben und zu befreien.
Oder »Piggies«. Der Beatle George Harrison hatte diesen Song komponiert, angelehnt an George Orwells dystopischen Roman »Animal Farm«. Doch während sich bei Orwell hinter den Schweinchen kommunistische Machtmissbraucher verbargen, waren die »Schweinchen« bei Harrison lediglich eine Satire auf Konsum und Klassenunterschiede. Mehr nicht. Es war die Rede von »kleinen Schweinchen« und »größeren Schweinchen«, letztere »greifen Gabel und Messer, um ihren Speck zu essen«.
Der teuflische Guru aus Chatsworth hörte aber weit mehr heraus. »Schwein« war ursprünglich ein Schimpfwort von schwarzen Bürgerrechtlern für die Polizei. Auch die Gegenkultur-Bewegung bediente sich des Schimpfworts für die Ordnungshüter nur allzu gerne. Manson und seine Gang hatten die Bedeutung aber mithilfe des Beatles-Songs erweitert. Sie vertraten diese Interpretation anfangs exklusiv. Für sie war ein »Pig«, ein Schwein, grundsätzlich jemand aus dem weißen Establishment: höhere Mittelklasse aufwärts, Wohlhabende, Erfolgreiche. Wenn die Beatles also in dem Song feststellten, dass die »Piggies« eine Tracht Prügel verdient hätten, dann wäre damit das Establishment gemeint. Manson konnte diese Stelle nicht oft genug hören, um in sein markantes Mecker-Gekicher zu verfallen: »Hehehe«. Wie sich für die Ranchbande die letzte Zeile des Songs ebenfalls interpretieren ließ, zeigte sich nur wenig später in einem Mordhaus in Los Feliz nahe dem Griffith Park in Los Angeles. Dort vibrierte in der Nacht zum 10. August 1969 eine Tranchiergabel im Bauch eines Mordopfers, ein Messer steckte in der Kehle. Mansons Favorit auf dem Album war allerdings »Revolution 9«. Diese Kakofonie aus Geräuschen – das Musik zu nennen, wäre wohl übertrieben – endet in Maschinengewehrgeknatter und Geschrei. Armageddon kommt!
Sieben Monate lang hatte Manson jetzt seine Jünger mit fast täglichen Vorträgen und Musikübungen auf den Tag X vorbereitet. In den vorigen Wochen hatten sie alle gelernt, wie sie sich mit einem Schlachtermesser richtig verteidigen könnten, wenn der Rassenkrieg durchs Land fegte. »Nicht nur reinstechen«, gab Manson seinen Studenten mit auf den Weg. »Die Klinge danach hochziehen und drehen«, um so die größtmöglichen inneren Verletzungen herbeizuführen. Doch Blackie ließ den kleinen Satan zappeln. Nichts war in den vorigen Monaten von der Prophezeiung der vier Beatles eingetreten. Es gab sie einfach nicht, die schwarzen Massaker am weißen Establishment. Die Cowboys und Cowgirls aus Chatsworth mussten es sein, die Blackie zeigen sollten, was er zu tun habe. Jetzt drehte sich an diesem 8. August alles um ein wahnsinniges Fanal.
Sheriff Charles Manson hatte Tex, seinen Deputy auf der Ranch, am Nachmittag beiseitegenommen und ihn instruiert: Er solle mit einigen der Mädchen in einem Haus im Cielo Drive in den Hollywood Hills, das beiden bekannt war, alle anwesenden Personen so grausam wie möglich töten, den Opfern am besten noch die Augen herausreißen und sie an einen Spiegel hängen. Mit dem Blut sollten sie Botschaften an den Wänden hinterlassen. Als Tex mit Lady, Marnie und Cindy kurz vor Mitternacht abfahrbereit im gelben 1959er-Ford an der Front der Westernkulisse entlangblubberte, schaute Manson noch einmal für eine letzte Instruktion für die Mission ins Seitenfenster hinein:
»Denkt daran, ein Zeichen zu hinterlassen. Macht etwas Hexisches!«
Dann rollte der Ford auf der sandigen Zufahrt an der Pferdekoppel vorbei und bog nach rechts auf die Santa Susana Pass Road zu seinem höllischen Trip in Richtung Hollywood Hills ab. Die vier apokalyptischen Reiter waren unterwegs. Wenige Stunden später war in Los Angeles nichts mehr wie zuvor.
OAKLAND
22. Oktober 1969
Diese Kalkleisten von Blood, Sweat & Tears können auch richtig gute schwarze Musik machen, dachte sich Bob Morris, als er sich durchs Radioprogramm drückte und die alarmierenden Bläser den Song »Spinning Wheel« eröffneten. Er grinste kurz in sich hinein, wie rassistisch auch er sein konnte. Er setzte den Blinker und bog vom Sunset Boulevard nach rechts in den Laurel Canyon ein. Dort oben in der Künstlerenklave hatte es in der Nacht zuvor ein weiteres Gemetzel gegeben.
Aber über Rassismus musste ihm, dem schwarzen Aufsteiger, doch auch keiner etwas erzählen. Bobby, wie ihn alle seit der Grundschule nannten, hatte die gesamte Klaviatur der Diskriminierung kennengelernt. Seine Eltern waren in den 1950er-Jahren aus dem tiefen Süden, aus Alabama, nach Oakland gegenüber von San Francisco gezogen. Sein Vater in Hoffnung auf einen Job in der Industrie. Auch war der Ku-Klux-Klan jetzt weit, weit weg. Es langte für seinen Daddy dann doch nur zum Hafenarbeiter. Seine Mutter war anderweitig beschäftigt, nämlich mit neun Kindern. Bobby war der Jüngste. Zwei seiner Brüder saßen im Knast. Weiße Polizisten hatten sie einfach von der Straße weg eingesackt. Seine Mutter sagte, weil sie schwarz seien. Tatvorwurf: schwarz?! Der kleine Bobby dachte sich: Was ist daran eigentlich ein Verbrechen?
Oakland entwickelte sich in den 1960er-Jahren endgültig in einen Müllhaufen aus Kriminalität, sozialen Spannungen, Rassenunruhen, schwarzen Gettos, korrupten und voreingenommenen weißen Polizisten und Arbeitslosigkeit. Nur zwei von Bobbys Geschwistern hatten einen Job gefunden, der Rest gammelte zu Hause herum oder versuchte sich am College. Eine Schwester ging anschaffen. Die Wohnsituation war asozial. Ohne Aussicht auf Ausstieg oder Aufstieg in die Mittelklasse. Und ja: Der Morris-Clan gehörte zu den schwarzen Familien, die sich gelegentlich von Hundefutter ernähren mussten. War im Kilopreis einige Cents billiger. So konnte er auch aussehen, der amerikanische Traum.
Doch war da nicht dieses Versprechen: dass es jeder schaffen kann, wenn er sich nur anstrengte? Bobby glaubte daran. Er wollte für wirkliche Gerechtigkeit sorgen, die etwas anderes war als die weiße Gerechtigkeit, wie er sie kennengelernt hatte. Bobby war ehrgeizig und bissig in der Schule. Erst versuchte er sich noch einige Zeit in Gelegenheitsjobs und am College. Doch dann ließ er sich seinen Afro scheren, damit die Cop-Kappe passte, und schraubte mal eben eine Zahl nach oben: Mitte der 60er-Jahre stellten Afroamerikaner nur wenige von Oaklands über sechshundert Polizisten – Bobby war dann wieder Bob, wie es im Pass stand, und die schwarze Nummer 16.
Gesprochen hat während der Ausbildung keiner über Rassismus. Doch er war überall. Sobald sich Schwarze aus dem Sport, der Unterhaltungsbranche und, wie sein Vater es nannte, den »Negro Jobs« herauswagten, betraten sie vermintes Gelände. Zusammen nach der Schicht mit den weißen Kollegen duschen? Vergiss es! Die Kalk-Cops rotteten sich immer zu fünft zusammen und standen dann im Block unter den exakt fünf Brausen. Wenn es Bob Morris mal als erster unter die Dusche schaffte, blieben die vier Brausen neben ihm so lange frei, bis er das Handtuch um seine Hüfte geknotet und die Kabine verlassen hatte. Die angesäuerten Kollegen schlurften dann missmutig an ihm vorbei.
Als Bobby Seale und Huey Newton 1966 die Black Panther Partei ins Leben riefen und mit einer schwarzen Bürgerwehr die Polizeigewalt überwachen wollten, waren für Bob Morris in Oakland die Messen gelesen. »Deine« Leute kontrollieren »unsere« Arbeit, gaben ihm die weißen Kollegen eindeutig zu verstehen. Das Schweigen seines weißen Partners im Streifenwagen nahm unerträgliche Formen an. Er nannte ihn und die anderen Schwarzen jetzt auch »Blackie«, eine fast niedliche Form der Unterscheidung, die Bob später in Los Angeles an die Wand eines Mordhauses geschmiert lesen sollte. Geschrieben mit dem Blut eines der Opfer.
Von wegen also Summer of Love. Bob Morris packte seine fünf Sachen, darunter seinen verdammten »Negro Ass«, wie es sein weißer Kollege forderte, und wechselte 1967 zum Los Angeles Police Department, dem LAPD. Dafür gab es übrigens einen weiteren guten Grund. Die Megacity hatte gerade den Watts-Aufruhr überstanden. Die Revolte hatte tiefe Wunden bei Schwarz und Weiß gerissen. Die Rassenunruhen 1965 im südlichen L. A. hatten innerhalb von sechs Tagen vierunddreißig Todesopfer sowie über tausend Verletzte gefordert. Und eines der Todesopfer hieß: Morris. Es war Bobs älterer Bruder Abraham. Der kleine Bruder war auch deswegen nach L. A. gekommen. Abrahams Freund hatte Bob gesteckt, was als Gerücht die Runde machte: dass sein Bruder in einem Geschäft eingesperrt gewesen sei und die weißen Cops mit gezogenen Pistolen feixend von draußen zugesehen hätten, wie die Flammen ihn langsam, aber sicher kross durchgrillten. Bobs Flucht nach L. A. war eine Mission. Er wollte die Schweine in den eigenen Reihen ausfindig machen.
Das Fanal für die »Watts Riots« war eine umstrittene Polizeiaktion. Auch in L. A. waren neunundneunzig Prozent der Cops Weiße, die die Afroamerikaner brutal behandelten, sie rassistisch beleidigten und sogar schwarze Frauen vergewaltigt haben sollen. Der aufgestaute Frust der Schwarzen entlud sich im August 1965 mit geplünderten und brennenden Geschäftsgebäuden und Gewerbebetrieben. Die Polizei nahm daraufhin rund viertausend Schwarze fest. Die Zerstörungswut hatte sich in diesen heißen Augusttagen 1965 tief ins kollektive Bewusstsein der weißen Los Angelenos im wahrsten Sinne des Wortes »eingebrannt«. Vielen an der strahlenden Westküste war jetzt klar, dass der schwarze Mann nicht nur untertäniger Dienstleister war, sondern auch die gesellschaftlichen Wände richtig zum Wackeln bringen konnte, wenn er denn ernst machte.
Also drückte Morris an diesem sonnigen Oktobertag seinen linken Zeigefinger von unten an den Plastikhebel des Blinkers, schlug mit der linken Hand den Lenker nach rechts, schaltete runter in den zweiten Gang und ließ seinen roten Ford Mustang, den er als Zivilbulle benutzen durfte, den Laurel Canyon hochblubbern. Er passierte den Countrystore und schraubte sich immer höher in die hügelige, ländliche Wohngegend. Sie brauchten da oben in einem Blockhaus seine Hilfe. Vier Leichen einer aufstrebenden Popband lagen dort, drapiert wie in einem Horrorfilm. Und die Black Panther schienen auch dort ihre Spuren hinterlassen zu haben. Shit, dachte Morris, sollten seine Leute tatsächlich für diesen ganzen Wahnsinn verantwortlich sein?
NEUER PLANET
21. Juli 1969
Es war der Tag nach der Mondlandung. Am 21. Juli 1969, einem Montag, betrat endlich Mira Cooper ihren neuen Planeten. Er dürfte ihr mindestens so bizarr vorgekommen sein wie das, was die US-Astronauten Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin da oben zu sehen bekamen. Schon bald hatte an diesem heißen Julitag jemand angehalten, ein Pärchen in einem umgebauten Buggy. Der Typ hieß Clem, hatte schlechte Zähne und blonde Haare, die durch den Fahrtwind wild und zerzaust waren. Seine Jeans war speckig und mit Ölflecken übersät, eine Weste hing um den nackten, Miras Ansicht nach beeindruckenden Oberkörper. Neben ihm saß ein schwarzhaariger Frechdachs mit schwarzer Ballonhose und schwarzem Hemd, das sie über ihrem Bauchnabel oder unterhalb ihrer Brüste, je nach Sichtweise, zusammengeknotet hatte. Sie war keine Schönheit, aber trotzdem ein Hingucker, fand jedenfalls Mira. Allein schon wegen dieser leichenhaften Blässe, die sie sowohl im Gesicht als auch am restlichen sichtbaren Körper trug.
»Hey, Sister«, rief Lady aus dem offenen Wagen, »sollen wir dich mitnehmen?«
»Ja, ich will hoch nach Frisco.«
»Frisco, da kommen wir doch irgendwie alle her«, entgegnete Lady vorlaut. Was das eine mit dem anderen zu tun hatte, leuchtete Mira im ersten und auch im zweiten Moment nicht wirklich ein.
»Hey, ernsthaft. Ich will in den Norden.«
»Püppie, da bist zu zwei Jahre zu spät«, grinste Clem sie an. Und zwirbelte sich mit der rechten Hand am Kinn seinen Bart vor Freude: weil ihm mit diesem Spruch neben der tatsächlichen Botschaft implizit zudem der indirekte Hinweis darauf gelungen war, dass der Summer of Love doch aus und vorbei war. »Pass auf: Morgen wollen wir sowieso nach Santa Barbara. Liegt auf dem Weg. So lange kommst du mit uns zur Ranch. Wir sind da richtig viele. Alles Leute wie wir.«
Mira Cooper hatte alle Zeit dieser Welt. Und hier bot sich nun eine Mitfahrgelegenheit. Das mondäne Santa Barbara, dieses Palmen- und Strandparadies am Pazifik, klang auch nicht schlecht. Also schlüpfte sie hinter dem Beifahrersitz vorbei auf die Rückbank. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Aber ein Riesensprung in die Hippiehölle.
Aus dem Radio, das Lady jetzt wieder lauter drehte, offerierte Neil Diamond seinen Sommerhit. »Sweet Caroline« war ein Supersong, fand Mira. Und dieser Typ sah auch wirklich klasse aus! Sie lehnte den Kopf zurück an die Sitzbank und schloss die Augen. Sie träumte von etwas, von dem Mädchen wie sie auch wirklich nur träumen konnten. Als der Fahrer schließlich nach rechts in den Topanga Canyon Boulevard abbog, war Mira Cooper endgültig auf dem Weg zu ihren eigenen Mondlandung.
Der Buggy mit dem offenen VW-Motor knatterte den Boulevard hoch und passierte nach nur wenigen Meilen eine Abzweigung in die Topanga Canyon Road. Nur sechs Tage später sollte Lady hierher mit drei anderen zurückkehren und tatsächlich in die Road abbiegen, um dort einen Bekannten zu besuchen. Ein Besuch, der ein unerwartetes Ende nehmen sollte. Doch davon hatte in diesem Moment keiner der drei, die sich da vom Fahrtwind ihre Haare zerzausen ließen, auch nur eine Ahnung. Sie schlüpften unter dem Ventura Freeway hindurch, passierten den Canoga Park, rollten durch Chatsworth und bogen am Ende nach links auf die schmalere Santa Susana Pass Road ein.
Plötzlich eröffnete sich für Mira eine völlig neue Landschaft, nämlich eine ländliche, hügelige, ohne sichtbare Bebauung. Fast so, wie sie es aus Westernserien wie »Bonanza« kannte. Als der Buggy nach nur wenigen Hundert Metern nach links auf ein staubiges Grundstück einbog, war sie plötzlich tatsächlich in der Kulisse einer Westernserie angelangt. Aus dem Radio schrie der Beatles-Sänger Paul McCartney irgendetwas wie »Helter Skelter«. Was für ein Blödsinn, dachte Mira noch. Doch da trat Clem bereits auf die Bremse. Trockener Staub wirbelte hoch und hüllte den Buggy für einige Sekunden ein. Mira musste husten.
Die Szenerie: zur linken Seite direkt an der Auffahrt eine große Pferdekoppel, dahinter erstreckten sich einige Holzställe, offenbar um die Tiere unterzubringen. Direkt an der Santa Susana Pass Road, mittig zwischen den beiden Auffahrten von beiden Seiten, standen ein Wohnwagen und ein Klein-Truck mit einer Werbetafel: »Spahn Movie Ranch«. Clem hielt direkt vor einem Plankenweg, in dessen Flucht sich einige Holzbaracken wie in einem alten Westernstädtchen befanden. Er stellte den Buggy so ab, wie es einst die Cowboys mit ihren Pferden taten. Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Miras Blick erfasste eine nachgebaute Bestattungshalle, ein Kutschenhaus, ein Gefängnis, ein Rock City Café und einen Long Horn Saloon. Davor ein durchgehender hölzerner Plankenweg. Schaute sie dort entlang weiter nach hinten, stand da abgetrennt und einige Meter entfernt auf einer kleinen Anhöhe ein separates Holzhaus, von dem die weiße Farbe bereits erheblich abgeblättert war. Hinter der Gebäudefront dieser Westernfantasie, in diesem Moment aber für Mira Cooper noch nicht erkennbar, waren weitere Holzbauten angeflanscht, deren schmuddelige Matratzen sie schon sehr bald kennenlernen sollte.
Es roch nach Pferden und deren Mist. Und dann war da noch dieses Aroma, wie es nur altes Holz ausdünstet, wenn es Sonnenstrahlen und Hitze ausgesetzt ist. Mira gefiel das. Beim Gang auf dem Plankenweg, den sie wählte, um den Schatten zu genießen, krochen nacheinander wie lauernde Spinnen Mädchen und junge Frauen aus den Gebäuden, um sie zu begrüßen. Meist mit einem schnöden »Hi!«, gelegentlich nur mit einem Lächeln oder einer winkenden Hand oder gespreiztem Mittel- und Zeigefinger. Sollte so etwas wie »Peace« bedeuten. So lernte sie einige der Western-Protagonisten schon einmal kennen, deren Namen sie später nach und nach erfahren sollte: Marnie, Susu, Cindy, Fake, Cherry, Tex, Amy, Sappy und all die anderen. Kennengelernt hat sie auf dem nur kurzen Gang entlang der Bohle auch einige der etwa 523 Millionen Bremsen, die sich wegen der Pferde auf der Ranch zusammengerottet hatten.
Am Ende des Plankenweges kam aus Richtung des etwas abseits stehenden Hauses eine rothaarige, dünne Blasse in einem fast durchsichtigen weißen Sommerkleid, unter dem sie ganz offensichtlich nichts anderes trug, auf sie zu.
»Hi, ich bin Mira«, eröffnete der Neuling.
Der zierliche Rotschopf blinzelte in die Sonne, gab sich freundlich und wirkte ätherisch. Dafür fiel ihre Entgegnung umso beunruhigender aus.
»Na klar. Das wirst du aber nicht bleiben. Ich bin Speaky.«
HUFGETRAPPEL
30. Oktober 1969
Die Methoden der Polizei folgten einem gewissen Zeitgeist. Und der setzte Ende der 1960er-Jahre wieder vermehrt darauf, bei Ermittlungen zunächst unbeirrt auf simple, naheliegende Erklärungsansätze zu setzen. Einen davon bekamen seit jeher die amerikanischen Medizinstudenten im ersten Semester eingebläut: Wenn ihr in Wyoming, einem Pferdeland, an der Koppel steht, Hufgetrappel hört und in der Ferne meint, ein großes Tier mit schwarz-weißen Streifen zu sehen: Geht in erster Linie doch davon aus, dass es sich um ein Pferd handelt. Und eben nicht etwa um ein afrikanisches Zebra, was dann selbst die blödesten Erstsemestler für sich weiterkombinieren konnten. Den angehenden Ärzten sollte damit ein Grundmuster klar werden, mit dem sie Symptome einordnen und erste Diagnosen stellen konnten: Geht bei einem Befund zunächst immer von der wahrscheinlichsten und naheliegendsten Erklärung aus und lasst euch nicht von einer exotischen Nebensächlichkeit, die wahrscheinlich nur ein Schein ist, auf die falsche Spur bringen. Also: Kommt jemand hüstelnd in die Praxis, dann solltet ihr nicht gleich in Richtung Lungenkrebs analysieren. Ein Husten ist ein Husten ist ein Husten.
Auch im Journalismus und bei der Polizei besann man sich Ende der 1960er-Jahre wieder häufiger auf diese Tugend, nicht gleich als Erstes nach dem Ungewöhnlichen zu suchen. Während seiner Ausbildung hatte es Bob Morris bei mehreren Fallbeispielen mit diesem Ansatz zu tun. Er hielt ihn grundsätzlich für richtig. Doch was bedeutete das nun für ein inzwischen paranoides Los Angeles im Herbst 1969?
»Wieder Blutbad im Canyon«, »Popquartett massakriert«, »Angst und Schrecken in L. A.«, »Vier Leichen im Blockhaus« lauteten einige der jüngsten Schlagzeilen in den Zeitungen, nachdem die Polizei die wesentlichen Fakten an die Presse weitergegeben hatte. Die grausigsten Details hielt die Polizei allerdings zurück. Am Spiegel hängende Augäpfel waren nichts für den Frühstückstisch.
Bob Morris saß in seinem Büro, schlürfte einen Kaffee und sah aus dem Fenster auf die Skyline des relativ kleinen Banken- und Bürozentrums der Innenstadt, durch den Smog eingehüllt in flauem, flirrendem Licht. Neben den üblichen toten Nutten, die seine Kollegen regelmäßig aus den Hängen am Mulholland Drive fischten, den immer wiederkehrenden Leichen, die das erbarmungslose Drogenmilieu in Hollywood ausspuckte, oder den klassischen Opfern, die ein Raubüberfall auf eine Tankstelle oder ein Geschäft forderte, stachen in den jüngsten Wochen vier Fälle heraus. Bei denen seine bisher ermittelnden Kollegen zwar schon Parallelen erkennen konnten, aber nicht von denselben Tätern ausgingen, sondern allenfalls von Nachahmertaten.
Bob Morris’ Chef, Deputy Inspector Joe Roscoe, war ein Rassist. Er war schon bei dem Watts-Aufruhr dabei und vertrat eine Theorie, die nicht so selten unter L.-A.-Polizisten verbreitet war: dass die Schwarzen ein ganz besonderer Schlag Mensch wären und deswegen auch einer besonderen Behandlung bedürften. Sie nannten das »special treatments« oder, sarkastisch angelehnt an die Vor





























