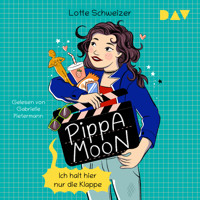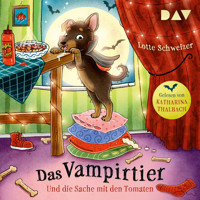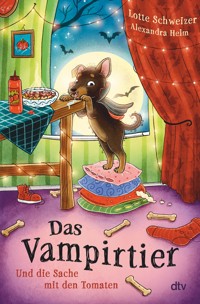9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Film ab für die Chaospraktikantin! Bei der 14-jährigen Pippa ist einiges los: Zu Hause streiten sich ihre Eltern täglich, weshalb Pippa auf dem Hausboot ihres Opas im Exil lebt, und ihre beste Freundin hat sich für ein Austauschjahr in die USA verabschiedet und kann Pippas Katastrophen nur per WhatsApp begleiten. Aber dann landet Pippa für ihr Schulpraktikum am Set eines Films mit dem süßen Teenie-Superstar Freddy - der absolute Jackpot! Eigentlich. Wäre da nicht ihre Erzfeindin und Oberzicke Cara, die just bei der gleichen Produktion ihr Praktikum macht. Und würde Pippa nicht in jedes Fettnäpfchen treten. Jetzt muss sie die gestresste Regisseurin bei Laune halten, einen TikTok-Kanal aufbauen und sich um das Lampenfieber des Nachwuchsstars kümmern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Point of view: Du machst ein Praktikum am Filmset und alles geht schief
In Pippas Leben ist gerade viel Luft nach oben: Weil sich ihre Eltern zu Hause ständig streiten, lebt sie auf dem Hausboot ihres Opas, und ihre beste Freundin hat sich für ein Austauschjahr in die USA verabschiedet. Dann landet Pippa für ihr Schulpraktikum mitten in Berlin an einem Filmset mit dem süßen Superstar Freddy – der absolute Jackpot! Eigentlich. Wäre da nicht ihre Erzfeindin Cara, die dort ebenfalls ihr Praktikum macht. Und würde Pippa nicht in jedes Fettnäpfchen treten. Jetzt muss sie die gestresste Regisseurin bei Laune halten, einen erfolgreichen TikTok-Kanal aufbauen und sich um das Lampenfieber des süßen Nachwuchsstars kümmern … Film ab für die Chaospraktikantin!
Von Lotte Schweizer ist bei dtv außerdem lieferbar:
Detektei für magisches Unwesen – Drei Helden für ein Honigbrot (Band 1)
Detektei für magisches Unwesen – Da braut sich was zusammen (Band 2)
Detektei für magisches Unwesen – Aufruhr in der Bonbonfabrik (Band 3)
Das Vampirtier und die Sache mit den Tomaten (Band 1)
Lotte Schweizer
Pippa Moon
Ich halt hier nur die Klappe
Mit Illustrationen von Isabelle Metzen
Für Christa & Ken
Danke, dass ihr mein Günther gewesen seid
Kapitel 1
»Man ist nie zu klein, um etwas Großes zu bewirken, pflegt meine beste Freundin Mell zu sagen. Ohne ihre täglichen Weisheiten wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Deshalb möchte ich ihr diesen Oscar widmen! Ihr und natürlich meinem Opa Günther, der mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben. Oh, und meiner Maus Obi-Wan, die auch in schweren Zeiten stets an meiner Seite war. Danke, dass ihr immer an mich geglaubt habt!«
Ziemlich gut meine Rede, finde ich. Gänsehaut pur. Tiefgründig, aber nicht kitschig und genau die richtige Länge. Ich habe mir sogar ein paar Tränen der Rührung rausgedrückt. Natürlich nicht zu viele, ich will ja nicht wie eine Heulsuse wirken. Ich spüre förmlich das warme Scheinwerferlicht auf meiner Haut und die Blicke der Zuschauerinnen und Zuschauer: Hollywoods Elite, die mir begeistert applaudiert. Es gibt sogar Standing Ovations. Klar, ich war ja auch umwerfend in meiner Rolle als Prinzessin Leia in der Neuverfilmung von Star Wars. Ich verneige mich und sage demütig: »Danke! Vielen Dank! Ich liebe euch alle!«
»Wir lieben dich auch, und wenn jemand den Oscar für die blühendste Fantasie verdient, dann eindeutig du, Pippa!«, sagt eine Stimme hinter mir.
Opa Günther steht schmunzelnd in der Tür.
Verlegen lasse ich den Plastik-Oscar sinken, den ich gerade noch dramatisch in die Höhe gehalten habe. Oberpeinlich. Das ist schon das zweite Mal diese Woche, dass Günther mich dabei erwischt, wie ich in einem seiner Kleider vor dem Spiegel stehe und eine Dankesrede probe, für die es nicht den Hauch eines Anlasses gibt. Das letzte Mal, als Günther hereinplatzte, nahm ich gerade einen Friedensnobelpreis entgegen, weil ich Mathe von den Lehrplänen dieser Welt verbannt hatte. Wenigstens sitzen heute nicht meine alten Stofftiere (die ich offiziell schon vor einigen Jahren an einen Kindergarten gespendet habe, inoffiziell aber immer noch mit ins Bett nehme) in den Publikumsrängen.
Langsam und mit hochrotem Kopf drehe ich mich zu meinem Opa um. Er steckt in Kniestrümpfen, Unterhose und Unterhemd und trägt dazu lange Opernhandschuhe aus schwarzem Satin. Auf dem Kopf hat er eine Lockenperücke.
»Ich war auf der Suche nach dem Kleid mit Perlenbesatz am Kragen. Und wie ich sehe, bin ich fündig geworden«, sagt er und lässt den Blick amüsiert an mir auf- und abschweifen.
»Mann, Op… Ich meine … Günther! Kannst du nicht klopfen?« Seit Günther vor einem Jahr mit der Schauspielerei angefangen hat, ist es strengstens untersagt, ihn mit »Opa« anzusprechen. Echt, darauf steht Höchststrafe. Schließlich sieht er für einen Opa viel zu jung aus, findet er. Stimmt auch, er sieht wirklich nicht aus wie 72. Er geht als glatte 69 durch!
»Kann ich schon, aber dann würde ich ja Auftritte wie diesen hier verpassen!« Günther lässt sein rasselndes Lachen ertönen. Immer wenn er lacht, kann man die Zigarillos hören, die er schon fast sein ganzes Leben raucht.
»Raus mit dir!«, rufe ich und schiebe ihn aus dem Zimmer. »Schon gut, schon gut! Aber – auch wenn es dir wirklich hervorragend steht – ich muss dich leider bitten, mir mein Kleid wiederzugeben. Ich hab’s eilig.«
»Jaja, gleich«, antworte ich und schließe die Tür hinter ihm. Ich stelle den Oscar wieder ins Regal. Und nach einem letzten Blick in den Spiegel tausche ich das Kleid gegen meinen Schlafanzug. Als ich in die Wohnküche komme, hat Günther inzwischen auch seine Glitzerpumps an. In der einen Hand hält er einen langen Zigarettenhalter, genau so einen, wie ihn Filmdiven in alten Schwarz-Weiß-Filmen oft benutzen. Er dreht sich im Kreis und breitet die Arme aus. »Na, wie sehe ich aus?«
»Toll«, sage ich und meine es auch so. »Aber mir wär’s trotzdem lieber, wenn du dir noch etwas überziehst!«
Ich reiche ihm lachend das Kleid. Günther sieht an sich herab. »Ach du liebe Güte, jetzt wäre ich fast in Unterhosen auf die Bühne gegangen.« Er mustert meinen Pyjama und zieht die Augenbrauen hoch. »Kommst du heute gar nicht mit?«
Opa Günther hat die Hauptrolle in einem Stück in dem kleinen Theater bei uns im Kiez ergattert und das macht ihn mächtig stolz. Deshalb erzählt er wirklich JEDEM davon. Als er zum Beispiel gestern eine Packung Zigarillos im neuen Späti kaufte, prahlte er vor dem Besitzer: »Mustafa, eine Hauptrolle nach nur einem Jahr als Schauspieler – das muss mir erst mal jemand nachmachen!« Manche mögen’s heiß war der Lieblingsfilm meiner Oma gewesen, und dass er ausgerechnet in diesem Stück seinen großen Auftritt haben wird, macht Opa besonders glücklich.
In der Komödie werden die beiden Musiker Jerry und Joe Augenzeugen eines Mordes und tauchen unter, indem sie sich – als Frauen verkleidet – einer Damenmusikgruppe anschließen.
»Und stell dir vor, Mustafa«, hat Opa begeistert gesagt, »Ich spiele einen davon: Jerry, der sich dann später als das Fräulein Daphne ausgibt!«
»Das macht dann bitte 4,50 Euro, Günni«, war Mustafas knappe Antwort. Tja, es ist leider nicht jeder so beeindruckt, wie Opa es sich erhofft. Aber ich wette, wenn das Stück in wenigen Wochen Premiere feiert, schwebt Oma mit einer großen Tüte Popcorn auf einer Wolke über dem Theater und beobachtet, wie Günther in einem ihrer alten Kleider das Publikum zum Lachen bringt. Das Stück wird ganz sicher ein Erfolg. Ich habe noch fast keine der Proben verpasst und falle jedes Mal wieder vor Lachen vom Stuhl. Aber heute bin ich zu müde, um Opa zu begleiten, denn obwohl ich mich bei Günther auf dem Hausboot total wohlfühle, waren die letzten Wochen anstrengend für mich. Vor allem emotional. Immerhin wird man nicht alle Tage von seiner besten Freundin im Stich gelassen, während gleichzeitig zu Hause quasi die Welt untergeht. Also schüttele ich als Antwort auf Günthers Frage den Kopf.
Opa zwängt sich ächzend in das Kleid.
»Pippa, Schätzchen, hilfst du mir mal mit dem Reißverschluss?«, fragt er und rückt sich die Perücke zurecht. Während ich an dem Reißverschluss herumfuhrwerke, hüllt er sich mit zwei Sprühstößen aus einer überdimensionalen Parfümflasche in eine Duftwolke. Jetzt riecht er nach einer Mischung aus Tabak und Omas Chanel No 5. Ich atme seinen Duft tief ein. Genau so riecht Geborgenheit für mich.
Die Kuckucksuhr über der Küchenzeile fängt an zu zwitschern. »Ach herrje, ich bin viel zu spät dran!«, stellt Günther fest und schnappt sich seine Handtasche. »Bestell dir etwas zu essen, ja? Am Kühlschrank hängt ein Flyer vom Lieferservice. Und eine neue Packung Cheddar-Cheese-Pringles hab ich dir auch mitgebracht. Ich bin nicht vor halb zwölf zu Hause, schätze ich. Wir sehen uns morgen! Und sei nicht zu brav, hörst du?«
»Dein Reißverschluss ist doch noch gar nicht zu!«, rufe ich ihm noch nach, aber da ist er schon aus der Tür geschlüpft und stöckelt über den Bootssteg.
Günther sagt, ein echter Schauspieler muss sich mit seiner Figur identifizieren, sie fühlen, eins mit ihr werden. Deshalb macht er sich auch bereits zu Hause zurecht und nicht erst im Theater. Er war schon als Daphne einkaufen, beim Yoga und im Kino.
Meine Großeltern waren schon immer echte Theater- und Filmfans, aber erst nach Omas Tod hat Günther selbst angefangen zu schauspielern. So richtig mit Unterricht und Vorsprechen und so! In Pasulkes kleinem Theater hat er seitdem schon den Pudel in Goethes Faust gespielt und war ein Baum in Shakespeares Sommernachtstraum. Ein sehr talentierter Baum, wie es scheint, sonst hätte Pasulke ihm wohl kaum eine Hauptrolle angeboten.
Weil ihn die Wohnung zu sehr an Oma erinnert hat (und er seine Rente lieber für Schauspielunterricht als für teure Miete auf den Kopf haut), ist Günther kurzerhand auf sein altes Hausboot gezogen. An ein paar Stellen musste er den abgeplatzten himmelblauen Lack etwas ausbessern, ansonsten ist die alte Dame aber trotz ihres betagten Alters in einem super Zustand und Günther kann sich ein Leben an Land inzwischen gar nicht mehr vorstellen.
Ich hole Opas – beziehungsweise Daphnes – roten Nagellack aus dem Bad und die Chips aus dem Küchenschrank. Zwei Stück zerbrösele ich und streue die Krümel vor das kleine Loch in der Holzwand neben dem Sofa. Dann mache ich es mir auf der Couch bequem und schalte den Fernseher ein. Während die Videokassette zurückspult (ja, richtig gelesen: Videokassette!), stopfe ich mir einen Stapel Pringles in den Mund. Im Zeitalter der Streamingdienste erscheinen DVDs ja schon veraltet, aber Günthers Technik-Equipment wäre in einem Museum definitiv besser aufgehoben. Na ja, immerhin hat er meinen Lieblingsfilm da. Ich drücke auf Play.
»Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis …«, murmele ich, noch bevor der Text auf dem Bildschirm erscheint. Und dann summe ich feierlich die Titelmusik mit, während ich mir die Fußnägel lackiere. Falls das noch nicht deutlich wurde: Ja, ich bin ein Star-Wars-Fan. Und ja, ich habe eine kleine Obsession. Immerhin habe ich Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung schon siebzehn Mal gesehen. Ein kompletter Nobody wird zum gefeierten Retter des Universums, ich meine, wie cool ist das bitte? Vielleicht wird aus mir ja eines Tages auch noch ein Star, wer weiß. In meinem Fall müsste der Film dann wohl School Wars: Episode IV – Die Hoffnung stirbt zuletzt heißen.
Als auf der Mattscheibe Prinzessin Leia gefangen genommen wird, bemerke ich in den Augenwinkeln eine Bewegung.
»Guten Abend, Obi-Wan!«, begrüße ich die Maus, die vorsichtig ihre Nase aus dem Loch in der Wand schiebt und an den Chipskrümeln knabbert. Obi-Wan ist mein hochgeheimes Haustier. Ich habe ihn (eine genauere Untersuchung ergab, dass es sich eindeutig um einen Mäuserich handelt) adoptiert, als er eines Abends hinter einem losen Brett in der Wohnküche hervorhuschte. Weil ich nicht weiß, wie Günther zu Mäusen steht, habe ich ihm Obi-Wan sicherheitshalber verschwiegen. Am Anfang war er ziemlich schüchtern, aber mittlerweile ist er total zutraulich. Ich habe ihm sogar schon eineinhalb Kunststücke beigebracht: Wenn er dafür ein Stück Käse bekommt, gibt er Pfötchen. Sehr beeindruckend für eine Maus, oder etwa nicht? Außerdem kann er auf den Hinterbeinen sitzen. Das mit den Hinterbeinen ist das halbe Kunststück, weil ich unsicher bin, ob das nicht vielleicht alle Mäuse können. Muss ich bei Gelegenheit mal googeln.
»Na, komm her!«, flüstere ich und klopfe sachte auf meinen Schoß. Obi-Wan blinzelt mich aus seinen schwarzen Knopfaugen an, dann kommt er zu mir gehuscht. Er setzt sich auf meinen Schoß, ich streichele über den klitzekleinen Mäusekörper und wir schauen zusammen Star Wars. Und das erste Mal seit Wochen kann ich mich entspannen. So sehr, dass ich längst eingeschlafen bin, als Han Solo das Raumschiff von Darth Vader in den freien Raum hinauskatapultiert und Günther wieder nach Hause kommt.
Kapitel 2
»Ist das dein Ernst?!« Ma steht neben dem Toaster und hält eine leere Brottüte in die Luft.
»Was?«, fragt Paps und knöpft seinen obersten Hemdknopf zu.
»Hast du die letzte Toastbrotscheibe gegessen?«, blafft Ma. Paps zuckt mit den Achseln.
»Ob du die letzte Toastscheibe gegessen hast, habe ich dich gefragt!«
»Kann schon sein«, murmelt Paps.
»Typisch! Das ist wieder mal so was von typisch für dich«, ruft sie und stopft die leere Tüte in den Mülleimer. »Du denkst immer nur an dich! Kannst du mir verraten, was ich jetzt frühstücken soll?«
Ich sitze am Esstisch, löffele meine Frühstücksflocken und versuche möglichst nicht aufzufallen.
Wegen Szenen wie dieser lebe ich im Exil bei Opa Günther. Seit drei Wochen schon. Heute bin ich nur hier, um mein Biobuch zu holen. Das brauche ich nämlich gleich in der ersten Stunde, und weil ich das Buch jetzt schon drei Wochen in Folge nicht dabeihatte, gab’s Ärger mit dem Froschkönig, meinem Klassenlehrer. Der hat mir sogar mit einem Eintrag ins Klassenbuch gedroht. Weil ich normalerweise zu den vorbildlichen Schülerinnen gehöre, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was überhaupt passiert, wenn man so einen Eintrag bekommt. Aber so wie der Froschkönig geguckt hat, kann es nichts Gutes sein. Deshalb sitze ich also hier, in der Wohnung meiner Eltern, und muss einem Streit über Weißbrot lauschen.
Seit einem halben Jahr zanken die zwei sich pausenlos. Ich glaube, das hat irgendetwas mit diesem Zumba-Heini Marcus aus Mas Sportverein zu tun. Seit sie den kennt, nörgelt sie ständig an Paps herum und die beiden bekommen sich andauernd in die Wolle. Das hält kein Mensch aus. Aus diesem Grund habe ich die Flucht aufs Hausboot ergriffen. Auch wenn die Spree keinen nennenswerten Wellengang hat, leide ich immer noch etwas an Seekrankheit. Aber wenn ihr mich fragt, ist das das kleinere Übel (im wahrsten Sinne des Wortes), verglichen mit den beiden Streithähnen hier.
Man könnte meinen, dass Eltern einen Aufstand machen, strikte Verbote aussprechen und alles tun, um zu verhindern, dass ihre vierzehnjährige Tochter auf ein Hausboot zieht – zu einem jung gebliebenen Rentner, der von einer späten Karriere als Bühnenschauspieler träumt. Aber Ma und Paps sind zurzeit so mit sich selbst beschäftigt, dass sie eher erleichtert waren, mich für eine Weile aus dem Weg zu haben. Das nehme ich ihnen durchaus übel. Eigentlich sollte es nämlich nur eine Drohung sein, als ich sagte, dass ich meinen Koffer packen und zu Opa aufs Hausboot ziehen würde, wenn sie sich nicht bald mal wieder einkriegten. Aber statt der erwarteten Entrüstung und überschwänglichen Beteuerung, dass ihr einziges, heiß und innig geliebtes Kind SELBSTVERSTÄNDLICH bei ihnen zu wohnen habe, fragten sie bloß: »Ist das dem Günther denn recht?«
War es natürlich. Günther war sogar hin und weg von der Idee, mit seiner Enkelin eine WG zu gründen (ehrlich, er sagte WG!). Deshalb lebe ich nun also auf einer schwimmenden Nussschale – sein Hausboot ist nämlich echt winzig. Opa hat mir netterweise sein »Schlafzimmer« überlassen und schläft auf der Küchenbank, was ich ihm hoch anrechne. Sein Rücken weniger. Aber so ein Hausboot hat auch Vorteile: Jetzt im Sommer, wo ich auf dem Sonnendeck liegen und das Wetter genießen kann, kann ich mir kein besseres Zuhause vorstellen.
»Iss doch Cornflakes«, sage ich zu meiner Mutter, stopfe mein Biobuch in den Rucksack und stehe auf. Meine Eltern gucken mich an, als hätten sie einen Geist gesehen.
Paps zuckt zusammen. »Pippa, ich hab einen Moment lang vergessen, dass du da bist.«
Ma ringt sich ein Lächeln ab und tätschelt meinem Vater den Arm. Dann wirft sie einen flüchtigen Blick auf die Uhr. »Musst du nicht langsam los, Spätzchen?« Ich verdrehe zur Antwort bloß die Augen und verlasse die Wohnung. Ich kann meine Mutter bis in den Hausflur hören, wie sie Paps anfährt: »Das ist alles deine Schuld!«
Ich steige in den Fahrstuhl und lehne mich seufzend an die Wand. Am meisten nervt, dass sie versuchen ihre Probleme vor mir zu verstecken. Als wäre ich noch ein Baby. Dabei weiß ich längst, was Sache ist. Bin ja nicht blöd.
Ich hieve mich auf den Stromkasten am Ende der Straße, schlage die Beine übereinander und warte auf Mell. Mit dem Finger fahre ich über das kleine Herz mit unseren Initialen, das wir mit einem lila Edding auf den Kasten gekritzelt haben, und denke über meine Eltern nach.
Und dann fällt mir auf, dass ich vielleicht doch ein bisschen blöd bin. Denn Mell wird natürlich nicht kommen. Ich werfe einen Blick auf die Uhr und ziehe neun Stunden ab. Vermutlich geht sie gerade ins Bett. Seufzend mache ich mich allein auf den Weg zur Schule. Wozu hat man eigentlich eine beste Freundin, wenn die einen für ein ganzes Jahr im Stich lässt?
Vor einer Woche haben wir uns am Flughafen verabschiedet, Rotz und Wasser geheult und uns geschworen, dass wir jeden Tag mindestens dreimal telefonieren. Dann ist die treulose Tomate in ihren Flieger nach Los Angeles gestiegen und hat bisher nicht ein einziges Mal angerufen. Scheinbar ist ihr unsere Freundschaft nicht mehr wert als ein paar lausige WhatsApp-Nachrichten mit einem Haufen Fotos von ihr und ihrem Gastbruder Luke, der – wie sollte es anders sein? – aussieht wie der Star aus einem Teeniefilm. Wozu soll das überhaupt gut sein, so ein Austauschjahr in den USA? Was ist dort besser als hier? Nehmen wir zum Beispiel das Essen: Das ist schrecklich. Die frittieren da drüben alles! Sogar Schokoriegel. Na gut, wo ich jetzt so darüber nachdenke, klingt das eigentlich ziemlich genial … Aber wie dem auch sei – ich sollte mir einfach eine neue beste Freundin suchen. Dann kann Mell mal sehen, wie das ist, wenn man fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel. Das Problem ist nur, dass ich nicht die größte Auswahl habe, was beste Freundinnen angeht. Zum einen, weil ich sicher bin, dass es auf der ganzen Welt keine zweite Mell gibt.
Das hat mehrere Gründe:
Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten, was bedeutet, dass wir ziemlich viel (eigentlich alles) übereinander wissen. Zum Beispiel weiß ich, dass Mell sogar mit sieben Jahren manchmal noch ins Bett gepinkelt hat. Dieses Wissen habe ich, weil ich unglückseligerweise des Öfteren mit in besagtem Bett lag. Und Mell weiß über mich, dass ich als Kind dachte, Babys würden aus dem Bauchnabel kommen, und deshalb immer eine Murmel in den meiner Mutter gesteckt habe, weil ich auf keinen Fall ein Geschwisterchen haben wollte. Solche Geheimnisse schweißen zusammen.
Gemeinsam haben wir die größten Lachflashs. Ich liebe Mell, weil ihr Lachen meistens lustiger ist als der Witz selbst. Sie grunzt dabei nämlich wie ein Schwein – nicht wie ein kleines Ferkel, sondern wie eine ausgewachsene, 350 Kilo schwere Sau. Und dann stecken wir uns gegenseitig mit dem Lachen an und können unmöglich wieder damit aufhören. Erst recht nicht, wenn Mell dann auch noch die Limo aus der Nase schießt, was ziemlich oft passiert.
Mell ist unersetzbar, weil sie zu wirklich jeder Lebenslage einen Rat weiß. Sie ist eine einzige wandelnde Pinterest-Pinnwand voller Weisheiten.
Kurz gesagt: Es ist nicht einfach, mal eben so einen Mell-Ersatz aus dem Ärmel zu schütteln.
Zum anderen dürfte es sich eh schwierig gestalten, eine neue beste Freundin zu finden, weil ich in der Schule nicht gerade beliebt bin. Also, ich bin auch nicht unbeliebt oder so. Ich bin eher gar nicht existent. Das Ding ist, dass ich weder zu den Coolen gehöre noch zu den Losern. Ich bin irgendwo dazwischen und das macht es erst so richtig kompliziert. Weder die einen noch die anderen wissen, dass es mich gibt. Dabei bringe ich großes Potenzial mit, zu den Nerds zu gehören: Ich kann den Text von zweieinhalb Star-Wars-Filmen mitsprechen, gucke freiwillig Tierdokus, habe einen Großvater, der mehr Glitzeroutfits besitzt als Helene Fischer, und halte eine Maus als Haustier. Außerdem gehöre ich zu der Art Mädchen, die über ihren eigenen Schatten stolpert, deren Schnürsenkel sich andauernd in Rolltreppen verheddern und die sich beim Trinken grundsätzlich bekleckert, egal ob mit oder ohne Kohlensäure. Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen: Wahrscheinlich bin ich sogar für die Uncoolen zu uncool.
Als Mell noch da war, waren wir wenigstens gemeinsam einsam. Ich hab mich immer gewundert, wieso Mell auf der Beliebtheitsskala nicht längst nach oben geklettert ist. Immerhin gehört sie zu den Turnerinnen – und das ist bei uns an der Schule so etwas wie das Cheerleader-Team in amerikanischen Highschool-Filmen. Außerdem ist sie klug und witzig und interessant. Muss also an mir liegen, dass Mell nicht zu den beliebten Mädels gehörte.
Ich betrachte mein Spiegelbild im Schaufenster von Mustafas Späti, in dem ich regelmäßig meinen Chipsvorrat wieder auffülle. Praktischerweise liegt der Laden genau zwischen Günthers Hausboot und der Wohnung meiner Eltern. Über dem Eingang hängen immer noch die verschrumpelten Luftballons von der Einweihungsparty, obwohl die schon ein paar Monate her ist. Ich strecke meinem Spiegelbild die Zunge raus. Dabei fällt mir eins von Mells zahlreichen Talenten ein: Sie kann mit der Zunge ihre Nasenspitze berühren. Echt wahr! Ich hab dieses Kunststück leider erst zweimal gesehen, weil Mell sich ziert es vorzuführen. Sie findet, es sieht albern aus. (Was es übrigens auch tut.) Nachdenklich lege ich den Kopf schief. Ob ich das auch kann? Wäre doch gelacht, wenn Mell die Einzige mit verborgenen Talenten ist.
Ich stülpe meine Unterlippe um und schiebe meine Zunge noch ein Stück weiter vor. Und noch eins. Und noch eins. In Nanometerschritten nähert sie sich ihrem Ziel. Angestrengt schiele ich auf meine Nasenspitze. Nur noch ein kleines Stück, dann … Plötzlich klopft jemand von innen an die Scheibe und ich bekomme den Schock meines Lebens. Mustafa glotzt mich durch das Fensterglas an. Neben ihm stehen Cara und ihre Clique. Na super.
Hier einige Fakten zu Cara:
Sie geht in meine Parallelklasse.
Letztes Jahr hat sie es bis ins Landesfinale der Schulturnmeisterschaften geschafft.
Sie liest ehrenamtlich Krimis in Senioreneinrichtungen vor und hilft einmal in der Woche im Tierheim aus.
Sie ist Vorsitzende der Mathe-AG.
Hab ich noch etwas vergessen? – Ach ja: Sie ist niemand Geringeres als meine Erzfeindin. Das weiß sie bloß nicht, weil sie sich nämlich nicht an den Vorfall in der zweiten Klasse erinnern kann.
Es war so: Weil ich sie bei einem Malwettbewerb geschlagen hatte, erzählte sie überall herum, meine Füße würden nach Käse riechen. Außerdem hat sie mir ein Stück Harzer Käse in den Ranzen geschmuggelt, was ich erst bemerkte, als dieser schon fast wieder von allein herausgeklettert kam. Es war schrecklich! Wochenlang nannte man mich »Stinki«. Einmal ist es sogar der Rektorin rausgerutscht. Wenn ich daran zurückdenke, brodelt es wieder in mir. Alle halten Cara für einen liebenswürdigen Engel, dabei ist sie ein Fiesling. Ein mieser, fieser Fiesling.
Cara und ihre Freundinnen sehen mich durch das Schaufenster an, als hätte ich nicht mehr alle Kekse in der Dose. Erst jetzt merke ich, dass meine Zunge sich immer noch auf halbem Weg zu meiner Nase befindet. Ich ziehe sie schnell wieder ein. Oh bitte, Erdboden, tu dich auf, zerkau mich gründlich und dann schluck mich runter. Und zwar für immer! Ich winke Cara zu. Sie runzelt die Stirn und wedelt mit der Hand vor ihrem Gesicht herum, vermutlich weil sie mich für plemplem hält.
Mell sagt, man muss immer das Positive im Leben sehen. Immerhin ist mal jemandem aufgefallen, dass es mich gibt, denke ich deshalb und trabe Richtung Schule.
Kapitel 3
In Bio bekomme ich dann trotz Biobuch einen Klassenbucheintrag, und zwar wegen Mell.
Mell
OMG, niceste Party ever! Du ahnst nicht, wie geil es hier ist, Pipps. Wie cute ist bitte dieser Typ?! Ist ein Kumpel von Luke. Und der kann sooo gut küssen! Eine glatte Acht auf der Kussmaterial-Skala.
08:31
Ich kann mir ein Augenrollen nicht verkneifen, als ich ihre WhatsApp-Nachricht lese. Es folgt ein Foto von Mell und einem Jungen, der – zugegeben – verdammt gut aussieht. Ich weiß nicht, ob ich ihm echt eine Acht geben würde, aber ich bin da vielleicht etwas strenger als Mell. Ich habe bisher noch keinem mehr als eine Vier gegeben. Nicht mal Max aus der 10c und in den sind echt alle verknallt.
Mells Kussmaterial-Skala geht übrigens so:
1: Never. Ever.
2: Urgh, nicht mal im Dunkeln!
3: Vielleicht auf die Wange.
4: Nur damit ich nicht als alte Jungfer sterbe.
5: Vielleicht.
6: Durchaus küssbar, aber ohne Zunge.
7: Durchaus küssbar, sogar mit Zunge.
8: Hallöchen, Popöchen!
9: Traumtyp!
10: Jackpot – schärfer als Chili-Pulver.
Ich fand Mells Kussmaterial-Skala immer ziemlich oberflächlich und ein wenig albern, weil Mell nämlich genau wie ich noch nie jemanden geküsst hat. Also jedenfalls bis jetzt.
Ich
Erde an Mell, bitte kommen! Du bist erst seit einer Woche in den USA und schon hast du vergessen, wie man Deutsch spricht?
08:32
PS: Habe ich dir schon gesagt, dass du eine treulose Tomate bist?
08:32
Mell
OMG, Pipps, komm mal runter. Du bist bloß neidisch! Kannst du dich nicht mal ein winziges bisschen für mich freuen?
08:34
Das sitzt. Stimmt. Ich bin neidisch. Ich bin neidisch, weil Mell am anderen Ende der Welt abhängt, die coolsten Sachen erlebt und haufenweise süße Jungs kennenlernt (und scheinbar sogar küsst?), während ich vereinsame, von den eigenen Eltern vernachlässigt werde und von meinem ersten Kuss so weit entfernt bin wie ein Wookie von einer Kurzhaarfrisur. Aber sie hat recht, als beste Freundin sollte ich mich für sie freuen. Und ich sollte mich für meine Gemeinheiten entschuldigen. Ich sollte Größe beweisen und zu meinem Fehler stehen.
Ich
Tomate!!!
08:35
Das Wort Pantoffeltierchen dringt in mein Unterbewusstsein. Und dann vernehme ich ziemlich bewusst, wie der Froschkönig sagt: »Pippa, bitte erkläre uns den Aufbau dieses Einzellers.«
Kann ich natürlich nicht und zucke bloß ratlos mit den Schultern.
»Vielleicht wüsstest du etwas mehr über Wimpertierchen, wenn du zur Abwechslung mal dem Unterricht folgen würdest, anstatt unter dem Tisch auf deinem Handy herumzuspielen.« Der Froschkönig schüttelt enttäuscht den Kopf und schlägt das Klassenbuch auf. »Ich sehe mich gezwungen, dir einen Eintrag zu geben.« Er kritzelt etwas in das Buch und macht dann mit dem Unterricht weiter.
Jetzt weiß ich also, was passiert, wenn man einen Eintrag bekommt: nichts.
Außer dass der Froschkönig mich nach der Schulstunde zu sich zitiert. Den Namen hat ihm übrigens Mell verpasst, weil er eine Stimme hat wie Kermit der Frosch.
»Ich mache mir ganz ehrlich Sorgen um dich, Pippa!«, quakt der Froschkönig jetzt. »In den letzten Monaten sind deine Noten stetig schlechter geworden. In allen Fächern, nicht nur in Bio.« Das stimmt leider. Mein letztes Zeugnis war nicht schlecht, doch ein paar Dreien waren dabei. Das sieht mir nicht ähnlich, denn normalerweise bin ich eine Einser-Schülerin. (Ich sag’s ja: größtes Potenzial, zu den Nerds zu gehören.) Ich habe keine Ahnung, was ich antworten soll, also zucke ich bloß mit den Schultern.
»Ich hoffe wirklich, dass du nach deinem Praktikum wieder mit neuer Motivation in den Schulalltag startest. Wo machst du es überhaupt?«, fährt der Froschkönig fort.
»Was?«
»Dein Praktikum?«, quakt er.
»Was für ein Praktikum?«, frage ich. Da erscheint vor meinem inneren Auge eine Mappe mit vielen bunten Informationsbroschüren, die der Froschkönig am Ende des letzten Schuljahres ausgeteilt hat.
Mist.
Damals herrschte zu Hause besonders dicke Luft und ich hatte so viel damit zu tun, mich seelisch auf den nahenden Abschied von Mell vorzubereiten, dass ich keinen freien Kopf für die Schule hatte. Der Froschkönig glotzt mich mit großen Augen an.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«, fragt er.
Ist es aber leider doch.
»Pippa, nächsten Montag fängt das zweiwöchige Schulpraktikum an! Du willst mir doch nicht erzählen, dass du noch keinen Platz dafür hast?«
Will ich aber leider doch.
»Ich … Na ja, ich …«, stammele ich nervös. Nächsten Montag schon? Doppelmist. Nie im Leben finde ich bis dahin einen Praktikumsplatz.
Der Froschkönig hebt fragend die Augenbrauen.
»Doch, na klar. Haha, war nur ein Spaß«, lüge ich ihm mitten ins Gesicht, weil ich mir nicht anders zu helfen weiß.
Er atmet auf. »Wir scheinen einen grundlegend unterschiedlichen Sinn für Humor zu haben, aber ich bin erleichtert das zu hören.«
Vor lauter Erleichterung vergisst er zum Glück, mich noch mal zu fragen, wo genau ich mein Praktikum mache, und ich kann gehen.
Kapitel 4
1. Filmpark Schöneiche
2. Mediengestaltung Beltz
3. Berliner Blatt
4. Mustafas Späti
5. Tante Ellis Schönheitssalon Schickeria
Nach der Schule sitze ich am Küchentisch auf Günthers Hausboot und flenne. Vor mir die Liste mit Ideen von Einrichtungen, bei denen ich mein Praktikum machen könnte. Am liebsten wäre ich beim Film untergekommen, klar. Schließlich will ich später mal in der Filmbranche arbeiten. Aber die Chance habe ich vergeigt, dafür bin ich viel zu spät dran. Beim Filmpark Schöneiche hat mir eine Dame am Telefon mit mitleidigem Ton erklärt, dass alle Plätze schon seit Monaten vergeben seien. Der Herr bei der Mediengestaltung Beltz, einer Filmproduktionsfirma in Mitte, hat bloß einmal laut gelacht und dann einfach aufgelegt. Bei meiner Notlösung, dem Berliner Blatt, fragte man mich, ob ich mich womöglich im Datum vertue und mich für das nächste Jahr bewerben wolle. Blieb also noch Mustafa, aber dem war ich seit meinem Auftritt am Morgen nicht geheuer und er brabbelte nur irgendetwas von wegen »zu kurzfristig« in seinen Bart.
Es scheint kein Weg daran vorbeizuführen: Tante Elli ist meine letzte Chance. Und als mir das klar wird, fange ich direkt wieder an zu schluchzen. Ich bin so eine Idiotin! Was ich in den zwei Wochen hätte lernen können – aber nein, ich muss mal wieder alles vermasseln. Nun stehen mir vierzehn quälend lange Tage in Ellis Schickeria zwischen Trockenhauben und Hornhauthobeln bevor. Zu den Kundinnen des Damensalons zählen Damen um die siebzig, die »mal was anderes wollen«, was »Flippiges«. Was »Freches«. Was »Gewagtes«. Und damit meinen sie eine gefärbte Ponyfranse in Pink oder Lila, meist im Partnerlook mit ihren Yorkshire Terriern. Das werde ich nicht überleben!
Schweren Herzens greife ich zum Telefon. Doch bevor ich Ellis Nummer eingeben kann, schwingt die Tür auf und Opa kommt herein. Heute ist er nicht im Kleid unterwegs, sondern trägt eine blaue Hose mit grünen Hosenträgern und eine Kapitänsmütze. Er ist schwer bepackt mit Einkaufstüten, die er vor Schreck fast fallen lässt, als er mich sieht.
»Ist jemand gestorben?«, fragt er und stellt die Tüten auf den Küchentresen.
»Schlimmer!«, schniefe ich und ziehe die Nase hoch. »Ich muss zu Tante Elli.«
»Willst du dir etwa den Pony färben lassen?«
»Nein. Ich muss dort mein Schulpraktikum machen.«
»Bei Tante Elli? Und was sollst du da lernen? Seit du das erste Mal dieses Star Trek mit den leuchtenden Schwertern gesehen hast, willst du beim Film arbeiten. Wieso zum Kuckuck machst du dein Praktikum in der Schickeria und nicht in der Filmbranche?«
»Star Wars«, verbessere ich ihn. Und dann berichte ich Günther von meiner Misere, während er den Einkauf auspackt.
»Weißt du was?«, fragt er und stellt zwei neue Packungen meiner und Obi-Wans Lieblingschips in den Küchenschrank. »Ich hätte da eine Idee …« Dann schnappt er sich das Handy und verdrückt sich auf das Sonnendeck.