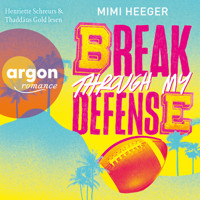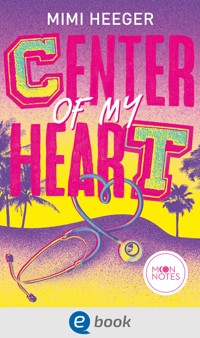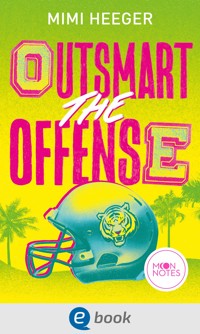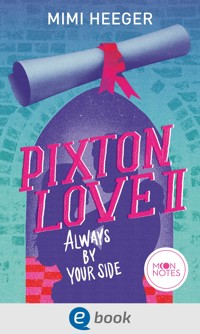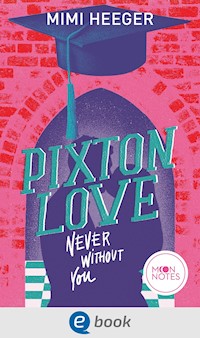
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Siegt am Ende das Herz oder doch der Verstand? Träumst du manchmal auch davon, wie alles gekommen wäre, wenn …? So geht es auch Abigail. Wie jedes Jahr schleicht sie sich auf die Freshmen-Party, die Erstsemester-Party an der Pixton University, und lebt einen Tag lang ihren großen Traum, Jurastudentin zu sein. Ein Traum, der für sie in unerreichbarer Ferne liegt, seit sie sich allein um die inzwischen fünfjährige Orphelia kümmern muss und weder Zeit noch Geld hat, um zu studieren. Und so steht sie wieder nervös, aber mit glänzenden Augen am Rande der Party – wo diesmal alles anders kommt: in Gestalt des mega attraktiven Medizinstudenten Quincy, der Abi in einer einzigen Nacht den Kopf verdreht. Er hält sie für eine Studentin der Pixton, und auch von Orphelia weiß er nichts. Wie lange kann sie ihr Geheimnis wahren? Ohne dich gehe ich nirgendwo hin. - Ganz nah dran, atemlos, intensiv und prickelnd. - Hot College Romance mit einem Schuss Real Life Drama. - Diese "Liebe-gegen-alle-Widerstände"-Story packt dich mit ganz viel Gefühl. - Wechselnd aus der Perspektive der beiden Liebenden geschrieben. - Eine erwachsene Uni-Lovestory zwischen Alltag und Leidenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Ihre Welten sind unvereinbar. Doch die Liebe hat andere Pläne. Als sie sich auf der Freshmen-Party der Pixton University kennenlernen, können sie die Finger nicht voneinander lassen. Ist ihre Anziehung groß genug, um den tiefen Graben zwischen ihnen zu überwinden?
Wie jedes Jahr schleicht Abigail sich auf die Freshmen-Party der Pixton University und lebt einen Tag lang ihren großen Traum, Jurastudentin zu sein. Ein Traum, der für sie in unerreichbarer Ferne liegt. Seitdem sie sich allein um die inzwischen fünfjährige Ophelia kümmern muss, findet sie weder Zeit noch Geld, um zu studieren. Doch auf der diesjährigen Party kommt alles anders als gedacht: Sie trifft den attraktiven Medizinstudenten Quincy, der ihr in einer einzigen Nacht den Kopf verdreht. Er hält sie für eine Studentin der Pixton, und auch von Ophelia weiß er nichts. Unvermittelt macht sich Abby aus dem Staub, weil sie es nicht übers Herz bringt, Quincy die Wahrheit über ihr Leben zu erzählen. Wie lange kann sie ihr Geheimnis wahren? Siegt am Ende das Herz oder der Verstand?
Sexy, intensiv und voll tiefer Gefühle.
Du kannst sein, wer du sein willst.
Alles, was du brauchst, ist die Stärke, dazu zu stehen – vor allem vor dir selbst.
PROLOG
So fest wie möglich schließe ich meine Finger um deine Hand.
»Ich werde dich niemals alleinlassen. Niemals«, schwöre ich.
Nicht nur dir, sondern vor allem mir selbst, denn für mich ist dieses Versprechen mindestens genauso wertvoll.
All die Liebe, die ich für dich empfinde, muss hinaus. Ich möchte so vieles sagen, so vieles versprechen. Doch die ersten Worte, die beinahe seufzend über meine Lippen kommen, sind: »Niemals ohne dich, hörst du? Ich werde ohne dich nirgendwohin gehen. Weil ich ohne dich nicht leben will.«
Es sind nur Sekunden, die wir uns tief in die Augen sehen.
Sekunden, in denen ich versuche, dir stumm begreiflich zu machen, wie viel du mir bedeutest.
Dann schlingst du deine Arme um mich. Warm und vertraut legen sie sich um meinen Körper und besiegeln damit mein Versprechen, ohne dass ein weiteres Wort nötig wäre.
Denn es wird immer so sein: niemals ohne dich.
Kapitel 1
Abigail
Ich liebe den Geruch von altem Holz vermischt mit dem Duft von Büchern. Er beruhigt mich zumindest ein kleines bisschen.
Im Eingang der großen Halle zu stehen, die an diesem Abend voller Menschen ist, fühlt sich trotzdem seltsam an. Seltsam vertraut, aber leider vor allem falsch. Ich sollte nicht hier sein. Das ist mir mit jeder Faser meines angespannten Körpers bewusst.
Die Livingston Hall ist das Herz der Pixton University und mit ihren hohen Decken, dem vielen Stuck und den dunklen Holzvertäfelungen mein absolutes Lieblingsgebäude. Es erinnert mich irgendwie an Hogwarts, auch wenn es nicht ganz so viele Türmchen besitzt.
1836 schrieben sich hier zum ersten Mal Studierende ein, und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie über den marmorierten Boden geschritten sind. Damals war das Bauwerk mit den breiten Treppen, die in die Hauptbibliothek führen, und den hohen bunten Fenstern bestimmt noch eindrucksvoller als heutzutage.
Dennoch kamen sich die Studierenden von damals gewiss nicht dermaßen fehl am Platz vor wie ich heute Abend.
Bestimmt haben sie nicht mit verschwitzten Händen im Türrahmen gestanden und sich selbst bemitleidet. Höchstwahrscheinlich waren sie eher so aufgeregt wie die Freshmen, die vor meiner Nase gerade dabei sind, sich unauffällig unter die älteren Studentinnen und Studenten zu mischen, um schlaue Gespräche zu führen. Dabei sieht man den Neuankömmlingen der Uni ihre Nervosität an der Nasenspitze an. Der erste Abend im neuen Semester. Der Duft nach Wissen und Macht, der von der Universität ausgeht, vermischt sich mit jeder Menge Angstschweiß. Wenigstens das haben die Freshmen mit mir gemeinsam.
An diesem Tag ist die Anspannung in den Räumen besonders greifbar. Nur maximal ein Drittel derer, die gerade um die Gunst ihrer Lehrkräfte, Mitbewohnerinnen oder Mitbewohner buhlen, wird es schaffen und in ein paar Jahren mit einem Titel in der Tasche Connecticut wieder verlassen. Ein Drittel wird es schaffen. Ein Drittel, zu dem ich sicher nicht gehören werde.
Noch nicht.
Hoch motiviert und mit schlauen Gesichtern streifen alle außer mir umher und halten sich für besonders klug. Doch die meisten von ihnen werden sich garantiert später auf dem Weg in ihre Zimmer verlaufen und sich morgen vor der ersten Vorlesung beinahe in die Hosen machen vor Angst. Erst gestern durften die Neuankömmlinge ihr neues Zuhause beziehen. Morgen starten die ersten Kurse, was mich eigentlich gar nicht interessieren sollte. Streng genommen sollte ich nicht mal wissen, dass heute die Einführungsveranstaltung ist, und zuallerletzt sollte ich nicht hier stehen und die Erstsemester stalken.
Mit jeder Minute, die der Zeiger auf der antiken Wanduhr vorrückt, wünschte ich mir mehr, mich einfach in Luft aufzulösen. Leider habe ich in der Vergangenheit viel zu oft am eigenen Leib erfahren, wie das so läuft mit meinen Wünschen.
Dabei könnte mir das ganze Theater herzlich egal sein. Immerhin bade ich weder im Freshmen-Angstschweiß, noch schlage ich morgen die erste Seite meines Notizbuches auf, um damit den Grundstein für etwas ganz Großes zu legen. Nein, ich habe nichts Besseres zu tun, als die Menschen in diesem Raum zu beurteilen, für die heute eine ganz neue Ära startet.
Ich bin armselig.
Armselig und anklagend.
Armselig, anklagend und dumm.
Nicht zu vergessen, ich bin extrem neidisch.
Sonst wäre ich sicherlich nicht hier. Nicht schon wieder.
Leise seufzend lehne ich mich gegen den Türrahmen und beobachte mit verschränkten Armen, wie die Dozentinnen und Dozenten sich tapfer den vielen Blicken und nervenden Fragen der Erstsemester stellen, während die Zweitsemester freiwillig Sekt ausschenken und Häppchen herumreichen.
Alles genau wie in jedem Jahr.
Sicher zum hundertsten Mal lockere ich meine Schultern und streiche meinen kurzen schwarzen Rock glatt. Einfach tief ein- und ausatmen.
… und nach Hause fahren.
Es ist langsam Zeit zu gehen …
Ich habe gesehen, was ich sehen musste, um mich daran zu erinnern, was meine Ziele sind. Oder um Wunden aufzureißen, die nicht mal ansatzweise angefangen haben, zu heilen.
»Es ist halb so schlimm, wenn du erst mal drin bist.«
Ich fahre herum. Den Kerl, der lässig an der anderen Seite des historischen Türrahmens lehnt, habe ich vorher nicht mal bemerkt. Und dabei ist er durchaus bemerkenswert.
»Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken«, reagiert er auf mein Stirnrunzeln, das sich ganz von allein einstellt und das ich schnell zu beheben versuche. Währenddessen streicht er sich die wild abstehenden Haare aus der Stirn. Ein Grübchen auf seiner Wange erscheint, als er mich anlächelt.
»Äh … danke«, murmle ich leise und verschränke die Arme wieder vor der Brust. »Und … schon okay.«
Meine Hoffnung, er beließe es dabei, wird jäh zerschlagen, als er sich vom Tor zu meiner Traumwelt löst und mir mit seiner stattlichen Größe den Blick in den Raum versperrt. Ich muss den Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht zu blicken.
Ein schönes Gesicht.
Fast ein bisschen zu schön.
Seine Wangen sind rosig, das Kinn glatt rasiert. Strahlend blaue Augen sehen auf mich herab und scheinen mich durchbohren zu wollen. Herrgott, sogar seine Nase ist kerzengerade und wohlproportioniert. Die schon fast lächerliche Perfektion seines Gesichtes wird eingerahmt von wilden dunkelblonden Locken, die aussehen, als käme er direkt vom Strand oder geradewegs aus einem Bademoden-Shooting. Verwegen chaotisch, aber irgendwie … perfekt. Mir will für sein Aussehen einfach kein anderes Wort einfallen.
»Hm«, murmelt er und tippt sich mit einem schlanken Zeigefinger ans Kinn, während sein Blick auf mir ruht. Ich möchte nicht auf seinen Mund starren, aber es ist mir unmöglich, es nicht zu tun. Immerhin ist es ein verdammt schöner Mund. Um nicht zu sagen, ein perfekter Mund. »Lass mich raten.« Mein Herz schlägt so fest in meiner Brust, dass es beinahe wehtut. Ich will am liebsten weglaufen, als ein breites Grinsen sein Gesicht aufhellt, wodurch seine Lippen leider nur noch verführerischer werden. »Jura«, sagt er fröhlich. »Habe ich recht?«
Er hat keine Ahnung, dass dieser Tipp sich anfühlt, als würde er mir ein Messer zwischen die Rippen stoßen.
Jura. Ja, das wäre es gewesen … Nein, das wird es werden … eines Tages.
Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen, was dieses kleine Wort mit den vier dämlichen Buchstaben in mir auslöst. Stattdessen presse ich meine Lippen aufeinander, um nichts Falsches zu sagen.
»Verdammt, ich habe recht, oder?« Strahlend streckt er mir seine Hand entgegen. »Ich bin übrigens Quincy. Medizin. Viertes Jahr.«
Ohne es zu wollen, löse ich meine verkrampfte Haltung und lege meine schwitzige Hand in seine.
»Willst du Gerichtsmediziner werden?«, frage ich wie ferngesteuert und betrachte die kleine Macke an seinem linken Eckzahn. Das erste Unperfekte an ihm und doch genau so, wie sie sein sollte. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Krankenschwestern sich eines Tages um diesen Doktor reißen werden. Ein waschechter McDreamy. Nur dass wir nicht in Seattle sind.
»Warum Gerichtsmediziner?«, fragt er, während sein Sunnyboy-Grinsen einem skeptischen Ausdruck weicht. Meine Hand liegt nach wie vor fest in seiner. Seine Finger sind weder feucht noch in anderer Art und Weise unangenehm. Ich würde mir den Gedanken selbst gerne verbieten, aber auch seine Haut an meiner fühlt sich nun mal ziemlich perfekt an. Rau und doch irgendwie weich. Warm und prickelnd. Meine Gedanken haben nie zuvor so wenig Sinn ergeben, und doch scheint alles an dieser Begegnung vollkommen einleuchtend.
»Na, Quincy … Medizin … die Achtziger?«
Zum ersten Mal an diesem Abend empfinde ich aufrichtige Freude, als der Groschen bei ihm fällt und das traumhafte Lächeln in sein Gesicht zurückkehrt.
»Du bist witzig …« Er zögert und zieht dabei eine Augenbraue gekonnt nach oben.
»Abigail«, kläre ich ihn auf, ohne darüber nachzudenken, ob das klug war. Bislang habe ich meinen richtigen Namen auf dem Campus für mich behalten. Doch irgendetwas an der Art, wie er meine Hand nach wie vor schüttelt und mich dabei mit seinen stechend blauen Augen fixiert, hat mich meine Vorsicht vergessen lassen.
»Und? Verrätst du mir bei einem Glas Wein, was du sonst so treibst, wenn du nicht gerade dabei bist, Anwältin zu werden, Abigail?«
Schon bei der Betonung meines Namens in Verbindung mit dem Verb treiben hätte ich wahrscheinlich zu allem Ja gesagt. Zu einer Versicherung, einem Waschmaschinenkauf und wahrscheinlich auch zu einem verdammten Heiratsantrag. Ich kann nicht mal genau sagen, was mich an seiner Art dermaßen gefangen nimmt, aber ich komme nicht gegen den Drang an, mehr über ihn erfahren zu wollen.
Mich überkommt so ein Gefühl, von dem man noch Jahrzehnte später erzählen wird. Im besten Fall seinen Enkelkindern.
Seit Jahren nehme ich an dieser Veranstaltung teil, doch nie zuvor habe ich meine Vorsicht fahren lassen und mich mit jemandem unterhalten. Normalerweise habe ich mich so unauffällig wie möglich im Foyer herumgedrückt oder nur einen Moment durch die Eingangstür gelugt, ehe ich schnell wieder in meine Welt geflohen bin.
Spätestens die Erinnerung daran, dass diese Veranstaltung nicht für mich gedacht ist, müsste mich wachrütteln. Ich sollte mich höflich verabschieden und wieder zurückkehren in die Realität, die nichts mit der Pixton University zu tun hat.
Aber es gibt etwas, das mich davon abhält, meine Grenzen einzuhalten. Ob dieser Grund ernsthaft ein Typ mit schönen Augen und traumhaften Haaren ist?
Vielleicht.
Möglicherweise ist es auch nur der Drang, das Unbekannte ein einziges Mal auf mich zukommen zu lassen, ohne immer an die Konsequenzen zu denken oder die Vernünftige zu sein.
Ich will noch nicht zurück. Zurück in ein Leben, das nicht ansatzweise so läuft wie geplant.
Ich will einen Abend lang das Gefühl haben, wirklich hierherzugehören. Diese kurzen, schmerzhaften Einblicke der letzten Jahre reichen mir heute nicht.
Ich will … mehr.
Nachdem Quincy meine Hand wieder freigegeben hat, starre ich einen Moment lang auf meine Schuhe.
Letzte Chance für einen Rückzieher.
»Was möchtest du denn wissen?«, flüstere ich kaum hörbar, in der Hoffnung, dass er mich nicht versteht oder in den Traum verschwindet, aus dem er gekommen ist.
»Alles«, antwortet er, was mich dazu bewegt, ihn erneut anzusehen. Der attraktive Student strahlt übers ganze Gesicht. »Ich weiß nicht so genau warum, aber ich will alles über dich wissen.«
Er hält mir seinen Arm hin. Ich zögere kurz, dann hake ich mich unter, und zum ersten Mal trete ich über die Schwelle, die in den letzten Jahren meine persönliche Grenze dargestellt hat. Und das am Arm eines Medizinstudenten der Pixton University.
Ich muss endgültig den Verstand verloren haben.
Ich werde stetig nervöser. Da hilft auch der Wein nicht. Im Gegenteil. Ich habe zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen. Immerhin hätte ich die beiden Gläser nicht trinken dürfen, weil ich erstens mit dem Auto hier bin und zweitens die Getränke nur für die Studierenden kostenlos sind. Statt mich zu beruhigen, steigert der Alkohol meinen Fluchtinstinkt in ungeahnte Ausmaße.
Nicht, weil Quincy ein unangenehmer Gesprächspartner ist oder ich mich hier nicht wohlfühle.
Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil. Er ist wundervoll. Klug, höflich, kultiviert. Ich mag es, wie er mir jedes Mal beiläufig zuzwinkert, wenn er das Glas an seine Lippen führt, und wie er flüchtig die Hand hebt, wenn andere ihn aus der Ferne grüßen. Er wird mit jeder weiteren Geste noch ein bisschen … perfekter. Arrgh.
Es ist eher meine eigene Hilflosigkeit, die mich verrückt macht. Ich bin hin- und hergerissen zwischen dem Drang, das Richtige zu tun und zu verschwinden, und dem Wunsch, die Situation in vollen Zügen auszukosten.
Vermutlich, weil es das hier hätte sein können. Genau so hätte mein Leben schon vor Jahren aussehen können. Mir hätte klarer sein müssen, wie sehr diese Einsicht auch nach all den Jahren noch schmerzt.
Wenn Quincy wenigstens nicht ganz so großartig wäre. Wenn er langweilig wäre oder sein Atem schlecht riechen würde. Wenn er einer dieser Typen wäre, der jeder zweiten Frau auf den Hintern starrt, während er sich mit mir unterhält. Aber verflucht. Ich wiederhole es nur ungern.
Dieser.
Typ.
Ist.
Perfekt.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als lächelnd dabei zuzusehen, wie meine sorgfältig errichtete Mauer immer tiefere Risse bekommt.
»Gleich kennst du meine halbe Lebensgeschichte, und ich weiß nichts über dich, bis auf die Tatsache, dass du Abigail heißt, zweiundzwanzig Jahre alt bist und Jura studieren willst.«
Ich habe nicht gelogen. Ich will Jura auf der Pixton University studieren.
Irgendwann.
Nur nicht dieses Semester.
Und vermutlich auch nicht nächstes.
»Erzähl mir irgendetwas von dir. Kommst du aus Connecticut? Wohnst du auf dem Campus? Im Alpha-Gebäude, hinten bei den coolen Freshmen?« Sein Blick deutet durch die bodentiefen Fenster hinaus in den Garten der Livingston Hall. Hinter den historischen Mauern schließt sich nahtlos das Alpha-Gebäude an, in dem die Erstsemester wohnen. Ein Gebäude, das ich nie betreten habe und in dem ich ganz sicher niemals wohnen werde.
»Du stellst ziemlich viele Fragen, vielleicht solltest du es tatsächlich mit Gerichtsmedizin versuchen. Du wärst der Polizei sicher eine große Hilfe«, foppe ich ihn und ignoriere den Seitenhieb über die uncoolen Freshmen. Ich bin nicht doof. Mir und jedem anderen in diesem Raum ist klar, dass die Neuen nach der offiziellen Einführung heute den Haien zum Fraß vorgeworfen werden. Sie müssen sich in der Rangordnung unter den bestehenden Semestern einfinden. Erst, wenn im nächsten Jahr neue Freshmen kommen, wird ihr Leben einfacher. Dann ziehen sie in die Wohnheime mit den Einzelzimmern oder in die Apartments des Beta-Gebäudes, weit weg von Profs und Lehrsälen. Mit dem Beenden des ersten Jahres verlassen sie das behütete Grüppchendasein im Alpha-Gebäude. Ab dann sind sie auf sich allein gestellt. Mit anderen Worten: Sie sind frei. Was auf einer Universität in etwa so viel bedeutet wie: Partys, Partys und, äh … Partys. Jap. Ich weiß all diese Dinge. Sie sind mir schmerzhaft bewusst, weil ich mich jahrelang mit diesem Leben auseinandergesetzt habe. Weil es exakt das war, was ich mir immer gewünscht habe.
Ein Leben, das mit meinem inzwischen so viel gemeinsam hat wie der Mond mit der Sonne. Willkommen im aussichtslosen Universum der Abigail Hamilton.
Quincy holt mich mit einem abschätzenden Blick zurück in die Livingston Hall. Die sanfte Klaviermusik drängt zusammen mit seiner Stimme in mein Ohr und vertreibt alle trübsinnigen Gedanken.
»Dafür, dass ich so viele Fragen stelle, beantwortest du ziemlich wenige davon. Das lockt den wahren Quincy in mir hervor«, schmunzelt er. Aus blauen Augen, die von dichten Wimpern umrahmt sind, blickt er mich an. »Ich bin allerdings noch unsicher, ob mich das nervt oder ob es dich nur noch interessanter macht.« Der intensive Augenaufschlag, den er mir daraufhin zuwirft, ist jedoch ziemlich eindeutig. Er ist ganz sicher nicht genervt.
Schon vor gut einer Stunde haben Quincy und ich uns in eine kleine, menschenleere Nische nahe der Garderobe zurückgezogen.
Meine Idee. Reiner Fluchttrieb.
Man kann nie wissen, wie überstürzt man gegebenenfalls eine Veranstaltung verlassen muss.
Mir ist mit jeder Synapse meines Gehirns bewusst, wie falsch unsere Unterhaltung ist. Ich sollte so schnell wie möglich sehen, dass ich in mein Auto komme und nach Hause fahre. Aber ich kann einfach nicht gehen. Meine Füße sind wie festgenagelt. Ich kann nur hier stehen und mir die Geschichten anhören, die er mir über sich und sein Leben am Campus erzählt. Einen Alltag zwischen Vorlesungen, Serienmarathons mit seinen Freunden und nächtlichen Lernsessions.
Ich hänge förmlich an seinen Lippen. Wunderschöne, perfekt geformte Lippen. Seine Unterlippe ist etwas voller als die Oberlippe. Jedes Mal, wenn er lächelt – was offen gestanden sehr oft vorkommt –, bilden sich kleine Fältchen neben seinem Mundwinkel. Am liebsten würde ich mit meinem Finger die kleinen Vertiefungen berühren. So fest ich kann, umfasse ich daher den Stiel meines Weinglases, um nicht auf dumme Ideen zu kommen.
»Ich hoffe doch Letzteres«, flüstere ich und muss schlucken, weil wir so dicht voreinanderstehen, dass ich ihn riechen kann. Ein teures Parfum, frische Wäsche und etwas, das ich nicht deuten kann. Herb und doch frisch. Auf verdammt betörende Weise.
Scarlett hat recht: Dass ich einen Mann berührt habe, ist schon viel zu lange her. Ich bin zweiundzwanzig und lebe so unschuldig wie eine Nonne. Ich sollte vielleicht in Zukunft auf meine beste Freundin hören und öfter mal ausgehen.
Ich kann spüren, wie mir der Wein zu Kopf steigt und meine Wangen heiß werden lässt. Eben noch auf dem Boden der Tatsachen, habe ich jetzt das Gefühl, durch die Livingston Hall zu schweben. Quincys Augen wandern in aller Ruhe über mein Gesicht. Als beobachte er die Röte, die er mit seiner tiefen Stimme in mir auslöst.
»Wer bist du, Abigail?«, flüstert er. Noch immer starre ich wie in Trance auf seine Lippen, die mit jeder Sekunde näher zu kommen scheinen. Ich bin nicht sicher, ob sie es wirklich tun oder ob ich mir nur wünschte, sie täten es.
Ihn zu küssen, wäre quasi eine Win-win-Situation. Erstens kann und will ich ihm keine Antwort auf seine Frage geben. Und zweitens will ich unbedingt wissen, wie sich seine Lippen anfühlen. Ob sie weich und zaghaft auf meinen liegen würden oder ob er wild und roh mit ihnen über mich herfallen würde.
Ich will meine Nase in seiner Halsbeuge vergraben und diesen Duft tief einatmen.
Verdammt, es geht gar nicht mehr um das Studium oder seine Fragen. Meine Knie zittern nur aus einem einzigen Grund: Ich will diesen Mann küssen. Unbedingt und sofort.
Wie er vor mir steht, mit einer Schulter lässig gegen die Wand gelehnt, als wolle er mich abschirmen von der Veranstaltung, für die wir eigentlich hergekommen sind. Das einfache schwarze Hemd, das sich eng an seinen Körper legt, und die perfekt sitzende Jeans, die sicher mehr gekostet hat, als ich in der Woche verdiene.
Quincy ist der Inbegriff von sexy. Nicht auf eine spezielle Art und Weise, für einen bestimmten Typ Frau. Er ist einfach anziehend für jeden, dessen Hormonhaushalt noch halbwegs arbeitet.
Und dann dieser Geruch. Immer wieder sein Geruch.
Ich will wissen, wie sich sein Haar anfühlt und wie seine Haut schmeckt. Ich möchte meinen Kopf auf seine Brust legen, um seinen Herzschlag zu hören.
Verrückt.
Ich muss endgültig verrückt geworden sein.
Denn ich will in diesem Augenblick schon beinahe zwanghaft einen Fremden küssen. Ich will mich in ihm verlieren und für den Augenblick die Realität aussperren.
Es ist Jahre her, dass ich mir einen solchen Gedanken erlaubt habe.
Ich schließe die Augen und atme tief ein, um mich wieder zu beruhigen. Noch ehe ich sie wieder öffnen kann, legt Quincy seine Lippen auf meine, und ich erstarre.
Mir entweicht ein eigenartiges Geräusch, und ich kann spüren, wie er an meinen Lippen lächelt. Das tiefe Heben und Senken seiner Brust trifft auf meine eigene und hinterlässt dort einen wohligen Schauer.
»Ich würde ja so was sagen wie Entschuldige, aber das wäre gelogen, und ich hasse Lügen«, murmelt er direkt in meinen Mund hinein. Keiner von uns bewegt sich. »Keine Ahnung, warum, aber das wollte ich schon tun, seit ich dich eben zum ersten Mal gesehen habe.«
Die Augen noch immer fest verschlossen, entscheide ich, erstmals in der Geschichte der Abigail Hamilton meiner Verrücktheit nachzugeben.
»Dann hör nicht auf«, flüstere ich. Ich kralle mich in den Stoff seines schwarzen Hemdes und ziehe ihn näher zu mir heran. Unsere Zähne stoßen unsanft gegeneinander, Quincy öffnet seinen Mund noch etwas mehr, und meine Zunge kann es kaum erwarten, ihn mit dem Virus der vollkommenen Unzurechnungsfähigkeit zu infizieren. Überrascht ist nun er es, der aufkeucht, doch nur eine Millisekunde später legt sich seine große Hand in meinen Nacken und zieht mich noch enger an sich.
Alles rückt in den Hintergrund. Die vielen Menschen um uns herum. Die beeindruckende Kulisse der Livingston Hall. Alles. Wir küssen uns, als stünde die Pixton University kurz vor der Apokalypse. Wie berauscht versuche ich, die Entfernung zwischen uns noch mehr zu minimieren, und lasse meine Finger über seine Arme, seinen Rücken und seinen Nacken wandern. Seine Hand gleitet hinunter zu meinem Hintern und fixiert ihn mit der gleichen Intensität, während er mit der anderen mein Gesicht sanft hält, als sei es ein wertvoller Schatz.
Apokalyptisch.
So fühlt sich dieser Kuss an.
Als gäbe es nichts mehr auf diesem Planeten, was noch Sinn ergibt.
Er und ich.
Die letzte Chance.
Der letzte Augenblick vor dem Untergang.
Ich nehme alles zurück. Dieser Moment ist keiner, von dem man den Enkelkindern erzählen sollte. Dieser Moment ist episch, und er gehört nur uns allein. Mal abgesehen davon, dass keine Großmutter bei ihren Enkelkindern davon schwärmen sollte, wie der Großvater ihr mit einem einzelnen Kuss den Verstand geraubt hat.
Wie von Sinnen erforschen wir den Mund des anderen. Rastlos. Junkies auf der Suche nach dem nächsten High. Jede seiner Berührungen jagt weitere Stromschläge durch meinen Körper und bringt mich dazu, beinahe das Gleichgewicht zu verlieren. Zu meinem Glück hat Quincy mich bereits mit dem Rücken gegen die kalte Wand gedrückt, andernfalls wäre ich vermutlich bereits zu Boden gegangen, derart zittern meine Knie.
Als ein Kellner auf uns zuhält, bin schließlich ich es, die Quincy am Kragen packt und rücklings von der Veranstaltung wegzerrt.
Ich oder die Verrücktheit.
Mittlerweile verschwimmen die Grenzen diesbezüglich erheblich.
Wir stolpern weiter hinein in die Tiefen der Garderobe. Getrieben von dem Verlangen, ihn zu schmecken, und auf der krampfhaften Suche nach Erlösung.
Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit spüre ich etwas anderes als Enttäuschung, Schmerz oder Verantwortung.
Dieser Typ, der keine Ahnung hat, wer ich eigentlich bin, gibt mir ein Gefühl, von dem ich nicht wusste, dass es noch existiert. Ein Gefühl von Freiheit. Vollkommen losgelöst von den Zwängen der bitteren Realität.
Mit einer lustvollen Mischung aus Küssen, Kichern und erkundenden Händen begeben wir uns immer weiter zwischen die vielen Wollmäntel und Kaschmirschals, bis ich rückwärts gegen etwas Hartes stoße.
Ich nutze die kurze Unterbrechung zum Luftholen, doch Quincy, der mich herausfordernd angrinst, hat offensichtlich keine Zeit zu verlieren, denn er greift hinter mich und öffnet die Tür in meinem Rücken.
Während er mich in den dunklen Raum schiebt, flüstert er etwas in mein Ohr, das sich anhört wie Latein. Aber alles geht so schnell, dass ich es nicht richtig verstanden habe.
Die Tür fällt hinter uns ins Schloss, und ich kann nichts mehr sehen. Der Geruch von Putzmitteln und Seife droht für einen Moment, die Stimmung kaputt zu machen.
Außer unserem schweren Atem sind alle Geräusche zum Erliegen gekommen. Ich möchte fragen, was er gesagt hat. Möchte ihm sagen, wie sehr ich das hier gerade brauche. Aber keine einzige Silbe kommt über meine Lippen.
Stattdessen strecke ich meine Hand aus, taste nach ihm und finde seine Wange.
Ich starre ins Schwarze. Nehme nichts wahr außer unserem abgehackten Atem und seinem Duft, der sich wie Balsam auf meine Nerven legt. Er hat ja keine Ahnung, was für ein beschissener Tag hinter mir liegt und wie sehr er die Leere gerade füllt, die mich noch vor wenigen Stunden ausgelaugt hat.
Langsam lehnt er sich nach vorne, und seine Zunge fährt zaghaft über meinen Unterkiefer, über meinen Hals und hinunter in den Ausschnitt meiner Bluse. Mit hauchzarten Küssen bahnt sich sein Mund den Weg in mein Dekolleté. Jede Berührung, die dieser mir völlig Fremde auf meiner Haut hinterlässt, ist ohne mein Sehvermögen noch viel intensiver als vorher und übertüncht die gewöhnungsbedürftige Atmosphäre.
Als der Stoff zwischen uns gerät, hält er einen Augenblick inne. Instinktiv weiß ich, dass das der Moment wäre, in dem ich einen Rückzieher machen könnte.
Aber ich will nicht.
Es ist zu dunkel, um ihm mit einem Blick grünes Licht zu geben. Also lege ich meine Hand auf seine Schulter und übe minimal Druck aus, um ihm zu zeigen, wohin die Reise führen kann, wenn er nicht aufhört.
»Was willst du?«, flüstert seine tiefe, raue Stimme gegen meinen angespannten Oberkörper.
»Alles«, erwidere ich und grabe meine Hände in seine weichen Haare. »Jetzt gerade will ich alles von dir, Quincy«, wiederhole ich seine Worte von vorhin.
Mir entfährt ein erleichterter Seufzer, als Quincy auf die Knie geht und jeden Knopf meiner Bluse in quälend langsamem Tempo öffnet. Allein wie seine Fingerknöchel dabei meine empfindliche Haut streifen und sein heißer Atem auf meinen Bauch trifft, lässt mich erschauern. Ganz gleich, wie verrückt diese Geschichte ist oder wie surreal es mir vorkommt, dass ein Medizinstudent der Pixton mir gerade aus meinem Rock geholfen hat und mir mein Höschen von den Beinen streift. Ich will auf keinen Fall, dass er damit aufhört.
Am besten nie wieder.
Kapitel 2
Zwei Wochen später
Quincy
»Ich war auf sämtlichen Einführungsveranstaltungen der Erstsemester, und es dauert sicher nicht mehr lange, dann meldet Mr. Purplemeyer mich dem Sicherheitsdienst, so oft, wie ich im Alpha-Gebäude rumhänge.« Die Hoffnung, mein tiefer Seufzer könnte meinen Frust schmälern, fährt dahin. So wie all meine Hoffnung in den vergangenen vierzehn Tagen. Es ist einfach nur noch armselig. Falsch: Ich bin einfach nur noch armselig. »Ich weiß ja nicht mal, ob sie überhaupt da wohnt. Sie könnte genauso gut pendeln oder in einer WG wohnen oder was weiß ich. Scheiße, Theo, ich weiß überhaupt nichts über sie. Sie ist wie ein verfluchter Geist.«
»Turtlefreyer«, brummt Theo und sieht weiterhin konsequent an mir vorbei.
»Hey«, ich schnippe mit dem Finger vor seiner Nase, was zwar drei Studentinnen am Nebentisch aufsehen lässt, meinen besten Freund allerdings kein Stück zu interessieren scheint. »Hörst du mir überhaupt zu?«
»Turtlefreyer«, wiederholt er, und sein Blick wandert für eine Millisekunde zu mir herüber, ehe er wieder über meine Schulter sieht. »So heißt der Hausmeister vom Alpha-Gebäude. Nicht Purplemeyer. Der Mann heißt Turtlefreyer. Ansonsten stimmt alles, was du gesagt hast. Ich denke auch, sie ist ein Geist.«
Ich spähe kurz über meine Schulter, um seinem Blick zu folgen.
Eine blonde, hübsche Frau Anfang zwanzig, die direkt neben der Glastür sitzt, hebt in regelmäßigen Abständen ihren Kopf, um zu uns herüberzusehen.
»Sie starrt mich an, oder?«, fragt Theo, dabei ist im Grunde er derjenige, der starrt.
»Theo«, mahne ich, »du trägst einen karierten Pyjama. Alle Blicke hier drin sind auf dich gerichtet.«
Er sieht sich in dem kleinen Café um, als wäre das etwas Neues für ihn. Für einen Freitagnachmittag ist erstaunlich wenig los im Bee’s. Sonst sind die Tische, der Tresen entlang der Fensterfront und die Ladentheke des beliebtesten Studentencafés um diese Uhrzeit voll besetzt.
Wahrscheinlich wäre ihm das sogar lieber.
»Aber sie.« Ungeniert zeigt er mit dem Finger auf die blonde Frau, die noch immer auf ihren Kaffee zu warten scheint. Sie sieht schüchtern zwischen ihm und dem Fußboden hin und her und fummelt dabei nervös am Saum ihres Pixton-Hoodies. »Sie starrt besonders.«
Seufzend lege ich die Hände vors Gesicht.
Ich mag Theo.
Wirklich.
Der Psychologiestudent und ich gehen seit unserem ersten Tag an der Pixton gemeinsame Wege. Die ersten vier Jahre meines Bachelorstudiums habe ich weitestgehend allein verbracht und währenddessen bei meinen Eltern gewohnt. Aber seit ich das Medizinstudium angefangen habe und auf dem Campus wohne, ist er mein Mitbewohner. Ich liebe ihn wie einen Bruder. Streng genommen sogar mehr als meine echten Brüder.
Es gibt nur einen Haken.
Theodor Augustus Martin O’Connor hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das ist keinesfalls ein Scherz. Mein Kumpel ist einer der schlausten Menschen, die ich kenne, aber er tickt nicht ganz sauber. Warum sonst sollte er an einem Freitagnachmittag mit einem karierten Pyjama mitten auf dem Campus sitzen?
Ich erinnere mich gut an die ersten Male, als wir gemeinsam unterwegs waren. Er legte seinen Arm um meine Schultern und sagte: ›Noch findest du es seltsam, doch eines Tages wird es dir komisch vorkommen, wenn ich normal gekleidet bin.‹
Er sollte recht behalten.
»Kein Wunder, dass sie starrt«, murmle ich zwischen meinen Fingern hindurch. »Du bist ja auch irre und ziehst die Blicke der Leute absichtlich auf dich.«
Auch wenn ich mich daran gewöhnt habe, ist mir aus objektiver Perspektive klar, wie seltsam Theos Anblick wirken muss.
»Wie viele Menschen haben Freud für einen Irren gehalten, Doc?« Ich lasse meine Hände sinken und sehe, wie er mich mit hochgezogener Augenbraue taxiert. Dabei ragt sie weit über den Rand seines schwarzen Brillengestells. Die dunklen Haare trägt er heute elegant nach hinten gelegt.
Ohne die Blicke der anderen würden mir seine eigenartigen Outfits wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Letzten Dienstag waren es Frauenkleider. Einen Tag später eine Badehose. Heute halt ein alter Pyjama.
Theo analysiert das Verhalten der Menschen beziehungsweise ihre Reaktion auf unkonventionelle Kleidung. Das Verrückte daran: Über die Schiene hat er das Interesse von mehr Frauen auf sich gezogen als die meisten Studenten, die ich kenne. Und er legt es nicht mal drauf an. Er zieht einfach sein Ding durch. Nicht so wie die hirnlosen Idioten, deren einziges Ziel es ist, die gesamte Cheerleader-Crew in einem Semester zu verführen. Womit wir wieder beim Thema wären, denn seit dem Abend der Freshmen-Einführung kann ich an nichts anderes mehr denken als die Stunden in der Besenkammer.
»Freud geht mir gerade so was von am Arsch vorbei. Es ist mir wirklich ernst, Theo«, versuche ich ein weiteres Mal, seine Aufmerksamkeit auf das eigentliche Problem zu lenken. Mein Problem. Die wunderschöne Jurastudentin, deren Stimme einfach nicht mehr aus meinen Ohren verschwinden will. Abigail. Die Frau, die mir an einem einzigen Abend den Verstand geraubt hat.
»Quin«, mahnt er mich wie einen Sohn, »mal im Ernst. Du hast eine der Freshmen an ihrem ersten Abend in der Besenkammer der Livingston Hall verführt, bist aber zu doof, dir ihren Nachnamen geben zu lassen oder auch nur das kleinste Detail über sie zu erfahren. Also erzähl mir nichts von irre. Du trägst die Konsequenzen hirnlosen Verhaltens. Lebe damit.«
Diese Unterhaltung führen wir nicht zum ersten Mal. Das Schlimmste an dem Geschwafel meines Freundes ist, dass er recht hat. Zumindest in diesem Fall. Die Aktion mit Abigail gehört zugegebenermaßen nicht gerade zu meinen Glanzleistungen. Ich kann mich zu hundert Prozent an den Duft ihrer Haut, die Hitze ihres Körpers und ihren Geschmack auf meiner Zunge erinnern, weiß aber ansonsten nichts über diese Frau. Das sagt eine Menge über mich aus, worüber ich mir lieber keine genauen Gedanken machen will. Einer dieser Typen wollte ich niemals sein und bin es bisher auch nicht gewesen.
»Jaja. Ich hab’s ja kapiert«, stöhne ich. »Scheiße, das war doch so nicht geplant. Sie ist einfach abgehauen. Davongerannt wie Cinderella kurz vorm Glockenschlag.«
Meine eigenen Worte bringen mich zum Lachen.
Ein Märchen. Genau so klingt die Geschichte unserer Begegnung. Allerdings habe ich nicht mal einen Schuh. Ich habe nichts außer meiner Erinnerung und der Angst, sie könnte verblassen. »Ich will sie unbedingt wiedersehen. Ich muss. Mann, ich muss sie wiedersehen. Es geht nicht anders. Du hast ja keine Ahnung. Sie und ich, das war so …«
»Mein alter Freund«, unterbricht Theo mich mit erhobenem Finger. »Vergiss die Regeln nicht.«
Regel Nummer zwei. Die wichtigste unserer Freundschaftsregeln nach Keine Lügen. Keine sexuellen Details. Auch unsere Freundschaft ist wohl etwas unkonventionell, und doch möchte ich niemals auf sie verzichten.
Theo ist eben einzigartig.
»Scheiße, ich kann nur noch an sie denken. Es ist, als wäre ich besessen.« Erneut stütze ich mein Gesicht auf meine Hände. »Gestern hat mich Mary aus dem Labor um ein Date gebeten.«
»Die Mary?«, fragt Theo. Ich blinzele durch meine Finger und muss lachen, weil er mit seinen Händen eine geschwungene Figur andeutet. Dass er dabei die langen Beine übereinandergeschlagen hat wie meine Grandma und Flanellhausschuhe an seinen Füßen baumeln, ignoriere ich.
»Ja«, knurre ich, »die Mary.« Dabei schlage ich seine Hände schmunzelnd zur Seite. »Und nur zur Info: Ich habe Nein gesagt.«
»Du bist ein Idiot. Mary ist nicht nur verdammt heiß, sie ist auch wirklich nett, was selbstredend wichtiger ist. Und du solltest mal wieder ein Date haben. Du bist nur noch der Doc. Mann, der alte Quin muss mal wieder unter Leute.«
»Ich bin verknallt, verdammt noch mal.«
»Verliebt in Cinderella. Quin, es wird Zeit, dass du aus deinem Dornröschenschlaf erwachst. Die Kleine hat dich eiskalt ausgenutzt und abserviert.«
Bevor ich ihm an die Gurgel springe, lege ich meine Hände lieber zurück auf die klebrige Tischplatte und knurre ein paar liegen gebliebene Krümel an.
Jede Minute in den vergangenen vierzehn Tagen habe ich mir mein Hirn über sie zermartert.
Hätte ich sie doch aufgehalten.
Sie nach ihrer Nummer gefragt.
Einem Namen.
Einer Adresse.
Ihrer Sozialversicherungsnummer.
Irgendetwas, verdammt!
Aber alles, was mir bleibt, ist das Gefühl dieses vollkommen surrealen Erlebnisses. Ein bahnbrechendes, die Welt aus den Angeln hebendes Erlebnis. Der beste Sex meines Lebens. Nicht nur, weil der Sex so perfekt war. Was er zweifelsohne war. Vielmehr wegen der Verbindung zwischen uns. Es war, als hätten sich zwei Puzzleteile gefunden, die erst zusammengesetzt ein vollkommenes Bild ergeben. Niemals zuvor habe ich mich in so kurzer Zeit einer Frau anvertraut. Und das nicht nur körperlich.
Langsam zweifele ich allerdings an meinem Verstand. Vielleicht habe ich mir all das auch nur eingebildet. Die Nähe, die Vertrautheit und die Harmonie, die sich für mich angefühlt haben wie ein … Ich weiß selbst nicht, wie ich es nennen soll. Tinder wäre vermutlich explodiert, weil es nie ein besseres Match gegeben hat. Es hat einfach gepasst. Perfekt gepasst. Doch womöglich existiert diese wunderschöne Frau mit dem fransigen Pony und den niedlichen braunen Augen so, wie ich sie in meinem Kopf habe, gar nicht. Wahrscheinlich existiert sie nur in meiner Fantasie.
So ein Mist.
Es war doch im Grunde viel zu schön, um wahr zu sein.
Warum zur Hölle konnte ich sie nicht erst mal um ein Date bitten, anstatt sie gleich in die Besenkammer zu zerren? Das ist überhaupt nicht mein Stil.
Ich hätte mit ihr ausgehen sollen. Ihr den Campus zeigen. Was weiß ich. Theater, Kino, essen gehen. Das volle Programm eben.
Nie zuvor hatte ich einen One-Night-Stand, und jetzt weiß ich auch, warum: Es fühlt sich scheiße an.
»Okay, ich verrate dir was«, murmelt Theo. Ich blicke auf, was sinnlos ist, weil er immer noch einen Punkt hinter mir anvisiert. Höchstwahrscheinlich nach wie vor die blonde Frau in dem grünen Pixton-Pullover.
»Verrate mir was«, brumme ich, lasse die Hände sinken und nippe an meinem Kaffee, der längst kalt geworden ist. Automatisch verzieht sich mein Gesicht. Der Campus-Kaffee ist selbst heiß widerlich, kalt jedoch ist er eine echte Qual.
»Kennst du noch Mitchell?«
»Deinen Cousin vierten Grades?«
»Dritten«, korrigiert Theo und schnalzt dabei mit der Zunge. Er hat ungefähr dreißig Cousins auf diesem Campus, wer soll da schon durchblicken? »Jedenfalls studiert er Jura. Er kann sich ja mal nach einer Abigail im ersten Semester erkundigen.«
Es ist komisch, mit jemandem zu reden, der permanent woanders hinsieht. Daher dauert es etwas länger als gewöhnlich, bis ich reagiere.
»Warum hast du das nicht direkt gesagt?«, frage ich und schiebe meine Tasse ein Stück von mir weg. »Seit zwei Wochen heule ich dir die Ohren voll und versuche einen Weg zu finden, um etwas über sie in Erfahrung zu bringen.« Bei all unseren Gesprächen hat er Mitchell mit keiner Silbe erwähnt.
»Du wirktest nie so verzweifelt wie heute. Außerdem wollte ich dir die Peinlichkeit ersparen.«
»Welche Peinlichkeit?« Genervt streiche ich mir die Locken aus dem Gesicht.
»Quincy.« Theo lehnt sich auf den Ellbogen gestützt zu mir rüber. Wenn er mich bei meinem vollen Namen nennt, wird es in der Regel ernst. »Ganz ehrlich. Wenn die Frau euer kleines Schäferstündchen genauso empfunden hätte wie du, dann hättest du ihre Nummer längst. Darauf kannst du dich verlassen. Denkst du, sie wäre Hals über Kopf davongerannt, wenn du ihr Prinz Charming wärst? Außerdem finden Frauen immer einen Weg, wenn sie einen Kerl wiedersehen wollen. Offensichtlich wollte sie nur ’ne schnelle Nummer, und du hast sie ihr besorgt.« Sein Gesicht hellt sich kurz auf. »Ha. Witziges Wortspiel.«
Ich verziehe angewidert das Gesicht.
»Du verstehst schon: ›Du hast es ihr besorgt.‹«
»Danke«, unterbreche ich ihn. »Ich habe schon verstanden.« Ich presse die Kiefer so fest aufeinander, dass meine Zähne knirschen.
Theo lehnt sich zurück, verschränkt die Arme vor der Brust und schaut wieder an mir vorbei. Ein breites Grinsen erscheint auf seinem Gesicht. Mir hingegen fallen beinahe die Augen aus dem Kopf, als die blonde Frau an unserem Tisch auftaucht und ihm eine Serviette zuschiebt, auf die sie eine Nummer geschrieben hat. Sie lehnt sich vor und haucht ihm etwas ins Ohr, woraufhin ihre Freundinnen, die sie begleitet haben, loskichern. Theo lächelt sie an, steckt die Telefonnummer in seine Pyjamatasche und winkt den drei Mädels hinterher. Sobald sie außer Sichtweite sind, richtet er seinen Blick wieder auf mich, und sein charmantes Lächeln verschwindet.
»Vielleicht hättest du an dem Abend lieber einen Pyjama tragen sollen.«
Erneut vergrabe ich stöhnend mein Gesicht in meinen Händen.
Das ist doch alles ein schlechter Scherz.
Kapitel 3
Abigail
»Gott«, schnaube ich, »fehlt nur noch, dass irgendjemand schreit: Cut und Klappe, die Zweite.«
Scarlett hakt sich bei mir unter, und wir kuscheln uns beim Laufen etwas dichter aneinander. Der Oktober hat in diesem Jahr den Spätsommer einfach in einem Happen verschluckt. Meine Zehen fühlen sich an, als wäre es bereits tiefster Winter.
»Ach komm. Anfangs waren wir auch ganz fasziniert von der Herbstdekoration.«
Ich lasse meinen Blick über die Kingstreet schweifen. Auch nach vier Jahren in Pixton ist unsere Stadtmitte zu dieser Jahreszeit bezaubernd, keine Frage. Der ganze Ort sieht aus wie ein Märchenschauplatz. Überall hängen bunte Blättergirlanden. Die Bäume, die das unebene Pflaster der Gehwege von den kaum befahrenen Straßen trennen, leuchten unnatürlich orange, und selbstredend stapeln sich die Kürbisse vor jeder Tür.
Auf der kleinen Wiese vor Joe’s Drogeriemarkt, die wir in diesem Moment erreichen, hat der Stadtrat wie in jedem Oktober eine ganze Pyramide aus Kürbissen aufgebaut. Davor liegen Strohballen und bunte Blumen.
»Damals wusste ich auch noch nicht, dass die Touristen kein Trinkgeld geben. Außerdem ist es eine Heidenarbeit, alles hinterher wieder zu entsorgen, wenn es Zeit für die Winterdekoration wird. Zumal nerven solche Leute mich einfach, weil sie unser Zuhause benutzen, um mit den Bildern ein paar zusätzliche Follower auf Instagram zu bekommen.«
Lachend lässt meine beste Freundin den Kopf in den Nacken fallen, während ich kopfschüttelnd die Gruppe Touristen beobachte, die sich vor der Deko in Szene bringen und ein Foto nach dem anderen schießen.
»Du wirst sehen, über die Schiene werden wir noch berühmt«, erwidert sie kichernd.
In Pixton gibt es im Grunde genommen nichts zu sehen. Unser kleines, verschlafenes Städtchen liegt an der südwestlichsten Spitze von Connecticut. Mit seinen gerade mal zweitausend Einwohnern und einer Handvoll Geschäften ist es nicht gerade ein beliebtes Ausflugsziel. Außer eben besagte Touristen, die sich mit unserer Jahreszeitendekoration für ihren Instagram-Account fotografieren lassen. Gerade die Herbstdeko eignet sich dafür hervorragend und taucht unendlich oft in den sozialen Medien auf. Dann finden wir unseren kleinen Ort auf Bildern mit Hashtags wie Autumnvibes oder Winterwonderland wieder.
Wohnen will hier von den Hipstern, die gerade allen Ernstes einen Handstand vor der Kürbispyramide machen, allerdings keiner. Denn wie gesagt: Das Leben in Pixton ist nicht gerade aufregend. Außerdem ist man nie allein. Eine Einwohnerin Pixtons zu sein, kommt dem Leben in einer Großfamilie gleich.
Keine Geheimnisse, keine Privatsphäre. Hier weiß jeder über jeden Bescheid.
Aber ja, Scarlett hat recht. Im Grunde waren es genau die idyllische Stimmung und die beschauliche Deko, die mich vor vier Jahren fasziniert haben, als ich das erste Mal durch den Stadtkern gefahren bin.
Vielleicht ist meine Laune auch nur so mies, weil es gerade die Zeit rund um Halloween ist, die mich an meine Ankunft hier erinnert. In einem Auto, voll mit Kram und unerfüllten Träumen.
Ich denke nicht gerne an damals zurück.
Und die Kürbispyramiden machen genau das. Sie erinnern mich. An meinen ersten Abend hier. An meine Schwester Riley, die auf drei der Kürbisse Gesichter gemalt hat. Wie wir uns kaputtgelacht haben, als wir später an diesem Abend zum ersten Mal bei Carol Milchshakes getrunken haben und plötzlich klar war, dass wir dort angekommen waren, wo wir sein wollten.
»Warum genau parkst du noch mal hinter der Kirche?«, frage ich, um mich auf andere Gedanken zu bringen.
Es ist eigentlich viel zu kalt, um durch den ganzen Ort zu laufen. Der Wind peitscht schneidend in unsere Gesichter und zerzaust unsere Frisuren. Scarlett wohnt genau wie ich am nördlichen Rand der Stadt. Und dennoch laufen wir schon seit zwanzig Minuten in die entgegengesetzte Richtung.
»Jackson denkt, ich stehe auf Samuel Williams, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich dachte, ich ärgere ihn ein bisschen, indem ich mein Auto vor Samuels Tür parke, damit Jack denkt, ich bin bei ihm. Ich will ihn eifersüchtig machen.«
»Scarlett«, mahne ich meine Freundin. »Dir sollte es egal sein, was Jackson denkt. Dieses ständige On-off muss irgendwann ein Ende nehmen. Was ist mit deiner Selbstachtung? Du bist eine starke Frau. Und völlig abgesehen davon ist Samuel Williams ungefähr hundert und noch dazu der Friedhofswärter.«
Kurz treffen sich unsere Blicke, während wir Arm in Arm in die Churchstreet biegen, in der meine Freundin aus fragwürdigen Gründen ihren Wagen geparkt hat.
»Jaja. Verurteile mich nur.« Mit ihrer freien Hand kramt sie in ihrer Manteltasche nach den Schlüsseln, und noch ehe sie ihre Finger wieder hervorgeholt hat, sehe ich in der Ferne die Lichter ihres Hondas aufleuchten. »Ich habe immerhin nur einen Wagen woanders geparkt. Also spare dir die Moralpredigt, Miss Ich-schmolle-wochenlang-wegen-dem-heißen-Doktor.«
»Ich schmolle nicht«, halte ich dagegen, ziehe aber unwillkürlich meinen Kopf ein. Wie eine Schildkröte möchte ich am liebsten in meinem Panzer verschwinden. Weil sie dummerweise recht hat. »Und nenn ihn nicht so.«
»Ha!« Scarlett lacht so laut auf, dass ich zusammenzucke. »Du bist witzig«, frotzelt sie und löst ihren Arm aus meinem. Wir steigen in ihren Wagen, und sofort nachdem sie den Motor gestartet hat, dreht sie die Temperatur höher. Sie reibt ihre Hände aneinander, bevor sie losfährt. Ich vergrabe meine zwischen meinen Oberschenkeln.
»Verdammt kalt heute«, murmle ich. Im Radio ertönt irgendein Indiesong.
»Lenk nicht ab, Prinzessin. Wir sind noch nicht fertig.«
»Einen Versuch war es wert.« Ich sehe rüber zu meiner besten Freundin. Zwischen ihren kohlrabenschwarzen Augenbrauen entsteht die Falte, die immer zum Vorschein kommt, wenn ihr was nicht gefällt. Scarlett ist um einiges größer als ich. Ihr hochgesteckter Dutt stößt beinahe gegen das Dach des Honda Civics.
»Du nimmst ihn immer noch in Schutz. Einen Kerl, der dich benutzt hat wie ein Stück Vieh. In einer verfluchten Besenkammer. Du musst die Sache mit diesem Doctor Charming langsam abhaken, Süße. Du bist dauerhaft mies drauf. Das ist schrecklich.«
»Ich habe ihn bereits abgehakt«, lüge ich. Denn ich kann an nichts anderes mehr denken als an die Begegnung mit Quincy. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ist es nicht allein die Jahreszeit, der meine schlechte Laune zu verdanken ist.
»Ach, so ein Quatsch! Einen Teufel hast du. Ich sage es dir auch gerne noch ein weiteres Mal: Wenn du ihn wiedersehen willst, dann such ihn. Nimm die Sache in die Hand. Du bist doch die, die ständig große Reden über Selbstbestimmung schwingt. Nimm dein Glück in die Hand, wenn du es willst. Aber ich sage dir, vergiss den Kerl. Sicher ist das seine Masche auf solchen Veranstaltungen. Es gibt solche Arschlöcher, die nur darauf warten, schüchterne Studentinnen auszunutzen.«
»Ach, egal«, wehre ich ab. Ich will nur, dass Scarlett das Thema fallen lässt. Mir ist klar, dass es witzlos ist, einen Fremden zu verteidigen. Außerdem weiß meine Freundin sehr wohl, dass nicht Quincy derjenige war, der sich wie ein Idiot verhalten hat. Ich war es. Ich war diejenige, die ohne ein Wort davongelaufen ist. Eine Entscheidung, die ich immer noch richtig finde, aber die ich seither jede einzelne Minute bereut habe. In einem hat sie womöglich recht – ich sollte ihn endlich abhaken.
Es war ein Fehler, mich auf einen One-Night-Stand mit ihm einzulassen. Nicht, weil der Sex mies war. Ganz im Gegenteil, er war grandios. Aber hätte ich geahnt, wie schwer es mir fällt, ihn hinterher zu vergessen, hätte ich es niemals so weit kommen lassen.
Ich habe das Gefühl, den Verstand zu verlieren, weil mein Körper sich so dermaßen nach ihm sehnt.
Wenn ich die Augen schließe, spüre ich noch immer seine Berührungen auf meiner Haut. Anfangs konnte ich mich tagelang an seinen Geruch erinnern, doch mit der Zeit verblasst die Erinnerung, und das macht mich nur noch trauriger.
Und in einem weiteren Punkt hat Scarlett recht – ich schmolle. Seit zwei tragisch langen Wochen. Nachts liege ich wach und denke an seine Stimme. Dann versuche ich, mir jedes Wort, das er gesagt hat, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und wenn ich doch mal schlafe, träume ich von ihm. Davon, wie er mich voller Leidenschaft gegen die Wand gepresst hat. Mit noch schlechterer Laune wache ich dann wieder auf.
»Ach, egal? Das ist alles, was du Geistreiches dazu zu sagen hast?« Scarlett biegt auf die Kingstreet, und wir fahren den ganzen Weg, den wir vorher laufen mussten, mit dem Auto wieder zurück. Ich lege meinen Kopf gegen die kühle Scheibe und beobachte die Touristen, die für die Fotos mittlerweile alle einen Kürbis vor ihre Gesichter halten.
Wir passieren im Schneckentempo Joe’s Drogeriemarkt, den Gemischtwarenhändler, das kleine chinesische Restaurant von Mr. Wan und schließlich das Pixton’s. Vor uns taucht die mir so vertraute Backsteinfassade mit dem im Wind baumelnden Reklameschild auf. Die Farbe blättert ab, und auch die Öffnungszeiten auf der Rückseite sind nicht mehr aktuell. Doch auch wenn Carols Laden kein hipper Großstadt-Diner ist, ist er für mich vor allem eins: mein Zuhause.
»Mir fällt zu dem Thema einfach nichts mehr ein. Es ist doch sowieso vorbei«, murmle ich vor mich hin und werde wehmütig. »Wir wissen beide, dass es zu nichts geführt hätte.«
Ich weiß, dass Scarlett recht hat. Zudem wäre es ein Leichtes, Quincy ausfindig zu machen. So viele Medizinstudenten im vierten Jahr namens Quincy Bowen wird es auf der Pixton University nicht geben. Die Wahrheit ist, dass ich es mir verbiete, nach ihm zu suchen. Sowohl im Internet als auch im echten Leben. Weil es schlicht keine Zukunft hätte. Ihn noch mal zu sehen, würde die Sache nur noch komplizierter machen. Weil mir ein weiteres Mal vor Augen geführt würde, wie perfekt er ist und wie unperfekt er in mein Leben passt.
Ganz gleich, wie sehr sich mein Herz nach ihm sehnt und mich seit zwei Wochen in einem Haufen tränennasser Taschentücher versinken lässt. Mein Verstand steht mit gestrafften Schultern darüber und erinnert mit erhobenem Finger daran, dass es besser so ist.
Eines Tages wird die Erinnerung an ihn verblassen, und ich werde unseren gemeinsamen Abend vergessen. »Wir hätten heute wirklich lieber zu Hause bleiben sollen.« Sehnsüchtig sehe ich hoch zu der kleinen Lampe, die im Fenster meines Wohnzimmers brennt. Ich könnte genau jetzt mit einem heißen Kakao auf dem Sofa liegen und mich von meinem Herzen Richtung Taschentuchmeer treiben lassen.
»Kommt überhaupt nicht infrage. Es ist Freitag. Der zweite im Monat. Keine Ausreden. Du kennst die Regeln.«
Anstatt meiner Freundin zu antworten, reagiere ich mit einem tiefen Seufzer. Gegen ihren Willen bin ich machtlos. Jeder ist das.
Seit vielen Jahren gehen meine beste Freundin Scarlett Newton und ich jeden zweiten Freitag im Monat aus. Das ist unser Abend. Und eigentlich immer ein Highlight für mich, denn das bedeutet, rauszukommen.
Raus aus Pixton.
Raus aus meiner Rolle.
Raus aus den Verpflichtungen und der ewigen Verantwortung. Einen Abend lang einfach eine junge Frau in einer Bar sein, die mit ihrer Freundin lacht und quatscht.
»Und wenn wir gerade bei deinem ›Wir hätten einfach‹ sind. Du hättest ihn definitiv nach seiner Nummer fragen sollen, wenn er wirklich so toll war, wie du behauptest. Diese Selbstgeißelei von wegen ›Ich habe das Glück nicht verdient‹ ist doch Blödsinn.«
Mein Blick wandert rüber zu Scarlett, doch sie ist vollkommen konzentriert auf die Straße. Dabei spielt sie mit der Zunge an ihrem Piercing. Ständig zupft sie mit dem Finger oder der Zunge an dem kleinen Ring in ihrer Unterlippe.
»Ich dachte, das Thema wäre vorbei«, stöhne ich. »Und es ist keine Selbstgeißelung. Es geht einfach nicht, jemanden so nah an mich heranzulassen. Und das weißt du«, beharre ich mit Nachdruck. »Genau deswegen lasse ich mich grundsätzlich nie auf so was ein.«
»Abigail.«
»Abigail?«, frage ich und runzele die Stirn. Meine Freundin nennt mich in der Regel Abby oder erfindet die tollsten Kosenamen. Aber niemals Abigail. Nie.
»Ja, richtig. Abigail«, betont sie und hört sich dabei an wie meine Mom. Unwillkürlich erschauere ich. »Du hast auch ein Recht darauf, glücklich zu sein. Du musst keine Elitestudentin sein, um einen Freund zu haben. Was nicht bedeuten soll, dass du keine Elitestudentin sein kannst.«
Bei dem Wort Elitestudentin verzieht sie ihr Gesicht, auch wenn sie versucht, es zu vertuschen. Scarlett weiß genau, welches Privileg es ist, in Yale zu studieren, so wie sie es tut. Ich kann einfach nicht begreifen, warum sie nicht den ganzen Tag vor Stolz strotzend durch die Gegend rennt.
»Ich bin auch ohne Freund und Eliteuni glücklich.« Den Kommentar, der mir auf der Zunge brennt, ignoriere ich. Wir wissen beide auch ohne meine pessimistischen Einwände, dass ich in naher Zukunft nicht studieren werde. Ich habe weder die Zeit noch die finanziellen Mittel noch die nötige Unterstützung.
»Tz«, zischt sie und wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht rum. »Niemand wird verletzt, wenn du hin und wieder ein bisschen Spaß hast oder dich …«, sie zögert kurz, »verliebst. Das steht dir zu. Warum wehrst du dich so dagegen?«
Jetzt bin ich es, die mit der Zunge schnalzt. »Ich bin glücklich. Wir führen ein gutes Leben. Ich habe alles, was ich brauche. Und eines Tages ändern sich die Dinge. Dann wird es einfacher.«
Nur kurz begegnen sich unsere Blicke.
»Wir werden sehen«, nuschelt sie. Scarlett weiß, dass sie dünnes Eis betritt.
»Es läuft wirklich gut momentan, okay? Was ich gerade am wenigsten gebrauchen kann, ist eine weitere Unvorhersehbarkeit in meinem Leben.« Seufzend sehe ich wieder auf die dunkle Fahrbahn. Das Willkommen in Greenwich-Schild zieht in diesem Moment an uns vorbei.
»Ich verstehe dich ja«, entgegnet meine Freundin. »Aber niemand verurteilt dich, wenn du auch ein eigenes Leben hast.«
»Ophelia ist mein Leben«, stoße ich aus und spüre, wie ich langsam wütend werde. »Da gibt es kein Sie-und-Ich. Es gibt nur ein ›Wir‹. Das verstehst du nicht.« Diese Diskussion hängt mir zu den Ohren raus. Ich mache doch nur, was am besten für meine Familie ist. Hier geht es nicht um mich. Es geht schon seit fünf Jahren nicht mehr um mich.
»Okay, okay«, sie hebt beschwichtigend die Hände, fasst dann aber schnell wieder ans Lenkrad, da wir mittlerweile auf den Highway fahren. »Ich bin ja auf eurer Seite, Abby. Ich will doch nur, dass du dich nicht selbst aufgibst. Die Sache mit deiner Schwester …«
»Bitte«, unterbreche ich Scarlett. Ich schließe die Augen und atme tief durch. »Ich weiß, was du meinst, okay? Und das hat nichts mit Riley zu tun. Meine Schwester kann tun und lassen, was sie für richtig hält. Wir brauchen sie nicht.« Nach wenigen Augenblicken der Stille erwischt mich eine Welle des schlechten Gewissens. »Tut mir leid, wenn ich momentan etwas schräg drauf bin«, entfährt es mir zusammen mit aller Luft aus meiner Lunge. »Es ist nur …«
»Du würdest ihn trotz allem gerne wiedersehen«, beendet Scarlett den Satz für mich, und ich ziehe meine Unterlippe zwischen die Zähne und beiße fest darauf.
Dabei nicke ich.