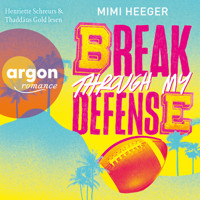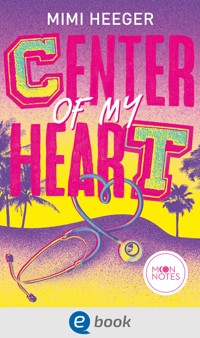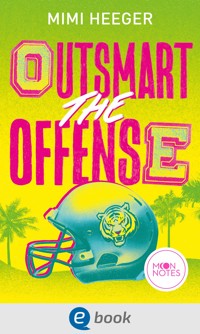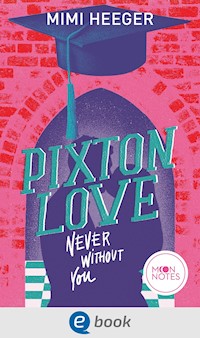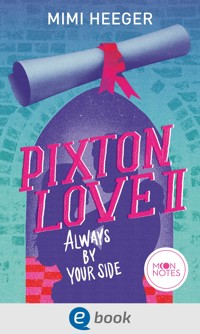
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer steht für dich ein? Bei Scarlett läuft alles nach Plan: Sie studiert Literatur in Yale und wohnt bei ihren Eltern in Pixton. In ihrer Freizeit schreibt sie erotische Liebesromane. Als ihre streng religiösen Eltern davon erfahren, werfen sie Scarlett aus dem Haus und streichen ihr die finanzielle Unterstützung. Vom einen auf den anderen Tag ist sie obdachlos und muss in ihrem Auto schlafen. Doch das behält sie für sich... Der unkonventionelle Psychologiestudent Theo durchschaut Scarletts Fassade und die beiden nähern sich langsam an. Was Scarlett nicht weiß: Auch Theo hat ein dunkles Geheimnis... Band zwei der Pixton-Love-Reihe von Bestsellerautorin Mimi Heeger ist eine spicy College Romance mit dem Erfolgstrope Friends-to-Lovers. Hier ist Herzklopfen vorprogrammiert! Pixton Love 2 – ein Liebesroman voller ganz großer Gefühle - Sexy und spicy: Eine prickelnde College Romance für Leser*innen ab 16 Jahren. - Intensiv und gefühlvoll: Band 2 der emotionalen Pixton-Love-Reihe von Erfolgsautorin Mimi Heeger – unabhängig von Band 1 lesbar. - Voll angesagt: Mit den beliebten Tropes Dark Secrets und Friends-to-Lovers. Der zweite Band der Pixton-Love-Reihe entführt in das College der amerikanischen Kleinstadt Pixton und in eine Welt der ganz großen Gefühle. Eine ordentliche Prise Spice sorgt für zusätzliches Herzklopfen. Der perfekte Lesestoff für Fans von Liebesromanen von Mona Kasten und Sarah Sprinz!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Wer steht für dich ein, wenn deine Familie geht?
Für Scarlett läuft alles nach Plan: Sie studiert Literatur an der Yale University und wohnt mit ihren Eltern im verschlafenen Örtchen Pixton. Ihre Freizeit verbringt sie mit dem Schreiben von erotischen Liebesromanen oder mit ihrer besten Freundin Abigail.
Doch als ihre religiösen Eltern von ihrem Hobby erfahren, ändert sich alles. Sie werfen Scarlett aus dem Haus und streichen ihr die finanzielle Unterstützung. Vom einen auf den anderen Tag ist Scarlett obdachlos und schläft in ihrem Auto. Doch das behält sie für sich. Nur der unkonventionelle Psychologiestudent Theo durchschaut Scarletts fröhliche Fassade, und so nähern sich die beiden langsam an.
Was Scarlett nicht weiß: Auch Theo hat ein Geheimnis …
Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden: www.nummergegenkummer.de
Schau gern hinten im Buch, dort findest du eine Auflistung der potenziell triggernden Themen in diesem Buch. Um Spoiler zu vermeiden, steht der Hinweis hinten im Buch.
Für alle, die noch nicht wissen, wer oder was sie sein wollen.
Seid einfach ihr selbst, dann seid ihr perfekt.
Prolog
Meine Hände klammern sich um das Lenkrad meines Wagens. Ein alter Honda Civic in einem grässlichen Grün.
Mein Dad hat ihn mir zum sechzehnten Geburtstag geschenkt. Ich sehe noch das Strahlen in seinen Augen, als er mir den Schlüssel vor die Nase gehalten hat. ›Grün ist die Farbe der Hoffnung, Scarlett‹, hat er gesagt, und ich habe seine Worte nicht angezweifelt. Ich habe niemals an meinen Eltern gezweifelt. Dafür gab es keinen Grund.
Hoffnung, Leichtigkeit und Glück waren feste Bestandteile meines Lebens.
Beim Gedanken an meine Naivität kämpft sich ein lautes Schnauben an meinen Schluchzern vorbei.
Verzweifelt kralle ich meine Finger noch enger in das abgenutzte Leder des Lenkrads. Meine Augen brennen vor lauter Tränen, mein Kopf schmerzt von all dem Kummer, der die Leichtigkeit in meinem Leben vertrieben hat.
Ich möchte schreien. Und schließlich tue ich es.
Ich klammere mich an meinem Lenkrad fest und schreie, so laut ich kann.
Doch niemand hört mich.
Denn niemand ist hier.
Ich bin allein.
Drei alte Koffer, zwei Rucksäcke und ein Auto grün wie die Hoffnung.
Das ist alles, was mir geblieben ist.
Kapitel 1
Scarlett
Eine Woche später
Mit Alkohol Gefühle gänzlich auszuschalten, hat noch nie funktioniert. Allerdings klappt es super, mit seiner Hilfe Sorgen und Kummer für einen kurzen Zeitraum aus dem Verstand zu verbannen. Man muss nur genug davon trinken und fest genug daran glauben. Bei beidem gebe ich mir heute Abend wirklich große Mühe. Nur deswegen habe ich zugestimmt, auf die Studentenparty an der Pixton University zu gehen. Deswegen, und um meiner besten Freundin einen Gefallen zu tun. Denn im Gegensatz zu mir ist Abby ein großer Pixton-Fan. Die ganze Fahrt hierher hat sie mir von der Livingston Hall erzählt. Einem geschichtsträchtigen Gebäude, das das Herz der Uni darstellt. Genau dort hat sie vor ein paar Wochen den Typen kennengelernt, wegen dem wir heute hier sind. Der Medizinstudent, dem sie mit Haut und Haaren verfallen ist, wohnt zusammen mit seinen drei Freunden im Beta-Gebäude auf dem Campus. Die vier Jungs sind offenbar bekannt für ihre legendären Wohnheimpartys, und bisher kann ich den Hype absolut nachvollziehen. Was die vier hier auf die Beine gestellt haben, geht weit über eine normale Studentenparty hinaus.
Die Flure leuchten in Schwarzlicht, und alle Zimmer auf dieser Etage erfüllen mit einem unterschiedlichen Motto einen eigenen Zweck.
Als wir angekommen sind, haben wir jeden Winkel unter die Lupe genommen, doch jede gute Party endet irgendwann auf der Tanzfläche. Hier ist die muffige Luft zwar fast nicht zu ertragen, aber niemand macht Anstalten, ein Fenster zu öffnen oder es ruhiger angehen zu lassen. Ich zuallerletzt.
Außer Abby, ihrem Freund Quincy und seinem besten Freund Theo kenne ich niemanden auf der Pixton. Die beiden anderen Jungs, die mit ihnen zusammenwohnen, habe ich nur ein einziges Mal gesehen. Ich habe die letzten Jahre an der Yale University studiert, die nicht gerade bekannt ist für ihre exzessive Partyszene. Aber diese Zeiten sind ohnehin vorbei.
Nun bin ich heimatlos und lasse mich durch ein Meer aus fremden Menschen treiben, von denen kein einziger weiß, was gerade bei mir los ist.
Alle tanzen, lachen und trinken miteinander, ohne hinter die Maskerade aus schimmerndem Make-up und hübschen Klamotten zu sehen. Keinen interessiert, was morgen ist. Früher fand ich das immer fragwürdig, heute Abend bin ich dankbar dafür.
»Diese Feier ist einfach der Hammer«, schreie ich Abby laut ins Ohr, damit sie mich trotz der dröhnenden Musik verstehen kann. Sie reißt die Arme in die Luft, weil Running Up That Hill aus den Boxen donnert und den Boden zum Vibrieren bringt. Jap, auch wir sind dem Stranger Things-Wahnsinn verfallen und fühlen uns den Achtzigern näher denn je.
Meine beste Freundin kreischt zustimmend und hüpft mit mir im Takt auf und ab. Ihr fransiger Pony klebt ihr auf der Stirn, und ihr bauchfreies Oberteil reicht dabei gerade so über ihren BH.
Wir tanzen, als gäbe es kein Morgen. Und dieser Gedanke gefällt mir immer besser. Meinetwegen kann diese Nacht endlos andauern. Ich brauche keinen neuen Tag. Denn dort wartet nichts auf mich als die niederschmetternde Wahrheit, die ich niemandem anvertrauen kann.
Schweiß rinnt über meinen Rücken und durchtränkt mein Shirt, aber ich werde nicht langsamer.
Ich will einfach nur Spaß haben und nicht mehr nachdenken. Dabei hilft die nicht zu unterschätzende Menge an Whisky-Cola wie ein echter Freund.
Außerdem ist es wie Medizin für meine wunde Seele, Abby glücklich zu sehen. Und das ist sie. Zum ersten Mal seit Wochen lächelt meine beste Freundin und strahlt dabei wie die Sonne selbst. Wie sollte sie auch nicht. Endlich haben sie und Quincy zueinandergefunden, und ich gönne ihr das Glück von ganzem Herzen.
Sie hat es schwer gehabt in den letzten fünf Jahren. Alleinerziehend mit Ophelia und immer auf der Hut vor den Behörden. Abigail hat für die Kleine ihr ganzes Leben aufgegeben, und auch wenn ich unsere süße Lee über alles liebe, weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Abby hat sich so lange gegen die Nähe eines Mannes gewehrt, aber Quincy hat ihre Mauern einfach eingerissen. Die beiden haben sicher noch einen langen Weg vor sich, nicht zuletzt, weil er noch keine Ahnung davon hat, dass Abby ein kleines Mädchen zu Hause hat. Aber das müssen die zwei unter sich ausmachen, ich werde einen Teufel tun und mich da einmischen. Mir reicht für den Anfang, dass meine beste Freundin einen Menschen gefunden hat, der sie liebt und gut behandelt und an dessen Seite sie sich eine Zukunft vorstellen kann. Der Rest wird sich schon irgendwie regeln.
Quincy, der zugegebenermaßen geradewegs aus einer Universitätsbroschüre entschlüpft sein könnte, schlingt in diesem Augenblick die Arme von hinten um Abby und bewegt sich rhythmisch mit ihr. Seine Lippen liegen auf ihrem Hals, und seine Hände wandern langsam, aber zielsicher über ihre Taille. Die beiden sehen perfekt zusammen aus. Er mit den wilden Locken und dem makellosen Gesicht und sie mit ihrer natürlichen Schönheit, die auch ganz ohne jedes Make-up erstrahlt.
Um die beiden nicht anzuglotzen wie die Affen im Zoo, drehe ich mich um und tanze mit einem von Quincys Mitbewohnern. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Spielt auch keine Rolle. Hauptsache, er hält eine Flasche Wodka in der Hand, die ich ihm in diesem Augenblick mit einem Zwinkern abnehme. Der breit gebaute Student mit den tätowierten Armen und dem stechenden Blick tanzt eigentlich gar nicht. Er steht nur leicht wippend da und beobachtet die Mädchen um ihn herum. Er fällt ganz sicher unter die Kategorie Mann, mit dem man die Party völlig überdreht verlässt, nur um es am nächsten Morgen ordentlich zu bereuen.
Vielleicht sollte ich nicht so viel trinken. Sehr wahrscheinlich sogar sollte ich das nicht. Aber ich kämpfe mit allen Mitteln gegen die Negativität an, die mich seit einer Woche umhüllt wie eine zweite Haut und die ich einfach nicht loswerde.
Eine Woche.
So lange ist es auf den Tag genau her, dass mein Leben auseinandergebrochen ist.
Seit einer Woche ist mir nichts mehr geblieben. Und seit einer Woche habe ich niemandem davon erzählt. Denn wenn ich es erst ausspreche, wird meine Situation wirklich real, und ich fürchte, unter der Realität zusammenzubrechen.
Die Party dient als Ablenkung. Eine Möglichkeit, für ein paar Stunden den Kopf freizubekommen. Und auch wenn ich mir einrede, dass das hervorragend klappt, funktioniert es nicht halb so gut wie geplant.
Jedes Mal, wenn ich Abby in die Augen blicke, erschlägt mich beinahe das schlechte Gewissen, weil ich sie – ebenfalls seit einer Woche – anlüge. Das ist nicht okay. Genauso wenig ist es in Ordnung, dass ich Quincys Freund verurteile und den billigen Schnaps sofort auskotzen möchte, als der versucht, mit mir zu tanzen. Was er jetzt gerade tut. Anmachsprüche und grabschende Männer sind zwar das Letzte, was ich gebrauchen kann. Aber ich möchte meiner Freundin nicht den Abend vermiesen. Sie kommt viel zu selten aus ihrem Schneckenhaus heraus.
Ohne Quincys Mitbewohner – ich glaube, der Typ heißt Wyatt – die Flasche wiederzugeben, drehe ich mich im Kreis und hüpfe zur Musik.
Ich schließe die Augen. Versuche, die Menschen auszublenden, die um mich herumtanzen. Lasse den Bass, der in meinem Bauch wummert, die Traurigkeit vertreiben und gebe mich der Musik hin. Je lauter mein Innerstes nach Hilfe schreit, umso wilder hüpfe und tanze ich. Ich beiße die Zähne zusammen und zwinge mich, nicht stehen zu bleiben. Nicht aufzuhören.
Doch es nützt nichts. Die zweite Haut scheint mich zerquetschen zu wollen. Sie lässt mich niemals los. Ganz gleich, wie viel ich trinke und wie sehr ich versuche, die Geschehnisse zu verdrängen.
Abrupt öffne ich die Augen, weil mich jemand am Ärmel zupft.
»Wir gehen rüber, einen Film ansehen.« Abby drückt ihre Wange an meine, weil ich sie sonst unmöglich verstehen kann. Die Party von Quincy und seinem Freund Theo breitet sich über das komplette Wohnheim aus. Es gibt nicht nur eine Bar, einige Tanzbereiche und Chillout-Ecken, sondern auch Räume, in denen alte Horrorfilme auf Leinwänden gezeigt werden. »Kommst du mit?«
Schnell schüttle ich den Kopf und nehme noch einen Schluck Wodka, sobald Abby sich von mir gelöst hat. Es ist zwar echt cool, dass es auf dieser Feier sogar Kinoräume gibt, aber ganz sicher werde ich mich nicht mit Abby und Quincy in ein ruhiges Zimmer verkriechen, in dem meine Probleme mich noch viel lauter anschreien können als hier.
»Ich tanze weiter.« Meine Freundin und ich kennen uns so lange, dass mir ihr skeptischer Blick selbst betrunken noch auffällt. »Ist okay. Wirklich.« Ich spreche die Worte direkt in ihr Ohr und gebe ihr anschließend einen Kuss auf die Wange. »Geh du. Wir sehen uns später.«
Ich muss weiter tanzen. Tanzen und trinken, bis ich mir diese Haut vom Körper reißen kann, ohne mich dabei ernsthaft zu verletzen.
»Sicher?« Abby lässt nicht locker.
Mein falsches Lachen kann es nicht mit der lauten Musik aufnehmen, daher winke ich mit der freien Hand ab und setze schnell die Flasche an, bevor sie hinter mein Pokerface sehen kann. Ich kann es nicht ertragen, wenn sie sich meinetwegen Sorgen macht.
Weil ich eben kein selbstsüchtiges Miststück bin.
Um ihr nicht wehleidig hinterherzusehen, schließe ich die Augen und drehe mich ein paarmal um meine eigene Achse.
Nur nicht stehen bleiben.
Immer weiter tanzen.
Wer weiß, vielleicht schaffe ich es? Vielleicht bricht der Morgen erst an, wenn alle Gedanken in meinem Kopf endlich schweigen. Oder vielleicht habe ich ein einziges Mal Glück, und er kommt gar nicht.
Mein Leben lang gab es eine Reißleine, wenn ich irgendwo unglücklich gestrandet war und es in der Situation nicht mehr aushalten konnte: mein Zuhause.
Ob auf der Klassenfahrt in der Highschool, bei der George Baker mir Zahnpasta in die Socken geschmiert hat. Oder als ich das erste Mal betrunken war und mich am laufenden Band übergeben musste. Wann immer mir etwas zu viel wurde, gab es diesen einen Ort, an dem ich sicher war.
Das Haus meiner Eltern ist weder besonders prunkvoll noch groß, aber es ist mein Zuhause.
Oder vielmehr war es das. Der eine Platz auf dieser Welt, an dem mir niemals etwas passieren konnte. Dort wurde ich liebevoll großgezogen. Ich habe mein Lieblingsessen bekommen und Krankheiten auskuriert. Ich war geborgen.
Es war mein Zuhause.
Jetzt ist es nur noch das Haus meiner Eltern.
Ein Ort, den ich meide.
Ein Ort, an dem ich nicht gern gesehen bin.
Jetzt bin ich allein.
An diesen Ort kann ich nicht mehr gehen, wenn alles schiefläuft. Da ist niemand mehr, der mir seine Hand reicht, wenn ich das Gefühl habe, im Meer der Katastrophen zu ertrinken.
Durch die bodentiefen Fenster fällt lediglich das Mondlicht in das stille Zimmer, in dem nichts zu hören ist außer meinen Schluchzern.
Nicht mehr lange, und der Morgen wird hereinbrechen und einen weiteren sinnlosen Tag mit sich bringen. Mit der aufgehenden Sonne werde ich mich nicht länger versteckt halten können, hier im Schutz der Dunkelheit.
Die Ellbogen auf die Knie gestützt, sitze ich allein auf dem Fußboden des Studentenzimmers und lasse den Tränen seit einer gefühlten Ewigkeit freien Lauf.
Als ich vor Stunden beschloss, Abby endlich die Wahrheit zu sagen, konnte ich sie nicht finden. Stattdessen bin ich mit der Flasche Wodka durch die Flure getorkelt und habe vergeblich nach einem bekannten Gesicht gesucht. Doch da war niemand. Ich war allein. Bin allein. Mal wieder. Immer.
Ich kenne mich in dem Beta-Gebäude der Pixton nicht aus. Deswegen habe ich das einzige Zimmer angesteuert, das ich abseits der Räumlichkeiten kannte, in denen immer noch die Party tobt.
Eigentlich wollte ich lediglich meine Jacke holen, die Quincys Freund Theo in seinem Zimmer abgelegt hat. Doch die Dunkelheit, der angenehme Geruch und die Stille des Raumes waren so einladend, dass ich mich an der Wand habe herabsinken lassen. Seitdem sitze ich hier und heiße zur Abwechslung den Schmerz willkommen.
Isoliert in der Finsternis.
Dort, wo die Verstoßenen wohl hingehören.
Als die Tür sich öffnet, zucke ich zusammen und hebe den Kopf.
»Hier sind wir allein«, murmelt eine Männerstimme. Schemenhaft erkenne ich im Licht, das durch den Türspalt fällt, wie der Kerl eine Frau an ihrer Taille an die gegenüberliegende Wand schiebt.
Sie fummelt an seinem Shirt herum und stöhnt genüsslich auf, als sie es ihm über den Kopf gezogen hat. Der Typ hat seinen Mund an ihre Halsbeuge gepresst, während sich seine Hände auf Wanderschaft über ihren Körper begeben. Sie scheinen es eilig zu haben, sich auch die restlichen Klamotten vom Leib zu reißen.
Ich gebe keinen Mucks von mir, als er sie bestimmt gegen die Wand presst und einen ihrer Oberschenkel anhebt. Dabei muss sie wohl mit dem Rücken gegen den Lichtschalter gekommen sein, denn plötzlich blinzele ich, weil alles von grellem Licht geflutet wird. Alles, inklusive mir.
Regungslos starre ich auf die Hände des Typen, die gerade auf Höhe des Hinterns hinter der, wie ich nun erkenne, blonden Frau verschwinden. Mein Mund klappt auf, als ich unwillkürlich meinen Blick über die starken Unterarme, den beeindruckenden Bizeps bis hin zu seinem Gesicht gleiten lasse, das ich nur im Halbprofil sehen kann. Aber dennoch erkenne.
Theo.
Der Kerl, der offensichtlich genau weiß, was er da tut, ist Theodor. Quincys bester Freund, den ich bisher aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet habe.
Theo ist schräg. Er trägt seltsame Klamotten, provoziert die Menschen und diskutiert einen in Grund und Boden.
So kenne ich Theo.
Das Bild von dem großen, heißen Kerl, der seine Finger gerade in die Schenkel einer Frau krallt, will nicht im Geringsten zu jenem Bild passen, das ich bislang von ihm im Kopf hatte.
Wie sein Oberschenkel sich anspannt, als er ihn zwischen die Beine seiner Gespielin schiebt. So … selbstbewusst. Fast … dominant. Theo ist … heiß. Sicher liegt das an meinem Alkoholpegel. Andernfalls würde mich der Anblick von Quincys schrägem Freund mit dieser Studentin wohl nicht dermaßen faszinieren.
»O mein Gott!« Die Frau stößt gemeinsam mit ihren Worten ein entsetztes Geräusch aus. Mein Gehirn benötigt etwas länger, um zu kapieren, dass ich die Ursache ihres Schocks bin. Muss am Wodka liegen.
Erschrocken sieht sie mich an. Sie ist hübsch mit den langen blonden Haaren und dem viel zu kurzen Kleid. Bestimmt ist sie nicht halb so kaputt wie ich.
»Hi«, sage ich schniefend und winke ihnen flüchtig zu.
»Scarlett.« Theo löst sich abrupt von seiner Eroberung. »Heilige Scheiße.«
Wem sagt er das.
Ohne zu antworten, schlucke ich.
Theo macht einen Schritt zurück, schnappt sich sein Shirt und zieht es über, ehe ich mir seinen Oberkörper von vorn ansehen kann. Anschließend kommt er zu mir, bückt sich zu mir herunter und legt mir eine Hand aufs Knie.
»Alles okay bei dir?«, fragt er leise.
Ich könnte lügen. Ich könnte mich entschuldigen, aufspringen und schnellstens von hier verschwinden. Ich könnte …
»Nein.« Ein neuer Schluchzer bahnt sich den Weg über meine Lippen, und ich bin zu langsam, um ihn aufzuhalten. »Nichts ist okay«, ergänze ich wimmernd und vergrabe dabei das Gesicht hinter den Händen, damit er das Zittern meines Kinns nicht sieht.
Da sind so viele Gefühle, die auf mich einstürzen. Enttäuschung, Schmerz, Scham. Vor allem Scham. Es sind zu viele, um ihnen standzuhalten. Zumindest, wenn man den Wodka mit einrechnet.
Versteckt hinter meinen Handflächen weine ich und wünschte, ich könnte mich irgendwie unsichtbar machen.
Doch das will einfach nicht klappen.
Dann wird es wieder dunkel, und ich nehme irritiert die Hände von meinem Gesicht.
Verwirrt sehe ich auf und erkenne in dem schmalen Lichtstreifen, der wieder durch den Türspalt fällt, wie Theo die Frau wegschickt. Ich bin nicht schnell genug, um ihn daran zu hindern, und schon im nächsten Moment ist es stockfinster. Meine Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, bevor ich wieder irgendetwas erkennen kann.
Theo sagt kein Wort, aber ich weiß, dass er nicht gegangen ist. Seine Schritte sind deutlich zu hören. Er dreht den Schlüssel in der Tür herum, und im nächsten Moment spüre ich, wie er sich neben mir an der Wand auf den Boden sinken lässt.
Mein Atem ist lauter als seiner, doch seine Anwesenheit ist so präsent, dass ich zu schwitzen anfange.
Es dauert eine ganze Weile, bis ich meine Stimme wiederfinde, und als ich zu sprechen beginne, bringe ich bloß ein Flüstern zustande.
»Jetzt habe ich dir die Nummer verdorben, hm?«
Ich schäme mich. Noch mehr als ohnehin schon.
Theo und ich sind im Grunde Fremde füreinander. Wir haben uns bislang nur ein paarmal gesehen, als Quincy und Abby sich getroffen haben. Ich habe kein Recht, in seinem Zimmer zu hocken. Noch dazu heulend und jammernd. Und ich habe definitiv kein Recht, ihn oben ohne beim Rummachen zu beobachten.
»Halb so wild.« Er stößt leise lachend die Luft aus. »Ich glaube, wir waren sowieso nicht ganz auf einer Wellenlänge.« Schemenhaft erkenne ich, wie er mir etwas hinhält. Ich greife danach und stelle dankbar fest, dass es ein Taschentuch ist.
»Danke.«
Um meinen Worten Taten folgen zu lassen, reiche ich ihm im Gegenzug die Wodkaflasche, die neben mir steht.
Theo nimmt sie wortlos entgegen und setzt sie an.
Es fühlt sich komisch an, so dicht neben ihm in der Dunkelheit zu sitzen. Bisher waren wir nie allein, und um uns herum war es auch noch nie still. Wann immer ich ihn gesehen habe, ging es laut und lustig zur Sache.
Jetzt gerade ist es alles andere als das.
Vielleicht bin ich zu betrunken, um noch klar denken zu können, aber es ist schön hier. Mit ihm. Mit Theo, dem lustigen Psychologie-Yuppie, der in einem Minirock in Bars geht oder im Bademantel über den Campus läuft, nur um herauszufinden, wie die anderen Leute darauf reagieren.
Sein Atem geht ruhig und gleichmäßig, der Duft seines herben Parfums benebelt mir zusätzlich die Sinne.
»Ich hasse Sex«, platzt es mit einem Mal aus mir heraus.
Prustend verschluckt Theo sich an dem Wodka und klopft sich mit der Faust auf die Brust.
»O ja. Sex ist schrecklich.« Er keucht die Worte mehr, als dass er sie spricht. »Wirklich grauenvoll. Keine Ahnung, was alle daran finden.«
Ich kann mich nicht zwischen Lachen und Weinen entscheiden. Stattdessen stoße ich ihn neckend mit dem Ellbogen an.
»Sex macht alles kaputt, weißt du? Einfach alles. Wahrscheinlich habe ich dich gerade vor einer riesigen Katastrophe bewahrt. Du solltest mir danken. Wer weiß, was diese Nummer aus dir gemacht hätte?!«
Ich taste blind nach seinen Händen und nehme ihm die Flasche wieder ab. Das Taubheitsgefühl hat viel zu sehr nachgelassen. Also setze ich das Gift an und trinke gleich mehrere Schlucke auf einmal. Inzwischen brennt der Alkohol nur noch halb so schlimm in meinem Hals. Man gewöhnt sich wohl an alles. Ob ich mich jemals daran gewöhnen werde, obdachlos zu sein? Ohne Perspektive und ganz allein?
Durch eines der Fenster kann ich sehen, dass sich der Mond hinter den Wolken hervorgekämpft hat. In seinem zarten Schein erkenne ich, dass Theo mir seinen Kopf zugewandt hat. Sein Gesicht liegt zwar im Dunkeln, aber ich bilde mir ein, dass er lächelt.
»Natürlich danke ich dir. Immerhin hassen wir Sex, nicht wahr? Bestimmt hätte sie mir eine üble Geschlechtskrankheit beschert.«
»Ganz genau«, erwidere ich schnaubend, kann mir aber ein Lachen nicht verkneifen. Mit Theos Taschentuch wische ich mir die Augen trocken und putze mir die Nase. Ich sollte nicht nur damit aufhören, zu trinken, sondern auch damit, vor einem Fremden zu heulen wie ein liebeskranker Teenager.
Nachdem sich die Stille wieder zwischen uns gelegt hat, stupst dieses Mal er mich leicht an.
»Willst du drüber reden?« Jegliche Belustigung ist aus seiner Stimme gewichen.
»Darüber, warum ich Sex hasse, oder warum ich heulend mit einer Flasche Wodka in deinem Zimmer sitze?«
»Hm«, brummelt Theo. Die Wärme seines Körpers neben mir beruhigt mich irgendwie. Es ist viel zu lange her, dass ich mich in irgendeiner Form geborgen gefühlt habe. »Meine nicht zu unterschätzende Intuition verrät mir, dass das eine möglicherweise mit dem anderen zusammenhängen könnte. Oder aber, dass das eine das andere ausgelöst hat.«
Ein weiteres freudloses Lachen löst sich aus meiner Kehle, das sich falsch anfühlt. Weil Menschen wie ich, die nichts mehr haben, eigentlich nichts zu lachen haben.
»Ich hatte völlig vergessen, dass ich es mit einem angehenden Psychologen zu tun habe.«
Theo studiert Psychologie an der Pixton und ist außerdem der seltsamste Mann, den ich je getroffen habe. Trotz der völligen Finsternis sehe ich sein Outfit des heutigen Abends vor mir. Vergessen lässt sich das nämlich nicht: schwarz-weiß karierte Hose, ein völlig zerschlissenes Bandshirt und on top schwarzer Nagellack und schwarzer Eyeliner. Völlig schräg. Aber auf seine eigene Art und Weise sexy. Vor allem jetzt, da ich weiß, wie es aussieht, wenn er sich über eine Frau hermacht.
Ich erinnere mich gut daran, für wie durchgeknallt ich ihn bei unserer ersten Begegnung hielt.
Wie er mir erklärte, sind unangepasste Outfits für ihn eine Art Challenge an sein Umfeld. Er versucht, die Leute anhand ihrer Reaktionen zu analysieren. Ich habe an dem Abend vor einigen Wochen schnell gemerkt, dass Theo ein besonderer Mensch ist. Hinter der Maske von ungewöhnlichen Klamotten steckt ein wirklich kluger Kopf voller bemerkenswerter Denkweisen. Sicher wird er eines Tages brillant sein in seinem Beruf.
»Glaub mir, mit mir wäre selbst der beste Psychologe überfordert. Spar dir besser die Mühe. Sonst verpasst du meinetwegen nicht nur den abendlichen Sex, sondern stellst am Ende auch noch dein Studium infrage. Keine gute Idee.«
»Keine Sorge«, entgegnet er leise lachend. »Meine Dienste sind oberhalb einer gewissen Promillegrenze sowieso nicht verfügbar. Ich frage aus reiner Neugierde. Gut möglich, dass ich es morgen schon wieder vergessen habe.«
Er kann nicht sehen, dass ich ihm die Flasche Wodka hinhalte, deswegen taste ich in der Dunkelheit nach seiner Hand und schließe seine Finger um den Flaschenhals. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn er morgen keine Erinnerungen an diesen Moment haben würde. Erschöpft lasse ich den Hinterkopf gegen die Wand sinken.
»Ich habe versucht, meinen Kummer wegzutanzen. Das hat nicht funktioniert. Dann wollte ich ihn ertränken.«
»Lass mich raten. Hat auch nicht geklappt?«
»Nope. Na ja, und dann wollte ich gehen. Aber die Dunkelheit in deinem Zimmer hat mich dazu eingeladen, mich nur für ein paar Minuten meinem Selbstmitleid hinzugeben.«
Eine Zeit lang schweigen wir. Nichts außer dem schwachen Mondlicht und den Stimmen aus dem Flur dringen in dieses Zimmer.
Hier gibt es nur die Finsternis, die unsere Körper fast vollständig verschluckt. Das ist schön und hat etwas Friedliches. Meinetwegen könnte dieser Moment ewig andauern.
Die Realität schafft es nicht durch die geschlossene Tür. Nicht, wenn ich es ihr weiterhin verbiete. Theo stößt mich erneut mit der Schulter an. Dieses Mal allerdings sanfter.
»Sag mir, was ich tun kann.«
»Du musst gar nichts tun.« Ich hasse es, dass meine Stimme so dünn und kratzig klingt. »Ich werde jetzt mal lieber verschwinden. Vielleicht wartet deine …«
»Scarlett.« Er unterbricht mich, indem er seine Hand auf mein Knie legt. Sie brennt sich wie Feuer durch meine engen Jeans. »Ich habe nicht gefragt, was ich tun muss, sondern was ich tun kann. Das ist ein erheblicher Unterschied.« Ich sehe ihn an, aber außer den Umrissen seines Profils kann ich nichts erkennen. Frische Tränen treten mir in die Augen und lassen seinen Umriss verschwimmen. »Ich würde das nicht fragen, wenn ich es nicht wollte. Also sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Gibt es irgendetwas, was du jetzt gerade brauchst?«
Ich nehme mir ein paar Sekunden, um darüber nachzudenken. Es gibt nicht viel, was man in meiner Lage noch machen könnte, aber beim Blick durch den Raum tritt ein Wunsch ganz deutlich an die Oberfläche.
»Ich würde mich verdammt gern in dieses Bett legen und einfach nur ein paar Stunden tief und fest schlafen, ohne dass die Realität es in dieses Zimmer schafft.«
Die Vorstellung von einer weichen Matratze mit einer richtigen Decke und einem Kopfkissen ist mehr als verlockend.
»Du willst schlafen?«
»Du hast ja keine Ahnung, wie verdammt müde ich bin.«
»Okay.« Schmunzelnd stupst er mich noch einmal an. »Da kann ich definitiv etwas tun.«
Bevor ich Theo aufhalten kann, springt er auf, und im nächsten Moment wird der Raum durch eine sanfte Lampe erhellt, die auf dem mit Büchern überladenen Nachttisch steht.
Zum ersten Mal habe ich die Gelegenheit, mir ein Bild davon zu machen, wo ich mich eigentlich befinde. Als wir vor vielen Stunden nüchtern unsere Jacken hier abgelegt haben, war ich viel zu hibbelig und zudem nicht wirklich interessiert an Theos Zimmer. Und als ich es vorhin zum zweiten Mal betreten habe, war ich froh über die Dunkelheit, die mich verschluckt hat. Ich weiß nicht genau, was sich seitdem geändert hat, aber irgendwas fühlt sich definitiv anders an.
Theos Zimmer ist ordentlich und sauber. Es sieht fast aus wie ein Hotelzimmer. Nur die Bücher, die überall verteilt liegen, und der riesige Berg Jacken auf dem Bett beweisen das Gegenteil.
Er wirft mir nur einen flüchtigen Blick zu, während ich dazu übergehe, ihn genauso eingehend zu mustern wie sein Zimmer. Theo ist anders als die meisten Menschen. Es gehört sicher eine Menge Selbstbewusstsein dazu, in seinen ungewöhnlichen Outfits durch die Gegend zu laufen. Ihn scheint das allerdings nicht im Geringsten zu stören. Doch da ist noch mehr, was ihn von der breiten Masse abhebt: seine Sicht auf die Dinge. Wir hatten noch nicht oft die Gelegenheit, uns zu unterhalten, aber wenn wir es taten, war ich jedes Mal fasziniert von seiner Einstellung zu der Welt.
Ich erinnere mich gut an einen Satz, den er bei unserem ersten Treffen gesagt hat: ›Wir machen das aus, was wir tragen.‹ Damals ging es um eine Diskussion über Kleidung und deren Wirkung auf andere. An diesem Abend fand ich seine Einstellung interessant, heute verstehe ich aber erst, wie sehr er diese Aussage verkörpert. Mit seinem schwarzen Nagellack und dem zerrissenen Bandshirt sieht er aus wie ein verfluchter Rockstar. Als wären diese Details ein Teil von ihm. Beneidenswert.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht schnappt er sich sämtliche Jacken vom Bett und türmt sie auf seinem Arm auf.
Umständlich hantiert er mit dem riesigen Kleiderberg vor dem Körper am Schlüssel der Tür herum, und ich muss lachen, weil er beinahe umstürzt, als er mit dem Ellbogen die Türklinke herunterdrückt.
Für einen Moment ist er verschwunden, aber als er wieder hereinkommt, hat er die Arme frei und grinst mich noch eine Spur breiter an.
»Was hast du gemacht?«, frage ich und lehne mich vor, um zur Tür hinauszuschielen, doch er kickt sie mit dem Fuß zu.
»Die Garderobe wurde gerade eine Tür weiter nach vorn befördert.« Mit dem gleichen breiten Lächeln im Gesicht umrundet er sein Bett und schlägt die Tagesdecke zurück. »Es ist zwar nicht frisch bezogen, aber ich schwöre, es sind bisher keine unanständigen Dinge in dieser Wäsche geschehen. Wenn es wirklich dein Wunsch ist, hier ein paar Stunden zu pennen, kann ich ihn leicht erfüllen.«
Unsicher starre ich ihn an.
»Ich …«, setze ich an, weiß aber nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll. »Also das …« Ungelenk zeige ich zwischen uns hin und her. Mit einem Mal fühle ich mich viel zu nüchtern.
»Großer Gott, nein!« Die Worte platzen so schnell und selbstsicher aus Theo heraus, dass ich zurückweiche.
»Dann würdest du nicht mit mir ins Bett gehen?«, frage ich verwirrt. Ich bin wohl doch betrunkener, als ich gerade noch dachte.
»Doch, auf jeden Fall.« Er verzieht das Gesicht, weil meine Augen sich weiten. »Aber natürlich nicht!« Beschwichtigend hebt er die Hände, während ich fragend den Kopf schief lege. »Heilige Scheiße, ich fürchte, egal, was ich als Nächstes sage – es wird falsch klingen.«
Wir blicken uns an, und plötzlich muss ich lachen. Ich weiß nicht, ob es an seiner Verzweiflung liegt oder an meiner grauenvollen Situation, aber das Prusten kommt von ganz allein aus mir heraus.
»Ich glaub auch«, stimme ich ihm zu und schüttle lachend den Kopf.
»Einigen wir uns doch einfach darauf, dass dieser Aspekt gerade nicht zur Debatte steht.«
Theo legt beide Hände auf seinen Kopf und fährt durch seine wilde Mähne. Die dunkelblonden Haare stehen in alle Richtungen ab, so wie man sich einen zerstreuten Professor vorstellt. Dabei bildet sich ein wirklich charmantes Lächeln auf seinen Lippen.
»Na, komm.« Er hält mir seine Hand hin, und ich zögere nicht, sie zu ergreifen. Als wir schließlich voreinanderstehen, wird er wieder ernst. Mit einem seltsamen Ausdruck wischt er mir sanft mit den Daumen unter den Augen entlang.
Sofort erstirbt auch mein Grinsen. Die schwarzen Spuren an seinen Fingerkuppen holen mich zurück in die bittere Realität. Ich bin und bleibe total und unwiderruflich am Arsch.
»Wenn du es dir anders überlegst und reden willst …« Er holt tief Luft, und als er ausatmet, spüre ich den Luftzug an meiner Stirn. »Egal, ob heute, morgen oder wann auch immer …«
Zaghaft nicke ich. Er muss den Satz nicht zu Ende sprechen.
»Danke.«
Einer seiner Mundwinkel hebt sich, was wirklich süß aussieht. Theos Wangen sind glatt rasiert. So glatt, dass man nicht einen einzigen Stoppel darauf erkennen kann. Das lässt ihn jünger erscheinen, als er mit seinen fünfundzwanzig Jahren ist. In meinen Fingerspitzen kribbelt es, weil ich unbedingt wissen möchte, wie sich seine Haut anfühlt.
»Ich bin da. Merk dir das einfach, ja?« Bisher klang alles, was er gesagt hat, immer so frei und fröhlich. Zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, klingt seine Stimme tief und dunkel. Ernst und irgendwie … bedeutungsvoll.
»Okay. Mache ich.« Ich hingegen bringe nicht mehr als ein unsicheres Krächzen zustande.
»Mein Bett gehört ganz dir. Ich schlafe im Wohnzimmer auf dem Sofa oder bei Wyatt.«
Ich sehe zu dem breiten Holzbett, dann wieder in sein warmherziges Gesicht.
»Okay«, wiederhole ich ein weiteres Mal.
Theo legt mir eine Hand auf die Schulter und drückt sie sanft.
»Schlaf ein bisschen, Scarlett.«
»Mache ich.« Wie auf Kommando muss ich gähnen, was ihn schmunzeln lässt. Doch auch nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hat und ich Hose und Schuhe ausgezogen habe, um unter die weiche Decke zu schlüpfen, ist an Schlaf nicht zu denken.
Ich kuschle mich zwischen die weichen Kissen, stecke meine Nase hinein und atme den Duft ein. Seinen Duft. Es ist schön, etwas anderes zu riechen als den Geruch meines alten Hondas.
Während ich mich einrolle wie eine Kugel und versuche, mich fallen zu lassen, denke ich an Abby und Quin. Ich denke an Jackson und die Uni. An meine Eltern und an die letzten Wochen.
Erschöpft reibe ich mir mit dem Daumen meiner rechten Hand über die übrigen Fingerspitzen. Neben so vielen anderen Dingen fehlt mir vor allem meine Arbeit. Mir fehlt es, zu schreiben. Es ist ein bisschen wie ein Drang. Eine Droge, die mir Schmerzen bereitet, sobald ich sie nicht bekomme. Wenn ich schreibe, dann ist es, als hätte ich endlich eine Stimme.
Aber es ist nicht nur das. Mein komplettes altes Leben fehlt mir. Und ganz gleich, wie unrealistisch dieses Denken ist, ich wünsche mir einfach, ich könnte es wieder zurückhaben.
Als die Sonne schließlich die Nacht vertreibt, wird mir bewusst, dass die unbarmherzige Realität die ganze Zeit da war. Wie ein Geier lauert sie über mir und lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ganz gleich, wo ich mich verstecke. Ich werde keinen Frieden finden. Hier nicht und auch sonst nirgendwo.
Außerdem ist an Schlaf in Theos Bett nicht zu denken. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn, wie er die Frau gegen die Wand presst. Ich denke an seine starken Finger, die Sehnen auf seinen Unterarmen und die tiefe Stimme, mit der er gesprochen hat.
Keine Ahnung, ob die letzte Stunde mich hat nüchtern werden lassen, aber ich kann keine Minute länger still liegen. Seufzend ziehe ich mich wieder an und schleiche leise aus dem bodentiefen Fenster davon.
Ich will nicht, dass Quincy mich hier sieht. Niemand soll mich hier sehen. Das würde nur unnötige Fragen aufwerfen, auf die es keine klugen Antworten gibt.
Ich muss den Honda vom Parkplatz schaffen, ehe er jemandem auffällt. Ein Blick auf die Rückbank reicht, um neugierige Fragen zu provozieren. Später werde ich mit Abby sprechen, sobald ich vollständig ausgenüchtert bin. Es wird Zeit, dass sie die Wahrheit erfährt. Sie ist meine beste Freundin, und ich weiß, dass sie mich nicht verurteilen wird. Zumindest hoffe ich das.
Der Morgen kommt.
Ob ich es will oder nicht. Die zweite Haut, die mich mit all den negativen Gefühlen überzieht, ist noch immer da. War nie wirklich weg. Aber möglicherweise hat sie einen winzigen Riss bekommen an der Stelle, an der Theo meine Tränen fortgewischt hat. Zumindest fühle ich mich nicht mehr ganz so einsam auf dieser Welt wie noch vor wenigen Stunden.
Kapitel 2
Theo
Das Drama anderer Leute zieht mich magisch an.
Aber das ist okay, weil ich den Menschen gern helfe, andernfalls wäre mein Studiengang wohl ein ziemlicher Griff ins Klo gewesen. Vor allem aber hat das Ganze den netten Nebeneffekt, dass ich mich nicht meinen eigenen Problemen widmen muss, solange meine Freundinnen und Freunde meinen Rat einfordern.
Im Prinzip ist es ganz einfach: Solange ich witzele, analysiere oder anderen mit Wort und Tat zur Seite stehe, ploppt niemals die Frage auf, wie es mir selbst geht. Das kommt mir recht gelegen. Denn die Antwort darauf höre ich nicht besonders gern.
Und die anderen haben auch etwas davon. Immerhin bin ich ein wirklich guter Zuhörer. Aufmerksam und nicht zu sehr involviert. Immer den professionellen Abstand bewahren, den ich später in meinem Job brauchen werde, um nicht selbst vollends den Verstand zu verlieren. Ich liebe es, menschliches Verhalten aus psychologischer Sicht zu betrachten und es zu zerlegen. Wenn ich neue Menschen treffe, habe ich sofort den Impuls, ihrem Charakter auf den Grund zu gehen. Das ist mein Ding.
Deswegen finde ich es halb so schlimm, in einem Diner mitten in Pixton zu sitzen, anstatt mit Quin weiter Richtung Old Saybrook zu fahren. Unser Plan war eigentlich ganz simpel: Wir drücken uns vor der Aufräumaktion nach der Party, indem wir zum Angeln fahren und ein paar Tage chillen. Nicht geplant war, dass ich völlig verkatert aufgewacht bin und auf dem Weg dringend ein gutes Frühstück brauchte. Noch weniger geplant war, dass wir dabei in einem Diner Namens Pixton’s landen und dort auf Quins neue Freundin Abigail treffen. Wie es aussieht, wusste er weder, dass sie hier als Kellnerin arbeitet, noch, dass sie in Pixton beziehungsweise über dem Diner wohnt. Von dem kleinen Mädchen, das plötzlich aufgetaucht ist, mal ganz abgesehen. Es konnte also keiner ahnen, dass wir heute mitten in einer neuen Folge Quin und Abigail – Das Drama des Jahres landen würden.
Ich bin allerdings noch viel zu betrunken von der gestrigen Party, um die volle Tragweite der Ereignisse zu kapieren.
Wie es aussieht, hat Abigail meinem Freund ein Kind verheimlicht, der Doc ist richtig angepisst, und das Happy End scheint sich zu vertagen. Im besten Fall.
Ich wünsche Quin wirklich nur das Beste, aber momentan steht seine Beziehung auf ziemlich wackligen Füßen, und so langsam gehen mir die klugen Ratschläge aus. Ich weiß nicht, was Abigail noch alles vor ihm verbirgt, was ihre Motive sind, und im Grunde geht mich all das auch nichts an. Aber ich bin mit niemandem so lange und so gut befreundet wie mit Quin, und ich will, dass er glücklich ist.
Neu an der Quin und Abigail-Serie, Staffel zwei, ist für mich, dass meine Finger zu schwitzen anfangen, sobald Abbys Freundin auf der Bildfläche erscheint. Mit ihr habe ich heute Morgen hier in Pixton, am gefühlten Ende der Welt, am allerwenigsten gerechnet. Vor nicht einmal zwei Stunden bin ich noch fest davon ausgegangen, dass sie in meinem Bett liegt. Vielleicht zucke ich deshalb derart zusammen, als sie durch den dicken Vorhang hinter dem Tresen des Diners schlüpft.
Scarlett Newton.
Die geheimnisvolle Freundin an Abigails Seite, die letzte Nacht weinend in meinem Zimmer saß und meine sonst so knallhart aufrechterhaltene Distanz wie selbstverständlich überwunden hat.
Bezaubernde Augen. Eine kleine, niedliche Stupsnase und Lippen, die zum Küssen gemacht sind. Sie ist atemberaubend schön.
Scarlett ist etwas Besonderes.
Ihre schwarzen langen Haare hat sie zu einem seitlichen Zopf geflochten, der ihr über die Schultern reicht und weit über ihren engen Strickpullover fällt. Die schwarzen Spuren, die ihre Tränen hinterlassen haben, sind verschwunden, ihre Augen und ihre Nase nicht mehr gerötet. Rein optisch hat sie wenig mit der Frau gemein, die noch vor wenigen Stunden völlig fertig auf dem Boden meines Zimmers gehockt hat. Aber ich meine, noch immer den Schmerz in ihrem Blick aufflackern zu sehen, den sie zu verbergen versucht. Das macht mich mit einem Schlag stocknüchtern und hellwach.
»Hi«, beeile ich mich, zu sagen, und richte mich auf meinem Barhocker kerzengerade auf, als sie vor mir steht.
Mitten in dieser seifenopertauglichen Szene zwischen Abby und Quin steht sie da. In einem Diner in Pixton, der aussieht, als käme er geradewegs aus den Sechzigern.
»Äh … Hi«, erwidert sie etwas schüchtern und streichelt dem kleinen Mädchen über den Kopf, das sich an ihr Bein geklammert hat, als Abigail und Quin den Diner überstürzt verlassen haben. Ich sag ja: Seifenoperpotenzial. »Was macht ihr denn hier?« Mein Blick wandert zwischen Scarlett und der Kleinen an ihrem Bein hin und her. Ein langes Bein, wie ich bei der Gelegenheit feststelle.
Zu viele Fragen schießen durch mein alkoholbenebeltes Hirn. Abigails Tochter? Wie alt ist sie? Warum weiß der Doc nichts von dem Mädchen, und vor allem: Was zur Hölle machen die alle hier in Pixton?
»Tja, das könnte ich dich auch fragen, oder nicht?«
Scarlett verzieht leicht das Gesicht, bleibt mir aber eine Antwort schuldig. »Hey, komm schon, Lee.« Sie löst die Kleine vorsichtig von sich und hebt sie auf den Barhocker neben mich. »Hör auf, zu weinen. Es ist alles okay.« Ihr Blick zuckt hinaus auf die Straße, wo Abigail und Quin wild diskutieren. Wenn ich ehrlich bin, kann ich seinen Schock nachvollziehen. Aber wie gesagt: Das ist nicht mein Krieg. Quin ist alt und klug genug, das allein auf die Reihe zu kriegen.
»Mom hat mich angemotzt«, protestiert die Kleine und verschränkt wütend die Arme vor dem Körper. Dabei wandert ihr Blick immer mal wieder in meine Richtung. Als Quin und ich hier eben ankamen, hatten wir keine Ahnung, dass es sich bei dem aufgeweckten Mädchen um Abigails Tochter handelt. Die Kleine sprang in dem Restaurant herum, als wir uns an den Tresen gesetzt haben, und hat uns prächtig unterhalten. So richtig kann ich das selbst noch nicht glauben. Wie sie aus tränenverhangenen Wimpern zu mir hinübersieht, bricht mir beinahe das Herz.
»Sie hat es sicher nicht so gemeint«, lenke ich deshalb ein und schiebe ihr zum Trost Quincys Frühstück hin. Ihm ist wohl vorerst ohnehin der Appetit vergangen. »Pancake?« Fragend zucke ich mit einer Schulter. »Nichts ist so schlimm, dass es ein guter Pancake nicht wieder in den Griff kriegen würde.«
Scarlett sieht mich an, doch als ich ihren Blick erwidere, wendet sie sich hastig ab. Seit der letzten Nacht hat sich die Stimmung zwischen uns völlig verändert. Allzu gern wüsste ich, wohin sie heute Morgen so überstürzt aus dem Fenster geflohen ist. Und vor allem, warum.
»Genau«, pflichtet Scarlett mir bei und streicht der Kleinen die Haare aus dem Gesicht. »Lass uns Quincys Frühstück aufessen, und dann gehen wir spielen.«
»Können wir in den Zoo fahren?« Das Mädchen, das sicher nicht mal sechs Jahre alt ist, pikst mir in den Arm. »Du kannst auch mitkommen. Letti und ich waren letzte Woche im Zoo. Da haben wir so viel Eis gegessen, bis uns schlecht geworden ist. Aber du darfst nur mitmachen, wenn du es Mom nicht verrätst. Tante Letti und ich machen ständig Sachen, die wir niemandem erzählen.«
Während Scarlett ertappt die Augen aufreißt, streiche ich mir mit der Serviette über den Mund, um meine Belustigung etwas zu kaschieren.
Dass mir statt eines Angelausflugs unter Männern plötzlich ein Zoobesuch mit zwei Frauen blüht, macht mir erstaunlich wenig aus. Ich war sowieso nicht besonders scharf darauf, die kommenden Tage in Old Saybrook zu verbringen. Zu viele Erinnerungen knüpfen sich um diese Jahreszeit an das alte Strandhaus meiner Eltern. Früher hat meine Familie viel Zeit dort verbracht, heute habe ich das Gefühl, dass zu viele Schatten auf dem Ort liegen und dass ihn keiner von uns wirklich genießt. Da vergnüge ich mich lieber mit den Geheimnissen, die Scarlett mit diesem kleinen Mädchen teilt.
»Okay.« Lachend lege ich meine Serviette weg und drehe mich auf meinem Hocker in ihre Richtung. Scarlett steht hinter der Kleinen, damit sie nicht von dem hohen Stuhl segeln kann. Liebevoll hat sie ihr die Hände auf die Schultern gelegt. »Ich würde wirklich gern mit dir und Tante Letti«, beim Erwähnen dieses Namens zwinkere ich Scarlett zu, »in den Zoo gehen und geheime Dinge tun, aber Quin und ich wollten für ein paar Tage angeln fahren.«
»Angeln finde ich doof. Das tut den Fischen weh.«
Mir bleibt keine Zeit für eine sinnvolle Erwiderung, weil Scarlett mit gequältem Gesicht über meine Schulter Richtung Ausgang schielt und ihren Kopf schüttelt.
»Ich wäre mir mit dem Angelausflug an deiner Stelle nicht so sicher.«
Das Glöckchen über der Tür erklingt, und ich drehe mich genau in dem Moment herum, in dem Abigail tränenüberströmt den Diner betritt und durch den Vorhang in den hinteren Bereich flüchtet. Von Quincys Wagen sind nur noch die Rücklichter in der Ferne zu erkennen.
Da sitzen wir. Völlig Fremde, die plötzlich aufeinander angewiesen sind, weil Abigail und Quin ihren Scheiß nicht geregelt kriegen. Noch dazu mit einem Kind.
Es ist nicht zu übersehen, dass die Kleine traurig auf den Vorhang schielt, durch den ihre Mom verschwunden ist.
Ich räuspere mich, um Scarletts Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, und deute unauffällig mit dem Kinn zu dem Zwerg in unserer Mitte. Sie reagiert sofort.
»Wie wäre es, wenn wir nach Greenwich fahren? Wir könnten in den Park gehen, den du so gern magst, und die Enten füttern.« Scarlett legt ein künstliches Lachen auf und kitzelt das Mädchen. »Und wenn du brav bist, holen wir uns anschließend ein Eis, okay?« Sie versucht, die Kleine von dem Drama abzulenken, das sich gerade unmittelbar vor ihrer Nase abgespielt hat. Dabei ist Scarlett die seelische Erschöpfung nicht mehr anzumerken, die sie selbst noch vor wenigen Stunden empfunden hat.
Tatsächlich funktioniert ihr Plan. Freudig klatscht Ophelia in die Hände und dreht sich auf ihrem Hocker einmal im Kreis.
»Und er?«, fragt das Mädchen und zeigt mit seinem kleinen, lackierten Fingernagel auf mich. »Kommt er auch mit?«
Scarletts Blick richtet sich auf mich. Die Farbe ihrer Augen ist schwer zu bestimmen. Je nach Lichteinfall wirken sie blau oder fast schon grau. Sie verschleiern das, was in ihrem Inneren liegt, perfekt.
Fragend sieht sie mich an. »Wir können dich auf dem Weg zurück zum Campus bringen, wenn du willst.«
Ich schlucke, weil es mir schwerfällt, ihrem Blick standzuhalten. Er hat etwas Fesselndes an sich. Und ich möchte unbedingt herausfinden, was hinter dieser fröhlichen Fassade steckt, die sie hier aufsetzt.
»Das wäre wirklich nett von euch.« Ich spüre, wie sich meine Mundwinkel unwillkürlich nach oben ziehen. »Allerdings wollte ich schon immer mal die Enten in Greenwich füttern.«
Scarletts Lächeln kommt etwas zögerlich. Mit der Zunge spielt sie an dem kleinen silbernen Ring an ihrer Unterlippe, von dem ich seit dem ersten Tag, an dem ich sie gesehen habe, kaum die Augen wenden kann.
»Okay.« Sie streichelt dem Mädchen liebevoll über die Wangen. »Gehen wir mit Theo die Enten füttern. Ich bin sicher, das wird lustig.«
»Was denkst du, wann kommt der Punkt in unserem Leben, an dem wir aufhören, die Welt durch diese Augen zu sehen?«, frage ich und sehe dabei etwas wehmütig Lee an, die mit einer Tüte voller Brotreste zwischen den Enten umherhüpft, denen sie Namen gibt. Ich habe nicht nachgehakt, was es mit der Kleinen auf sich hat. Das geht mich nichts an. Ob ich damit leben könnte, wenn meine neue Freundin mir ein Kind verschweigen würde, tut nichts zur Sache. Diese Entscheidung muss Quin allein treffen. Mir bleibt nichts übrig, als für ihn da zu sein, wenn er mich braucht.
Scarlett und ich schlendern am Ufer des Sees entlang. Sie hat die Hände tief in die Taschen ihres Mantels geschoben und lässt Abigails Tochter keine Sekunde unbeobachtet. Quietschend vor Freude hüpft diese durch das dichte Herbstlaub. Die beiden Freundinnen müssen sich sehr nahestehen, wenn sie das Kind mitnehmen kann, ohne Abigail darüber zu informieren.
»Hm. Ich weiß nicht. Mit der Pubertät? Dem ersten Liebeskummer? Den ersten richtigen Sorgen? Oder wenn man kapiert, dass die Welt einfach kacke ist?«
»Wow. Weil die Welt einfach kacke ist.« Aufmunternd klopfe ich ihr auf die Schulter. »Ich bin froh, dass du nicht pessimistisch veranlagt bist.«
»Ich hasse Pessimismus.« Sie versucht, sich ihr Lachen zu verkneifen, verliert den Kampf aber gnadenlos.
Der kalte Wind klärt langsam mein Hirn nach dieser durchzechten Nacht. Zumindest habe ich nicht mehr permanent den Drang, mich übergeben zu müssen, und auch der Kopfschmerz verzieht sich allmählich.
»Ich glaube nicht, dass es die Pubertät oder die erste Liebe ist. Es ist das System.«
Scarlett, die beinahe so groß ist wie ich, schüttelt nur lachend den Kopf und wendet sich wieder von mir ab.
»Du redest über das System. So?« Sie zeigt mit dem Finger auf meinen Kopf. »Sorry, das kann ich einfach nicht ernst nehmen«, erklärt sie kichernd.
Schockiert bleibe ich stehen und presse mir eine Hand auf die Brust.
»Was stimmt denn nicht mit mir?« Auch ich schaffe es nicht, mein Lachen zu unterdrücken. »Du wirst doch wohl nicht oberflächlich werden, hm?«
Grinsend wackle ich mit dem Kopf, sodass sich der rosa Bommel an der Mütze bewegt. Lee hat sie im Auto neben ihrem Kindersitz gefunden und meinte, die würde mir vortrefflich stehen. Die Geste kam von Herzen. Immerhin habe ich nicht mal eine Jacke dabei, und in diesem Oktober merkt man in Connecticut nicht gerade viel von der Erderwärmung. Soll heißen: Es ist arschkalt.
Ich trage daher voller Stolz eine rosa glitzernde Mütze mit Einhörnern darauf.
»Du siehst total bescheuert aus.« Scarlett stupst mich mit dem Ellbogen an, was ich lachend erwidere.
»Okay. Machen wir einen Deal«, schlage ich vor. »Ich verzichte auf diese wunderschöne und noch dazu wärmende Kindermütze, die mir erstaunlicherweise perfekt passt. Dafür verrätst du mir, warum du heute Morgen durchs Fenster getürmt bist.«
Bislang waren wir so damit beschäftigt, die Kleine zu unterhalten, dass wir keine Gelegenheit hatten, über gestern zu reden. Aber mir will das Bild einfach nicht aus dem Kopf, wie Scarlett mit verschmierter Wimperntusche vollkommen fertig auf meinem Fußboden hockt. Ich kenne sie noch nicht besonders lange und habe keine Ahnung, wie sie tickt. Doch bisher wirkte sie nicht wie ein besonders zerbrechlicher Charakter, der beim kleinsten Widerstand ins Wanken gerät. Mein Gefühl sagt mir, dass es einen triftigen Grund dafür geben muss, dass eine Frau wie sie buchstäblich am Boden ist.
Ihr Gesichtsausdruck unterstreicht diese These, lässt allerdings auch keinen Zweifel daran, dass ihr mein Themenwechsel nicht sonderlich gefällt.
»Ich wollte einfach nicht für Gerüchte sorgen.«
»Gerüchte«, wiederhole ich mit monotoner Stimme.
»Wenn Quincy gesehen hätte, dass ich aus deinem Zimmer komme … Er und Abigail haben auch so schon genug Theater.«
»Ganz offensichtlich«, seufze ich und beobachte, wie Lee versucht, die Brotkrümel gerecht unter den Enten aufzuteilen.
»Das ist alles.« Auch wenn Scarlett nichts an ihrer Haltung ändert, ist nicht zu übersehen, wie sie sich versteift. Ihre ganze Körpersprache schreit genau das Gegenteil. Das ist noch lange nicht alles. Sie will es mir nur nicht sagen.
Ich stecke die Hände in die Hosentaschen und kicke ein paar Eicheln zur Seite, die auf dem schmalen Weg liegen.
»Uuund …« Ich ziehe das Wort unnötig in die Länge und sehe auf das Wasser, dessen Oberfläche sich im Wind ganz sanft kräuselt. Aus dem Augenwinkel schiele ich jedoch so unauffällig wie möglich zu ihr hinüber. »… heute geht es dir besser als gestern?«
»Ja«, erwidert sie, ohne zu zögern mit einem breiten Grinsen. »Aber klar. Ich war einfach betrunken.« Sie zieht eine Hand aus der Tasche, um abzuwinken. »Du kennst das. Party, Alkohol, Drama. Aber alles gut. Ehrlich. Mir geht es bestens. Alles hervorragend. Super. Wirklich.«
Meine Augen weiten sich bei jeder ihrer Lügen ein bisschen mehr. Um ihre Worte als Bullshit zu erkennen, braucht man kein Psychologiestudium.
Langsam nicke ich.
»Das klingt, als ginge es dir wirklich ganz fantastisch. Beneidenswert.« Ich lasse sie anhand meines Tonfalls deutlich spüren, dass ich ihr kein Wort glaube.
Scarlett holt Luft, und ihr Mund öffnet sich. Ihr Blick flattert nervös umher und sucht einen Punkt, auf dem er verweilen kann. Es kommt kein Ton über ihre Lippen.
»Weil«, hole ich noch einmal aus, »gesetzt den Fall, es wäre nicht so, ist das auch okay. Diese Unbekümmertheit«, mit dem Kinn deute ich auf Lee, die von einem Schwarm Enten belagert wird, »verliert sich automatisch irgendwann. Jedem geht es mal scheiße. Das ist … keine Schande.«
Scarlett stößt ein trauriges Lachen aus.