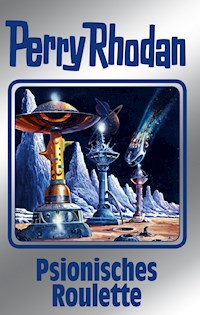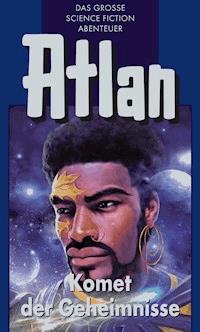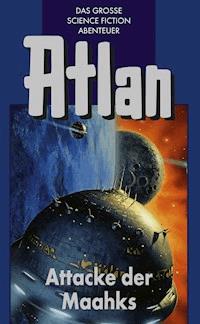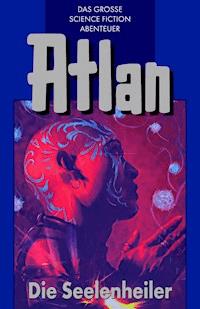Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Planetenroman
- Sprache: Deutsch
Auf dem Planeten der Ewigkeit - die Meister der Insel entstehen Gleichwohl sie eine die Milchstraße umspannende Macht waren, liegt die Geschichte der Lemurer, der Ersten Menschheit, immer noch weitgehend im Dunkeln. Seit der Vertreibung der Lemurer aus der Milchstraße sind mehr als zwanzigtausend Jahre vergangen. Nun aber macht eine kleine Gruppe von Neu-Lemurern auf einer namenlosen Welt in den Weiten ihrer neuen Heimatgalaxis eine aufsehenerregende Entdeckung. Dieser Fund weist ihnen den Weg zur Unsterblichkeit, zur Materieduplikation und letztlich zur Entstehung der Meister der Insel, die später zu den gefährlichsten Gegnern der Menschen werden sollten ... Ein echter Weltraum-Thriller mit packenden Szenen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Planetenroman
Band 15
Schmied der Unsterblichkeit
Auf dem Planeten der Ewigkeit – die Meister der Insel entstehen
Peter Terrid
Gleichwohl sie eine die Milchstraße umspannende Macht waren, liegt die Geschichte der Lemurer, der Ersten Menschheit, immer noch weitgehend im Dunkeln.
Seit der Vertreibung der Lemurer aus der Milchstraße sind mehr als zwanzigtausend Jahre vergangen. Nun aber macht eine kleine Gruppe von Neu-Lemurern auf einer namenlosen Welt in den Weiten ihrer neuen Heimatgalaxis eine Aufsehen erregende Entdeckung.
Prolog
Gleichwohl sie eine die Milchstraße umspannende Macht waren, liegt die Geschichte der Lemurer, der Ersten Menschheit, immer noch weitgehend im Dunkeln. Wir wissen, dass sie wohl vor 200.000 Jahren aus Genexperimenten der Takerer aus der Galaxis Gruelfin entstanden sind. Es sollte dann allerdings noch fast 150.000 Jahre dauern, bis die Zivilisation auf der galaktischen Bühne auftrat.
Der rasche Höhenflug der Lemurer wird durch den Krieg gegen die Haluter fast ebenso schnell beendet, wie er begonnen hat. In dieser fast einhundert Jahre dauernden Auseinandersetzung, die beide Seiten mit äußerster Härte führten, wurde nahezu das gesamte lemurische Erbe in der Milchstraße vernichtet. Immer wieder finden sich, selbst heute noch, Relikte aus jener Zeit. Die Natur dieser Relikte ist stets aufs Neue unberechenbar – jedes neue Fundstück birgt die Chance, die uns bekannten Fakten über die Erste Menschheit auf den Kopf zu stellen.
Dies ist irritierend für den Chronisten, auch wenn er vornehmlich mit der Zweiten, der terranischen Menschheit befasst ist. Zu vieles in der Geschichte auch der Zweiten Menschheit hängt von den Lemurern ab oder geht auf sie zurück, zu viele spätere Begegnungen fußen auf lemurischen Aktivitäten. Auch ES, die der Lokalen Gruppe zugehörige Superintelligenz, kannte die Lemurer, bediente sich ihrer und ihrer Abkömmlinge.
Eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Terraner spielte die Auseinandersetzung mit den Meistern der Insel in der Nachbargalaxis Andromeda. Es gibt eindeutige Beziehungen zwischen den im Lauf des Kriegs gegen die halutischen »Bestien« nach Andromeda geflohenen Lemurern (die später als Tefroder bekannt werden sollten), den Meistern der Insel und ES – Beziehungen, die für das Verständnis der kosmischen Bedeutung der Zweiten Menschheit von hoher Wichtigkeit sind.
Im Jahr 1173 Neuer Galaktischer Zeitrechnung enthüllte ES die Hintergründe des Entstehens der Meister der Insel – und doch ist dies nicht die einzige Version dieser Ereignisse. Es gibt andere, vielleicht teilweise bewusst unterdrückte. Der Einfluss übergeordneter Wesenheiten ist gerade in diesem Bereich überall fühlbar. Vielleicht wollte ES zuerst seine Beteiligung verschleiern.
Der nachstehende Bericht ist etwas, das man zu Gründungszeiten der Zweiten Menschheit als »Karteileiche« bezeichnet hätte: ein isoliertes Datenfragment mit der Bezeichnung »TBMV-288-3811851-36-5«. Es wird im Jahr 1282 in den Speichern der lunaren Großsyntronik NATHAN gefunden, und selbst der riesige Rechner kann sich seine Anwesenheit nicht erklären. Fest steht, dass dieses Fragment im Widerspruch steht zur tradierten Entstehungsgeschichte der Meister der Insel. Sein Ursprung ist weiterhin ein Rätsel.
Kapitel 1
Wie geschmolzenes Blei, schwer und gleißend, lastete der Himmel auf dem Land. In der Ferne verschwammen Himmel und Erde zu einem undefinierbaren Etwas, das in den Augen brannte. Die Hitze, die über der Landschaft lag, war kaum zu ertragen. Die Tiere hatten sich in die dürren Sträucher zurückgezogen oder in Erdhöhlen, um dort wenigstens ein bisschen Schatten zu finden.
»Eine Schwachsinnsidee«, murmelte Hervon Prokther, während er sich den dickperligen Schweiß von der Stirn wischte. »Ausgerechnet hierher einen Ausflug zu unternehmen. Hättest du dir nicht einen etwas einladenderen Planeten aussuchen können, Agaia?«
Die junge Frau hob nur die Schultern. »Warte ab«, empfahl sie ihrem Begleiter. »Die Sache wird noch aufregend werden.«
Selaron Merota lächelte still in sich hinein.
Vor sechs Stunden hatte das Beiboot die kleine Gruppe auf diesem Planeten abgesetzt, vier Männer und eine Frau. Agaia hatte diesen Ausflug geplant, um der Langeweile zu entgehen, der sie als Enkelin eines Tamrats ständig ausgesetzt war, und es war ihr auch gelungen, ein paar ihrer Freunde dazu zu bewegen, sich dieser Exkursion anzuschließen.
Selaron kannte Agaia seit einigen Jahren, und er hatte sehr schnell erkannt, dass sie das Risiko liebte. Wenn es eine Möglichkeit gab, irgendetwas Verrücktes oder Aufregendes anzustellen, konnte man sicher sein, dass Agaia darauf ansprang und die Rädelsführerin bildete. Allerdings hatte Selaron niemals herausfinden können, ob Agaia tatsächlich so unternehmungslustig war oder ob diese Abenteuer nicht vielmehr darauf zurückzuführen waren, dass sie sich in ihrem normalen Leben entsetzlich langweilte.
Als Enkelin eines Tamrats des neu-lemurischen Tamaniums genoss sie alle Privilegien dieser Oberschicht. Hunderte von Robotern und Dienern standen ihr zur Verfügung und gehorchten dem leisesten Wink. Ihr Taschengeld hätte ausgereicht, den Etat einer Zehn-Millionen-Stadt zu finanzieren. Selbst die ausgefallensten und verschwenderischsten Wünsche konnte sie sich erfüllen. Solange sie sich nicht in die politischen Geschäfte ihres Großvaters einmischte, konnte sie praktisch machen, was sie wollte. Für einen einfachen Neu-Lemurer – inzwischen bürgerte sich langsam der Name Tefroder ein – lebte Agaia in schier unvorstellbarem Luxus.
Selaron kannte Agaia seit drei Jahren und hatte sich von ihrer Stellung und ihrem Reichtum niemals verblenden lassen; vielleicht war das die Erklärung dafür, dass sie seiner noch nicht überdrüssig geworden war.
»Was wollen wir eigentlich auf diesem Planeten?«, wollte Hervon wissen. Er schnaufte heftig. »Gibt es hier irgendetwas zu finden, was man nicht auch anderswo haben könnte?«
Agaia lächelte geheimnisvoll.
Selaron sah sie von der Seite her an.
Sie war eine bemerkenswert schöne Frau; das sagte jeder, der sie einmal zu Gesicht bekommen hatte – sie war hochgewachsen und schlank. Die zarte Brauntönung ihrer Haut wies sie als reine Lemurerin aus. Selaron wusste, dass Agaia imstande war, ihre Ahnenreihe durch etliche Jahrtausende zurückführen zu können bis auf Vorfahren, die noch in der Ursprungsgalaxis der Lemurer geboren waren. Agaias Haare waren tiefschwarz, glatt zurückgekämmt und im Nacken zu einem breiten und schweren Geflecht zusammengewirkt. Auffällig waren die vollen Lippen und die ausdrucksvollen, mandelförmigen Augen.
Aber körperliche Schönheit war nicht das, was Agaias eigentümlichen Reiz ausmachte – es war ihre Ausstrahlung, die sie für die meisten Betrachter zum Inbegriff weiblicher Vollkommenheit machte. Es gab kaum einen männlichen Lemurer, der sich ihrem Zauber hätte entziehen können. Keiner anderen Person in dieser Galaxis wäre es beispielsweise gelungen, den rundlichen und verwöhnten Hervon Prokther zu einer solchen Expedition zu bewegen, bei der die Teilnehmer sich ihrer angeborenen Fortbewegungsmittel bedienen mussten.
Natürlich hatte auch Hervon schon zahlreiche Abenteuer erlebt, aber stets nur auf solchen Welten, die eigens für dieses Vergnügen der Oberschicht präpariert worden waren. Hier aber gab es nicht, in Büschen versteckt, Servoautomaten, die jederzeit erfrischende Getränke liefern konnten, oder fernhypnotisch gesteuerte Bestien, die zwar grauenvoll aussahen und sich ungeheuer wild und angriffslustig gebärdeten, aber letztendlich einem vornehmen Lemurer kein Haar zu krümmen imstande waren. Hervon hatte sichtlich Angst, das verrieten seine besorgten Blicke, mit denen er ständig die Landschaft musterte.
Agaia machte eine auffordernde Handbewegung. »Weiter«, drängte sie freundlich.
Langsam bewegte sich die Gruppe vorwärts. Die meisten seiner Kameraden kannte Selaron bereits – den rundlichen Hervon Prokther, der gewaltig unter dem Bündel schwitzte und stöhnte, das er sich aufgeladen hatte. Agaia trug die gleiche Last anscheinend ohne Mühe. Ihre rechte Hand hing herab, die Fingerspitzen pendelten neben dem Kolben ihrer Waffe.
Neben ihr schritt Gebdan Avalani, ein hagerer Mann mit einem leicht verbittert wirkenden Gesichtsausdruck. Als drittältester Sohn eines vornehmen Tamrats genoss er zwar ebenfalls alle Privilegien der Oberschicht, aber sein gut erkennbarer Ehrgeiz, selbst einmal Tamrat zu werden, hatte wenig Aussicht auf Verwirklichung – es sei denn, er griff zu einem Mittel, das in den letzten Jahrtausenden immer gebräuchlicher bei internen Machtkämpfen geworden war, und ließ seine beiden Brüder ermorden. Nach Selarons Einschätzung fehlte es ihm dazu aber an der nötigen Entschlossenheit.
Blieb noch Gorn Flaquor, ein bemerkenswert gut aussehender junger Mann, der sich Hoffnungen auf Agaia machte. Sein Vater war der prominenteste Emporkömmling des letzten Jahrhunderts gewesen, wahrscheinlich der reichste Lemurer, den es jemals gegeben hatte. Gorn oblag in der Planung seines Vaters die Aufgabe, dessen Lebenswerk zum Abschluss zu bringen und in die Oberschicht des Tamaniums einzuheiraten.
Selaron selbst war von solchen Ambitionen frei. Er war Wissenschaftler, und das dazu notwendige klare und analytische Denken hatte ihm schnell klargemacht, welchen Spielraum er in der Gesellschaft der Lemurer besaß. Die lemurische Wissenschaft hatte eine jahrhundertelange Talfahrt hinter sich, und die Prognosen für die Zukunft waren ähnlich düster.
Mehr als zwanzig Jahrtausende waren vergangen, seit die Lemurer aus ihrer heimatlichen Galaxis vertrieben worden waren. Inzwischen hatte man sich damit abgefunden, sich in der neuen Galaxis bequem eingerichtet und von der Vergangenheit viel vergessen. Wissenschaftler wurden zwar gebraucht, genossen aber kein hohes Ansehen; ihre Einkünfte waren bescheiden, Ruhm ließ sich nur innerhalb der Zunft ernten, und auch das nur, wenn man sich den gängigen Spielregeln unterwarf, die ebenso verwickelt und absurd waren wie in der regierenden Oberschicht des Tamaniums.
Selaron war einen halben Kopf größer als Agaia, noch recht jung und auffallend muskulös – die meisten Lemurer, die mit ihm zusammentrafen, hielten ihn für einen Teilnehmer an Arenakämpfen oder für Agaias Leibwächter.
Agaia machte wieder eine Handbewegung. »Duckt euch«, zischte sie.
Die Männer gehorchten sofort. Das hatte nichts mit eifriger Ergebenheit zu tun, mit der Absicht, ihre Gunst zu gewinnen – es lag vielmehr an der seltsamen, unwiderstehlichen Autorität, die Agaia ausstrahlte. Immer wieder hatte Selaron den Gedanken gehabt, dass Agaia zum Herrschen geboren zu sein schien. Ihre Aussichten, in die traditionsbewusste Altherrenriege der Tamräte eindringen zu können, waren allerdings praktisch gleich null.
»Eingeborene?«, wollte Gorn wissen.
Agaia lächelte und nickte dann. Selaron griff unwillkürlich nach seiner Waffe. Er hasste Gewaltanwendung, aber unter diesen Umständen ...
Die Teilnehmer der Expedition duckten sich hinter dem purpurfarben schimmernden Stachelgesträuch. In der Ferne waren Geräusche zu hören. Sie klangen wie Stimmen.
»Was sind das für Eingeborene?«, wollte Selaron wissen. »Echsenabkömmlinge? Insektoide?«
»Lass dich überraschen«, gab Agaia wispernd zurück.
Die Geräusche wurden lauter. Jetzt waren sie deutlicher zu hören. Sie ähnelten einer dumpfen, getragenen Litanei, vergleichbar den Gesängen, die bei Leichenbegängnissen der Lemurer üblich waren.
Selaron schob vorsichtig ein paar Blätter zur Seite und spähte in die Richtung, aus der die Klänge vom Wind herübergetragen wurden. Seine Brauen wölbten sich. Er wandte den Kopf und starrte Agaia entgeistert an.
»Aber das ist doch wohl nicht möglich«, sagte er mit gedämpfter Stimme. Agaias Lächeln bekam einen triumphierenden Anstrich.
»Wart es ab«, empfahl sie.
Jetzt konnte Selaron auch Gestalten sehen, von der Hitze umflimmerte Wesen, die langsam näher kamen, in einer feierlichen Prozession. Mehr als die verschwommenen Konturen konnte Selaron nicht ausmachen, aber das genügte ihm. Was er nicht zu erkennen vermochte, konnte er aus Kenntnis von Agaias Charakter rekonstruieren.
Er sah seine Nachbarin in dem Versteck eindringlich an. »Lemurer?«, fragte er flüsternd.
»Du hast es erfasst«, gab Agaia zurück.
Die anderen rissen weit die Augen auf; die Information war zu überraschend.
Selaron nestelte das Fernglas vom Gürtel und setzte es an die Augen. Eine Zeit lang bekam er nichts anderes zu sehen als Sand und Geröll, über dem die erhitzte Luft heftig flimmerte, aber dann erfasste die Optik die Eingeborenen.
Es waren mindestens einhundert, und schon auf den ersten Blick war zu sehen, dass sie von Lemurern abstammen mussten. Die Ähnlichkeit des Körperbaus war unübersehbar.
»Wie heißt diese Sonne?«, fragte Selaron, ohne das Glas sinken zu lassen.
»Luum«, antwortete Agaia sofort. Sie schien sich auf diesen Ausflug sorgfältig vorbereitet zu haben.
»Und von wem stammt der Name?«, forschte Selaron weiter. Gorn stieß ihn an, und Selaron gab ihm den Feldstecher. Er hatte genug gesehen. Er blickte Agaia an.
»Von mir«, sagte Agaia gelassen.
Selaron hatte ein ziemlich gutes Gehör, vor allem wenn es um Untertöne lemurischer Stimmen ging. Die Genugtuung, die in Agaias Stimme mitschwang, verriet ihm, dass dies nicht die eigentliche Überraschung dieser Expedition sein sollte – da war noch mehr.
Luum, wie Agaia die weißgelbe Sonne getauft hatte, lag in der südlichen Randzone der Galaxis, in der die Lemurer lebten, weitab von jenen Welten, die nach der Flucht aus der Nachbargalaxis entdeckt und kolonisiert worden waren.
Das System besaß nur drei Planeten. Der erste war eine sehr kleine, fast glutflüssige Welt, der dritte ein Wasserstoff-Methan-Riese. Nur der mittlere Planet, Luum-2, verfügte über eine für Lemurer atembare Atmosphäre.
Eigentlich hätte es in diesen entlegenen Regionen überhaupt keine Lemurer geben dürfen – es sei denn die Besatzung eines geheimen, weit vorgeschobenen Stützpunkts.
Aber die Besatzung eines solchen Stützpunkts wäre niemals halbnackt, nur mit Lendenschurzen bekleidet, herumgelaufen. Die Männer und Frauen hätten sich nicht Kronen aufgesetzt, die aus Zweigen und Blüten zusammengeflochten worden waren. Sie hätten moderne Energiewaffen getragen, keine urtümlichen Waffen wie Pfeil und Bogen. Und eine solche Besatzung hätte einen Toten entweder zu dessen Heimatwelt transportiert oder ihn, nach altem Brauch, im Raum bestattet. Ganz bestimmt hätte sie den Leichnam nicht auf eine Trage gepackt und durch die sengende Sonne geschleppt.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Selaron. »Wer sind diese Lemurer?«
»Das weiß ich auch noch nicht«, antwortete Agaia. Sie öffnete eine der Packtaschen und brachte einen Sprachanalysator mit einem hochempfindlichen Richtungsmikrofon zum Vorschein. Das Mikrofon richtete sie auf die Prozession, die knapp tausend Schritte von den Versteckten entfernt vorbeizog. Als Agaia das Gerät einschaltete, erschienen auf dem kleinen Kristallbildschirm Schriftzeichen.
Selaron blinzelte.
Die Zeichen, die langsam über den Bildschirm hinwegwanderten, waren nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, die phonetischen Transkriptionen fremder Laute. Es waren einwandfrei lemurische Schriftzeichen ...
Agaia deutete auf den Text.
»Siehst du es?«, fragte sie leise. »Es ist unsere Sprache, aber ein ganz seltsamer Dialekt.«
Gebdan Avalani kroch zu den beiden hinüber. Er zog die Stirn in Falten, als er die Schriftzeichen las, dann schüttelte er den Kopf. »Seltsam«, murmelte er. »Das ist doch wohl nicht möglich.«
»Kennst du diesen Dialekt?«, fragte Agaia schnell.
»Ja und nein«, antwortete Gebdan verwirrt. Über seine Schulter hinweg konnte Selaron die Prozession sehen, die langsam im Sonnenglast verschwamm. »Es ist eigentlich gar kein Dialekt.«
»Sondern?«
»Ich würde es für eine sehr urtümliche Form unserer Sprache halten«, erklärte Avalani kopfschüttelnd. »Seht hier – diese Schreib- und Sprechweise war üblich vor der zweiten großen Konsonantenverschleifung, und die liegt mindestens sechstausend Jahre zurück. Und diese Form scheint mir noch älter zu sein.«
Selaron versuchte sich zu erinnern, was er darüber wusste. Eine Sprache war durchaus in der Lage, sich im Lauf der Zeit zu verändern. Dabei wechselte nicht nur der Wortschatz durch Neuaufnahme von Begriffen oder das Verschwinden alter Wörter; auch die Schreib- und Sprechweise von Standardwörtern änderte sich, wenn auch nur sehr langsam. Es kam zu Konsonantenverschleifungen, zu Vokalverschiebungen und anderen Vorgängen, die aber allesamt so langsam abliefen, dass zeitgenössische Sprecher davon praktisch nichts mitbekamen. Nur wenn man Unterlagen aus längst vergangenen Jahrhunderten studierte, stieß man des Öfteren auf Begriffe, Redewendungen und Schreibweisen, die in der Alltagssprache nicht enthalten waren.
»Wie alt?«, fragte Agaia nach.
Avalani machte eine Geste der Ratlosigkeit. »Mindestens fünfzehntausend Jahre, wahrscheinlich sogar noch mehr.«
»Aber das kann nicht sein«, stieß Hervon Prokther aufgeregt hervor. »Älter als fünfzehntausend Jahre ... Das würde ja bedeuten, dass dieser Planet schon in der ersten Welle besiedelt worden ist.«
»So wird es wohl gewesen sein«, versetzte Agaia. Sie richtete sich auf und klopfte den rötlichen Sand von der Kleidung. »Und da schon in den ersten Jahrhunderten des neuen Tamaniums sehr sorgfältig Buch darüber geführt worden ist, welche Planeten angeflogen und besiedelt wurden, gibt es zur Erklärung dieser Lemurer auf dieser Welt nur eines ...«
Sie machte eine bedeutungsschwangere Pause.
»Diese Welt muss eine der allerersten gewesen sein, die jemals in dieser Galaxis von Lemurern angeflogen worden ist, zu einer Zeit, als die Verhältnisse in unserer alten Heimat so chaotisch waren wegen des Krieges mit den Halutern ...«
Unwillkürlich verzogen alle die Gesichter und spien auf den Boden; dieser Brauch hatte sich durch die Jahrtausende gehalten, eine Erinnerung an die erbitterte Feindschaft zwischen Lemurern und den Bestien von Halut, die nach dem Empfinden der meisten Lemurer immer noch Bestand hatte, auch wenn die riesenhaften Kreaturen ihnen nicht in die neue Heimat gefolgt waren.
Agaia setzte ihre Erklärung fort: »Nur in dieser Zeit konnte ein Schiff mit Siedlern verloren gehen, ohne dass dieser Verlust registriert und später durch Suchkommandos aufgeklärt worden wäre.«
Selaron stieß einen Laut der Bewunderung aus.
Vergangenheitsforschung war seit knapp zwei Jahrhunderten das liebste Freizeitvergnügen der lemurischen Oberschicht. Ahnenreihen wurden aufgestellt, und wem es gelang, zweifelsfrei seine Abstammung von den Lemurern der früheren Heimat nachzuweisen, der konnte sich höchsten Ansehens erfreuen. Überbleibsel aus den ersten Jahrtausenden der neueren lemurischen Geschichte wurden als Kostbarkeit gehandelt, mochten sie auch noch so schäbig und wertlos sein – es genügte, dass sie hinreichend alt waren.
Unter diesem Gesichtspunkt war Agaias Entdeckung eine Sensation allerersten Ranges, durchaus geeignet, ihr Jahrtausende währenden Ruhm einzutragen.
Selaron lächelte schwach, als er die Gesichter seiner Begleiter sah. Die Augen leuchteten, der Atem ging schneller, jeder war von freudiger Erregung erfüllt, wahrscheinlich getragen von der Hoffnung, dass alle Teilnehmer dieser Expedition Berühmtheit erlangen würden.
Der Wissenschaftler machte sich nicht viel daraus; außerdem war abzusehen, dass dieser Entdeckung früher oder später ein Prioritätenstreit folgen würde, dessen Gezänk und Gezeter in allen Medien erschallen würde, durchaus geeignet, den Entdeckern den Rest ihres Lebens gründlich zu versauern.
»Und wie bist du ausgerechnet auf diese Sonne gekommen?«, wollte er wissen.
»Glück«, antwortete Agaia offen. »Und Berechnung. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass ein paar der frühesten Transporter, die diese Galaxis angeflogen haben, verschollen sind. In den ersten Jahren waren die Transmitterverbindungen alles andere als stabil und sicher. Und dann habe ich mich gefragt, welche Art von Sonne ein versprengtes Schiff wohl anfliegen würde, wenn es nach einer Siedlungswelt sucht – doch wohl ein Gestirn, das dem unserer alten Heimat ähnlich sieht. Also habe ich konsequent nach gelben Sonnen in abgelegenen Bezirken unserer Galaxis geforscht, und dabei bin ich auf diese Welt gestoßen. So einfach war das.«
»Purer Zufall also«, murmelte Gebdan Avalani nachdenklich. Der Blick, den er für ein paar kurze Sekundenbruchteile auf Agaia warf, gefiel Selaron gar nicht. Unwillkürlich schoss in ihm der Verdacht hoch, dass der ehrgeizige Avalani vielleicht schon über einem Plan brütete, wie er diesen gewaltigen Erfolg für sich und seine Zwecke ausschlachten konnte. Dabei standen ihm die anderen Teilnehmer der Expedition natürlich im Weg ...
An der Skrupellosigkeit, die anderen Teilnehmer auszuschalten, fehlte es Avalani sicherlich nicht, nur an dem Mut, eine solche Handlung auch tatsächlich auszuführen. Aber das konnte sich ändern, und Selaron beschloss, ein waches Auge auf Avalani zu haben.
»Und was jetzt?«, fragte Gorn Flaquor.
»Wir folgen den Eingeborenen und studieren sie«, erklärte Agaia. »Wenn wir mit unserem Erfolg an die Öffentlichkeit treten, wollen wir dem neuen Tamanium einen möglichst vollständigen Bericht abgeben können. Also werden wir Material sammeln.«
Gorn rümpfte die Nase.
»Ließ sich das nicht bequemer anstellen?«, warf er missmutig ein. »Mit Robotsonden und dergleichen?«
»Bequemer ja, aber ganz gewiss nicht aufregender und ruhmvoller«, versetzte Agaia. »Was wären wir für Entdecker, wenn wir die eigentliche Arbeit von automatischen Kameras erledigen ließen. Kommt, wir wollen dem Zug der Alt-Lemurer folgen.«
Sie stand auf und marschierte los. Ihren Begleitern blieb nichts anderes übrig, als ihrem Beispiel zu folgen. Vorsichtshalber hatten sie ihre Waffen gezogen. Niemand konnte schließlich wissen, wie sich die notgelandeten Lemurer in den letzten Jahrtausenden entwickelt hatten. Selaron hatte allerdings den Verdacht, dass sie zivilisatorisch und technisch weit hinter den Stand des alten lemurischen Reiches zurückgefallen waren. Sicher war das aber nicht.
Nach kurzer Zeit erreichten sie die Spuren, die die Alt-Lemurer hinterlassen hatten. Selaron bückte sich neugierig und studierte die Abdrücke.
»Sandalen«, stellte er fest. »Einfache Platten unter den Fußsohlen; die Zehen liegen zum Teil frei. Hier kann man es genau sehen.«
Agaia lächelte zufrieden. »Also Primitive. Vielleicht haben sie auch absonderliche Bräuche entwickelt. Dieser Planet gefällt mir immer besser.«
»Diese Leute könnten gefährlich sein«, warnte Selaron, der ungern vermeidbare Risiken einging.
Agaia widersprach ihm. »Nicht für uns. Nicht, solange wir unsere Waffen haben. Ein Schuss wird genügen, und sie werden uns für Götter halten.«
»Der Gedanke scheint dir zu gefallen«, antwortete Selaron, während er sich wieder aufrichtete. Unwillkürlich warf er einen Blick nach oben. Irgendwo dort, weit oberhalb der Atmosphäre, kreiste das Schiff. Ein Funkspruch würde genügen, es herbeizurufen und mit ihm alle Mittel, die die lemurische Technik zur Verfügung stellte. Es tat gut, diese Rückversicherung zu haben, auch wenn Selaron wusste, dass Agaia erst im äußersten Notfall davon Gebrauch machen würde.
Die Gruppe marschierte weiter. In der Ferne ballten sich am Horizont Wolken zusammen. Selaron sah sie als Erster. Er runzelte die Stirn, sagte aber nichts.
Stunde um Stunde wanderte die Gruppe hinter der Kolonne der Alt-Lemurer her, sorgfältig darauf bedacht, von den Eingeborenen nicht gesehen zu werden. Offenbar lag das Ziel der Prozession tief im Gebirge, auf das die Lemurer zielstrebig zumarschierten.
Unterdessen hatte sich der Himmel hinter den beiden Gruppen verfärbt – eine massive Wand aus schwarzen Wolken schob sich am Horizont heran. Selaron sah Blitze in den Wolkenmassen zucken. Die Temperatur war gesunken, ab und zu fegten Böen über das Land, drückte die Pflanzen tief auf den Boden und wirbelte Staubfahnen vor sich her.
»Es sieht nach einem Sturm aus!«, warnte Selaron.
»Bevor er uns erfassen kann, haben wir längst das Gebirge erreicht«, gab Agaia zurück, ohne auch nur einen Blick über die Schultern zu werfen. Dass sich die Lage ein wenig verschärfte, schien ihr Vergnügen zu bereiten.
Agaia behielt recht, wie so oft. Die Gruppe hatte tatsächlich bereits das Gebirge erreicht, als der Sturm mit voller Wucht losbrach. Verschätzt hingegen hatte sie sich, was die Auswirkungen des Sturmes anging – vor diesem chaotischen Wirbel aus Wind und Sand boten auch die zerklüfteten Ausläufer des Gebirges keinen ernsthaften Schutz. Ein ohrenbetäubendes Tosen machte jede Verständigung unmöglich; die Wolkendecke war so dicht und schwarz, dass die Lemurer kaum die eigenen Füße erkennen konnten. Vorsichtshalber hatten sie eine Kette gebildet und hielten sich an den Händen. Der Wind zerrte an der Kleidung, feinkörniger Sand fegte schmirgelnd über die Haut und ließ den Boden rutschig werden.
Plötzlich verlor Selaron den Kontakt zu seinem Hintermann; jetzt hielt er nur noch die Hand von Agaia, die wie üblich die Spitze der Gruppe übernommen hatte.
Selaron zerrte an Agaias Hand. Sie blieb stehen. Da eine akustische Verständigung unmöglich war, benutzte Selaron ein eindeutiges Signal – er griff auch mit der nun freien Hand zu.
Agaia begriff sofort. Selaron konnte einen seltsamen, vom Wind verzerrten Laut hören. Die heftige Bewegung, die Agaia machte, schien auf Unwillen hinzudeuten.
Selaron zerrte Agaia auf den Boden. Weiterzumarschieren war jetzt nicht mehr angeraten. Wenn die Versprengten genug Verstand besaßen, dann suchten sie sich jetzt ebenfalls schnellstens eine Deckung und warteten das Ende des Sturmes ab. Jeder Versuch, auf eigene Faust weiterzumarschieren, konnte die Gruppe endgültig auseinanderreißen.
Die beiden Lemurer kauerten sich hinter einen großen Felsen, zogen die Kleidung dicht zusammen und warteten.
Es gehörte viel Nervenstärke dazu, einfach dazusitzen und den Sturm toben zu lassen. Wie bei einem Wolkenbruch ergossen sich Unmengen des feinkörnigen Sandes über die beiden. Weggeschwemmt werden konnten sie davon nicht, aber es bestand die Gefahr, dass sie unter den Sandmassen regelrecht begraben wurden. Selaron hielt noch immer Agaias Arm. Unwillkürlich versuchte er, ihren Puls zu tasten.