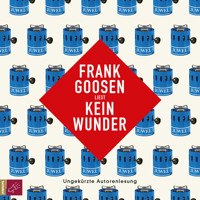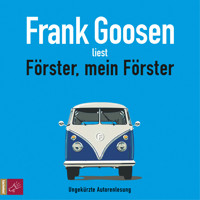7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Wer schon einmal in einem rosa Cadillac saß und über sein Leben sinnierte, weiss, wovon Frank Goosen schreibt.
Pokorny, Sohn des Schrottplatzbesitzers, rettet sich nach dem Tod seiner Mutter in den Spaß und wird Komiker. Sein Freund Zacher, Sohn einer Trinkerin, richtet sich in einer nüchternen Welt ein, als Anwalt. Was sie verbindet und gleichzeitig trennt: die Liebe zu Ellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Ähnliche
Frank Goosen
Pokorny lacht
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Das Buch
Friedrich Pokorny hat das gnadenlose Talent zum Entertainer. Seine bissigen Witze schützen ihn gegen alle Zumutungen des Lebens. Nahezu täglich steht er als Unterhalter auf der Bühne und verdient bei dem Kampf gegen seine selbstgewählte Einsamkeit auch noch gutes Geld. Doch ein Brief aus der Vergangenheit reißt die Mauern ein, die er um sich gebaut hat. Thomas Zacher, Pokornys Freund aus Schul- und Jugendjahren, ist wieder in der Stadt und lädt zum Abendessen ein. Pokorny wird überschwemmt von schmerzhaften Erinnerungen, die vor allem um Ellen kreisen. Sie war die große, die einzige Liebe von Pokorny und Zacher – bis über den Tag hinaus, an dem die beiden sie in den Tod trieben.
Der Autor
Frank Goosen, geboren 1966 irgendwo im Ruhrpott, hat sich Ruhm und Ehre als Hälfte des Kabarett-Duos »Tresenlesen« erworben und geht auch mit verschiedenen Soloprogrammen wieder auf Tournee. Sein Durchbruch war der Roman »Liegen lernen«, der viele Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste war und erfolgreich verfilmt wurde. »Pokorny lacht« ist sein zweiter Roman. 2003 erhielt Frank Goosen den vom Literaturbüro NRW-Ruhrgebiet verliehenen Literaturpreis Ruhrgebiet.
Inhaltsverzeichnis
Für Robert Hans Richard Goosen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Taschenbucherstausgabe 02/2005 Copyright © Eichborn AG, Frankfurt am Main, 2003 Copyright © dieser Ausgabe 2005 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, nach einer Idee von Christine Hucke unter Verwendung einer Fotografie von © 1996 Dovling Kindersley Limited, London/American 50’s Car Hire Gesetzt aus der Excelsior Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
eISBN: 978-3-641-21532-3V001
http://www.heyne.de
www.randomhouse.de
Zu Hause riss er zuerst die Fenster auf. Die Luft war abgestanden und muffig, wie immer, wenn er drei Wochen auf Tournee gewesen war. Die dicke Frau Sander, seine Putzfrau, hatte hier zwar einmal in der Woche nach dem Rechten gesehen, dabei aber wieder nicht gelüftet. Er ging in die Küche und machte sich einen doppelten Espresso. Sein Blick fiel auf den Haufen Post, den Frau Sander auf dem Tisch deponiert hatte. Das hatte Zeit. Das waren sowieso nur Rechnungen, Programme von Kleinkunsttheatern und Post von Veranstaltern, die seinen Agenten umgehen wollten, weil sie glaubten, dann kriegten sie Friedrich Pokorny billiger. Mit der Tasse in der Hand ging er nach draußen.
Der Garten war in einem schlimmen Zustand. In den nächsten Tagen würde er Maus anrufen müssen, den pensionierten Gärtner, der ihm das Grünzeug in Ordnung hielt.
Er zog seine Schuhe aus und ging über den Rasen. Er liebte das. Manchmal erwischte er sich dabei, wie er schon im Zug, lange vor der Ankunft am heimischen Bahnhof, diesem Moment entgegenfieberte.
Er trank den Espresso im Stehen und dachte an nichts. Dann ging er wieder hinein und packte seinen Koffer aus. Im Keller warf er die Leibwäsche in die Waschmaschine und stopfte den Rest in den großen Stoffsack, den die Reinigung am nächsten Morgen abholen würde.
Jetzt wäre Zeit für die Post gewesen, aber ihm ging nun die Stille im Haus ein wenig an die Nerven. Das passierte meistens eine bis anderthalb Stunden, nachdem er von einer Reise zurückgekommen war. Er legte A Man alone von 1969 in den CD-Player, die Platte, die Rod McKuen eigens für Sinatra komponiert hatte. Wahre Fans hielten nicht viel von dieser Schaffensphase des Meisters. Zu viele sentimentale Balladen, kein Biss, kein Swing. Friedrich fand, es war die richtige Musik für einen einsamen Mann, der gern heimlich in Selbstmitleid versank.
Er wollte gerade in die Küche gehen und sich endlich der Post zuwenden, als das Telefon klingelte. Es war sein Vater.
»Bist du wieder zu Hause?«
Sag bloß nicht Guten Tag, alter Mann, dir könnte die Zunge im Maul verdorren. »Hallo Papa, wie geht es dir?«
»Ach, wie soll es mir gehen …« Pause.
So war das immer. Sein Vater rief an, beklagte sich und wartete darauf, dass sein Sohn das Gespräch bestritt. Friedrich tat ihm den Gefallen. »Was macht der Rücken?«
»Ach, was soll mein Rücken schon machen …«
»Soll ich heute Abend mal vorbeikommen?«
»Tja, wenn du meinst …«
»Möchtest du, dass ich vorbeikomme?«
»Also, wenn es dein Terminplan erlaubt …«
»Er erlaubt es.«
»Tja, wenn du einen Teil deiner kostbaren Freizeit mit deinem alten Vater verbringen möchtest …«
Friedrich atmete hörbar aus. Konnte sein Vater überhaupt noch einen Satz sagen, der nicht in drei Punkten endete?
»Also, wenn dir das alles zu viel wird«, sagte der alte Pokorny, »dann bleib lieber zu Hause.«
»Ich komme am frühen Abend vorbei.«
»Sehr genaue Zeitangabe!«
»Gegen sieben.«
»Gegen sieben? Na ja, dein alter Vater hat ja nichts mehr vor. Der sitzt nur blöd rum und wartet darauf, dass der Herr Sohn mal vorbeikommt.«
»Ich bin um Punkt sieben bei dir. Zufrieden?«
»Ich weiß nicht. Hört sich an, als wäre es eine enorme Überwindung für dich.«
»Das stimmt nicht. Also um sieben?«
»Tja, wenn du meinst …«
Sie legten auf.
Der Vater hatte nie begriffen, womit Friedrich sein Geld verdiente.
»Was soll das heißen, du stehst auf einer Bühne und erzählst komische Geschichten?«, hatte er gefragt, als sein Sohn ihm eröffnete, er wolle das jetzt beruflich betreiben.
»Na ja, es heißt, was es heißt. Ich erzähle komische Geschichten und die Leute lachen.«
»Worüber? Über dich?«
»Über das, was ich erzähle.«
»Das ist dasselbe.«
»Finde ich nicht.«
»Du kriegst Geld dafür, dass die Leute über dich lachen. Das ist ja schlimmer als eine Nutte!«
»Ich kriege aber mehr Geld.« Das stimmte damals noch nicht, aber Friedrich hoffte, den Vater wenigstens mit der Aussicht auf materiellen Erfolg beruhigen zu können.
»Friedrich, so etwas ist keine Arbeit.«
»Aber es macht Spaß.«
»Spaß, wenn ich das schon höre!«
Für Karl Pokorny hatte Arbeit nichts mit Spaß zu tun. Arbeit hatte einem gefälligst die Gesundheit zu ruinieren. Spaß war etwas für Schwätzer. Mit fünfzehn hatte Friedrich seinen Vater mal gefragt, ob er in seinem Beruf »Erfüllung« fände. »Erfüllung?«, hatte der Alte ausgerufen. »Ich stehe morgens auf, gehe arbeiten, komme abends nach Hause und am nächsten Morgen geht es wieder von vorne los. Ich habe keine Langeweile, wenn du das meinst.« Als sein Sohn anfing, Geld zu verdienen, bestand der Vater auf der Rückzahlung des Geldes, das er Friedrich für sein Studium gegeben hatte.
Nach dem Gespräch mit seinem Vater wäre eigentlich Zeit für die Post gewesen, aber Friedrich beschloss, seine schlechte Stimmung an seinem Agenten auszulassen. Er rief Konietzka an und beschwerte sich zum x-ten Male über die Qualität der Hotels, die Kleinstädte und vor allem die freien Tage.
»Friedrich«, sagte Konietzka, »im letzten Jahr hattest du zweihundertfünfzig Auftritte. Kein normaler Mensch spielt so viel!«
»Also waren noch einhundertfünfzehn Abende frei. Von Matineen will ich gar nicht sprechen.«
»Ich vermute mal, dann wird es dich auch nicht gerade freuen, dass der Auftritt am nächsten Samstag ins Wasser fällt.«
»Wieso?«
»Denen ist die Finanzierung zusammengebrochen. Das passiert schon mal bei diesen kleinen Kulturinitiativen.«
»Ich könnte mit der Gage runtergehen.«
»Das Ding ist vom Tisch. Tut mir Leid. Dafür hast du doch übermorgen die Aufzeichnung mit Korff und Steiner.«
»Ach komm, du weißt, das ist nur Drittes Programm, öffentlich-rechtlich. Das sieht kein Schwein. Und die, die es doch sehen, kommen nicht in meine Vorstellungen, weil sie abends das Altersheim nicht verlassen dürfen.«
»Du übertreibst maßlos, mein Bester. Ich faxe dir gleich mal den Probenplan und den Sendeablauf.«
»Und Korff ist ein Arschloch.«
»Natürlich ist Korff ein Arschloch«, sagte Konietzka, »und Steiner ist auch eins, das weiß jeder. Aber es gibt zweieinhalbtausend Juros, also hab dich nicht so.«
»Bitte sag Euro und nicht Juros.«
»Ich lege dir die Pläne gleich mal aufs Fax.«
»Ja, leg mir die Pläne mal aufs Fax. Was für eine bescheuerte Formulierung!«
»Du, ich muss jetzt Schluss machen. Mein Zeitmanagement erlaubt mir höchstens fünfzehn Minuten pro Künstler am Tag.« Konietzka kicherte wie ein Kind. Friedrich hasste es, wenn sein Agent so redete, deshalb zog Konietzka ihn immer wieder damit auf.
Kaum hatte er aufgelegt, rief Silvia an.
»Ich hätte dich auch heute noch angerufen«, sagte er. »Ist alles in Ordnung?«
»Ja. Das heißt nein. Es geht um Kai.«
»Probleme?«
»Ich mache mir Sorgen um ihn.«
»Mütter machen sich immer Sorgen.«
»Seine Zensuren gehen in den Keller. Er ist frech und treibt sich mit merkwürdigen Leuten herum.«
»Er ist fünfzehn. Was erwartest du?«
»Er ist gerade mal vierzehn, und ich komme an ihn nicht mehr heran.«
»Das nennt man Pubertät. Nur weil du keine hattest, musst du nicht glauben, sie sei abgeschafft worden.«
Silvia seufzte. »Das war nicht nötig.«
»Du hast Recht, es tut mir Leid.«
»Kai ist beim Klauen erwischt worden«, sagte Silvia.
Jungs klauen nun mal, wollte Friedrich erst sagen, aber er konnte sich gerade noch zusammenreißen. »Was hat er denn geklaut?«
»CDs. Die haben ihn angezeigt. Sie sagen, sie machen das immer so.«
»War er allein?«
»Nein, es waren noch andere dabei, aber er will nicht sagen, wer. Obwohl es ihm sicher nützen würde.«
Na, wenigstens ist der Junge kein Denunziant, dachte Friedrich.
»Könntest du nicht mal mit ihm reden?«, fragte Silvia.
»Ich weiß nicht, was das bringen soll.«
»Und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er nimmt mich doch gar nicht mehr ernst. Ich habe Angst, dass er eines Tages etwas wirklich Schlimmes macht.«
»Okay, ich rede mal mit ihm.«
»Ich muss jetzt Schluss machen.«
Silvia lebte allein. Sie hatte mehr Pech mit Männern als sie verdiente, und das war Friedrichs Schuld. Hätte er sie nicht geschwängert, wäre sie jetzt nicht eine allein erziehende Mutter mit einem pubertierenden Sohn, der jeden Mann angiftete, der seine Mutter auch nur nach der Uhrzeit fragte. Zwei oder drei hatten es ein paar Monate mit ihr ausgehalten, aber dann war es ihnen zu viel geworden.
Jetzt die Post. Er fing an, die Umschläge durchzuarbeiten. Das Übliche, lauter Altpapier. Und dann hielt er in der Bewegung inne. Da war ein Kuvert mit einem Absender, den er nicht glauben konnte. Er betrachtete den Umschlag von allen Seiten. Feines Papier, verschnörkelte Schrift. Er stand auf, ging ins Wohnzimmer, setzte sich auf das Sofa, stand wieder auf und ging zurück in die Küche. Der Umschlag war noch da. Mit dem gleichen Absender. Links oben in der Ecke: Thomas Zacher. Die Straße kannte Friedrich nicht, aber die Postleitzahl erlaubte keinen Zweifel: Zacher war wieder da.
Friedrich stand auf und machte sich noch einen Espresso, den er dann nicht trank. Stattdessen starrte er in das Halbdunkel des Gartens und stellte fest, dass er seine Schuhe am Nachmittag auf dem Rasen vergessen hatte. Er holte sie herein und setzte sich wieder an den Küchentisch. Er fragte sich, seit wann Zacher wieder zurück war, wie lange sie beide wieder in der gleichen Stadt wohnten.
Friedrich sah auf die Uhr. Viertel vor sieben. Um sieben musste er bei seinem Vater sein. Er rannte nach oben, zog sich in aller Eile um, holte den Wagen aus der Garage und fuhr davon, ohne das Garagentor zu schließen und ohne die Alarmanlage zu schärfen. Sollten sie doch bei ihm einsteigen! Vielleicht nahmen sie dann den ganzen Scheiß mit, der auf seinem Küchentisch lag.
Obwohl er schneller fuhr als erlaubt und zwei Ampeln bei Gelb nahm, kam er sieben Minuten zu spät bei seinem Vater an. Der Alte stand schon in der Tür und sah auf die Uhr. »Ah, der Herr Sohn konnte sich doch noch freimachen.«
Als er um kurz nach elf wieder nach Hause kam, stand das Garagentor noch immer offen. Niemand war eingebrochen. Der Küchentisch sah aus wie vorher. Friedrich kippte den Espresso weg, den er am frühen Abend nicht getrunken hatte, und reinigte die Maschine.
Er ging ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein, drehte aber den Ton herunter und legte Sammy Davis junior auf. So hielt er durch bis zum Nachtmagazin auf RTL, zu dem er den Ton wieder aufdrehte und Sammy Davis abwürgte. Er hörte zu, aber kriegte nicht mit, was in der Welt passiert war. Um halb eins schaltete er ab und ging nach oben. Er machte Abendtoilette, legte sich ins Bett und schaltete das Licht aus. Die Leuchtziffern des Radioweckers zeigten 0.44 Uhr. Dann 0.45 Uhr. Dann 0.46 Uhr. Dann 0.47 Uhr. Das ging so weiter bis 1.12 Uhr. Dann hatte Friedrich eine Lücke bis 2.01 Uhr. Etwa eine halbe Stunde zählte er wieder die Minuten. Dann war es plötzlich 3.45 Uhr. Um 4.12 Uhr stand er auf, setzte sich wieder vor den Fernseher und versuchte, sich von einer dieser dämlichen Dauerwerbesendungen einschläfern zu lassen. Das funktionierte nicht. Er ging barfuß in den Garten und wartete auf den Sonnenaufgang. Der Himmel wurde irgendwann milchig grau, aber die Sonne zeigte sich nicht.
Friedrich wusste, dass er den Umschlag irgendwann würde öffnen müssen.
Aber bevor er das tat, ging er in den Keller. Es dauerte immerhin eine Viertelstunde, bis er die kleine Holzkiste mit den schwarzen Beschlägen und dem winzigen Vorhängeschloss gefunden hatte. Er trug sie nach oben und stellte sie auf den Küchentisch. Den Schlüssel hatte er mit einem Streifen Tesafilm oben auf den Deckel geklebt. Er öffnete die Kiste und nahm die Fotos heraus.
Sie lagen wild durcheinander. Da waren welche von seinen ersten Auftritten im »Marty’s«, von Silvia, als sie schwanger war, und von Konietzka mit wechselnden Frauen. Friedrich fiel wieder auf, dass er so gut wie keine Aufnahmen von seinen Eltern hatte. Sein Vater hatte sich noch nie gern fotografieren lassen. »Geh mir weg mit Fotos«, hatte er einmal gesagt. »Die liegen nur rum, und alle wollen sie sehen und dann muss man sie sich angucken. Ich will nicht wissen, wie ich mal ausgesehen habe.« Es gab natürlich ein Hochzeitsbild von Friedrichs Eltern, aber auch das war verschwommen und unscharf, die Gesichter nur helle Flächen mit dunklen Flecken, dort, wo die Augen, die Nasenlöcher und der Mund sein mussten. Immerhin, man konnte erkennen, dass die Braut Weiß getragen hatte und der Bräutigam einen dunklen Anzug.
Und dann: Pokorny und Zacher am Tag der Ausgabe ihrer Abiturzeugnisse, wobei sich Zachers Mutter so blamiert hatte. Zacher, der ernste junge Mann aus schwierigen Verhältnissen, der so viel klüger war als alle, die über ihn die Nase rümpften.
In einer zusammengefalteten Klarsichthülle steckten die drei Fotos von Ellen. Das eine zeigte sie von hinten, den Kopf aber der Kamera zugewandt. Sie lachte. Auf dem zweiten lag sie auf dem Bett in ihrem winzigen Wohnheimzimmer und las in einer Zeitschrift. Und dann das dritte. Das, welches er immer vor Augen hatte, wenn er an sie dachte. Wie sie im Bett saß, das Glas in der Hand. Und von der Seite konnte man so gerade noch den Ansatz ihrer Brust sehen.
Er steckte die drei Bilder wieder in die Klarsichtfolie, legte sie zu den anderen Fotos in die Kiste und verschloss sie wieder. Er nahm den Brief und riss ihn auf, ohne das Küchenmesser zu benutzen.
Es war eine Einladung, sehr förmlich, auf schwerem Papier. Dr. Thomas Zacher und Carla Veneri-Zacher luden ihn zu einem Abendessen ein. Zacher hatte also seinen Doktor gemacht, was Friedrich nicht sonderlich überraschte. Und er hatte geheiratet.
Das Abendessen sollte am folgenden Samstag sein. Der Samstag, den er nun frei hatte, weil dieser Auftritt abgesagt worden war. Vielleicht sollte Friedrich dort anrufen und sagen, er spiele zur Not auch umsonst. Er konnte nicht zu Zacher gehen, sich mit ihm an einen Tisch setzen und essen, als sei nichts gewesen. Immerhin war Zacher dafür verantwortlich, dass Ellen nicht mehr lebte.
Erster Teil
1
Friedrich war schon fast an der Sonderschule vorbei, als ihm drei Jungen und zwei Mädchen entgegenkamen, die er schon öfter gesehen hatte. Er fing an zu schwitzen und sehnte sich auf die andere Straßenseite. Mit den Kindern von der Sonderschule gab es immer nur Ärger. Sie riefen einem Schimpfwörter hinterher, so was wie Arschloch, Wichser, Ficker oder Spasdi, und Friedrich hatte schon gehört, dass sie einen Jungen, der ganz in seiner Nähe wohnte, verprügelt hatten.
Sie kamen immer näher. Auf die andere Straßenseite durfte er aber nicht, das hatte ihm seine Mutter verboten, es war zu gefährlich. Unauffällig versuchte er, möglichst weit rechts zu gehen, obwohl er damit der Straße bedrohlich nahe kam. Die fünf aber gingen nebeneinander her, wie in einer geübten Formation, es würde eng werden. Der zweite von rechts war der größte, er hatte dunkles Haar, das ihm an den Seiten bis über die Ohren reichte, hinten bis weit über den Kragen und vorne in die Augen hing. Die beiden Mädchen waren dick, hatten schlechte Haut und trugen Kleider, obwohl es nicht besonders warm war. Ganz links ging ein Junge in Fußballschuhen. Und ganz rechts ein kleiner, dunkler Junge, der Turnschuhe trug, von denen sich die Streifen zu lösen begannen. Ohnehin waren es nur zwei gewesen und nicht drei, wie sich das gehörte. Friedrich spürte den Luftzug der Autos, die an ihm vorbeifuhren.
Es war eigentlich kaum zu spüren, nur eine leichte Berührung, Friedrichs Schulter hatte die des kleinen Jungen gestreift. Es war der, an dessen Schuhen die Streifen nicht mehr halten wollten. Erst eine Sekunde zuvor hatte Friedrich gedacht, es könnte klappen, er könnte vorbeikommen, aber dann machte der kleine Junge eine Bewegung, eine ganz kleine nur, und ihre Schultern berührten sich. Friedrich ging einfach weiter. Der kleine Junge schrie ihm hinterher: »Ey du Sau! Bist du bescheuert?« Dann hörte Friedrich eine andere Stimme, wahrscheinlich die des großen Jungen. »Was ist los?«
»Die schwule Sau hat mich angerempelt!«
Friedrich ging weiter, ohne sich umzudrehen, aber er wusste, dass er in Schwierigkeiten war. Er war nicht nur eine Sau, sondern eine »schwule Sau«. Er hatte keine Ahnung, was das Wort bedeutete, aber es konnte nichts Gutes sein.
»Ernsthaft?«, fragte die zweite Stimme.
»Hat mich voll angerempelt, der Arsch!«
»Ey, Kurzen!«, rief der große Junge, und es war klar, wen er meinte, aber Friedrich hielt es für besser, gar nicht zu reagieren.
»Ich rede mit dir! Du Arsch mit dem orangenen Tornister!«
Friedrich ging weiter. Aber dann spürte er, wie eine Hand seinen Tornister nach unten drückte, damit er nach hinten kippte. Friedrich konnte sich gerade noch fangen und drehte sich um. Der große Junge stand vor ihm und sah ihn durch die vor seinen Augen hängenden Haare an. »Du hast meinen Kumpel angerempelt!«
»Entschuldigung«, murmelte Friedrich.
»Wie bitte? Ich kann dich nicht hören!« Die anderen Kinder kamen näher.
»Entschuldigung!«, sagte Friedrich etwas lauter. Er sah auf den Boden, so wie er es tat, wenn sein Vater zu Hause mit ihm schimpfte. Der große Junge drehte sich zu den anderen um und lachte: »Der Arsch entschuldigt sich.«
Der kleine Junge mit den kaputten Schuhen rief: »Und du meinst, das reicht, oder was?«
Friedrich schwieg.
»Er hat dich was gefragt!«, sagte der Große.
Friedrich zuckte mit den Schultern.
»Ich glaube nicht, dass das reicht«, schüttelte der Große den Kopf. »Ich glaube, du brauchst noch ein paar auf die Fresse. Hä? Was sagst du dazu?«
Friedrich hielt den Mund.
»Würdest du nicht auch sagen, du brauchst ein paar auf die Fresse?«
Friedrich konzentrierte sich auf die Fuge zwischen den beiden Gehsteigplatten, auf denen er stand.
»Los sag schon! Sag es! Sag, dass du ein paar auf die Fresse brauchst!«
Friedrich war schon klar, dass er auf jeden Fall verprügelt werden würde. Wenn er tat, was der Junge wollte, würde er Prügel bekommen, weil er darum gebeten hatte, und tat er es nicht, würde der Junge ihn schlagen, weil er nicht gehorcht hatte. Er hoffte, dass die Schläge nicht so schlimm sein würden, wenn er den Jungen nicht noch weiter gegen sich aufbrachte, also flüsterte er: »Ich brauche ein paar auf die Fresse.«
»Was? Ich habe dich nicht gehört! Habt ihr ihn gehört?«
»Nein!«, riefen die beiden Mädchen wie aus einem Munde.
»Also noch mal! Spuck’s aus!«
Da es nun einmal raus war, konnte er es genauso gut auch wiederholen. Und Friedrich sagte lauter: »Ich brauche ein paar auf die Fresse!«
»Habt ihr das gehört?« Der große Junge fing an zu lachen. »Der Idiot will was auf die Fresse!«
Friedrich dachte noch, der Junge könnte doch mal eine andere Formulierung gebrauchen, da kam auch schon der erste Schlag, aber nicht der Junge hatte zugeschlagen, sondern eines der Mädchen. Sie kicherte, als hätte sie von etwas Verbotenem genascht. Sie hatte ihn mit der flachen Hand auf die Wange geschlagen, hatte ihm eine Ohrfeige verpasst, als sei er ein unartiges Kind. Das andere Mädchen schlug Friedrich mit der Faust ins Gesicht. Von seiner Nase breitete sich ein Schmerz im ganzen Kopf aus, gleichzeitig hatte er das Gefühl, niesen zu müssen. Jetzt kam bestimmt der große Junge an die Reihe.
Aber bevor Friedrich wieder einen Schlag einstecken musste, hörte er ein komisches Geräusch. Es hörte sich an wie »Ou!«. Gleichzeitig entwich irgendwo Luft, wie wenn man einen vollen Luftballon losließ, bevor man ihn zugeknotet hatte. Der Junge mit den kaputten Turnschuhen lag plötzlich am Boden. Vor ihm stand Thomas Zacher, ein Junge, der in die gleiche Klasse ging wie Friedrich, mit dem er aber noch nie gesprochen hatte. Für etwa eine Sekunde guckten alle sehr überrascht. Dann rief der große Junge: »Wer bist du denn?«
Statt zu antworten, rammte Thomas ihm den Kopf in den Bauch, sprang auf ihn drauf und schlug ihm ein paar Mal ins Gesicht. Dann packte er Friedrich, und sie rannten weg. An der nächsten Ecke stolperten sie, kamen zwar wieder hoch, aber da waren die anderen schon da. Und jetzt gab es richtig was auf die Fresse, ob verlangt oder nicht. Es gelang Thomas immerhin, dem Jungen mit den Turnschuhen einen Zahn auszuschlagen. Um nicht wie ein kompletter Idiot dazustehen, landete Friedrich einen Treffer bei einem der Mädchen, doch er traute sich nicht, ihr ins Gesicht zu schlagen, also schlug er ihr in den Magen. Ihre Schwester rempelte ihn so hart von der Seite, dass er das Gleichgewicht verlor. Dann waren beide Mädchen über ihm und traten zu, erwischten ihn am Kopf und an den Rippen. Der große Junge und der mit den Turnschuhen machten das Gleiche mit Thomas.
Zwei ältere Männer gingen vorbei, lachten und sagten: »Guck mal, die kloppen sich!«
Dann hörten die Tritte auf, Friedrich und Thomas blieben aber noch liegen. Die Kinder von der Sonderschule wurden noch ein paar Beschimpfungen los. Als Thomas aufstehen wollte, kam der mit den Fußballschuhen heran und trat ihm zwischen die Beine. Thomas schrie und rollte sich zusammen. Die anderen liefen weg.
»Tief durchatmen«, sagte Friedrich.
Nach einer Viertelstunde etwa waren sie beide wieder auf den Beinen. Sie gaben sich die Hand.
»Ich bin Thomas Zacher.«
»Ich weiß«, sagte Friedrich. Thomas wohnte in dem Haus gleich neben dem Schrottplatz, der Friedrichs Vater gehörte. In den letzten dreieinhalb Jahren hatte Friedrich Thomas schon oft gesehen, wenn er zur Schule ging. Thomas war nur immer ein paar Minuten früher dran gewesen als Friedrich. Sie waren jahrelang hintereinander hergegangen, manchmal im Abstand von nur fünfzig Metern.
Am Abend fragte die Mutter Friedrich, wie es in der Schule gewesen sei und was er danach so getrieben habe. Sie hatte einen Termin beim Arzt gehabt, und das hatte etwas länger gedauert, deshalb war Friedrich den ganzen Nachmittag allein gewesen. Er erzählte von der Sache mit den Kindern von der Sonderschule und dass Thomas Zacher ihm geholfen habe. Dabei sah Friedrich seinem Vater zu, wie der dicke Scheiben vom Röstbrot schnitt, wobei das Messer fast in seiner riesigen Pranke verschwand. »Dreckspack«, sagte der Vater, »asoziales Dreckspack«, und die Mutter fragte, wen der Vater meine, die Kinder von der Sonderschule oder den kleinen Thomas Zacher.
»Beide«, sagte der Vater. »Die Zacher säuft und hat ständig Kerle bei sich rumlaufen, richtig verlottert sieht die aus.«
»Aber der Thomas scheint ganz pfiffig zu sein«, sagte die Mutter. »Immerhin hat er Friedrich heute geholfen.«
»Muss man ihm lassen. Scheint kein Feigling zu sein.« Der Vater war mit dem Brotschneiden jetzt fertig und fing an, die steinharte Butter fast fingerdick auf den Scheiben zu zerdrücken und zu verteilen. Dann kam die grobe pommersche Gutsleberwurst obendrauf. »Lass dich nicht fertig machen«, sagte der Vater, »das hast du nicht nötig, wir sind keine Idioten, wir müssen uns nichts gefallen lassen. Dein Vater ist Unternehmer, schlag zurück, wenn sie dir krumm kommen.«
»Er soll sich nicht prügeln«, sagte die Mutter und wischte sich die Hände an der geblümten Schürze ab, obwohl sie nicht schmutzig waren.
»Ich sage ja nicht, dass er Prügeleien anfangen soll, aber wenn sie ihm krumm kommen, soll er sich wehren.«
»Thomas und ich wollen jetzt immer zusammen zur Schule gehen«, sagte Friedrich.
»Ist sicher eine gute Idee«, sagte die Mutter schnell.
»Meinetwegen«, brummte der Vater. »Der Junge kann ja nichts für seine Mutter.«
»Ich erinnere mich noch an deinen ersten Schultag«, sagte die Mutter. »Da war doch der kleine Thomas ganz alleine. Ohne Mutter und ohne Schultüte.«
Stimmt, Friedrich erinnerte sich. Thomas hatte in der Aula, als die Klassen eingeteilt wurden, auf der vordersten Kante seines Stuhls gesessen und das Kinn ganz weit nach vorn gereckt, um nichts zu verpassen.
Nach dem Abendessen verließ Friedrich das Haus und ging durch die breite Einfahrt, über der auf einem großen Schild »Autoverwertung Karl Pokorny« geschrieben stand. Abends, wenn hier keiner mehr war, nicht einmal sein Vater, fühlte er sich hier am wohlsten. Da hatte er all die kaputten Autos für sich, konnte sich hineinsetzen und so tun, als sei er auf der Autobahn, oder er krabbelte durch die Vorderseite hinein und zum Kofferraum wieder hinaus. Aber das alles war nur ein Vorspiel, damit machte er sich selbst Appetit auf die eigentliche Attraktion des ganzen Schrottplatzes. Ganz hinten stand ein Zwinger, ein Käfig, in dem jedoch kein Tier gefangen gehalten wurde, sondern ein Auto. Kaum zu glauben, dass dieses riesige Ding mal richtig gefahren war. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand groß genug war, auch nur über das Lenkrad hinwegzuschauen. Sein Vater sagte, das Auto sei ein »Käddi«, ein richtiger Straßenkreuzer. Es kam aus Amerika und war rosa.
Abends stand Friedrich oft vor dem Zwinger und starrte den »Käddi« an. Spielen durfte er darin nicht, dafür war das Auto zu wertvoll, aber er durfte davor stehen und es bewundern. Heute hatte der Vater die Tür des Zwingers offen gelassen, und Friedrich konnte nicht widerstehen, er ging hinein. Das war riskant. »Ein Schrottplatz ist nicht ungefährlich«, sagte der Vater immer. Sein Blick auf das Haus, das dem Schrottplatz am nächsten war. Ganz oben, fast unter dem Dach, stand Thomas Zacher am Fenster. Friedrich hob die Hand und winkte. Thomas schien zu zögern, dann aber winkte er zurück. Friedrich zeigte auf den Straßenkreuzer, legte sogar kurz seine Hand auf den vorderen Kotflügel. Dann hatte Thomas wohl etwas hinter sich gehört, er drehte sich kurz um, dann schloss er das Fenster und zog die Gardine vor.
Als er zurück zum Haus ging, blickte er noch einmal zu dem Schild über der Einfahrt hoch. »Autoverwertung Karl Pokorny«. Darauf war Friedrich stolz. Die Väter der anderen Kinder in der Gegend hatten keinen eigenen Betrieb, von ihnen gab es nirgendwo ein großes Schild mit ihrem Namen drauf. Komischerweise aber fanden die anderen Kinder und auch ihre Eltern das gar nicht so toll. Für sie war Friedrichs Vater immer noch der »Klüngelskerl«, weil er früher mit dem alten Pritschenwagen von Großvater Pokorny durch die Straßen gefahren war und Alteisen gesammelt hatte. Auf dem Armaturenbrett des Lasters hatte immer eine alte Glocke gestanden, die der Vater aus dem Fenster gehalten und geschüttelt hatte, damit alle wussten: Der Klüngelskerl ist da. Er nahm alles, Hauptsache es war aus Metall. Ein Jahr bevor Friedrich zur Welt kam, kaufte er das Gelände am Ende der Straße und eröffnete die »Autoverwertung Karl Pokorny«. Aber für die Leute blieb er »Klüngelskerl«, und das bekam auch Friedrich immer wieder zu spüren. Im Kindergarten hieß es nur: »Da kommt der Sohn vom Klüngelskerl«, und eine der Kindergartentanten sagte mal, ohne zu wissen, dass Friedrich es hören konnte, zu einer anderen: »Der lebt doch immer noch von dem, was andere wegwerfen. So ein Schrottplatz ist doch keine Umgebung für so ein Kind.« Friedrich erzählte das seinem Vater, und der wurde sauer und schnauzte: »Ein Schrottplatz ist kein Rosengarten, das müssen die endlich mal begreifen.«
Sein Vater war klein, aber sehr kräftig. Er rasierte sich jeden Monat seinen Schädel, um den Friseurbesuch zu sparen. »Rausgeschmissenes Geld« war das für ihn. Friedrichs Vater gab nicht gern Geld aus. Neue Hosen, neue Schuhe, neue Hemden und Pullover, das war alles Verschwendung. Friedrich musste seine Hosen tragen, bis sie ihm kaum noch bis zum Knöchel reichten. Bei allen Schäden vom Knöchel bis zum Knie musste die Mutter die Hose abschneiden und umnähen, damit Friedrich die Hose noch im Sommer anziehen konnte. Und selbst wenn es neue Sachen gab, hatten die billig zu sein, sonst zählte nichts. »Hose ist Hose«, meinte der Vater.
Als Friedrich wieder ins Haus kam, saß sein Vater vor dem Fernseher, auf dem Tisch eine zur Hälfte getrunkene Flasche Bier. Sein Schädel glänzte, er hatte geschwitzt; sein Hemd stand offen, als hätte er es sehr hastig zugeknöpft. »Du bist am Käddi gewesen«, sagte der Vater. Friedrich wusste, Leugnen hatte keinen Zweck, also hielt er den Mund. »Lass die Finger davon«, sagte der Vater, aber Friedrich wunderte sich, dass er nicht strenger mit ihm war.
Friedrich sagte: »Die Tür vom Zwinger steht noch offen.«
»Ich geh gleich raus und mach sie zu«, sagte der Vater, blieb aber sitzen.
Auf dem Weg zu seinem Zimmer kam Friedrich am Schlafzimmer vorbei und sah seine Mutter vor dem großen dreiteiligen Spiegel der Frisierkommode sitzen. Hier konnte man sich von allen Seiten ansehen, ohne sich groß den Kopf zu verrenken, das hatte Friedrich schon immer gefallen. Auch hatte er seine Mutter schon oft davor sitzen sehen, wie sie ihr Haar bürstete oder die Fingernägel lackierte, obwohl der Vater das nicht mochte. »Mal dich nicht so an«, hatte er ein paar Mal gesagt, aber das hatte die Mutter nicht weiter interessiert, und komischerweise war sein Vater dann gar nicht sauer geworden. Überhaupt hatte Friedrich noch nie gesehen, dass sein Vater und seine Mutter sich gestritten hätten. Sein Vater regte sich über alles Mögliche auf, über Kunden, die ihn bei den Ersatzteilen runterhandeln wollten, über die Nachbarn, für die er nur der Klüngelskerl war, über die Politiker im Fernsehen, aber zu seiner Frau hatte er noch nie ein böses Wort gesagt.
Friedrich sah, wie seine Mutter, nur in Unterrock und Büstenhalter, ihre schwarzen Lederhandschuhe anprobierte. Im Herbst und im Winter trug sie die Handschuhe jeden Tag, zog sie nicht mal im Supermarkt aus oder im Kaufhaus, beim Bäcker, beim Metzger oder im Café. Wenn Friedrich mit ihr unterwegs war, hielten ihre Lederfinger seine Hand fest umschlossen, aber das war kein unangenehmes Gefühl für ihn, das Leder fühlte sich ganz weich und geschmeidig an.
Sie schob jetzt das Material zwischen den Fingern zurecht, bis es perfekt saß, und begutachtete mit ausgestrecktem Arm die nach oben abgespreizte Hand. Sie griff nach einer Bürste und begann, ihr Haar zu kämmen. Sie saß oft vor dem Spiegel und kämmte ihr dichtes blondes Haar, durch das eine leichte Welle ging. Es konnte passieren, dass sie eine halbe Stunde lang bürstete, den Kopf schräg gelegt, erst die eine, dann die andere Seite. Wenn sie fertig war, leuchtete ihr Haar im Dunkeln.
Friedrich mochte sich von dem Anblick nicht losreißen, wie immer. Er sah durch den Spalt und fragte sich, ob seine Mutter die Schlafzimmertür absichtlich immer ein wenig offen stehen ließ, damit er ihr zusehen konnte, aber wahrscheinlich bemerkte sie ihn gar nicht. Er hoffte, sie würde heute wieder ihre Nägel lackieren, indem sie die Finger auf der Frisierkommode spreizte, ein kleines Pinselchen in das Fläschchen mit dem roten Lack tunkte und dann gewissenhaft über die Nägel führte. Zwischendurch kontrollierte sie den Farbauftrag, wieder mit ausgestrecktem Arm, die Hand nach oben abgespreizt, ganz so, wie sie den Sitz ihrer Handschuhe überprüfte. War sie fertig, schüttelte sie ihre Finger aus und pustete auf die Nägel, damit der Lack schneller trocknete. Heute aber schien sie das nicht machen zu wollen. Stattdessen griff sie zu dem Parfüm, das auf der Frisierkommode stand, eine achteckige Flasche mit einem Metallverschluss am Hals, an dem ein dünner roter Schlauch angebracht war, der in einem kleinen Ball endete. Friedrich beobachtete interessiert, wie seine Mutter die Flasche nahm, sie neben ihren Kopf hielt und dann mit der anderen Hand auf den Ball drückte, sodass ein feiner Nebel aus der Flasche kam. Kein anderes Kind hatte eine solche Mutter, das wusste Friedrich. Wenn er mit seiner Mutter in der Stadt unterwegs war, konnte es passieren, dass Männer sich nach ihr umdrehten oder ihr hinterherpfiffen. Sie lächelte dann und tat so, als kümmere es sie nicht weiter.
Er ging in sein Zimmer und legte sich auf sein Bett. Er freute sich immer, wenn er sie so sah, manchmal saß sie aber auch ganz allein in der Küche, den Kopf in die Hände gestützt, schwer atmend. Oder sie blieb beim Spazierengehen plötzlich stehen, griff sich an die Stirn und kniff die Augen zusammen, als ob sie etwas blendete. Wenn sein Vater dabei war, wandte er sich ihr sofort zu, sah Friedrich an, zog sie außer Hörweite, redete leise auf sie ein und strich ihr sanft über den Kopf. Ihn selbst umarmte der Vater nicht einmal zum Geburtstag, aber wenn die Mutter sich an die Stirn griff, dann küsste der Vater sie auf die Wangen und auf ihr Haar, auch wenn er sich dafür ein wenig auf die Zehenspitzen stellen musste.
Am nächsten Morgen wartete Thomas Zacher schon vor der Haustür, um mit Friedrich gemeinsam zur Schule zu gehen. Sie nickten einander zu wie alte Bekannte.
»Tolles Auto«, sagte Thomas Zacher.
»Ein Käddi«, sagte Friedrich.
»Ich weiß. Wahrscheinlich Baujahr ’56, Weißbandreifen. Klar, dass dein Vater dafür einen Käfig gebaut hat.«
»Er kann sogar den Maschendrahtzaun unter Strom setzen!«, sagte Friedrich, obwohl das nicht stimmte.
»Würde ich auch machen, wenn das Ding mir gehören würde.«
Es gehört dir aber nicht, dachte Friedrich, hielt aber den Mund, weil er sich mit Thomas nicht streiten wollte. Ohne ihn wäre er gestern aufgeschmissen gewesen.
In der Schule ging Thomas, kurz bevor der Unterricht losging, zu Frau Engels, der Klassenlehrerin, und besprach etwas mit ihr. Dann kam er zu Friedrich und sagte, sie dürften jetzt zusammensitzen. Friedrich wunderte sich etwas, aber eigentlich war das ganz gut, denn den dicken Jörg, der bisher sein Banknachbar gewesen war, konnte er nicht leiden. Thomas hatte bisher ganz allein gesessen. Friedrich nahm seine Sachen und ging hinter Thomas Zacher her in die letzte Reihe. Alle anderen drehten sich verwundert zu ihnen um und runzelten die Stirn. Frau Engels lächelte nur und fing mit dem Unterricht an.
Nach der zweiten Stunde, als alle zur großen Pause auf den Hof stürmten, hielt Frau Engels Friedrich zurück. »Friedrich, auf ein Wort!«, sagte sie. So redete sie immer. Sie sagte auch Sachen wie »Mich deucht, das ist falsch« oder »Eiderdaus« oder »Verdammich«. Sie hatte lange, glatte Haare und vorstehende Zähne. »Ich finde es schön«, sagte sie, »dass du dich ein wenig um den kleinen Zacher kümmerst.«
Friedrich verstand nicht ganz, was sie damit meinte.
»Na ja, ich habe mich natürlich erst ein wenig gewundert, als Thomas meinte, du wolltest unbedingt neben ihm sitzen, würdest dich aber nicht trauen, mir das zu sagen, aber dann dachte ich: Potzblitz, es ist doch fein, dass sich da zwei anfreunden, die es beide nicht leicht haben. So, und jetzt geh spielen.«
Friedrich ging nach unten auf den Schulhof. Er hatte sich doch gar nicht gewünscht, neben Thomas Zacher zu sitzen, das war dessen Idee gewesen. Draußen suchte er nach seinem neuen Banknachbarn, fand ihn aber nicht. Stattdessen stand plötzlich Andreas Frieling vor ihm. Andreas hatte ein rotes Gesicht und war schon einen ganzen Kopf größer als alle anderen in der Klasse. »Ey, Schrott-Spasdi«, sagte er, »bist jetzt dicke mit dem Asi, was? Der kommt sich vor, als wenn er was Besseres wär, aber der soll mal bloß aufpassen, er ist ein doofer Asi-Arsch und seine Mutter ist ne Nutte, das ist mal klar.« Und dann drehte sich Andreas Frieling um und lief weg.
Friedrich fand Thomas auf der Treppe zum Fahrradkeller. Er saß da und aß sein Pausenbrot. Friedrich setzte sich neben ihn und wollte ihn eigentlich fragen, wieso er das mit Frau Engels gemacht habe, aber da hielt ihm Thomas sein Pausenbrot hin und fragte, ob er mal abbeißen wolle. Friedrich nickte, biss ab und musste feststellen, dass die Wurst, die auf dem Brot war, viel besser schmeckte als der Adler-Weichkäse, den seine Mutter ihm immer aufs Brot schmierte.
»Das schmeckt gut«, sagte Friedrich. »Was ist das?«
»Schinken«, sagte Thomas.
»So was macht meine Mutter mir nie.«
»Meine auch nicht. Hab ich selbst gemacht.«
»Aber immerhin kauft deine Mutter so was.«
»Nee, auch nicht.«
»Lecker«, sagte Friedrich, und Thomas hielt ihm das Brot wieder hin. Friedrich biss ab und hatte keine Lust mehr, die Sache mit Frau Engels anzusprechen.
Nach der Schule gingen sie zusammen nach Hause. Die Mutter stand am Fenster und winkte, als sie die Straße herunterkamen. Friedrich rief ihr zu, ob Thomas mit zu ihnen nach Hause kommen dürfe, damit sie zusammen Hausaufgaben machten, und die Mutter nickte lächelnd. Friedrichs Vater ging gerade, die Hände in den Taschen seines Blaumanns versenkt, mit einem Kunden über den Schrottplatz. Friedrich bemerkte, wie Thomas’ Blick umherschweifte. Der will den Käddi, dachte er, aber da kann er lange suchen.
Thomas durfte auch mit Friedrich und seinen Eltern zu Mittag essen, es gab Erbsensuppe mit Mettwürstchen, und weil nur drei Würstchen da waren, sagte die Mutter, Friedrich könne seine doch mit Thomas teilen.
Mit den Hausaufgaben war Thomas als Erster fertig, so dass er Friedrich, der noch nicht einmal die Hälfte geschafft hatte, helfen konnte. Für Thomas war das alles ganz klar, Friedrich brauchte da etwas länger. Thomas sagte: »Stell dich nicht so an. Ist doch ganz einfach. So blöd bist du nicht.« Bisher hatte Friedrich keine Hilfe bei den Hausaufgaben gebraucht. Seine Mutter sah sie sich am Abend an, und manchmal hatte er auch ein paar Fragen, aber das war auch schon alles.
Danach gingen sie zum Spielen nach draußen. Thomas wollte auf den Schrottplatz, aber Friedrich meinte, er würde lieber zu dem Spielplatz zwei Straßen weiter gehen. Thomas blickte ein paar Mal zwischen Friedrich und dem Autofriedhof hin und her, war dann aber einverstanden. Eine halbe Stunde später kletterte Friedrich etwas lustlos auf dem bunten Gerüst herum, während Thomas auf der roten Parkbank an der Seite saß, wie eine Mutter, die auf ihr Kind aufpasste.
»Macht dir der Spielplatz keinen Spaß?«, wollte Friedrich wissen, als sie wieder nach Hause gingen.
»Ist nichts für mich«, sagte Thomas.
Thomas holte noch seinen Tornister aus Friedrichs Zimmer und ging dann nach Hause, und da fiel Friedrich auf, dass Thomas gar nicht seine Mutter gefragt hatte, ob er bei Friedrich bleiben dürfe. Er hatte sie nicht mal angerufen.
Am nächsten Morgen gingen sie wieder zusammen zur Schule, saßen im Unterricht nebeneinander, hockten in der Pause auf der Treppe zum Fahrradkeller. Thomas hatte für Friedrich ein Butterbrot mit Schinken mitgebracht. Als sie in die Klasse zurückkamen, guckten die anderen sie an, als hätten sie beide Dreck im Gesicht.
Mittags durfte Thomas wieder mitessen, es gab noch immer Erbsensuppe, heute aber für jeden eine ganze Mettwurst. Bei den Hausaufgaben war Thomas wieder sehr viel schneller. Zum Spielen gingen sie diesmal nicht auf den Spielplatz, sondern auf die große Brache hinter den Häusern, da, wo früher die alte Zeche gewesen war. Aber auch da schien es Thomas nicht zu gefallen. Auf nichts, was Friedrich vorschlug, hatte er so richtig Lust, und als sie sich am Abend verabschiedeten, sagte Thomas: »Wieso gehen wir morgen zum Spielen nicht mal auf den Schrottplatz? Oder meinst du, dein Vater hat was dagegen?«
»Muss ihn mal fragen«, sagte Friedrich. Er wusste nicht, wie er Thomas klar machen konnte, dass der Platz nur ihm gehörte. Er hoffte, sein Vater würde nein sagen, aber das war nicht sehr wahrscheinlich. Der Vater hatte nie was dagegen, wenn Friedrich zwischen den Autos spielte. Kaputtmachen konnte man auf einem Schrottplatz ja nichts mehr.