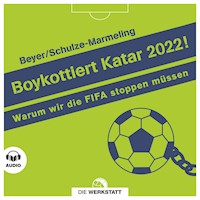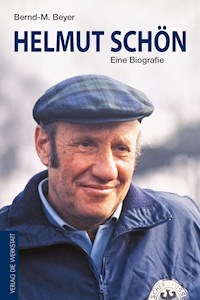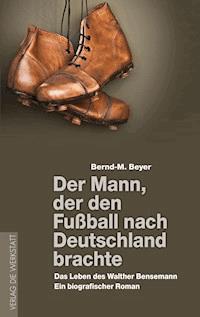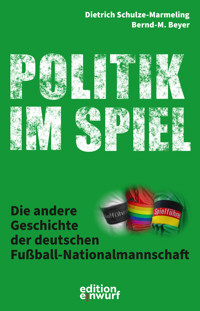
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Körber
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Nationalmannschaft steht nicht nur mit ihren sportlichen Leistungen im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Seit Spieler aus Migrationsfamilien mitkicken, fühlen sich rechtsradikale Kräfte herausgefordert. Die heftigen Diskussionen um den Auftritt in Katar oder Rüdigers Ramadan-Gruß zeigen zudem: Wenn es um die Nationalelf als Repräsentanten Deutschlands geht, ist immer auch Politik im Spiel. Das ist nicht neu. Dieses Buch verfolgt die "andere", die politisch gefärbte Geschichte der Nationalmannschaft. Zu den Stationen zählen der Missbrauch der Elf in der NS-Zeit, das "Wunder von Bern", der politisch gelungene Auftritt im WM-Finale 1966, das "Sommermärchen" 2006 und sein Revival 2024 sowie aktuell der Versuch rechter Kreise, die Nationalmannschaft als "undeutsch" zu diffamieren – gerade weil sie die gesellschaftliche Realität des Landes spiegelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietrich Schulze-Marmeling | Bernd-M. Beyer
Politik im Spiel
Dietrich Schulze-Marmeling | Bernd-M. Beyer
Politik im Spiel
Die andere Geschichteder deutschenFußball-Nationalmannschaft
Der Verlag behält sich das Text-und Data-Mining nach §44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
1. Auflage 2025
© edition einwurf GmbH, Rastede
Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:
ISBN 978-3-89684-725-6 (Print)
ISBN 978-3-89684-726-3 (Epub)
Satz und Gestaltung:
Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen
Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH
Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
www.edition-einwurf.de
Inhalt
Vorwort
1908 BIS 1920 „English sports“ und deutsches Spiel
EXKURS Drei Pioniere der „Ur-Länderspiele“
1920 BIS 1933 Von „deutschem Volksgemeinschaftsgeist“ und „fremder Mentalität“
EXKURS Ermordet, vertrieben: zwei jüdische Nationalspieler
1933 BIS 1945 Der deutsche Sonderweg: Die Nationalelf über alles
EXKURS Nationalspieler im braunen Dress: Rudolf Gramlich und manch anderer
1945 BIS 1958 Wir sind so frei …
EXKURS „7-8-9-10-Klasse“ – die DDR-Nationalmannschaft
1958 BIS 1973 Das Wagnis von mehr Demokratie
EXKURS Ein Wiedersehen, das nicht stattfinden durfte
1973 BIS 1988 Am Anfang war die Prämie
EXKURS Der DFB-Boss und der Nazi
1988 BIS 1998 Der Kanzler in der Kabine: Die Politik wird fußballerisiert
EXKURS „Für Deutschlands Ehre Die Nationalmannschaft und die politische Rechte
1998 BIS 2018 Zeitenwende beim DFB und der „Fall Özil“
EXKURS Hybride Identitäten – die Fans der Nationalmannschaft
2018 BIS 2024 Die Mannschaft unterm Regenbogen
EPILOG Berti Kohl und Angela Löw? Eine politische Geschichte der Bundestrainer
Literatur (Auswahl)
Personenregister
Die Autoren
Bildquellen
Vorwort
Seit im Mai 2018 İlkay Gündoğan und Mesut Özil auf einem Foto gemeinsam mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdoğan posierten, sind die politischen Debatten um die Fußball-Nationalmannschaft hitziger geworden. Özils zorniger Rücktritt, der unselige Auftritt der Mannschaft bei der WM in Katar, die Nominierung Gündoğans zum Kapitän oder ein über die sozialen Medien gestreutes Gebet des Moslems Antonio Rüdiger – das alles sorgte für gewaltige Aufreger in den Medien und vor allem im Netz. Schließlich wurde vor der Europameisterschaft 2024 sogar die Trikotfarbe zum Politikum: Durften deutsche Fußballjungs wirklich in solch einem tuntigen Pink-Lila die gastgebende Nation vertreten?
Dass die Nationalmannschaft politische Zuschreibungen und Diskussionen erfährt, dass bei ihren Auftritten also „Politik im Spiel“ ist und es nicht nur um Sport geht, ist jedoch keineswegs ein neues Phänomen, sondern begleitet die Auswahl von Beginn an. Das vorliegende Buch greift daher weit zurück in die Pionierzeit des Fußballs und arbeitet sich chronologisch in die Gegenwart vor, wobei einzelne Aspekte zeitlich übergreifend in Exkursen behandelt werden. Weitgehend ausgespart bleibt die Frauen-Nationalmannschaft, deren Geschichte erst 1982 begann. Schon dieser späte Zeitpunkt demonstriert ihre besondere Problemlage, nämlich die Konfrontation mit sexistischen Vorurteilen. Davon abgesehen gestalten sich die gesellschaftlichen Debatten um sie weit weniger akzentuiert und kontinuierlich als bei ihren männlichen Kollegen.
■ ■ ■
Der öffentliche Fokus, der auf das Männer-Nationalteam gerichtet ist, hängt eng mit dessen Rolle als Repräsentanten Deutschlands zusammen. Dies galt schon in den Kindertagen des Spiels, als Fußball im Deutschen Reich noch eine Randsportart war. Seinerzeit und hierzulande war es ein völlig neuer Gedanke, dass eine repräsentative Mannschaft Fußball-Deutschland in Länderspielen vertreten und sich dabei mit anderen Nationen messen sollte. Und dieser Gedanke war durchaus umstritten; insbesondere das deutsch-nationale Lager hielt nichts davon. In die Schlagzeilen gelangte dieser Diskurs allerdings nicht, dafür war das Spiel noch zu nebensächlich.
Als Fußball nach dem Ersten Weltkrieg zum Massen- und Zuschauersport avancierte, erhielt der Aspekt einer Repräsentanz eine wachsende Bedeutung. Siege oder Niederlagen in wichtigen Länderspielen waren fortan auch politisch konnotiert. Der viel zitierte WM-Gewinn von 1954 war dafür beileibe kein Einzelfall. In der Bundesrepublik gab und gibt es keine andere Instanz oder Persönlichkeit, die über politische Strömungen, soziale Schichten und kulturelle Schranken hinweg eine solch breite Zuschreibung als Aushängeschild des Landes erfährt wie die Fußball-Nationalmannschaft. Für nicht wenige Deutsche ist sie auf internationaler Bühne der wichtigste Vertreter.
Das ist nicht ganz unbegründet. Dank der weltweiten Bedeutung des Fußballs prägt die nationale Auswahl das Bild, das Deutschland international abgibt, in gewissem Umfang mit. Im Guten wie im Schlechten. Der atmosphärisch gelungene Auftritt von Fritz Walter und Co in Moskau 1955, während der Hochphase des Kalten Krieges also, relativierte im Nachhinein ein wenig die Selbstgefälligkeit des DFB-Präsidenten Peco Bauwens, der den WM-Gewinn ein Jahr zuvor in völkischer Tradition als „Repräsentanz besten Deutschtums“ überhöht hatte. Die Fairness, mit der Uwe Seelers Mannen im Finale 1966 das ungerechte „Wembley-Tor“ akzeptierten, wurde gerade im Land des vormaligen Weltkriegsgegners als „sportsman-like“ anerkannt. Die kreative Leichtigkeit der EM-Sieger von 1972 unterstrich, parallel zur Brandt’schen Ostpolitik, eine neue Wahrnehmung der Deutschen im Ausland – so wie die arroganten Auftritte von Schumacher, Breitner und Co. bei der WM zehn Jahre später dieses Bild wieder arg beschädigten. Und die empathische Zurückhaltung, die Jogi Löws Team beim 7:1-Triumph über die brasilianischen Gastgeber im WM-Halbfinale 2014 zeigte, nahm diesem Kantersieg zumindest politisch den Stachel einer Demütigung.
Bei den Turnieren 2006 und 2024 im eigenen Land bemühte sich der DFB, die deutschen Gastgeber als tolerant und weltoffen zu präsentieren. Die meisten internationalen Beobachter nahmen es tatsächlich so wahr, auch wenn dieses Bild nicht ganz den Realitäten entsprach. Als internationale Visitenkarte Deutschlands hat die Nationalelf jedenfalls ihre Bedeutung.
■ ■ ■
Stärker als um die Wirkung im Ausland geht es in diesem Buch allerdings um die Wahrnehmung, die die Nationalmannschaft im eigenen Land erfährt. Dass die Sympathien für die Elf sportlichen Konjunkturen folgen, dass beispielsweise nach gelungenen WM-Auftritten die Identifikation der Fans mit ihrem Team höher ist als nach schlappen Niederlagen, ist selbstverständlich. Unabhängig davon existiert jedoch eine zweite Perspektive, die auf die DFB-Auswahl als Repräsentantin der Nation gerichtet ist. Das Verhältnis zur Nationalelf wird stark dadurch geprägt, inwieweit sie auch jenseits sportlicher Leistungen dem jeweils erwünschten Bild von Deutschland entspricht.
Für die Nazis war die Angelegenheit ziemlich klar: Die Nationalmannschaft sollte die großdeutsche Volksgemeinschaft abbilden, in all ihrer arischen Reinheit und Gesinnung. Weshalb neben Juden auch nicht-jüdische Spieler ausgeschlossen blieben, die gegen das völkisch geprägte Amateurideal verstoßen hatten, wie die Stürmerstars „König Richard“ Hofmann oder „Ossi“ Rohr. Nachdem die Volksgemeinschaft gewaltsam um Österreich erweitert worden war, wurde Reichstrainer Herberger jenseits aller sportlicher Logik angewiesen, seine Nationalelf streng paritätisch aus „Altdeutschen“ und „Ostmarkern“ zu besetzen – um die völkische Einheit auch im Fußball zu demonstrieren.
Das Misstrauen gegen Profifußballer überdauerte die Nazi-Zeit, und Kicker, die notgedrungen im Ausland ihr Geld verdienten, galten in der Bundesrepublik vielfach als raffgierige Vaterlandsverräter. Noch bis weit in die 1970er Jahre und in die Amtszeit von DFB-Boss Hermann Neuberger hinein war ihre Berufung für Länderspiele keine Selbstverständlichkeit. Mit ähnlichen, aus heutiger Sicht kuriosen, in damaliger Zeit jedoch reaktionär geprägten Vorurteilen hatten Spieler zu kämpfen, die nicht dem braven, angepassten, strammdeutschen Ideal entsprachen. Lange Haare auf dem Schädel von Nationalspielern provozierten eine Lawine wütender Briefe an Bundestrainer Helmut Schön, vergleichbar mit heutigen Hass-Posts im Internet. Dass diese Jungs beim Abspielen der Nationalhymne stumm blieben oder gar Kaugummi kauten, kam erschwerend hinzu.
Mag es sich dabei (auch) um einen Generationenkonflikt gehandelt haben, so änderte sich dies, als mit Erwin Kostedde 1974 erstmals ein schwarzer Nationalspieler für Deutschland auflief, und 25 Jahre später mit Mustafa Dogan der erste Spieler mit türkischen Wurzeln. Vorbehalte und Hetze gegen sie und ihre Nachfolger griffen auf die völkische Blickweise des Nationalsozialismus’ zurück: Die Nationalelf hatte eine (fiktive) rassisch reine Volksgemeinschaft abzubilden, in der Nicht-Weiße und Menschen mit Migrationsgeschichte keinen Platz haben. Mit dem Erstarken rechtsradikaler Stimmungen und Parteien wurden diese Stimmen lauter. Nicht alle mögen so weit gehen wie AfD-Politiker, die dem DFB-Team jegliche Legitimation absprechen, Deutschland zu repräsentieren, und die jede Niederlage als Bestätigung ihres Rassismus’ sehen. Doch der Konflikt um Rüdigers Gebetsvideo zeigte, welchen Vorurteilen sich jene Nationalspieler weiterhin ausgesetzt sehen, die nicht der „biodeutschen“ Norm entsprechen. Nicht von ungefähr stehen gerade sie auch unter besonderer Beobachtung, wenn es um das Mitsingen der Nationalhymne geht, das den Spielern 1984 im Zuge von Helmut Kohls „geistig-moralischer Wende“ verordnet worden war: Singen sie tatsächlich mit? Oder tun sie nur so?? Oder kennen sie gar den deutschen Text nicht???
„Es ist offenbar kein Zufall“, schrieb 2024 die Frankfurter Allgemeine Zeitung, „dass gerade rund um den Fußball eine Homogenität des Volkes beschworen wird“. Doch jenseits völkischer Phantastereien gilt: Die deutsche Nationalmannschaft spiegelt in ihrer heutigen Zusammensetzung die gesellschaftliche Realität in Deutschland, in all ihrer Vielfalt und Diversität. Nichts anderes wäre mit sportlichen Grundsätzen vereinbar. Fairness und Toleranz gebieten es, niemanden aus rassistischen oder religiösen Gründen von der sportlichen Teilhabe auszuschließen. Eine Nationalelf, in der keine Spieler mit familiärer Migrationsgeschichte stünden, wäre heutzutage nicht wirklich eine deutsche.
■ ■ ■
Das vorliegende Buch bildet in gewisser Weise die Essenz jener Tätigkeit, bei der sich die beiden Autoren in den vergangenen 30 Jahren forschend und schreibend mit der Geschichte des deutschen Fußballs auseinandergesetzt haben. Dabei ging es immer auch um die gesellschaftlichen Implikationen des Spiels, die in den Untersuchungen und Publikationen des 20. Jahrhunderts noch kaum Beachtung gefunden hatten. Beide Autoren verstanden sich als Teil eines größeren Kreises von Publizist:innen, Fans und Wissenschaftler:innen, die in diesem Sinne das Spiel neu entdeckten und seine gesellschaftliche Relevanz entschlüsselten. Ohne ihre Arbeit wäre dieses Buch nicht möglich gewesen.
Nicole Selmer und Hardy Grüne danken wir herzlich für ihre Gastbeiträge zu diesem Buch. Großer Dank gebührt ebenso unserem Lektor Christoph Schottes sowie dem Team der neuen edition einwurf, das die Idee zu diesem Buch engagiert aufgegriffen hat.
Dietrich Schulze-Marmeling
Bernd-M. Beyer
1908 BIS 1920„English sports“ und deutsches Spiel
Eines der frühesten Länderspiele führte die Nationalelf im März 1912 nach Zwolle. In einem denkwürdigen 5:5 gegen die Niederlande schossen die beiden bis heute einzigen Nationalspieler jüdischen Glaubens alle deutschen Tore: Julius Hirsch (sitzend zweiter von rechts) vier, Gottfried Fuchs (sitzend dritter von rechts) eins.
Die politische Geschichte der deutschen Nationalmannschaft begann bereits viele Jahre bevor der Deutsche Fußball-Bund gegründet und das erste offizielle Länderspiel angepfiffen wurde. Vor 1900, dem Gründungsjahr des DFB, gab es im Reichsgebiet mehrere regionale Verbände, von denen einige schon in ihrem Namen nationale Bedeutung reklamierten, so etwa der „Deutsche Fußball- und Cricket-Bund“ von 1891 oder der „Verband Deutscher Ballspielvereine“ von 1897. Sie alle konzentrierten sich darauf – teils in eifersüchtiger Konkurrenz untereinander –, innerhalb des Deutschen Reiches Strukturen für den Spielbetrieb zu schaffen. Die Rivalitäten waren auch politisch unterlegt: Anglophile Kosmopoliten auf der einen Seite, auf der anderen deutsch-nationale Kräfte, die Wert darauf legten, aus dem „english sport“ einen deutschen zu machen. Internationale Spiele, für die es in Deutschland keine Vorbilder gab, wurden zunächst von keinem dieser Verbände angestrebt. Sie waren die Domäne eines Mannes, der mit Verbandsarbeit wenig am Hut hatte: Walther Bensemann.
Politisch umstritten: die ersten internationalen Spiele
Der Fußballpionier aus jüdischer Familie hatte als Gymnasiast in Karlsruhe 1893 den ersten süddeutschen Verein gegründet und anschließend in mehrjähriger Missionsarbeit den Grundstein dafür gelegt, dass der Süden rasch zu einer Hochburg des deutschen Fußballs wurde; beispielsweise wirkte er an den Vereinsgründungen dreier späterer Deutscher Meister mit: Karlsruher FV, Eintracht Frankfurt und FC Bayern München. Dass er mit den Verbandsstrukturen nicht recht klarkam, hatte zwei Gründe: Zum einen zeichnete ihn ein forscher Tatendrang aus, der sich von komplizierten Entscheidungsstrukturen nicht zügeln lassen wollte. Zum anderen verfolgte er mit dem Initiieren internationaler Spiele eine klare politische Vision: Grenzüberschreitende Begegnungen sollten zur politischen Verständigung zwischen den Nationen beitragen.
Das galt gerade auch für verfeindete Nationen wie die damaligen „Erbfeinde“ Deutschland und Frankreich. In einem „Aufruf an die Herren Capitaine aller Fußballclubs in Deutschland“ begründete der 21-jährige Student Bensemann 1894 sein Werben für solch eine Fußball-Begegnung: „Nur ein Dummkopf, der keine Idee von der furchtbaren Tragweite eines Weltkrieges in der heutigen Kulturepoche hat, kann wünschen, dass Frankreich und Deutschland wieder zu den Waffen greifen. […] Jeder Mann von Gefühl und Verstand sollte sich freuen, wenn Franzosen und Deutsche sich zum ersten Mal auf friedlichem Boden träfen und den alten Nationalhass vergessen würden.“ Ähnlich argumentierte Bensemann 1910 in einem Beitrag für das DFB-Jahrbuch: „Nicht nur die Kabinette, auch die Nationen sind für die Kriege verantwortlich. Wird erst das gegenseitige Verständnis besser, die gegenseitige Achtung tiefer, dann wird auch der kleine Lederball im Rate der Völker als Friedenssymbol vorschweben.“
Sport als Mittel der Völkerversöhnung – was sich heute als üblicher Bestandteil sportpolitischer Sonntagsreden liest, war seinerzeit durchaus umstritten. Mit seinen Ansichten vertrat Bensemann meist eine Minderheitenmeinung, als junger Pionier in der Kaiserzeit ebenso wie als Leitartikler des Kicker in den Jahren der Weimarer Republik. Seinem Konzept eines friedlichen sportlichen Wettstreits, eines Sports als „das einzige wahre Verbindungsmittel der Völker und Klassen“ (so Bensemann) stand die Auffassung entgegen, Sport habe der „Ertüchtigung“ und „Wehrhaftmachung“ des eigenen Volkes zu dienen. Internationale Begegnungen, sofern sie überhaupt gewollt waren, dienten demzufolge weniger dem Kennenlernen und einander Verstehen, sondern der Demonstration nationaler Tugenden und Stärken, nach Möglichkeit Überlegenheit. Zwei Jahre nach Bensemanns „Friedenssymbol“-Beitrag wurde im DFB-Jahrbuch die Gegenposition formuliert: „Wenn man sich beklagt, daß der deutsche Gedanke in der Welt noch nicht den Raum einnimmt, der ihm gebührt, so braucht man sich nur zu einer umfassenden Förderung des Sports entschließen, und Deutschland wird ein ehrgeiziges, willensstarkes Geschlecht hervorbringen, dem nichts verhaßter ist als laues Abwarten und müdes Zusehen, wenn andere die Welt unter sich teilen.“
Fast eine Premiere bei Olympia
Dieser grundsätzliche Disput entzündete sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts an den Olympischen Spielen, die vom Baron de Coubertin als völkerverbindendes Sportfest konzipiert waren, von konservativen deutschen Kreisen aber, so die Sporthistorikerin Christiane Eisenberg, „als ‚Humbug‘ erkannt“ und „seine Internationalität als Ausdruck von ‚Vaterlandslosigkeit‘ mißverstanden“ wurden. Folgerichtig gab es im Deutschen Reich vor der olympischen Premiere 1896 starke Bestrebungen, dem Ereignis demonstrativ fernzubleiben. Als es gegen den heftigen Widerstand der seinerzeit dominanten Deutschen Turnerschaft gelang, eine Art nationales olympisches Komitee ins Leben zu rufen, schloss sich Walther Bensemann der Initiative an und kümmerte sich um die Entsendung einer Fußballmannschaft sowie die Finanzierung ihrer Reise. Zusammen mit Berliner Vereinen stellte er eine elfköpfige Auswahl zusammen, mit ihm selbst als „captain“ sowie seinem Jugendfreund Ivo Schricker als Mittelläufer. Dieses Team, die erste Urform einer deutschen Nationalmannschaft, existierte allerdings nur auf dem Papier, denn ein olympisches Fußballturnier kam in Athen aus Kostengründen nicht zustande.
An zwei weiteren Pioniertaten Bensemanns waren eher regionale Auswahlteams beteiligt: Im Oktober 1893 fädelte er die erste grenzüberschreitende Begegnung der deutschen Fußballgeschichte ein, indem er ein prominentes schweizerisches Team nach Karlsruhe holte. Und im Dezember 1898 gelang es ihm nach jahrelangen Bemühungen, mit einer von ihm zusammengestellten Auswahl zwei Begegnungen in Paris zu bestreiten. Auch dort gab er selbst den Kapitän, der wertvollere Spieler bei den beiden Siegen war aber wohl wiederum Ivo Schricker auf der wichtigen Position des Mittelläufers. Die Reise zum „Erzfeind“ im Zeichen des friedlichen Miteinanders war eine erstaunliche Leistung, fand jedoch seinerzeit außerhalb der noch sehr überschaubaren Fußballszene keine Beachtung.
Die Ur-Länderspiele
Nicht weniger umstritten blieben die von Bensemann geplanten Begegnungen gegen eine englische Auswahl. Dem jungen Mann war es gelungen, die ehrwürdige englische Football Association davon zu überzeugen, erstmals in ihrer Geschichte ein Auswahlteam auf den Kontinent zu schicken. Die deutschen Regionalverbände – der DFB existierte noch nicht – waren allerdings alles andere als begeistert. Sie fürchteten, sicherlich zu Recht, eine hohe Niederlage gegen die Lehrmeister von der Insel. Und darin sahen sie weniger einen Lernprozess als eine nationale Blamage. Energischster Gegenspieler Bensemanns wurde Friedrich Wilhelm Nohe, der Vorsitzende des Verbandes Süddeutscher Fußballvereine und spätere DFB-Bundesvorsitzende. Er sorgte dafür, dass Bensemann, der eigentliche Vater der süddeutschen Fußballbewegung, aus dem Verband ausgeschlossen wurde, und drohte jedem Spieler, der gegen England antreten würde, die gleiche Sanktion an.
Unterstützt wurden die Pläne nur durch den Verband Berliner Ballspielvereine, an dessen Spitze der fortschrittlich gesonnene Fritz „Ette“ Boxhammer stand. Ihm leuchtete Bensemanns Intention ein, in dem Gastspiel „eine Sache (zu sehen), die uns mehr als ein Fortschritt an der ethischen Culturarbeit der Völker, denn als ein sportlicher Fortschritt anmutet“.
Tatsächlich reiste im November 1899 eine FA-Auswahl nach Berlin, die von zwei Vizepräsidenten des Verbandes begleitet wurde. Ihr stand, nun mit Ivo Schricker als Kapitän, eine Elf gegenüber, die sich aus den damaligen Hochburgen Süddeutschland und Berlin zusammensetzte und insofern zwar nicht repräsentativ, aber doch prominent besetzt war. Zwei Spiele fanden in Berlin, eines in Karlsruhe statt; dazwischen gab es eine Partie in Prag gegen eine erweiterte Mannschaft des DFC Prag. Es setzte hohe, teils zweistellige Niederlagen, dennoch gaben die Begegnungen der jungen deutschen Fußballszene einen gewaltigen Auftrieb, denn die meisten Zuschauer erlebten durch den Auftritt der Engländer zum ersten Mal, welches große Potenzial in dieser Sportart steckte. Für sie war es, wie die Zeitschrift Spiel und Sport schrieb, „ein Ereignis, wie es in der Fußballgeschichte noch nicht vorgekommen ist“.
Im September 1901 kam es zu Rückspielen, diesmal reiste eine deutsche Auswahl auf die Insel, nun angeführt von Ivo Schricker. Sie kickte in London gegen die legendären Gentleman-Amateure der Corinthians und in Manchester gegen eine Profiauswahl, verlor haushoch und feierte das ganze Unternehmen im Zeichen der Völkerverständigung. Bensemann erhielt als erster Deutscher die goldene Ehrennadel der FA „in recognition of his merits for the sauce of international sporting“. Damit endete die Vorgeschichte der deutschen Nationalmannschaft; es sollten noch sieben Jahre vergehen, bevor sie zu ihrem ersten offiziellen Länderspiel antrat.
Nationalisten und Militaristen versus Kosmopoliten
Am 27. Januar 1900 tagte in der Leipziger Gaststätte „Mariengarten“ der 1. Allgemeine Deutschen Fußballtag. Die Anwesenden beschlossen mit 64 zu 22 Stimmen die Gründung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zu den vehementesten Befürwortern der Gründung gehörten die Gebrüder Gus und Fred Manning. Die Mannings waren Söhne eines aus Frankfurt/M. stammenden jüdischen Kaufmanns, aber in England aufgewachsen und anglophil gestimmt. (Gus Manning ging 1905 aus beruflichen Gründen in die USA und wurde 1948 als erster US-Amerikaner in das FIFA-Exekutivkomitee gewählt.) Die Namensgebung „Deutscher Fußball-Bund“ erfolgte auf Vorschlag von Walther Bensemann.
Die Männer der ersten Stunde waren ein buntes Völkchen. Erster Präsident wurde Professor Ferdinand Hueppe, Delegierter des DFC Prag. Der Wissenschaftler mit dem Fachgebiet Hygiene, Schüler des Bakteriologen Robert Koch, hatte 1897 ein Werk mit dem Titel „Zur Rassenhygiene und Sozialhygiene der Griechen im Alterthum und in der Gegenwart“ veröffentlicht, in dem er Vergleiche zwischen dem (von ihm bevorzugten) „arisch-hellenischen“ Menschen mit dem niederen „semitischen“ Typ „jüdischer Krieger“ zog. 1898 veröffentlichte Hueppe einen Aufsatz mit dem Titel „Volksgesundung“, in dem er die Befürchtung äußerte, dass „Edelvölker“ wie die Deutschen eine „Beute minderwertiger Völker“ werden könnten. „Rassemischung in unserem Volke“ könnte die „hohen Charaktereigenschaften des vorherrschenden arischen Teils unseres Volkes“ beeinträchtigen. Der Trierer Sporthistoriker Thomas Schnitzler bezeichnet Hueppe als „ideologischen Wegbereiter der nationalsozialistischen Rassenlehre“.
1905 trat der DFB dem Zentralausschuss zur Förderung der Jugend- und Volksspiele (ZA) bei. Der Fußballhistoriker Hardy Grüne: „Mit dem Beitritt zum ZA bezog der DFB erstmals klar eine anti-sozialdemokratische Position und betrieb damit eine Art Ausgrenzungspolitik – wenngleich er satzungsgemäß für alle Schichten offen blieb.“ Unter anderem betonte der ZA die Bedeutung des Sports für das Militär. Die deutsche Fußballszene wurde im Zuge ihrer Konsolidierung konservativer und nationalistischer. Hardy Grüne: „Die liberalen, idealistischen und kosmopolitischen Pioniere der ersten Stunde – Walther Bensemann als Beispiel – waren ausgeschieden und ersetzt worden durch nationale und konservative ‚deutsche Männer‘, die auf Vaterland und Kaiser nichts kommen ließen.“
Auch passte sich der Fußball dem Militär an. Schon 1903 wurde Fußball von Teilen der Militärverwaltung offiziell eingeführt, wenig später auch als Teil der Offiziersausbildung. 1907 nahm der DFB folgenden Passus in seine Statuten auf: „Der Zweck des Bundes ist die Einwirkung auf die öffentliche Meinung, um das Verständnis für den Wert körperlicher Übungen, besonders bei Schulbehörden und Militärkreisen zu wecken und zu heben.“
Damit einher ging eine „fast zwanghaft betriebene ‚Germanisierung‘ der Fußballsprache“, schreibt der Historiker Rudolf Oswald. „Klubs, deren Namen an die Vermittler der Sportart erinnerten, gerieten in das Visier völkischer Puristen. Regel- und Taktikbegriffe, die auf die englische Herkunft der Mannschaftssportart hindeuteten, wurden durch – oftmals gekünstelt anmutende – deutschsprachige Äquivalente ersetzt. Termini schließlich, welche die Dramatik des Spiels wiedergaben, wurden militarisiert: Aus der ‚Britannia‘ wurde die ‚Borussia‘, aus dem ‚free kick‘ der „Freistoß‘, aus dem ‚heißen match‘ die ‚Schlacht‘.“
Die Annäherung zwischen Fußball und Militär ging noch weiter. Am 13. November 1911 nahm das DFB-Präsidium in Person des Präsidenten Gottfried Hinze und des 2. Vorsitzenden Hans Hofmann an der Gründung des Jungdeutschlandbundes (JDB) teil. Der JDB war auf Initiative des preußischen Kriegsministeriums entstanden, das einen bedenklichen Rückgang der militärischen Brauchbarkeit der Heranwachsenden diagnostiziert hatte. Ziel des JDB war die Schaffung einer kriegsverwendungsfähigen Jugend. Der JDB-Vorsitzende Generalfeldmarschall Freiherr von der Goltz forderte die Schaffung „eines „starken und frommen Geschlechts, (…) das erfüllt ist von vaterländischem Geist, das treu zu Kaiser und Reich steht, (…) um Deutschland siegreich durch die Stürme zu tragen, die ihm nicht erspart bleiben werden.“
Im DFB-Präsidium war die Beteiligung von Hinze und Hofmann stark umstritten. Die beiden Funktionäre hatten ohne Rücksprache mit den restlichen Präsidiumsmitgliedern gehandelt. Reue ließen sie nicht erkennen: „Es ist eine Pflicht für uns, eine Bewegung zu unterstützen, die in ihrem Wesen das gleiche Ziel enthält wie der DFB, der durch die Pflege des Fußballspiels in der frischen Luft die Gesundheit unseres Volkes und damit die Wehrkraft im besten Sinne des Wortes heben will.“
Die ersten Länderspiele: Im Konzert der Großen noch zu klein
Inzwischen war die Länderspielgeschichte des DFB offiziell eingeläutet worden. Am 5. April 1908 lief im Stadion Landhof in Basel eine deutsche Mannschaft auf, der vier Süddeutsche, drei Westdeutsche, zwei Mitteldeutsche, ein Norddeutscher und ein Berliner angehörten, die sich untereinander kaum kannten und niemals zuvor miteinander gespielt hatten. Die elf Akteure repräsentierten elf verschiedene Vereine aus neun Städten. Vor rund 4.000 Zuschauern gewannen die Schweizer Gastgeber mit 5:3. „Der Entschluss des DFB, von jetzt an internationalen Spielverkehr zu pflegen, ist eine sensationelle Maßnahme von Männern, die die gegenwärtigen Verhältnisse klar erkannt haben“, lobte Walther Bensemann. Er war eigens aus seiner englischen Wahlheimat Liverpool angereist, um der Länderspielpremiere einen angemessenen (teils aus eigener Tasche bezahlten) würdigen Rahmen zu geben.
Nur 15 Tage später bestritt die Nationalelf ihr erstes Heimspiel. Auf dem Viktoriaplatz in Berlin-Mariendorf unterlag man der englischen Amateurnationalmannschaft mit 1:5. Gerade einmal 7.000 sahen zu – doch das war zu diesem Zeitpunkt Rekord für ein Fußballspiel in Deutschland.
Ihren ersten sportdiplomatischen Erfolg verbuchten DFB und Nationalmannschaft 1910, als der Kronprinz die Auslobung eines „Wanderpreises für ständige Wettkämpfe mit einem anderen Land“ ankündigte. Der DFB wählte hierfür Frankreich. Doch die Verhandlungen mit dem „Erbfeind“ platzten, als in England ein Konkurrenzverband zur FA gegründet wurde, der um Aufnahme in die FIFA nachsuchte. Während der DFB diesem Ansinnen ablehnend gegenüberstand, unterstützten es die Franzosen, woraufhin der DFB die Verhandlungen abbrach. Erst 1931 sollten sich Frankreich und Deutschland erstmals auf dem grünen Rasen miteinander messen.
Die Verbindungen zur FA dagegen wurden vorerst weiter gepflegt. Am 14. November 1911 empfing die Nationalmannschaft auf dem Berlin-Mariendorfer Union-Platz erneut ein englisches Auswahlteam – und dieses Mal ausschließlich Profis. 10.000 Zuschauer waren Zeuge eines überraschenden 2:2. Dieses Unentschieden gegen das Fußball-Mutterland stellte die bis dato größte Sensation in der deutschen Fußballgeschichte dar. Selbst die lange Zeit zurückhaltende Tagespresse räumte dem Fußball erstmals breite Beachtung ein, und auch konservative Kreise kamen nun nicht mehr umhin, zuzugeben, dass Fußball auf dem besten Wege war, „gesellschaftsfähig“ zu werden.
Mit den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm nahm die Nationalelf erstmals an einem großen Turnier teil. Im Vorfeld hatte sich die Elf ein viel beachtetes Remis gegen die Niederlande erarbeitet. 18.000 sahen die Begegnung in Zwolle. Das erste offizielle Länderspiel lag zwar noch keine drei Jahre zurück, trotzdem wurde der Auswahl bereits eine „Botschafter-Rolle“ attestiert. Zumindest im Ausland, denn in Zwolle wurden die deutschen Spieler von den niederländischen Zuschauern mit langanhaltendem Beifall und „Deutschland“-Rufen begrüßt.
In Stockholm musste die Nationalelf allerdings realisieren, dass sie mit den etablierten Teams noch nicht mithalten konnte. Im Auftaktspiel gegen Österreich kassierte sie eine 1:5-Schlappe. Dass man zwei Tage später gegen Russland einen 16:0-Rekordsieg erzielte, war nur noch von statistischem Wert. Die russische Auswahl bestand vornehmlich aus fußballerisch ungeübten Leichtathleten, zudem hatten beide Teams am Abend zuvor gemeinsam gefeiert, was den Russen auf dem Spielfeld offensichtlich mehr zu schaffen machte. Herausragend an jenem 1. Juli 1912 war freilich Karlsruhes Gottfried Fuchs, der gleich zehn der 16 Tore markierte. Dass die deutsche Auswahl in Wahrheit nicht zu den europäischen Spitzenteams zählte, bewies sie zwei Tage später, als sie im Spiel um den Einzug ins „kleine Finale“ gegen Ungarn eine 1:3-Niederlage bezog.
Auch im Freundschaftsspiel gegen England unterlag die DFB-Elf im März 1913 deutlich mit 0:3. Auf dem Berliner Victoria-Platz sahen rund 17.000 der Begegnung zu, das bedeutete Zuschauerrekord für ein Länderspiel vor dem Ersten Weltkrieg.
Auf in den Krieg
1913 erschien im „Fußball-Jahrbuch“ des DFB unter der Überschrift „Von völkischer Arbeit des Sports im deutschen Land“ ein Beitrag, der den Krieg verherrlichte und dem Pazifismus und Internationalismus eine klare Absage erteilte: „Waffenklirrend schreitet die Zeit einher, zerschlägt mit stählerner Faust, was morsch und alt geworden, und düngt das Land zu neuer Saat mit Blut und Bein. (…) Entwicklung, Leben – das zeigt Mutter Natur überall – heißt Kämpfen! (…) Und doch rufen die Toren auch in unserem Land: Krieg dem Kriege! Es wäre gefährlich, wenn ihr Werben im Volke Erfolg finden sollte. Verzichten wir jemals auf den ehernen Schiedsspruch der Waffen, dann gehen wir folgerichtig zugrunde. Oder lehren die jüngsten Geschehnisse nicht, was entmannten Völkern droht, dass noch immer das Recht der Stärkeren gilt, das ewige, weil Leben gebärende?“
Der preußische Kriegsminister von Falkenhayn charakterisierte die erzieherischen Werte des Fußballspiels ganz in diesem Sinne: „Neben der Ausbildung von Kraft und Gewandtheit beim einzelnen Spieler schätze ich bei diesem Sport als besonderen Vorzug die Erziehung zur selbstlosen Opferwilligkeit des Einzelnen und zur Zurückstellung des persönlichen Ehrgeizes im Interesse des gemeinschaftlichen Erfolges und ebenso die Unterwerfung unter die Anordnungen des Parteiführers, des Schiedsrichters, der Vereinsleitung und in größeren Verhältnissen des Bundesvorstandes. Das sind disziplinfördernde Eigenschaften, deren eifrige Weiterpflege von ihrer Seite dem Heeresdienst zum Vorteil gereichen werden.“
Am 1. August 1914erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg und eine allgemeine Mobilmachung. Hunderttausende meldeten sich freiwillig für den Dienst „am Vaterland“, darunter viele Fußballspieler. Zwischen einigen Sportvereinen brach ein regelrechter Wettkampf darum aus, wer mehr Kriegsfreiwillige stellen konnte. Kurz nach Kriegsbeginn veröffentlichte der Norddeutsche Fußballverband eine Erklärung, in der es hieß: „Machen wir uns endlich frei von unseren Feinden im Osten und Westen. Zeigt in diesem heißen Ringen, dass ihr echte Sportsleute seid, dass Mut, Tapferkeit und Gehorsam und glühende Vaterlandsliebe Euch beseelt. Durch den Sport wurdet ihr für den Krieg erzogen, darum ‚ran an den Feind, auf ihn und nicht gezittert‘.“
„Unerwünschte Ausländer“ wurden aus den Vereinen und von Sportveranstaltungen ausgeschlossen, einige in Deutschland tätige britische Trainer interniert. Als „unerwünschte Ausländer“ definierte der DFB „Angehörige von Staaten, die sich mit dem Deutschen Reich oder seinen Verbündeten im Krieg befinden. (…) Hierbei ist gleichgültig, ob diese Ausländer innerhalb Deutschlands geboren sind oder nicht.“ Der Fußball erfuhr durch den Ersten Weltkrieg eine tiefgreifende Politisierung und Ideologisierung, die die internationalen Begegnungen in den 1920er Jahren prägen sollten.
EXKURSDrei Pioniere der „Ur-Länderspiele“
Die wichtigsten Akteure der „Ur-Länderspiele“ von 1899 spielten im deutschen Fußball weiterhin eine große Rolle, doch wurden sie in der NS-Zeit und auch in den Jahrzehnten danach wenig gewürdigt.
Fritz „Ette“ Boxhammer wurde 1905 Mitglied des DFB-Bundesvorstands und 1906 des FIFA-Präsidiums. Er war wesentlich daran beteiligt, im deutschen Fußball ein einheitliches Regelwerk einzuführen. Über den Sinn von Länderspielen schrieb er im DFB-Jahrbuch 1907: „In dieser internationalen Betätigung des Sports liegt ein außerordentlich wichtiges Moment zur Überbrückung politischer und nationaler Gegensätze, und in diesem Sinn ist der Sport einer der erfolgreichsten Förderer der Friedensidee.“ Eine Haltung, mit der er sich im deutschen Fußball nicht unbedingt Freunde machte. 1912 kämpfte er auf dem DFB-Bundestag vergebens dagegen, dass der Verband sich dem militaristischen „Jungdeutschland-Bund“ anschloss, einer vom preußischen Militär initiierten Organisation. Danach zog er sich aus der Arbeit im DFB zurück. Er starb 1926 mit nur 52 Jahren, und Bensemann schrieb in einem Nachruf, Boxhammer sei im Fußball „eine große Autorität (gewesen), vielleicht die größte, die wir besessen haben“. Eine Autorität, auf die leider zu wenig gehört wurde.
Walther Bensemann selbst gründete, von einem mehrjährigen England-Aufenthalt zurückgekehrt, 1920 den Kicker, der zur Bühne seines kosmopolitischen Sportverständnisses wurde. Die furchtbaren Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, in dem er auf beiden Seiten der Front gute Freunde verlor, bestärkten ihn in seiner Mission. Als streitbarer Publizist definierte er die Zeitung explizit als „ein Symbol der Völker-Versöhnung durch den Sport“, trat für den Ausbau des internationalen Spielverkehrs und für die politische Einigung Europas ein. Mit der DFB-Führung lag er damit permanent über Kreuz. Deren Auftreten auf internationalem Parkett kritisierte er beispielsweise 1925 im Kicker als „taktlos“ und „überheblich“. Die anderen Nationalverbände seien „durchaus nicht gesonnen, am deutschen Sportwesen zu genesen“. Rechte Kreise im DFB diffamierten ihn dafür als vaterlandslosen Gesellen (siehe dazu näher das folgende Kapitel). Bei Hitlers Machtantritt musste Bensemann, der gebürtige Jude und Verfechter eines pazifistischen Sports, Deutschland und seinen Kicker verlassen; er starb 1934 verarmt im schweizerischen Exil. Erst in den 2000er Jahren wurde sein Andenken „wiederbelebt“; seither ist er als bedeutsamer Pionier des deutschen Fußballs anerkannt. Seit 2006 wird jährlich der Walther-Bensemann-Preis an einen prominenten Fußballer verliehen, der sich um die Völkerverständigung verdient gemacht hat. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Bert Trautmann, César Luis Menotti, Clarence Seedorf und Christian Streich.
Ivo Schricker schlug nach einem längeren Aufenthalt in Ägypten eine Funktionärslaufbahn im Fußball ein. 1927 gelangte er in den DFB-Vorstand und ins FIFA-Präsidium. 1932 wurde er zum ersten hauptamtlichen Generalsekretär der damals ziemlich mittellosen FIFA gewählt; zusammen mit seinem Assistenten bildete er die alleinige Belegschaft der nur 30 Quadratmeter großen FIFA-Zentrale in Zürich. Schricker konsolidierte die Organisation und blieb bis 1950 im Amt. Während der NS-Zeit widersetzte er sich erfolgreich den Versuchen des DFB, den Weltverband für die Zwecke der Nazis zu instrumentalisieren. Nach dem Ende der NS-Herrschaft mahnte er den deutschen Fußball: „Es ist klar (…), dass alle Leute, die eine braune oder schwarze Jacke getragen haben, von jeder Beteiligung am Aufbau und an der Verwaltung des Deutschen Sports auf immer ausgeschlossen werden.“ Die Mahnung verhallte ungehört, und Ivo Schricker, der große Kosmopolit des Fußballs, blieb in seiner Heimat bis heute nahezu ein Unbekannter.
1920 BIS 1933Von „deutschem Volksgemeinschaftsgeist“ und „fremder Mentalität“
Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich der Fußball zum Arbeiter- und zum Massensport. Erste Rundfunkreportagen direkt vom Spielfeldrand trugen zur Popularisierung bei.
Als die deutsche Nationalmannschaft erstmals nach dem Ersten Weltkrieg wieder ein Heimspiel austrug, am Sonntag, 24. Oktober 1920 gegen Ungarn, pilgerten 55.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Deutsche Stadion von Berlin. Das war eine bis dahin kaum vorstellbare Zahl und Verdreifachung des bis dahin gültigen Zuschauerrekords. Die Popularität des Spiels war sprunghaft gewachsen.
Fußball hatte in Deutschland nicht als Arbeiterkultur begonnen, sondern war zunächst beheimatet im Milieu der bürgerlichen Akademiker sowie der neuen – und damit traditionslosen – expandierenden Schicht der Angestellten in den kaufmännischen und technischen Berufen. Zum Sport der Arbeiter und zum Massen-mobilisierenden Zuschauersport wurde das Spiel erst so richtig nach dem Ersten Weltkrieg – dank der Einführung des Achtstundentags sowie einer vielfältigen Förderung des Sports durch die öffentliche Hand. Seitdem haftete am Spiel das Etikett „Arbeitersport“, der allerdings in der Regel weiterhin unter bürgerlicher Ägide betrieben wurde.
Zu Beginn der 1920er Jahre zog sowohl die Zahl der aktiven Fußballer wie der Zuschauer enorm an. Die gewaltige Expansion des Fußballs korrespondierte mit dem Entstehen einer Massenkultur in Deutschland, die auch in Bereichen wie Musik und Kino ihren Ausdruck fand. Der deutsch-britische Journalist und Publizist Sebastian Haffner beobachtete: „In den Jahren 1924, 25 und 26 entwickelte sich Deutschland schlagartig zu einer Sportgroßmacht. Nie vorher war Deutschland ein Sportland gewesen, nie ist es im Sport eigentlich schöpferisch und erfinderisch gewesen wie England und Amerika, und der eigentliche Geist des Sports, das selbstvergessen-spielerische Aufgehen in einer Phantasiewelt mit ihren eigenen Regeln und Gesetzen, ist der deutschen Seelenverfassung fremd. Dennoch verzehnfachten sich in jenen Jahren die Mitgliederzahlen der Sportklubs und die Zuschauerzahlen bei Sportfesten.“
Für die Jahre 1920 bis 1933 betrug der Zuschauerschnitt bei Endspielen um die Deutsche Meisterschaft 43.7870 und verzehnfachte sich damit gegenüber der frühen Phase 1903 bis 1914. Bei heimischen Auftritten der Nationalmannschaft wurden in den Jahren der Weimarer Republik durchschnittlich 36.533 Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt – gegenüber 9.635 in den Vorkriegsjahren.
Die Entwicklung zum Massensport wurde auch durch ein vielfältiges System der Sportförderung unterstützt. Bis 1925 wurden 850 öffentliche und 400 vereinseigene Stadien gebaut, von denen eine Reihe für große Zuschauermassen ausgelegt waren. Dazu zählten auch einige Spielstätten, die als Kulisse für Länderspiele dienen würden, beispielsweise das Müngersdorfer Stadion in Köln (1923), das Frankfurter Waldstadion (1925), das Hamburger Volksparkstadion (1925), das Freiburger Mösle-Stadion (1922), das Stadion am Ostragehege in Dresden (1919) oder das Duisburger Wedaustadion (1926).
Der Amateurgedanke als neuer Sinnstifter
1920 erließ der DFB ein Amateurstatut: „Wir bekämpfen das Berufsspielertum aus ethischen Gründen. (…) Es wäre ein Frevel an unserer deutschen Jugend, wollten wir das Berufsspielertum in Deutschland auch nur im geringsten begünstigen.“ Während nach England und Schottland auf dem europäischen Festland Österreich (1924), die Tschechoslowakei (1925), Ungarn (1926), Italien (1926), Spanien (1928) und Frankreich (1932) den Berufsfußball legalisierten, beschritt Deutschland somit einen Sonderweg. In der Darstellung der DFB-Repräsentanten war der Berufsfußball, so Rudolf Oswald, „stets etwas Unmoralisches, Unsoziales, Kapitalistisches, das den ‚Volksgemeinschaftsgeist‘ zu zerstören drohte“.
Das dogmatische Festhalten am Fußball als Amateursport implizierte auch die Absage an eine nationale Liga, wie sie in den genannten Ländern existierte. Eine nationale Liga war ohne die Legalisierung des Professionalismus nicht möglich – allein schon aufgrund der weiten Fahrten, die die Teams hätten zurücklegen müssen. So durften sich bis 1933 über 500 Vereine im deutschen Fußball als „erstklassig“ bezeichnen. Viele Spitzenvereine fanden in ihren Ligen kaum ernstzunehmende Gegner. Erst ab den regionalen Endrunden, die der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft vorgeschaltet waren, wurden sie gefordert – auch ein Grund dafür, dass die deutsche Nationalelf in den Weimarer Jahren nicht reüssieren konnte.
„Sport ohne Glanz“ überschrieb Christiane Eisenberg in ihrem Klassiker „English sports und deutsche Bürger“ (1999) das Kapitel über die Vorherrschaft des Amateurismus in den frühen 1920er Jahren. Nach dem Ersten Weltkrieg habe sich der Amateurgedanke als „neuer Sinnstifter“ erwiesen. „Für diese spezifisch englische Idee hatte in Deutschland vor 1914 kaum jemand Verständnis aufgebracht.“ Mit dem Versailler Friedensvertrag, der dem Deutschen Reich u. a. eine allgemeine Wehrpflicht untersagte und die Größe der Berufsarmee stark einschränkte, begann aus Sorge um den vermeintlichen Verlust von „Wehrkraft“ und „Volksgesundheit“ die Suche nach einem Surrogat für die Wehrpflicht. Nun sollten die Massen dazu motiviert werden, sich selbst aktiv sportlich zu betätigen. Das sei nur zu erreichen, wenn die beträchtlichen Einnahmen aus Eintrittsgebühren nicht eigennützigen Unternehmen, sondern den Vereinen zugutekämen. Schon bald wurde der Amateurgedanke in der Öffentlichkeit politisch überhöht. Eisenberg weiter: „Der dem Geld widerstehende Amateurathlet avancierte in dieser Situation zum zivilen Pendant des von den Freiheitskämpfern glorifizierten Kriegshelden. In seiner ‚Persönlichkeit‘ vereinigte er angeblich dieselben Eigenschaften, die auch schon den idealtypischen Sportsmann des 19. Jahrhunderts ausgezeichnet hatten: Er war dynamisch, erfolgsorientiert, selbstdiszipliniert und risikofreudig, durchaus auch rücksichtslos, kurz: ein jeder Situation gewachsener ‚Herrenmensch‘, natürlich männlichen Geschlechts. Anders als sein Vorgänger war der Amateurathlet jedoch zugleich selbstlos und ‚opferfähig‘ für die Vereinsgemeinschaft und für das Vaterland.“
Die DFB-Führung wurde von beinharten Verfechtern des Amateurismus dominiert. Zu ihren ersten prominenten Opfern gehörte Sepp Herberger, der für seinen Wechsel vom SV Waldhof Mannheim zu Phoenix 07 Mannheim eine Zahlung von 10.000 DM sowie die Zusage einer Trainerausbildung erhalten hatte. Als diese nicht eingehalten wurde, wechselte Herberger zur Saison 1921/22 zum VfR Mannheim. Funktionäre des Phoenix 07 zeigten sich wegen der verbotenen Geldzahlung beim Süddeutschen Fußball-Verband selbst an. Herberger wurde zum Berufsspieler erklärt und – trotz freiwilliger Rückgabe des Geldes – lebenslang gesperrt. In einer Berufungsverhandlung wurde die Strafe auf ein Jahr reduziert. 1930 wurde beim amtierenden Westdeutschen Meister Schalke 04 fast der gesamte Kader vom DFB zu Berufsspielern erklärt und aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen – wegen angeblich überhöhter Spesenzahlungen. Und 1935 scheute man sich nicht, den damaligen Rekord-Nationalspieler zu sperren, den sehr populären „König Richard“ Hofmann, weil er für eine Zigarettenmarke geworben hatte (1936 wurde er begnadigt).
Die Profidebatte zwischen dem Verband und den Klubs war Teil eines Ringens um die Hegemonie im deutschen Fußball, das bis heute andauert. Und mittendrin war und ist die Nationalmannschaft.
Zurück auf der internationalen Bühne
Nach dem Ersten Weltkrieg mochten Deutschlands Kriegsgegner mit den als Kriegsschuldigen ausgemachten Deutschen zunächst keinen Spielverkehr pflegen. Die britischen Verbände forderten sogar einen Ausschluss des DFB aus der FIFA. Als sie damit scheiterten, verließen sie selbst den Weltverband.
Als erstes Land tanzte die neutrale Schweiz aus der Reihe und lud die Deutschen zu einem Ländervergleich am 27. Juni 1920 nach Zürich ein. Das Auswärtige Amt der Reichsregierung unterstützte das Zustandekommen der Begegnung mit heimlichen Zahlungen. Insbesondere aus England und Belgien kassierten die Eidgenossen für diesen Bruch der internationalen Blockade heftige Prügel, ebenso aus Frankreich. Auch in der französischsprachigen West-Schweiz hagelte es Proteste. Der dortige Regionalverband boykottierte das Spiel.
Der sportliche Aspekt des Kräftemessens war eher zweitrangig. Stattdessen bekamen die deutschen Nationalspieler vor der Abreise eingebläut, um jeden Preis ein positives Bild zu hinterlassen und „nur keinen Anlass zum Klagen zu geben“. Unter diesem Gesichtspunkt wurden auch die Spieler ausgewählt, die über „entsprechende gesellschaftliche Formen verfügen“ mussten.
Sportlich setzte es eine 1:4-Niederlage, auch weil das DFB-Team sich bewusst zurückhielt. Der Nürnberger Nationalspieler Hans Kalb: „Wir verzichteten oft im entscheidenden Moment lieber auf den Ball, nur um einem möglichen Zusammenprall aus dem Weg zu gehen.“ Offenbar hatte es auch entsprechende Vorgaben gegeben, denn im Kicker schrieb dessen Herausgeber Walther Bensemann: „Die Spieler hatten ausdrückliche Weisung vom Bund (also dem DFB, Anm. d. A.), vom Verband und von der Sportpresse, lieber den Ball zu verlieren, als ‚unfair‘ zu erscheinen.“ In diplomatischer Hinsicht war die Reise ein voller Erfolg. Die 8.000 Zuschauer im Züricher Utogrund-Stadion verabschiedeten die deutschen Gäste mit Beifall. Bensemann: „Nie (hat) eine internationale Elf fairer und mustergültiger gespielt als unserige in Zürich. (…) Das hat natürlich einen sehr guten Eindruck gemacht.“
Dem Spiel gegen die Schweiz folgten bis zum Ende des Jahres 1920 noch Begegnungen gegen die ehemaligen Kriegsverbündeten Ungarn und Österreich sowie die in die Souveränität entlassenen Finnen. Zu den im belgischen Antwerpen stattfindenden Olympischen Spielen wurden die deutschen Sportler nicht eingeladen. 1914 waren deutsche Truppen unter Missachtung der Neutralität in Belgien einmarschiert.
Auch 1921 und 1922 lief die DFB-Elf nur jeweils dreimal auf. Gegner waren erneut nur die Schweiz, Österreich und Finnland. Als die Nationalelf der Schweiz im März 1922 in Frankfurt/Main eintraf, wurde sie von 40.000 Menschen begeistert empfangen. In seiner Begrüßungsansprache versicherte der Frankfurter Stadtrat Alfred Schmude den Gästen: „Wir Deutschen werden niemals vergessen, dass die Schweiz, zu einer Zeit, wo die ganze Welt gegen uns stand, ihre unbedingt neutrale Haltung nicht verleugnet hat.“ Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.
Walther Bensemann und Guido von Mengden: Internationalismus versus Nationalismus
1921 schrieb Walther Bensemann: „Wenn man die Unmenge der internationalen Spiele betrachtet, möchte man fast doch daran glauben, dass wir endlich wieder in unserem zerfleischten Europa einen wirklichen Frieden haben; nicht mehr den, der nur ein verdeckter Krieg ist, sondern einen wirklichen, wahrhaftigen Frieden. Unser Fußballsport hat den Frieden gemacht – das ist einmal gewiss.“
1920 hatte Walther Bensemann in Süddeutschland den Kicker gegründet. Die politische Ausrichtung der Zeitschrift war liberal und kosmopolitisch. Zum politischen Gegenpol entwickelte sich die in Dortmund erscheinende Zeitschrift Fußball und Leichtathletik (FuL). Deren Redakteur Guido von Mengden, zugleich Geschäftsführer des Westdeutschen Spielverbandes (WSV), avancierte zum publizistischen Gegenspieler Bensemanns und sparte in dieser Auseinandersetzung nicht mit völkischen und antisemitischen Tönen. So warf er Bensemann vor, dieser mache zwar „sehr viel in Sportpolitik, allerdings nicht in deutscher“. Der Kicker-Herausgeber gehöre zu jenen Menschen, „die Krämer und Geschäftemacher mit Volksseele und Volksgemüt sind“. Später bezeichnete er Österreichs jüdischen Verbandskapitän Hugo Meisl als einen „Mausefallenhändler“, der „aus den Ländern um Galizien“ stamme. Diese antisemitische Pöbelei zielte auch auf Bensemann, der mit Meisl eng befreundet und wie dieser jüdischer Herkunft war.
Der Kicker wurde 1924 das Zentralorgan des Süddeutschen Fußball-Verbandes, FuL war das des WSV, und die Fehde zwischen den beiden Männern war durchaus repräsentativ für die politische Konfliktlage im DFB. Bensemann verfolgte in den wichtigsten sportpolitischen Fragen (wie Profitum, Verhältnis zum Arbeitersport, Beziehungen zum Ausland) einen Kurs des Ausgleichs, des Pragmatismus und der Verständigung. Dagegen dominierte bei FuL eine aggressive, deutschnationalistische Ideologie. Von Mengden und sein Mitstreiter Josef Klein, Funktionär des einflussreichen WSV und Mitglied im DFB-Jugendausschuss, formulierten in pointierter Form allerdings lediglich eine Position, die im DFB längst Mehrheitsmeinung war. Die Verbandsführung stand Bensemanns Sport-Internationalismus und -Pazifismus feindselig gegenüber. Für den für internationale Beziehungen zuständigen DFB-Funktionär Felix Linnemann, der 1925 Präsident des Verbands wurde, dachte der Kicker-Herausgeber „zu international“. Bensemann würde „nicht nur in fremden Sprachen träumen“, sondern fühle auch „zu stark in fremder Mentalität“.
Dieser Streit, der in der Verbandszeitung offen ausgetragen wurde, dokumentierte, dass der DFB in der Weimarer Zeit die Option auf eine andere politische Entwicklung besaß, ohne dabei seine bürgerliche Grundhaltung aufgeben zu müssen. Aus freien Stücken wählte er einen Weg, der ihn 1933 schließlich in die Arme der Nationalsozialisten führte. Das galt ganz persönlich auch für die Protagonisten dieses Konflikts: Guido von Mengden machte im Nationalsozialismus ab 1933 eine steile Karriere und profilierte sich als rechte Hand des Reichssportführers, Felix Linnemann konnte seinen Posten als DFB-Führer problemlos behalten und zudem zum SS-Standartenführer aufsteigen. Walther Bensemann hingegen musste seinen Kicker aufgeben und wurde ins schweizerische Exil gezwungen.
Passend zu dieser Konfliktlage wurde die Nationalelf am 1. Januar 1923 in Mailand von Italien empfangen. Im Gastland regierten seit dem 28. Oktober 1922 die Faschisten mit ihrem „Duce“ Benito Mussolini. Die DFB-Elf unterlag mit 1:3; wichtiger als das Ergebnis war aber, dass mit diesem Spiel die internationale Boykottfront gegen Deutschland zu bröckeln begann. Nur Belgien und die britischen Verbände hielten noch am Boykott fest.
In diesem Jahr bestritt die Nationalelf immerhin sechs Begegnungen, war aber trotzdem weit davon entfernt, das fußballerische Aushängeschild der Nation zu sein. In den Vereinen wurde deutlich professioneller gearbeitet, wozu auch die Verpflichtung von hauptamtlichen Trainern gehörte. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg versuchten einige deutsche Klubs, die Qualität ihres Spiels zu verbessern, indem sie Wissen aus Ländern importierten, die fußballerisch weiter waren. Zunächst kamen die Entwicklungshelfer vornehmlich aus dem „Fußball-Mutterland“ England. Ab 1920 waren auch Trainer aus Wien, Budapest und Prag, den Metropolen des sogenannten Donaufußballs, besonders begehrt. Die deutschen Spitzenklubs vereinbarten Freundschaftsspiele und wurden Teil eines internationalen Netzwerkes, das neben dem heimischen Wettbewerb existierte. Sie erhielten Einladungen aus ganz Europa und besaßen auch jenseits der Grenze einen exzellenten Ruf. Sie verdankte ihr Niveau letztlich permanenten Verstößen gegen die Amateurbestimmungen.
Das Niveau der Nationalelf war hingegen eher mäßig, was angesichts des Fehlens einer professionellen Betreuung – einschließlich einer Kaderbildung – sowie des Mangels an internationalem Kräftemessen nicht verwunderte.
„Treu, Teutsch und Tüchtig“
1924 veröffentlichte der Tübinger Universitätsprofessor Paul Sturm sein Werk „Die seelischen und sittlichen Werte des Sports, insbesondere des Fußballsports, als Grundlage zur Befreiung aus der Knechtschaft“. Für den Sporthistoriker Michael Krüger stehen Sturms Abhandlungen „im Kontext einer Fülle von Äußerungen von Fußball- und Sportfunktionären, die ähnlich wie Sturm die nationalen und militärischen Funktionen des Fußballs betonen“. Einzelne Passagen des Buches seien „fast wörtlich in Hitlers ‚Mein Kampf ‘ zu finden“, weshalb zu vermuten sei, „dass es Hitler als Quelle diente“. Für Krüger war Sturm „der wichtigste und einflussreichste nationale Fußballideologe der zwanziger und dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts“.
Ebenfalls 1924 veröffentlichte Josef Klein ein vom WSV abgesegnetes Traktat, in dem er forderte, Sport in Deutschland müsse unter dem Motto „Treu, Teutsch und Tüchtig“ zu einer Volksbewegung werden. Ein Bekenntnis „zum deutschen Volksgemeinschaftsgeist“ (Teutsch!), zum „sportlichen Idealismus“ (Treu!) und zur „auf sich gestellten, selbstverantwortlichen Persönlichkeit“ (Tüchtig!) sei dringend geboten, um aus einem „hemmungslosen Materialismus“ auszubrechen. Der „schwachsinnige Traum von sportlicher Weltverbrüderung internationaler Fußballer“ sei ad acta zu legen.
Kleins Forderungen lösten eine heftige Debatte aus. Zu seinen Befürwortern gehörte u. a. der ehemalige DFB-Präsident Wilhelm Nohe: „Wenn solch ideale Sportauffassung wieder Wurzeln schlägt, dann möchte ich nicht verzagen an der gesunden Weiterentwicklung des deutschen Fußballsports; dann erlischt das Trug- und Zerrbild der heutigen Fußballsintflut, wie sie seit Kriegsende den europäischen Kontinent überschwemmt, und wie sie alles Gute und Schöne und Edle mit sich fortreißen und zu verschlingen droht in den schmutzigtrüben Fluten der Selbstsucht, der Geldgier und der Götzendienerei.“
Walther Bensemann veröffentlichte Kleins Traktat im Kicker und ließ es durch – überwiegend ablehnende – Gastbeiträge kommentieren. Guido von Mengden warf Bensemann im FuL daraufhin vor, er habe „das ganze Heer“ seiner „Spottjournalisten aufgeboten, um Herrn Dr. Klein lächerlich zu machen und seine Gedanken als die Ausgeburt eines nationalistischen Gehirns zu verdummteufeln.“
Währenddessen ermahnten die Zeitschriften Berliner Rasensport und Fußball-Woche den DFB zu politischer Neutralität. Sie bemängelten, dass die DFB-Leitung bei Länderspielen nach wie vor das schwarz-weiß-rote Tuch bevorzugte, also die Farben des Kaiserreichs statt die schwarz-rot-goldenen der Republik.
Kampf der „professionellen Seuche“
1924 bestritt die Nationalelf noch sieben Spiele. 1925 waren es nur noch vier, ebenso 1926. Und 1927 lief man sogar nur dreimal auf. Kein einziges Mal in den Jahren 1925 bis 1930 maß sich die DFB-Elf mit den hochkarätigen Nachbarn Österreich und Tschechoslowakei. Das hatte Gründe.
Im Februar 1925 hatte der DFB zu einem weiteren Schlag gegen den Berufsfußball ausgeholt. In Hannover beschloss der Vorstand nicht nur die Ablehnung des Profisports „für alle Zukunft“, sondern schränkte auch den Spielverkehr mit ausländischen Profiteams stark ein. Außerdem hatten nun ausländische Kicker, die in Deutschland spielen wollten, zunächst einmal eine einjährige Sperre abzusitzen, „um unerwünschte Elemente fernzuhalten“.
Im Kicker interpretierte Walther Bensemann die Beschlüsse von Hannover als Kampfmaßnahme gegen die Nachbarstaaten Österreich, Ungarn und Tschechoslowakei und deren Profifußball. Der Boykottbeschluss sei von dem Wunsch getragen, „auf die irregeführten, räudigen Schäflein in Wien und Pest eine ethische Wirkung auszuüben, auf dass sie von dem bösen Profitum ließen“. Unter dem Deckmantel der Abwehr der professionellen „Seuche“ treibe der DFB „sportliche Expansionspolitik (…) mit der eigentlichen Absicht, den Professionalismus im Osten zu regulieren und gar zu erdrosseln“. Prophetische Worte, denn von 1938 an wird der DFB im Windschatten der marschierenden Wehrmacht tatsächlich seinen Amateurismus in diese Länder exportieren.
Das Wettspielverbot gegen Profimannschaften traf die auf diesem Feld sehr aktiven Vereine FC Bayern und 1. FC Nürnberg besonders hart, da sie zu den nahe gelegenen Fußball-Metropolen Wien, Prag und Budapest lang gewachsene Beziehungen pflegten. Die Bayern und der „Club“ bewegten sich in zwei Kontexten: einem deutschen und einem mitteleuropäischen.
Noch in seiner Festschrift zum 50-jährigen Bestehen widmete sich der FC Bayern eingehend den damaligen Auseinandersetzungen mit dem DFB: „Vom grünen Tisch aus versuchte man, die sich deutlich abzeichnende Wegerichtung zum Professionalismus im Fußball in letzter Minute noch durch drakonische Maßnahmen zu bremsen. (…) Die Verhältnisse in den Großvereinen waren aber bereits so weit schon vorgetrieben worden, dass man, ohne nicht die Existenz der Vereine aufs Spiel zu setzen, niemals auf diese Bedingungen eingehen konnte. (…) Die Männer im DFB hatten den Kontakt mit der Wirklichkeit bereits völlig verloren und versuchten eine Entwicklung aufzuhalten, die man niemals aufhalten konnte.“
Ein Jubiläum und der erste „Reichstrainer“
Am 2. Oktober 1925 feierte der DFB auf seinem 26. Bundestag in Leipzig sein 25-jähriges Bestehen. Nach harscher Pressekritik verzichtete man auf das Hissen der angestammten Verbandsfahne in den Kaiserreich-Farben Schwarz-Weiß-Rot. Ein Verzicht, der sich aber nicht auf die Farben der Festschrift erstreckte.
Diese begann mit kurzen Grußworten des Reichspräsidenten und des Reichsministers des Auswärtigen, die inhaltlich unterschiedlich ausfielen. Reichspräsident Paul von Hindenburg: „Durch Spiel und Kampf Körperkraft und Manneszucht, Entschlossenheit und Mut in der deutschen Jugend zu stärken, ist ein schönes und großes Streben, das der Volksgesundheit und damit Deutschlands Zukunft dient.“ Hingegen betonte Außenminister Gustav Stresemann den friedlichen und völkerverbindenden Charakter des Spiels: „Möge der Deutsche Fussball-Bund durch körperliche Ausbildung und friedliche Wettkämpfe den Geist der Energie, des Mutes und froher Tatkraft weiterpflegen und durch Zusammenwirken mit anderen Völkern auch Sportbetätigung und Sportgeist zum neuen Bindeglied zwischen den Nationen machen.“
Ein Jahr später verkündete der Vorstand des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen (DRA), dem auch der frisch zum DFB-Boss gewählte Felix Linnemann angehörte, in einem Brief an den Kriegsminister Geßler die Turn- und Sportwelt als „freiwillige Kerntruppe“ für eine später zu vergrößernde Reichswehr, „die durch keinen Friedensvertrag verboten ist“. Der DRA könne sich „keine sinnvollere Verwendung der ehemaligen Exerzierplätze denken, als wenn sie in Form von Turn- und Sportplätzen der Wehrfähigkeit des Volkes dienstbar gemacht werden“. Nach einigen Jahren der Ruhe wurde der deutsche Sport wieder von Militarisierungstendenzen heimgesucht.
Immerhin: Dank der Stresemann’schen Entspannungspolitik kehrte der DFB wieder in die internationalen Organisationen zurück und nahm in Prag erstmals seit Kriegsende an einer FIFA-Sitzung teil. Dort agitierte er gegen den bezahlten Fußball und versuchte seinen Amateurparagraphen auch international zu verankern, scheiterte damit aber.
Länderspiele sollte es nun wieder öfter geben. Vor allem bereitete sich die Nationalmannschaft darauf vor, 1928 in Amsterdam erstmals wieder an einem olympischen Fußballturnier teilzunehmen. Die sportlichen Voraussetzungen dafür lasen sich nicht berauschend: Von den 28 zwischen 1920 und bis Mitte 1926 ausgetragenen Länderspielen hatte die DFB-Auswahl elf verloren. Gewonnen wurden zehn, sieben endeten mit einem Unentschieden. Keine stolze Bilanz.
Im Juli 1926 stellte der DFB deshalb mit dem diplomierten Sportpädagogen und promovierten Mediziner Otto Nerz erstmals einen hauptamtlichen Reichstrainer ein. Nerz revolutionierte das Auswahlverfahren und propagierte „Energiefußball“, worunter er eine Kombination von „Schnelligkeit“ mit „Technik und Taktik“ verstand. Dem Trainer hatte es vor allem der englische Fußball angetan, in dem er urdeutsche Eigenschaften entdeckte. Noch heute gilt Nerz als progressiv denkender Übungsleiter, eine These, der der Zeithistoriker Rudolf Oswald widerspricht: „Eher dürfte das Gegenteil der Fall gewesen sein. Denn flankiert wurden seine Reformen durch immer wiederkehrende Reminiszenzen an das kulturpessimistische und biologistische Weltbild des Weimarer Sports: Fußball bestand für den Bundestrainer in der ‚Unterordnung‘ des individuellen Sportlers unter die ‚Gemeinschaft‘, der einzelne Kicker war für ihn nur ‚ein Glied des Ganzen‘. Sport an sich schließlich fasste er als ‚Erziehungsarbeit an (…) Volk und Vaterland‘ auf.“
Zwar war für DFB-Boss Felix Linnemann der Berufsfußball unverändert ein „Zeichen des Niederganges eines Volkes“, aber am 17. März 1928 wurden die „Hannoveraner Beschlüsse“ gelockert. Pro Jahr wurden acht Begegnungen mit österreichischen und jeweils vier mit tschechoslowakischen und ungarischen Klubs gestattet. Der Beschluss traf auf den Widerstand des Westdeutschen Verbandes. WSV-Vorstandsmitglied Wilhelm Erbach: „Wenn der DFB dem Berufsspielertum die Tore öffnet, dann verdient er nicht mehr zu bestehen, dann verleugnet er seine gewordene Mission und seine Aufgabe der deutschen Jugend gegenüber.“
Als sechs europäische Fußballverbände und die FIFA eine Resolution verfassten, mit der ein Profi-Boykott wie der des DFB künftig unmöglich gemacht wurde, hob der DFB den Beschluss vom 17. März wegen „unzulässiger Einmischung in deutsche Verhältnisse“ wieder auf. Vorerst also blieb es bei dem ebenso trotzigen wie realitätsblinden Boykott.
Von „Farbigen“ um den verdienten Lohn gebracht
Im Fußballprogramm der Olympischen Sommerspiele in Amsterdam kämpften 17 Nationalteams um Medaillen. Bei der Eröffnungsfeier der Spiele liefen die deutschen Sportler unter der schwarz-rot-goldenen Reichsfahne ins Stadion ein. Die Frankfurter Zeitung kommentierte: „Der deutsche Sport, d. h. die Massen seiner Teilnehmer, sind gute Staatsbürger, welche die Flagge kennen und ehren, die durch die Verfassung festgelegt ist, also Schwarz-Rot-Gold. Lediglich in den Kreisen der Führer, sowie in der Dach-Organisation des deutschen Sports, dem deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen (dritter Vorsitzender war DFB-Boss Felix Linnemann, Anm. d. A.), hegt man zum großen Teil noch andere Empfindungen.“ Der Dress der DFB-Elf bestand also wohl nicht zufällig aus einem weißen Hemd mit rotem Brustring und schwarzem Adler, einer weißen Hose und schwarzen Stutzen.
Die Nationalelf hatte die Kluft zu den stärksten Teams auf dem Kontinent verringert, und bei Olympia wurde ohne die Profis gekickt, was ihre Chancen erhöhte. Am 28. Mai 1928 besiegte die Nerz-Elf den selbst ernannten „Europameister“ Schweiz – die Eidgenossen waren vier Jahre zuvor ins olympische Finale eingezogen und kürten sich nach der Niederlage gegen Uruguay zum besten Team Europas – souverän mit 4:0. Aus Deutschland waren 10.000 Fans nach Amsterdam gereist. Die DFB-Elf war damit in den Kreis der Titelfavoriten vorgestoßen.
Doch schon sechs Tage später beendete Uruguay den Traum vom olympischen Gold. Vor gut 25.000 Zuschauern im Amsterdamer Olympiastadion, darunter erneut mehrere Zugladungen mit deutschen Anhängern, unterlag Deutschland dem späteren Turniersieger mit 1:4. In der von beiden Seiten hart geführten Partie wurden zwei zentrale Akteure der DFB-Elf, Torjäger Richard Hofmann und Mittelfeldlenker Hans Kalb, wegen Unsportlichkeit vom Platz gestellt.