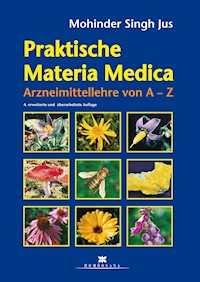
144,99 €
Mehr erfahren.
Praktisch Materia Medica Wieder ist dem Autor von "Kindertypen in der Homöopathie" und "Die Reise einer Krankheit" ein hervorragendes Werk gelungen, Dieses Buch ist das Resultat der über 30jährigen Praxis- und Lehrerfahrung von Dr. Mohinder Singh Jus und überzeugt durch seinen didaktischen Aufbau. 310 Arzneien werden nach dem Kopf-zu Fuss Schema eingeteilt und die Übersichtlichkeit wird durch eine zweifarbige Gestaltung des Textes verstärkt. Die einprägsame und lebhafte Darstellung der Polychreste ist besonders nützlich, um ein deutliches Bild von den Arzneien zu erhalten. Neben den Polychresten werden auch viele weniger bekannte homöopathische Arzneien ausführlich besprochen. Der Autor hat seine grosse therapeutische Erfahrung in unzählige Vergleiche einfliessen lassen. Feine Unterschiede zwischen den Arzneien werden präzis und und sorgfältig erklärt, so dass die Arzneien für den Leser zu einem klaren, lebendigen Bild werden. Dank der übersichtlichen Darstellung eignet sich diese Arzneimittellehre sowohl zur Überarbeitung eines Falles als auch für das Studium der Materia Medica. Der praktische Nutzen wird durch ein Repertorium, das auf diesem Werk basiert. "Praktische Materia Medica" ist nicht nur für erfahrene Homöopathen, sondern auch für Anfänger zu empfehlen. Es wird dem Praktiker das mühsame Nachblättern in verschiedenen Büchern ersparen und sich als ausserordentlich wertvolle Hilfe in der täglichen Arbeit mit den Patienten erweisen. Die allabendliche Bettlektüre für alle Homöopathen, die es genau wissen wollen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3774
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mohinder Singh Jus
Praktische Materia Medica
Arzneimittellehre von A – Z
Impressum
Mohinder Singh Jus: Praktische Materia Medica
4. erweiterte Auflage, Homöosana, 2021
ISBN-13: 978-3-906407-20-3
© 2021 Homöosana, SHI Homöopathie AG, 6300 Zug.
Homöosana, SHI Homöopathie AG
Steinhauserstrasse 51
CH-6300 Zug
+41 (0)41 748 21 80 Tel.
+41 (0)41 748 21 88 Fax
http://www.homoeosana.ch
http://www.shi.ch
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen werden.
Manuskriptbearbeitung, Lektorat: Martine Jus, Regula Schmid Satzherstellung: Martine Jus
Satz: Homöosana Verlag, Peter Oswald
E-Book: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt, Deutschland
In dankbarer Erinnerung an meinen verehrten Lehrer, Dr. Bijoy Kumar Bose (1879 – 1977)
Übersicht
Vorwort
Hinweise zum Buchaufbau
Liste der Arzneien Band 1-4
Arzneien A – Z
Repertorium
Anhang Band 1-3:
Gesamtverzeichnis der Arzneimittel
Index der Vergleiche
Vorwort
Wenn ein homöopathischer Arzt älter wird und reicher an beruflicher Erfahrung, blickt er oftmals auf seine Erfolge und ebenso auf viele seiner Fehlschläge zurück. Ein erfahrener Homöopath kommt mit den Jahren zu der Einsicht, dass all die Fälle von Rheumatismus, mentalen Störungen, Psoriasis, Asthma usw., die er behandelt hat, keine einfachen Fälle waren. Die Erfolge geben ihm enormes Selbstvertrauen, und die Fehlschläge lassen ihn spüren, dass jene Fälle, die so schwierig schienen und bei denen er scheiterte, tatsächlich gar nicht so schwierig waren: Im Gegenteil – in Wirklichkeit waren es oft ganz einfache Fälle.
■Hahnemann
Selbst unser Meister, Dr. Hahnemann, musste sich mit solchen Situationen auseinandersetzen, und auch er hat mit den Jahren Fortschritte gemacht. Er selbst war sein bester Kritiker. Er lernte am meisten aus seinen Fehlschlägen.
Hahnemann hatte jedoch nur eine begrenzte Zahl von Arzneimitteln und Potenzen zur Verfügung. Bedenkt man, mit wie wenigen Mitteln er auskommen musste, so erscheint das, was er erreicht hat, äusserst bemerkenswert. Er war der Pionier, der Wegbereiter. Ihm standen keine Richtlinien zur Verfügung, denen er hätte folgen können; er selbst war es, der sie festlegte.
Er war ein Forscher und hatte keine fertige Literatur und von Vorgängern geprüfte Arzneimittel zur Hand. Er war der erste, der das Naturgesetz der Heilung «similia similibus curentur» (Ähnliches es möge durch Ähnliches geheilt werden) systematisch angewendet hat.
■Unangebrachter Materialismus
Unglücklicherweise blieb die medizinische Welt Hahnemanns Entdeckung gegenüber verschlossen und der Materialismus in der Medizin wucherte immer weiter.
Materialismus in der Medizin ist der schwerwiegendste Fehler überhaupt. Es ist ein Irrweg, Krankheiten und Kranke aufzuspüren. Jede Behandlungsmethode, die auf dem Glauben beruht, ein Mensch sei krank, weil seine Organe nicht richtig funktionieren, ist naiv, zeugt von Unwissenheit und führt in die falsche Richtung. Sie bringt den Therapeuten vom Brennpunkt der Krankheit weg, und seine Patienten lernen nichts aus ihrer Krankheit. Deshalb hören wir Patienten oft sagen: «Wie kann ich mich gut fühlen, wenn meine Haut so schlecht aussieht?», oder: «Wie kann ich zufrieden sein, wenn die Ergebnisse meines Leberfunktionstests so schlecht ausgefallen sind?»
Jeder erkrankte Mensch spricht von äusseren Anzeichen und Symptomen, aber keiner ist dazu bereit, nach innen, in sich selbst hineinzuschauen.
An dieser Stelle möchte ich aus einem Kommentar von Kent zu diesem Thema zitieren: «Solange ein Therapeut auf diese Weise denkt, wird er auch die Symptome entsprechend auffassen und mit dem Repertorium in der nämlichen Weise arbeiten, und, obwohl er mit den von ihm erzielten Ergebnissen zufrieden sein mag, werden sie sich nicht mit den Ergebnissen vergleichen lassen, die man erhält, wenn man davon ausgeht, dass erkrankte Organe nur die Folge eines in Unordnung geratenen Gesamtzustands des Menschen sind, des Menschen, der sich zusammensetzt aus Geist, Körper und Seele.»
■Lebenskraft und Homöopathie
Jeder Mensch, der die Existenz der unsichtbaren Lebenskraft bezweifelt, wird Schwierigkeiten haben, das wahrzunehmen, was von einem Homöopathen unbedingt wahrgenommen werden sollte.
Jemand, der nicht über die Gegebenheiten des physischen Körpers hinausblickt oder nicht an Dinge glaubt, die er nicht riechen, berühren oder anschauen kann, ist arm dran und sehr zu bedauern. Er ist weit von sich selbst, von der Wirklichkeit seiner eigenen Existenz entfernt. Wird ein solcher Mensch Therapeut, so taugt er nicht zum Homöopathen; sollte er sich trotzdem als ein solcher ausbilden lassen, so wird er zu einer Bedrohung für die klassische Homöopathie und für die Patienten, die sich ihm anvertrauen.
■Holistische Medizin
Die Homöopathie ist eine holistische Medizin, die auf den Gesetzen der Natur beruht: Sowohl den mentalen und seelischen als auch den körperlichen Beschwerden des Patienten wird die ihnen gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Auf diese Weise kann dem Patienten schon geholfen werden, bevor pathologische Veränderungen auftreten.
■Mikroorganismen und Lebenskraft
Heutzutage kommt es oft vor, dass man einen Schulmediziner verwirrt und unglücklich sieht, wenn er bei der Untersuchung eines Patienten keine pathologischen Befunde entdecken kann. Der Patient klagt immer wieder über seine Beschwerden, aber die Symptome, die er schildert, werden nicht ernst genommen, weil die Untersuchung von Blut, Urin und Stuhl, die Röntgenaufnahmen und sogar die Ergebnisse des MRI keine Anomalitäten aufweisen. Die Symptome werden dann als «eingebildet» oder «psychisch» bezeichnet und als bedeutungslos abgetan. Das Vorhandensein von Verstand und Seele ist eine Tatsache und bedarf keines klinischen Nachweises.
Ein System, das sich auf die Behandlung der Endergebnisse von Erkrankungen stützt, nur weil diese sichtbar sind, kann den leidenden Menschen nicht viel Hoffnung geben. Ausserdem verändern sich Bakterien, Viren und andere Erreger im Lauf der Zeit und sprechen anders auf Behandlungen an. Immer mehr Medikamente und Gifte, die darauf abzielen, diese Organismen zu zerstören, tragen nur dazu bei, sie noch resistenter und cleverer zu machen.
Dies kommt klar in der sich stets verändernden allopathischen Materia Medica zum Ausdruck. In der allopathischen Medizin werden die Substanzen, die einmal gegen einen bestimmten Erreger angewendet wurden, immer wieder durch neue oder stärkere ersetzt. Das ist ein Beweis für das falsche Vorgehen. Die sich ständig verändernde Palette von Arzneimitteln ist ein Zeichen dafür, dass die traditionelle Medizin eine falsche Richtung eingeschlagen hat. Der Krieg gegen die mikroskopisch kleinen Organismen ist heftig, andauernd und endlos. Alle Impfungen oder sonstigen Geschütze gegen die sogenannten Schuldigen sind zum Scheitern verurteilt. Mikroorganismen sind wie Nachbarn, die zufällig vorbeikommen und dort, wo die Lebenskraft schwach und anämisch ist, alles und jedes angreifen und zerstören.
Dieses Prinzip gilt nicht nur für Infektionskrankheiten, sondern für alle Formen von chronischen und akuten Erkrankungen. Aus diesem Grund muss der Materialismus aus der Medizin verschwinden. Die Medizin muss sich auf die Lebenskraft des Patienten konzentrieren. Die Lebenskraft aber kann nur durch ein potenziertes, dynamisiertes Arzneimittel unterstützt und gestärkt werden; solche vergeistigten, hochdynamisierten Substanzen sind die einzigen Mittel, die innere Harmonie schaffen und somit einen Menschen nicht nur von seinen Symptomen befreien, sondern ihn wirklich heilen können.
■Die Heilmethode der Homöopathie
Die homöopathische Behandlungsmethode beruht auf strengen Prinzipien. Sie respektiert die Naturgesetze der Heilung: Sie hält sich genau an das Gesetz der Prioritäten, demzufolge die Symptome und Organe in einer genau festgelegten Reihenfolge behandelt und geheilt werden.
Ein Patient, der an einer komplexen chronischen Krankheit leidet, wird sich nicht schon allein deshalb glücklich fühlen, weil man ihm sagt, dass sein EKG in Ordnung ist und dass seine Blutwerte normal sind. Was nützen solche Untersuchungsergebnisse, wenn er an einer schweren Depression leidet, wenn er nicht den Wunsch hat weiterzuleben? Einem solchen Patienten ist das Leben nicht lieb und teuer; er findet auch zu Hause, bei seiner Familie, keine Freude, geht ohne Motivation zur Arbeit, hat Konzentrationsschwierigkeiten und sein Gedächtnis lässt nach.
Die klinischen Untersuchungen beziehen sich auf den Körper – aber über dem Körper steht das Selbst des Menschen, und ihm räumt die Homöopathie beim Heilungsprozess die höchste Priorität ein. Vor den Organen kommt der Mensch selbst. Deshalb muss zuerst der Mensch geheilt werden, und nur dann können sich die Organe erholen.
Das bedeutet, dass der Patient zunächst den Wunsch zu leben, zu lieben und Verantwortung auf sich zu nehmen, empfinden muss; wird eine homöopathische Arznei verabreicht, so ist in dieser Hinsicht die erste Verbesserung zu erwarten. Die Symptome, die lebenswichtige Organe wie Herz und Lungen und Nieren betreffen, sollten sich als nächstes bessern. Dann folgen die Gelenke und am Ende die Haut – von innen nach aussen, vom Zentrum zur Peripherie. Wenn Sie gründlich darüber nachdenken, wird Ihnen das einleuchten. Denn wozu benötigt ein Mensch ein gut funktionierendes Herz, wenn er keinen Lebenswillen mehr hat? Die Gelenke und die Haut sind nur dann von Bedeutung, wenn die lebenswichtigen Organe noch funktionieren und gesund sind.
Die unbedingte Gültigkeit dieses Gesetzes der menschlichen Existenz lässt sich während der Behandlung eines jeden Patienten immer wieder beobachten. Der Heilungsprozess muss vom Zentrum zur Peripherie erfolgen; in dieser Hinsicht gibt es keine Kompromisse.
■Ein Beispiel
In der Homöopathie wird der erkrankte Patient behandelt und nicht die Krankheit. Es werden auch keine radikalen und giftigen Substanzen verabreicht, um einen bestimmten Mikroorganismus gezielt zu eliminieren. Vielmehr stimuliert das homöopathisch indizierte Mittel die Lebenskraft des Patienten, die sich in der Folge selbst von der Krankheit befreit.
Diese Tatsache lässt sich auch im Labor verifizieren. Nehmen wir das Beispiel eines Patienten mit einer akuten Zystitis; er kann mit einer Dosis Cantharis C200 geheilt werden. Träufelt man ein klein wenig Cantharis C200 auf eine Kultur angeblich verursachender Bakterien, geschieht gar nichts. Verabreicht man hingegen dem Patienten eben dieses potenzierte Cantharis, wird schon wenige Tage später die aus dem Urin gewonnene Kontrollkultur steril sein.
Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass eine bestimmte Substanz, die im Hinblick auf die Gesamtheit der Symptome verabreicht wird, die Mikroorganismen entfernt, aber keine Wirkung zeigt, wenn sie direkt auf eine Bakterienkultur geträufelt wird? Die Antwort liegt auf der Hand: Der Patient konnte geheilt werden, weil das dynamisierte Cantharis seine Lebenskraft erreichte, die ebenfalls dynamisch ist; dadurch wurde der Heilungsprozess ausgelöst.
Kent sagt: «Das Ähnlichkeitsgesetz bringt die Heilbeziehung und das einzige Gesetz von dieser Art, das dem Menschen bekannt ist, zum Ausdruck – müssen wir daraus nicht den Schluss ziehen, dass diese heilende Macht oder Kraft, um ein korrektives Prinzip zu sein, insgeheim wesensmässig mit der Lebenskraft gleich sein muss?»
Alle Krankheiten lassen sich von intelligenten Ärzten an Zeichen und Symptomen erkennen. Es sind dies die nach aussen reflektierten Bilder der inneren Befindlichkeit der Lebenskraft. Die homöopathische Behandlung setzt sich zur Krankheit im allgemeinen und zum Patienten im besonderen in Beziehung. Das bedeutet: Die Krankheitsdiagnose beschreibt einen generellen Zustand, aber wir sollten uns am meisten für das Individuum, den Patienten – seine Gemütsverfassung, seinen Charakter, seinen Körperbau, seinen Gesichtsausdruck, seine Vorlieben und seine Abneigungen – interessieren. Alle diese individuellen Besonderheiten fallen bei der Auswahl des Arzneimittels stark ins Gewicht, ausserdem die Krankheitssymptome, der auslösende Faktor, der befallene Körperteil, die Empfindungen, die Art, wie der Patient seine Symptome schildert, die Modalitäten und die Begleitsymptome.
Nach der sorgfältigen Fallaufnahme wird ein wahrer Homöopath nur ein Mittel für all die aufgelisteten Symptome verschreiben. Er wird kein besonderes Mittel gegen Husten, Kopfweh, Depression oder Schlaflosigkeit geben. Die potenzierte Arznei wird, wenn sie richtig ausgewählt ist, die ganze Arbeit von selbst erledigen.
■Materia Medica
Hahnemann hat darauf hingewiesen, dass es sich bei medizinischen Substanzen um keine tote Materie handelt, sondern dass vielmehr ihre wahre Natur im Kern rein geistig ist. Sie kann entwickelt und ihre Wirksamkeit durch den bemerkenswerten Prozess des Verreibens und Schüttelns (Potenzierung genannt) ins nahezu Grenzenlose verstärkt werden.
In der Homöopathie rufen die potenzierten Substanzen keine toxischen oder sedativen Wirkungen hervor. Jenseits von C12 findet sich, materiell betrachtet, keine Spur der Ausgangssubstanz mehr. Deshalb sind die giftigsten der heute bekannten Substanzen (etwa das Botulinum-Toxin oder das Kalium cyanatum), in homöopathischen Dosen angewendet, wunderbare Heilmittel.
Die einzige Möglichkeit, die Heilkräfte so giftiger Stoffe wie Arsenicum, Strychnin, Ferrum cyanatum oder Mercurius cyanatum nachzuweisen, besteht darin, diese Mittel zu prüfen. Homöopathische Arzneimittel werden an gesunden Menschen erprobt, damit man den genauen Charakter der Beschwerden und die genauen Empfindungen des Probanden feststellen kann. Die Symptome, die eine Substanz an einem Gesunden hervorruft, entsprechen genau der Bandbreite der Heilmöglichkeiten eben dieser Substanz.
Kurz gesagt: Während der Prüfung sollte ein Mittel bei einem gesunden Mann oder einer gesunden Frau ein Symptomenbild hervorrufen, das mit dem des Patienten, dem das Mittel zur Heilung verabreicht werden soll, identisch ist.
Die Symptome der Mittel, die in den meisten Büchern über die homöopathische Materia Medica erwähnt werden, stammen aus zwei Quellen: aus Arzneimittelprüfungen an gesunden Menschen und aus klinischer Erfahrung. Obwohl Letzteres nicht genau auf der Linie der Hahnemannschen Empfehlungen liegt, weil die Mittel an Kranken erprobt worden sind, stellt sie einen recht erheblichen Teil der homöopathischen Materia Medica dar. Jeder engagierte Homöopath sollte mit den Ergebnissen der Prüfung von Arzneimitteln, wie sie in den Materia Medica-Büchern aufgelistet sind, sehr gut vertraut sein. Die Materia Medica ist das wichtigste Werkzeug, wenn es darum geht, den Kranken zu helfen. Es gibt keine Abkürzung, keinen Weg um die harte Arbeit herum. Niemand kann oder darf sagen, er wisse genug. Halbwissen macht einen Menschen arrogant und töricht. Ein wirklich grosser Homöopath ist der, der einfach und stets bereit ist dazuzulernen. Man könnte sagen: Je schlichter und demütiger ein Homöopath ist, umso grösser ist er und umso grösser sind seine Aussichten, noch weiter zu wachsen. Hat man die Grundlagen der Homöopathie verstanden, ist also das Nächstwichtige die gründliche Kenntnis der Materia Medica. Erst danach lernt man den Gebrauch des Repertoriums und nicht vorher. Es ist immer ratsam, sich zuerst mit der Materia Medica zu befassen und dann mit dem Repertorium – nicht umgekehrt. Wenn ein kluger Homöopath die Charakteristika des Patienten und die korrespondierenden Eigenschaften des gewählten Arzneimittels kennt, kann er die Symptome besser bewerten. Richtet sich die Verschreibung allein nach den besonderen Symptomen, so können sie zwar zum Verschwinden gebracht werden, jedoch entspricht dies nicht der Definition von Heilung, wie sie von Hahnemann gegeben wurde: «Die Beseitigung der Symptome stellt die Gesundheit des Patienten womöglich nicht wieder her. Jedoch die Heilung des Patienten wird die Symptome beseitigen und seine Gesundheit wiederherstellen.»
Unsere Art, an die Materia Medica heranzugehen, wird als bildhafte Methode bezeichnet. Diese Methode, die Materia Medica zu lehren, wurde von Kent, und danach von seinem Schüler B. K. Bose, auf eindrückliche Weise angewendet.
Es ist daher ganz natürlich, dass auch ich als Lehrer diesem Beispiel folge. Ich versuche, die Symptome und ihre Bedeutung bei jeder Verschreibung zu erklären, und bei meinen Vorlesungen schildere ich die Arzneien als Persönlichkeiten: Die Erscheinungsweise verschiedener Polychreste wie Lycopodium, Sulphur, Calcium carbonicum oder Phosphor wird den Studenten schauspielerisch dargestellt. Diese lebendige Methode, die Dr. Bose bei seiner Lehrtätigkeit so wunderbar anwendete, hat einen festen Platz in meiner Seele gefunden. Damals, als ich – selbst noch ein Student der Homöopathie – sie kennenlernte, wusste ich sofort, dass ich sie nie vergessen und sie, wenn ich selbst Lehrer wäre, auch einsetzen würde.
Das Lernen geht immer weiter. Ich lerne auch durch die Beobachtung von Menschen im Restaurant, im Zug, im Flugzeug; auf diese Weise versuche ich, Einblick in die Besonderheiten der einzelnen Persönlichkeiten zu bekommen. Das fördert mein Wachstum als Lehrer und als praktizierender Homöopath.
■Über dieses Buch
Setzt man sich hin, um ein Buch zu schreiben, gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Zahlreiche Ideen drängen sich heran, und es wird schwierig, einen Anfang zu finden.
Ein Gedanke – eher eine Frage als ein Gedanke –, der mir immer wieder in den Sinn kam, war:
Ist es überhaupt notwendig, ein weiteres Materia Medica-Buch herauszubringen? Es gibt schon so viele – angefangen von Hahnemanns Materia Medica Pura, Herings Enzyklopädie über die Materia Medica von Kent bis hin zu Lippe, Allen, Clarke, Nash, Tyler u. a. Was mich aber immer gestört hatte, war die Tatsache, dass es kein Materia Medica - Buch von meinem eigenen Lehrer, von Dr. B. K. Bose gibt. Wann immer er dazu befragt wurde, antwortete er sehr klar und deutlich, dass man im Leben nicht Zeit für alles habe. Er meinte: «Meine Schüler sind meine Bücher, und wenn sie in der Kenntnis der Homöopathie reif genug sind, werden sie aus ihrer eigenen Erfahrung heraus eine Materia Medica schreiben.»
Dieses Buch baut in erster Linie auf den Vorlesungen von Dr. Bose und auf meiner in drei Jahrzehnten gesammelten persönlichen Erfahrung auf. Bei den Vorarbeiten zu diesem Buch habe ich natürlich auch die Werke anderer Homöopathen wie Kent, Hering, Lippe, Clarke oder Boger zu Rate gezogen.
Dr. Bose war einer der brillantesten Lehrer, was das Studium der Miasmen und der vergleichenden Materia Medica angeht. Deshalb erwähne ich an vielen Stellen, in welche miasmatische Gruppe ein bestimmtes Arzneimittel oder Symptom gehört. Wo immer es nötig ist, werden die Namen anderer Arzneimittel, die dieselben Symptome aufweisen, genannt und einige davon miteinander verglichen. Dadurch soll es dem Leser erleichtert werden, auch die Wirkungsweise der anderen Mittel auf einen Blick zu erfassen und sein Spektrum bei der Auswahl eines Mittels zu erweitern.
Mitunter heisst es bei der Beschreibung eines Mittels «er» und/oder «sie» und/oder «es, das Kind» (als Handelnde bzw. Erleidende): damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sich der betreffende Aspekt eines Mittels (und je nachdem auch das ganze Mittel) in erster Linie auf das genannte Geschlecht bezieht.
Ich habe in diesem Buch 302 Arzneien nach dem Kopf-zu-Fuss Schema eingeteilt. Die Übersichtlichkeit wird durch eine zweifarbige Gestaltung verstärkt. Die einprägsame und lebhafte Darstellung der Polychreste ist besonders nützlich, um ein Bild von den Arzneien zu erhalten. Nicht nur Polychreste, sondern viele weniger bekannte Arzneien werden besprochen, um ihre Wirksamkeit bei der Behandlung akuter Fälle und ihre hervorragende Eignung als Palliativum aufzuzeigen. Es handelt sich in der Regel um klinisch geprüfte Arzneien. In den Fällen, in denen ich gute Erfahrungen mit ihnen gemacht habe, werden auch Potenz und Dosierung erwähnt.
In keinem Fall sollte aber eine durch solche weniger bekannten Mittel erreichte Linderung als Heilung aufgefasst werden. Diese Mittel decken nur einige Symptome der funktionellen und organischen Störung ab. Solange nicht alle für den Patienten charakteristischen Symptome angegangen werden können, wird die Linderung nur vorübergehend sein. Der Unterschied zwischen einer vorübergehenden Linderung und einer wirklichen Heilung darf nicht aus den Augen verloren werden.
Der Umfang einer bestimmten Arznei hängt einerseits von ihrem Bekanntheitsgrad, anderseits von meiner persönlichen Erfahrung ab. Deshalb werden solche Polychreste wie Lycopodium, Calcium carbonicum, Sulphur, Thuja usw. bedeutend umfangreicher beschrieben als Mittel wie Aethusa, Corallium rubrum oder Spongia usw.
Dank der übersichtlichen Darstellung eignet sich diese Arzneimittellehre sowohl zur Überarbeitung eines Falles wie auch zum Studieren der Materia Medica. Der praktische Nutzen wird verstärkt durch ein Repertorium, das auf diesem Werk basiert. Dieses kleine Repertorium erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte als Index verstanden werden. Zum Repertorisieren eines Falles eignet es sich nicht. Zusätzlich wurde ein Index der Vergleiche erstellt.
„Praktische Materia Medica“ ist sowohl für erfahrene Homöopathen als auch für Anfänger verfasst worden. Es wird dem Praktiker das mühsame Nachblättern in verschiedenen Büchern ersparen und sich als wertvolle Hilfe in der täglichen Arbeit mit Patienten erweisen. Um grösstmögliche Authentizität zu bewahren, wurde mein Sprachstil weitgehend behalten.
Ich habe beim Lehren stets versucht, mein Bestes zu geben; das Gleiche gilt jetzt für mein Unterfangen, dieses Werk der homöopathischen Fachwelt zu präsentieren. Es wurde nach bestem Wissen und Gewissen für all jene geschrieben, die nach der Vertiefung ihrer Kenntnisse streben.
Mit dem Verfassen dieses Buches habe ich jedenfalls ein Versprechen eingelöst, das ich meinem Lehrer und meinen Schülern gegeben habe.
■Ein Wort des Dankes
Das vorliegende Werk ist nur ein bescheidener Versuch, in den unergründlichen Ozean der Materia Medica einzutauchen. Seine Fertigstellung wäre ohne die Hilfe und die Unterstützung meiner lieben Schüler nicht möglich gewesen: Ich danke ihnen allen! Ich danke ebenfalls meinen lieben Patienten und meinem engagierten SHI-Team für ihr Verständnis und ihre Geduld. Ich habe nämlich viel Zeit von Ihnen genommen, um dieses Werk zu verfassen.
Besonderen Dank möchte ich Dr. Claudia Kolb-Stammheer aussprechen; von ihr stammen Aufzeichnungen von meinen Vorlesungen in der SHI Homöopathie Schule in Zug.
Ich bin Mechtild Jecker sehr dankbar für die Hilfe bei der Übersetzung und Korrektur des Manuskripts. Ihr Eintritt ins Team stärkte unser Rückgrat massgebend. Gott möge sie segnen!
Ich danke meinem Freund Alex Auer für die stets positive und ermunternde Unterstützung vom ganzen Herzen.
Die Manuskripte zusammenzutragen und sie zu einem systematisch geordneten Buch umzuformen, wäre ohne die Hilfe von meiner lieben Frau, Dr. Martine Cachin Jus, nicht möglich gewesen. Sie hat das Buch übersetzt, korrigiert und in unzähligen Stunden am PC gestaltet. Ihr gilt mein ganz spezieller Dank!
Neuheim, im Januar 2003
Mohinder Singh Jus
Vorwort zur 4. erweiterten Auflage
Die Praktische Materia Medica von Dr. Mohinder Singh Jus ist seit ihrem ersten Erscheinen in 2003 rasch ein unersetzbares Standardwerk für den Praktiker und Studierenden geworden. Absolut einmalig sind die feinen Differenzierungen zwischen den Arzneien und die bildhafte Darstellung der Polychresten. Die Arzneien nehmen eine lebendige Form, sodass man sie viel einfacher in der Praxis erkennt. Zudem werden vielen sogenannten «kleine Mittel» präzis und praxisorientiert erläutert.
Ich hatte das grosse Glück und die Ehre von diesem Meister der Homöopathie seit 1986 direkt unterrichtet zu werden und seither wende ich mit Überzeugung und Dankbarkeit die Jus-Methode an. Dr. Jus war sowohl ein fordernder und strenger, wie auch liebevoller und grosszügiger Lehrer. Er forderte seinen Studenten immer auf, kritisch zu bleiben und seinem Unterricht erst ganz zu glauben, nachdem sie es selber in der Praxis bestätigt hatten. Er war ein Perfektionist in seiner Arbeit. Er weigerte sich streng, Arzneien in seinen Büchern zu beschreiben, bei denen er selber nicht genug klinische Erfahrung hatte. So ist dieses Werk eine wahre Schatzkammer der homöopathischen Materia Medica, in dem die 50jährige Erfahrung des Autors drin fliesst.
Ich durfte bereits an der ersten Auflage dieses Werkes mitarbeiten, indem ich geordnet, übersetzt, den Text abgetippt und gesetzt habe. Als Dr. Jus am 10. Juni 2019 unerwartet verstarb waren die Arbeiten für die 4. Auflage auf gutem Wege und das Werk in der 3. Auflage seit mehreren Monaten vergriffen. Wir hatten den Sommer 2019 für das Erarbeiten der 4. Auflage reserviert. Nun lehrt uns das Leben immer eines Besseren. Als eine der ersten Jus-Studentin in der Schweiz und als seine Ehefrau wollte ich diese Arzneimittellehre unbedingt der Fachwelt wieder zugängig machen und möglichst alle von Dr. Jus geplanten Änderungen und Ergänzungen berücksichtigen.
2020 habe ich mich mit grossem Respekt an die Aufgabe herangewagt, die begonnene Arbeit zu vollenden. Wie oft habe ich dabei gewünscht, ich könnte Dr. Jus etwas fragen, eine Präzisierung, einen Vergleich! Zum Glück hatte ich Zugriff auf alle handschriftlichen Notizen und auf die umfangreiche Videothek der Seminaraufzeichnungen von Dr. Jus. Dadurch konnte den ursprünglichen Überarbeitungsplan -fast- eingehalten werden. Es war eine erfüllende Arbeit und es ist mir eine immense Freude, meinen Kollegen, meinen Studenten und der Fachwelt die 4. überarbeitete und erweiterte Auflage zu präsentieren.
Acht neue Arzneimittel wurden verfasst: Clematis, Croton tiglium, Echinacea angustifolia, Eupatorium purpureum, Helonias, Mephitis, Squilla und Terebinthinae Oleum. Zudem wurden vier neue Mittel als Vergleiche zu anderen Arzneimitteln integriert: Apomorphinum, Grindelia, Lycopus und Strophantus (siehe «Index der Vergleiche»).
In dieser Auflage wurde ebenfalls Dr. Jus’s Beitrag zur Erweiterung unserer Materia Medica eingebaut. Zwischen 2000 und 2006 initiierte und begleitete er als Prüfungsdirektor mehrere Homöopathische Arzneimittelprüfungen (HAMP). Die klinisch bestätigten Symptomen aus folgenden HAMP wurden aufgenommen: Amyl nitrosum, Hecla lava, Adonis vernalis und Natrium arsenicosum.
Insgesamt wurden über 40 Arzneimittel überarbeitet und das Repertorium ergänzt. Die Homöopathie stammt aus dem Mutterleib der Natur und die homöopathische Materia Medica ist so vielfältig und unendlich wie das Universum. Deshalb kann man die Homöopathie nie beherrschen und der Homöopath bleibt zeitlebens ein Lernende. Durch fleissiges Studieren und Liebe zur Homöopathie werden die Arzneimittel allmählich wie gute und treue Freunde, bei denen Rat eingeholt wird. So wird die Arbeit in der homöopathischen Praxis sehr erfüllend. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Reise auf dem Meer der Materia Medica. Möge dieses Werk Ihr treuer Kompass sein!
Danke an alle, die mir in diesem Projekt unterstützt und motiviert haben. Mein besonderer Dank geht an: Regula Schmid, Homöopathin in der SHI Homöopathischen Praxis, für die wertvolle fachliche Unterstützung und das Lektorat; Peter Oswald, für die endlose Geduld beim Setzen und Anpassen des Layouts; Jens Schnetzler für den Beitrag zur Überarbeitung des Repertoriums.
Neuheim, 31.12.2020
Martine Jus
Hinweise zum Buchaufbau
■Einführende Bemerkung
das Buch wird in 4 Bände aufgeteilt:
Band 1: A – D
Band 2: E – N
Band 3: O – Z
Band 4: Repertorium
Die Arzneien werden in verschiedener Hinsicht verglichen. Nach den einzelnen Symptomen werden Arzneien in Klammer erwähnt, welche ebenfalls diese Symptome aufweisen. Wichtige Unterschiede werden anschliessend erläutert. z.B. bei Ledum:
Verlangen, allein zu sein, weil alles für ihn zu viel wird (Thuj, Aur, Graph, Phosac, Sil); zieht sich zurück, um in aller Ruhe trinken zu können
vgl. Thuj: ist v. a. mit sich beschäftigt, ist voller Fixierungen, denkt über die Vergangenheit nach, meditiert; scheu, Angst vor dem Gegengeschlecht
vgl. Phos-ac: ist dermassen erschöpft, dass er nur noch liegen und seine Ruhe haben will; will niemand um sich haben, keine Musik, nur er und sein Bett
Aur: hat genug vom Leben, übt massive Selbstkritik, sitzt und führt Selbstgespräche, empfindet keine Freude für nichts, verwirrt, > Musik, meditieren
Graph: scheu, mangelndes Selbstvertrauen, isoliert sich, sitzt und denkt über seine Jugend nach; nervös, unruhig, kann nicht konzentriert arbeiten
Sil: scheu, stur, beschäftigt mit seiner eigenen Welt, voller Komplexe; denkt über alles, was in der Vergangenheit schief gelaufen ist, nach
■Rubriken
310 Arzneien werden nach dem Kopf-zu-Fuss Schema beschrieben. Die Symptome werden in folgende Rubriken geordnet (einführende Bemerkungen wurden in der Regel vorangestellt):
Miasmen
Mund
Schlaf
Indikationen
Hals
Haut
Charakteristika
Magen/Abdomen
Fieber
Aussehen
Rektum/Stuhl
Allgemein
Gemüt
Harnwege
Modalitäten
Kopf
Frau
Leitsymptome
Augen
Mann
Beziehungen
Ohren
Herz
Vergleiche
Nase
Atemwege
Gesicht
Bewegungsapparat
Bei der Rubrik „Miasmen“ wird die miasmatische Zugehörigkeit der Arznei in absteigender Wertigkeit aufgelistet.
Beispiel:
Bei Iodium steht: psorisch, tuberkular, syphilitisch, sykotisch; dies bedeutet, dass der Hauptanteil psorisch ist, der zweitgrösste tuberkular usw.
Bei „Charakteristika“ werden die Grundmerkmale der Arznei kurz zusammengefasst
Die physiognomischen Merkmale und das Verhalten eines Menschen haben einen hohen Stellenwert in der homöopathischen Fallaufnahme. Deshalb wurden solche Eigenschaften in einer eigenen Rubrik „Aussehen“ aufgeführt.
Der Übersichtlichkeit halber wurden die Gemütssymptome, wo immer möglich, in Gruppen unterteilt.
Gelsemium z.B. wurde wie folgt unterteilt: Kinder – Erwachsene – Ängste
Die Kopfsymptome wurden folgendermassen unterteilt:
– Kopfhaut und Haar
– Epilepsie
– Schwindel
– Kopfschmerzen
Die weiblichen Symptome wurden unter „Frau“ folgendermassen unterteilt:
– allgemeine weibliche Symptome
– Menstruation
– Prämenstruell
– Menstruell
– Postmenstruell
– Schwangerschaft
– Entbindung
– Wochenbett
– Menopause
Die Modalitäten sind in diesem Buch klar gegliedert worden: Ich habe mich darum bemüht, zwischen den allgemeinen und den lokalen Modalitäten zu unterscheiden.
Mit allgemeinen Modalitäten sind die Faktoren gemeint, die den Patienten in seiner Gesamtheit beeinflussen, zum Beispiel: besser bei Wärme (> Wärme).
Mit lokaler Modalität ist zum Beispiel gemeint: Kopfschmerzen schlimmer bei Wärme [< Wärme (Kopfschmerzen)]. Solche Details sind, wo immer möglich, dargestellt worden.
<dieses Zeichen bedeutet eine Verschlimmerung
<< steht für eine ausgeprägte Verschlimmerung
> dieses Zeichen bedeutet eine Besserung
>> steht für eine ausgeprägte Besserung
Ich bin der Ansicht, dass man ein Arzneimittel leichter auf einen Blick erfassen kann, wenn jede Verschlimmerung und jede Verbesserung deutlich herausgearbeitet ist. So findet man zum Beispiel unter Lycopodium:
< auf dem Rücken liegen (Rückenschmerzen)
> auf dem Rücken liegen (Blähungen)
< Bettwärme (Kopfschmerzen)
> Bettwärme (Zahnschmerzen)
Die aufgeführten Leitsymptome verschaffen dem Leser einen schnellen Überblick über das betreffende Mittel.
Unter „Beziehungen“ werden die Namen anderer ähnlicher Mittel genannt. In ähnlicher Weise werden, wo es möglich ist, Antidote, Komplemente und Feinde erwähnt.
Unter „Vergleiche“ werden einige Mittel - meist tabellarisch - miteinander verglichen.
Nur wo es sinnvoll oder nötig erschien, wurde dieses Schema modifiziert bzw. erweitert.
■Repertorium
Band 4 enthält ein Repertorium. Dieses kleine Repertorium ist eine korrigierte und erweiterte Ausgabe, die auf den in der „Praktischen Materia Medica“ von Mohinder Singh Jus enthaltenen Vergleichen basiert. Es wurde mit über 500 Nachträgen erweitert wobei dem Kapitel Auslöser besondere Beachtung beigemessen wurde. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollte vielmehr eine Orientierungshilfe für den Leser sein.
■Arzneiverzeichnis des Gesamtwerks
Am Ende jedes Bandes erscheint ein Arzneiverzeichnis von Band 1-3. Dieses Verzeichnis enthält sowohl die 310 Hauptarzneien, wie auch alle anderen in Vergleichen erwähnten Arzneien. Zusätzlich wurden jeweils die im Werk benützten Arzneiabkürzungen aufgeführt.
■Index der Vergleiche
Es wurde ein Index der Vergleiche erstellt, die in der Rubrik „Vergleiche“ beschrieben sind.
Inhaltsverzeichnis Arzneien
■Band 1
Abies nigra
Abrotanum
Absinthium
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Actaea spicata
Adonis vernalis
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Ammonium phosphoricum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Angustura vera
Anthracinum
Antimonium arsenicosum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifica
Apocynum cannabinum
Aralia racemosa
Aranea diadema
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arsenicum iodatum
Artemisia vulgaris
Arum triphyllum
Arundo mauritanica
Asa foetida
Asarum europaeum
Aspidosperma quebracho-blanco
Aurum metallicum
Aurum muriaticum
Avena sativa
Bacillinum
Badiaga
Baptisia tinctoria
Barium carbonicum
Barium iodatum
Barium muriaticum
Barium sulphuricum
Belladonna
Bellis perennis
Benzoicum acidum
Berberis aquifolium
Berberis vulgaris
Bismuthum
Blatta americana
Blatta orientalis
Borax veneta
Bothrops lanceolatus
Bovista lycoperdon
Bromium
Bryonia alba
Bufo rana
Cactus grandiflorus
Cadmium sulfuratum
Caladium seguinum
Calcium arsenicosum
Calcium carbonicum
Calcium causticum
Calcium fluoricum
Calcium iodatum
Calcium phosphoricum
Calcium silicatum
Calcium sulfuricum
Calendula officinalis
Camphora
Cannabis indica
Cantharis vesicatoria
Capsicum annuum
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Carbolicum acidum
Carcinosin
Carduus marianus
Castor equi
Caulophyllum thalictroides
Causticum Hahnemanni
Cedron
Chamomilla
Chelidonium majus
Chimaphila umbellata
China officinalis
Chininum arsenicosum
Chionanthus virginica
Cicuta virosa
Cimicifuga racemosa
Cina maritima
Cistus canadensis
Clematis recta
Coca
Cocculus indicus
Coccus cacti
Coffea cruda
Colchicum autumnale
Collinsonia canadensis
Colocynthis
Conium maculatum
Convallaria majalis
Corallium rubrum
Crataegus oxyacantha
Crocus sativus
Crotalus horridus
Croton tiglium
Cundurango
Cuprum arsenicosum
Cuprum metallicum
Cyclamen europaeum
Digitalis purpurea
Dioscorea villosa
Diphtherinum
Dolichos pruriens
Drosera rotundifolia
Dulcamara
■Band 2
Echinacea angustifolia
Elaps corallinus
Equisetum hyemale
Erigeron canadense
Eucalyptus globulus
Eupatorium perfoliatum
Eupatorium purpureum
Euphorbium officinarum
Euphrasia officinalis
Ferrum iodatum
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Ferrum picricum
Fluoricum acidum
Formicicum acidum
Gambogia
Gelsemium sempervirens
Gettysburg aqua
Glonoinum
Glycerinum
Gnaphalium polycephalum
Gossypium herbaceum
Granatum
Graphites
Guajacum
Hamamelis virginiana
Hecla lava
Helleborus niger
Helonias dioica
Hepar sulfuris calcareum
Hydrangea arborescens
Hydrastis canadensis
Hydrocotyle asiatica
Hydrocyanicum acidum
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum
Ignatia
Iodium
Ipecacuanha
Iris versicolor
Jaborandi
Jalapa
Justicia adhatoda
Kalium arsenicosum
Kalium bichromicum
Kalium bromatum
Kalium carbonicum
Kalium iodatum
Kalium muriaticum
Kalium phosphoricum
Kalium sulfuricum
Kalmia latifolia
Kreosotum
Lac caninum
Lachesis muta
Lapis albus
Ledum palustre
Lilium tigrinum
Lithium carbonicum
Lobelia inflata
Lycopodium clavatum
Lyssinum
Magnesium carbonicum
Magnesium muriaticum
Magnesium phosphoricum
Magnesium sulphuricum
Malandrinum
Manganum aceticum
Medorrhinum
Melilotus officinalis
Mephitis putorius
Mercurius corrosivus
Mercurius cyanatus
Mercurius dulcis
Mercurius iodatum flavus
Mercurius iodatum ruber
Mercurius solubilis
Mercurius sulphuratus ruber =Cinnabaris
Mercurius sulphuricus
Mezereum
Millefolium
Moschus
Murex purpureus
Muriaticum acidum
Mygale lasiodora
Myristica sebifera
Naja tripudians
Naphthalin
Natrium arsenicosum
Natrium carbonicum
Natrium muriaticum
Natrium phosphoricum
Natrium sulphuricum
Negundium americanum
Nitricum acidum
Nux moschata
Nux vomica
■Band 3
Ocimum canum
Oenanthe crocata
Oleander
Onosmodium virginianum
Oophorinum
Opium
Origanum majorana
Ornithogalum umbellatum
Oxalicum acidum
Paeonia officinalis
Pareira brava
Passiflora incarnata
Pertussinum
Petroleum
Phosphoricum acidum
Phosphorus
Phytolacca decandra
Picricum acidum
Plantago major
Platina
Plumbum metallicum
Podophyllum peltatum
Psorinum
Pulsatilla pratensis
Pyrogenium
Radium bromatum
Ranunculus bulbosus
Ratanhia peruvania
Rheum palmatum
Rhododendron chrysanthum
Rhus toxicodendron
Rumex crispus
Ruta graveolens
Sabadilla officinalis
Sabal serrulata
Sabina
Sambucus nigra
Sanguinaria canadensis
Sanicula
Sarsaparilla officinalis
Scutellaria laterifolia
Secale cornutum
Selenium
Sepia
Silicea terra
Sinapis nigra
Skookum chuck aqua
Solidago virgaurea
Spigelia anthelmia
Spongia tosta
Squilla maritima
Stannum metallicum
Staphysagria
Sticta pulmonaria
Stillingia silvatica
Stramonium
Strontium carbonicum
Sulphur
Sulphuricum acidum
Symphytum officinale
Syphilinum
Tabacum
Taraxacum officinale
Tarentula hispanica
Tellurium metallicum
Terebinthinae Oleum
Teucrium marum verum
Theridion curassavicum
Thiosinaminum
Thlaspi bursa pastoris
Thuja occidentalis
Thyreoidinum
Trillium pendulum
Trinitrotoluenum
Tuberculinum Koch
Urtica urens
Uva ursi
Valeriana officinalis
Variolinum
Veratrum album
Veratrum viride
Vespa crabro
Viola tricolor
Vipera communis
Wyethia helenoides
Xanthoxilum fraxineum
X-Ray
Zincum metallicum
Zincum phosphoricum
Zingiber officinale
Abies nigra
Schwarzfichte
■Miasmen
psorisch, sykotisch
■Indikationen
Ösophagusstriktur
Magen- und Ösophaguskarzinom (palliativ)
Ulcus pepticum, Gastritis
Hiatushernie
Verstopfung
Dyspepsie bei alten Leuten
Auslösende Faktoren
–zu viel Tee
–zu viel Tabak
■Gemüt
niedergeschlagen
benommen am Tag, wach in der Nacht
unfähig zu denken
■Kopf
Hitze mit Wangenröte
■Magen / Abdomen
Magenschmerzen immer gleich nach dem Essen
Empfindung, als ob nach dem Essen ein hartgekochtes Ei im Mageneingang liege
der Durchgang der Speisen wird verhindert; Druck und Krampfschmerzen
morgens appetitlos, daher Frühstück unmöglich (Caust, Ferr, Lach, Sep, Sulph, Tub)
Appetit erst mittags und nachts; nachts Heisshunger
Essen ohne Hunger, der Hunger kommt erst mit dem Essen (Lyc, Phos, Calc, Psor, Cic, Arg-m)
Hunger, aber das Gefühl, die Nahrung verbleibe im Magen
Gefühl von Einschnürung über der Magengrube, als wäre etwas zusammengeknotet
■Rektum /Stuhl
hartnäckige, tagelange Verstopfung, kein Stuhldrang
allgemein langsame Verdauung
■Schlaf
Schlaflosigkeit wegen Hunger (China, Ign, Lyc, Phos, Sanic, Psor, Petr)
unruhiger Schlaf
Angstträume
■Modalitäten
Verschlimmerung
–Schlafen
–nach dem Essen (Psyche > nach dem Essen)
Besserung
–bei leerem Magen (Magenbeschwerden)
■Beziehungen
konstitutionelle Entsprechung ist am ehesten der Calc-Typ
Vergleiche: Kali-c, Lyc, Thuj, Nat-m, Puls, Bry, Nux-v, Chin
■Vergleiche
Vergleich mit Orni: siehe unter Ornithogalum umbellatum
Abrotanum
Eberraute, Zitronenkraut, Artemisia abrotanum
Die Eberraute ist in der englischen Volksmedizin eine altbekannte Pflanze. Die in Wasser gekochten Samen wurden gegen Ischialgie und unterdrückte Menstruationen eingesetzt. Gemischt mit Wein, wurde die Eberraute als Antidot gegen alle Gifte gebraucht. Die Pflanze wurde auch gegen Würmer und Akne verschrieben. Die Asche wurde, gemischt mit etwas Öl, lokal angewendet, um das Haarwachstum zu stimulieren. Letztlich brauchte man die in Wasser gekochten Blätter zur Reinigung infizierter und sogar gangränöser Wunden.
Die homöopathische Tinktur wird aus den frischen Blättern und Stielen zubereitet. Abrot ist eine stark antituberkulare Arznei, an die man bei der Behandlung von Kindern mit Assimilationsstörungen denken sollte; die Kinder haben einen sehr guten Appetit, trotzdem verlieren sie an Gewicht; sie sind sehr schwach und können nicht stehen.
Abrot sollte auch in Fällen von unterdrückter Gicht oder Rheuma mit daraus resultierender Symptomverschiebung auf andere, wichtige Organe in Betracht gezogen werden.
■Miasmen
psorisch, tuberkular
■Indikationen
Marasmus von Kindern und Säuglingen (besonders kleine Jungen), vor allem der unteren Extremitäten (Arg-n)
Abmagerung trotz gutem Appetit
Rheumatismus, Gicht
Gicht-Metastasen in Augen, Magen oder Herz
Hämangiom
vergrösserte, entzündete Lymphdrüsen
Epilepsie
Hydrozele nach Mumps
Nasenbluten; Nasenbluten bei Säuglingen kurz nach der Geburt
Hämaturie
Wurmbefall
Hämorrhoiden
blutiger Ausfluss aus dem Nabel bei Kleinkindern
Frostbeule, Furunkulose
Auslösende Faktoren
–Grippe (massive Erschöpfung)
vgl. Erschöpfung nach Grippe: Nat-ar, Nat-sal, Chin, Chin-ar, Psor
–Brustoperation, Brustamputation (z. B. Schmerzen, Neuralgien, Phantomschmerzen)
–Thorax-Operation, Lungen-Operation (z. B. Pleuraerguss)
–Hämorrhoiden-Operation, unterdrückte Hämorrhoiden-Blutung, Venenoperation (Rheumatismus)
–unterdrückter Durchfall (Rheumatismus)
–unterdrückte Hautausschläge (Hydrozele)
■Aussehen
kleine Kinder sehen wie alte Menschen aus; das Gesicht ist bleich, runzelig, hat einen nachdenklichen Ausdruck
bei Rachitis sind Bauch und Kopf gross, der Nacken und die Extremitäten sehr schmal
bei Abrot ist die Abmagerung aufsteigend, d. h. zuerst werden die Beine dünn, dann die Arme und der Oberkörper; Lyc, Sanic, Nat-m magern von oben nach unten ab
blaue Augenringe
erweiterte Venen auf der Stirn (Lach, Chin, Calc, Crot-h)
fröstelig
■Gemüt
ärgerlich, gereizt
besorgt, ängstlich
Ängste und Unruhe werden im Magen empfunden (Asar, Ars, Calc, Calc-p, Tarent, Cupr, Coff, Kali-c, Puls, Stram, Dig, Verat)
Angst vor Alzheimer, Gehirnerweichung (Med, Asaf)
Angst beim Erwachen aus einem Traum (Lyc, Bov, Phos-ac, Sil, Cina)
Stimmungsschwankungen: glücklich, dann plötzlich traurig
sture Kinder, machen immer das Gegenteil von dem, was man ihnen sagt
manipulativ, «Trouble shooter», clever
vgl. Aeth: hat auch Assimilationsstörungen, ist aber dümmlich
will nicht reden, will seine Ruhe haben
denkt, er könnte etwas Unmenschliches und Brutales tun (Anac, Plat, Croc, Cur, Nux-v, Op, Tub, Tarent, Iod, Kali-br, Lac-c)
Abneigung gegen geistige und körperliche Arbeit
müde von der kleinsten geistigen Anstrengung oder vom kleinsten Gespräch, < nach Grippe
vgl. Phos-ac: ist am liebsten im Bett, hat eine Abneigung gegen Musik und hat keinen Appetit, hat Durchfall ohne >; Abrot hat viel Hunger und ist > wenn er Durchfall hat
vergesslich
hat keinen Ehrgeiz
Depression bei Kindern; sitzen traurig da, ohne ein Wort zu artikulieren
vgl. Depression bei Kindern: Nat-m, Calc, Ars, Lach, Sulph, Aeth
■Kopf
kann wegen Nackenschwäche den Kopf nicht gerade halten (Calc-p, Nat-m, Calc, Sil, Graph, Phos-ac, Zinc, Aeth)
müder Kopf, sobald er reden muss oder bei der kleinsten geistigen Anstrengung (Phos, Nux-m, Nat-m, Aeth)
Gefühl von tiefen Kältewellen, die sich wie Nebel durch die Hirnkonvolutionen bewegen
vgl. Kältegefühl im Kopf: Bell, Calc, Merc-c, Rhus-t, Stann, Iod, Tarent, Verat, Nat-m, Mosch, Sanic
vgl. Sanic: Gefühl, ein kalter Wind blase auf dem Gehirn
vgl. Calc: Gefühl von Eiswürfeln am Scheitel
■Augen
blaue Augenringe
Gicht-Metastasen in den Augen, sieht nicht gut
rheumatische Augenbeschwerden oder abwechslungsweise Rheuma und Augenbeschwerden (Thuj)
■Nase
Epistaxis bei Kleinkindern (Coc-c, Ter, Ferr, Ferr-p, Phos)
vgl. Epistaxis bei alten Leuten: Agar, Carb-v, Sec, Sul-ac
■Gesicht
faltig, ausgetrocknet, blass (Aeth)
Hämangiom
■Mund
klebriger Speichel (Puls)
trockene Zunge
Gefühl, die Zunge sei heiss
■Magen
Heisshunger (Am-c, Anac, Arg-m, Ars-i, Calc, Calc-p, Cann-i, Chin, Cina, Ferr, Iod, Graph, Lyc, Nat-m, Olnd, Phos, Petr, Psor, Puls, Sulph, Verat)
vgl. Calc-p: beim Zahnen isst er zu wenig, sonst eher viel
vgl. Calc: ist ständig am Knabbern
vgl. Iod: Heisshunger, isst viel und oft oder wechselhafter Appetit, isst entweder zu viel oder zu wenig
Verlangen nach Brot, das in Milch gekocht wurde
vgl. Verlangen nach trockenem Brot: Bar-m
vgl. Verlangen nach Brot und Butter: Ign, Mag-c, Ferr, Merc, Puls, Grat
Abmagerung trotz gutem Appetit (Phos, Tub, Iod, Nat-m, Sanic, Sil, Cina, Calc, Calc-p, Bar-c, Chin, Lyc, Mag-c, Sulph)
nagende, schneidende Magenschmerzen, < nachts
brennende Magenschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen von einer stinkenden Flüssigkeit
Gefühl, als ob der Magen im Wasser schwimmen würde
vgl. Kali-c: als ob der Magen voll Wasser wäre
Gefühl, als ob der Magen locker hängen würde (Ign, Ip, Bar-c, Bism, Carb-v, Lyc, Staph, Calc, Calc-p, Sul-ac, Tab)
■Abdomen
aufgebläht; bei der Palpation spürt man harte Klumpen im Bauch
Gefühl, als ob die Eingeweide nach unten sinken würden (Arg-n, Aloe, Calc-p, Ign, Phos, Podo, Psor, Sep, Sul-ac, Staph)
blutige Absonderung aus dem Nabel bei Neugeborenen (Calc, Calc-p, Stann, Kali-c, Nat-m, Sil)
■Rektum / Stuhl
Unverdautes im Stuhl (Ars, Calc, Chin, Chin-ar, Ferr, Ferr-ar, Aeth, Mag-m, Olnd, Phos-ac, Podo, Phos, Sil, Sulph)
abwechselnd Durchfall und Rheumatismus (Kali-bi, Cimic, Dulc)
abwechselnd Durchfall und Verstopfung (Aloe, Nux-v, Lyc, Podo, Sulph, Ant-c, Chel, Op, Kali-c, Phos, Iod, Lac-d, Ptel, Puls, Tub, Zinc); hat aber mehr Durchfalltendenz
häufiger Stuhldrang mit jeweils nur geringfügigen Entleerungen
fühlt sich allgemein > nach Stuhlgang
kleine Kinder: Analprolaps nach hartem Stuhl (Podo, Mag-m, Gamb, Calc, Ant-c, Sep, Sulph, Ruta, Lyc, Nux-v); Würmer mit Juckreiz am Anus
abwechselnd Hämorrhoiden und Rheumatismus
sobald die rheumatischen Schmerzen besser werden, fangen die Hämorrhoiden an, sehr stark zu bluten
abwechselnd Hämorrhoiden und Lumbalgie (Aeth)
schlechte Folgen von Hämorrhoidenoperation oder Unterdrückung der Hämorrhoidenblutung durch irgendwelche Therapie (Nux-v, Sulph, Calc, Puls, Aloe, Apis, Ran-b)
■Frau
Amenorrhoe
unterdrückte Menstruation in jungen, tuberkularen Frauen; seit sie keine Menstruation hat, hat sie immer wieder Nasenbluten
unterdrückte Menstruation als Folge einer Lebererkrankung (Chel, Podo, Ptel)
plötzliche, brennend-stechende Schmerzen im linken Eierstock, > Kühle; man sollte an Abrot in solchen Fällen denken z. B wenn Apis versagt hat
Zuckungen in den Eierstöcken, die bis in den Rücken ausstrahlen
vgl. Zuckungen in den Eierstöcken: Psor, Cycl, Calc, Clem, Sulph, Zinc
stechende Schmerzen in der Narbe der amputierten Brust, < Berührung
■Mann
Hydrozele, angeboren oder nach Scharlach, Mumps (Puls, Sil, Graph, Sulph, Calc)
Hydrozele nach Unterdrückung von Hautausschlägen (Hell, Calc)
■Herz
Gichtmetastasen im Herzen, d. h. Gelenksymptome wurden unterdrückt und jetzt hat der Patient Herzbeschwerden (Bry, Rhus-t, Sulph, Kalm, Thuj, Benz-ac, Lith-c, Cimic, Colch, Kali-c, Kali-bi, Lach)
stechende Schmerzen durch das Herz bis zum Rücken mit Atemnot, schwachem Puls, reichlichen Schweissausbrüchen
■Atemwege
trockener Husten seit der Durchfall verschwunden ist
Wundgefühl in den Atemwegen beim Einatmen von kalter Luft
nach einer Pleuritis bleibt ein Druckgefühl auf der erkrankten Seite
vgl. Folge von Pleuritis: Kali-i, Iod, Ars, Ars-i, Nat-m, Sep, Sil, Sulph, Ant-t, Calc, Arg-n
■Bewegungsapparat
der Nacken ist so schwach, dass er den Kopf nicht halten kann
plötzliche Kreuzschmerzen mit Schwächegefühl im Kreuz, > gehen (Kali-c)
Gicht, Rheumatismus, Arthritis mit Knötchen
Schmerzen in Hand- und Fussgelenken, Schultern und Armen
juckende Frostbeulen mit Prickeln; Kälte und Taubheitsgefühl in Fingern und Zehen (Agar, Nit-ac, Petr, Thuj, Phos, Zinc, Sulph, Mur-ac, Bad)
Beine stark abgemagert
Rheumatismus abwechselnd mit Durchfall
Rheumatismus nach Unterdrückung von Durchfall
starke, stechende Schmerzen in den Muskeln ohne Schwellung; hat allgemein mehr Schmerzen in den Muskeln und weniger in den Gelenken
Wundgefühl im ganzen Körper
massive Schwäche nach Grippe, kann nicht gehen, kann die Arme, Beine oder den Kopf nicht bewegen
■Haut
Furunkulose bei kranken, abgemagerten, tuberkularen Kindern (z. B. nachdem Hep versagt hat)
■Schlaf
unruhiger Schlaf, hat viele Alpträume
schläfrig, kann aber nicht schlafen (Ambr, Op)
■Modalitäten
Verschlimmerung
–geistige Anstrengung
–bei Verstopfung (Analprolaps)
–nachts
–Kälte
–nasskalte Luft, nass werden, Nebel
–unterdrückte Absonderungen und Ausscheidungen, v. a. Durchfall
–Hämorrhoidenoperation
Besserung
–häufiger Stuhlgang, Durchfall
–Bewegung (Rücken, Rheuma)
–Kühle (Eierstock)
■Beziehungen
Vergleiche: Absin, Cham, Cina, Nux-v, Agar, Nat-m, Calc-p, Calc, Aeth, Benz-ac, Nat-s, Iod, Phos, Sanic, Hep, Acon, Bry, Sulph, Ruta, China, Led
Folgemittel: Iod, Tub, Nat-m
Abrot folgt gut auf: Acon, Bry; besonders bei Pleuritis
■Vergleiche
Abrotanum
Iodium
verliert Gewicht trotz sehr gutem Appetit
verliert Gewicht trotz sehr gutem Appetit
Abneigung gegen jegliche körperliche und geistige Arbeit
immer in Eile, will beschäftigt sein und fühlt sich > wenn er beschäftigt ist; beschäftigt sich v. a. mit der Gegenwart: »Was soll ich jetzt machen?» Wenn er nichts zu tun oder zu essen findet, kriegt er seltsame, aggressive bis mörderische Impulse; unruhig, bewegt sich ziellos, obwohl er müde ist; obschon er krank ist, realisiert er es nicht und behauptet, gesund zu sein
< Kälte
alles bei Iod ist < Wärme, Hitze und > Kälte, kaltes Waschen
Folgen von Hämorrhoidenoperation
Folgen von Schilddrüsenoperation
Heisshunger
Heisshunger oder wechselhafter Appetit
Abrotanum
Sanicula
Abmagerung von unten nach oben
bei Marasmus von kleinen Kindern indiziert; die Abmagerung findet von oben nach unten statt
liegt vorzugsweise auf etwas Hartem, obwohl er sehr dünn ist; Körper riecht nach altem Käse; Haare sind elektrisch aufgeladen
stur, Trouble-shooter, ärgerlich, clever
sehr stur, wechselhafte Stimmung, nicht sehr intelligent; Abneigung gegen Berührung und Körperkontakt
Angst beim Erwachen aus einem Traum, Angst vor Alzheimer
starke Angst vor Dunkelheit
müde, Abneigung gegen körperliche und geistige Anstrengung
sehr beweglich, geht von einem Ort zum anderen, spielt mit etwas, lässt alles in der Mitte liegen und widmet sich etwas anderem
schwitzt am Hinterkopf und Nacken, empfindlich auf kalte Luft
eher Durchfalltendenz
der Stuhl ist hart und kommt in grossen Stücken, die manuell entfernt werden müssen
> nach Durchfall
fühlt sich > nach Erbrechen
hat gerne in Milch gekochtes Brot
hat gerne kalte Milch und Salziges
Vergleich Aethusa cynapium - Abrotanum
gemeinsame Symptome
–Assimilationsstörungen; Unverdautes im Stuhl
–Nackenschwäche
–Depression bei Kindern
–abwechselnd Hämorrhoiden und Lumbalgie
Differenzierung
–Aethusa ist eher verwirrt, kann nicht denken, dümmlich
–Abrotanum ist gereizt, ärgerlich, grausam, clever, manipulativ
Absinthium
Wermuth
■Miasmen
psorisch, syphilitisch
■Indikationen
Epilepsie, Grand-mal- oder Petit-mal-Anfälle
Pilzvergiftung
zerebrale Reizung, hysterische Spasmen bei Kindern
Schlaflosigkeit
■Charakteristika
nützlich bei epileptischen Kindern
typisch ist eine erhöhte zerebrale Erregbarkeit mit Absenzen und Schlaflosigkeit
Zittern ist ein wichtiges Leitsymptom; besonders indiziert bei partiellen Epilepsieformen, wenn der Patient das Bewusstein nicht oder nur teilweise verliert
■Gemüt
egozentrische Kinder, die keine Liebe zu einem Menschen empfinden oder sich auch an keine Person gebunden fühlen (Sulph)
nervöse, erregte, schlaflose Kinder mit Wutanfällen
Grausamkeit
Kleptomanie
Delirium mit Halluzinationen, Bewusstseinsverlust, Verwirrung
Gedächtnisverlust, vergisst kurz Zurückliegendes; vollständiger Gedächtnisverlust nach Epilepsieanfall
Weinen während Epilepsieanfall
■Kopf
Schwindel bei Epileptikern, < beim Aufstehen
Tendenz, nach hinten zu fallen (Caust, Rhus-t, Phos-ac, Oena, Bov, Sil, Spong)
Epilepsie
–vor dem Anfall: nervöses Zittern, verwirrt, Schwindel mit Tendenz, nach hinten zu fallen, eiskalte Füsse, verzerrtes Gesicht, mit Tics
–während dem Anfall: blutiger Schaum im Mund, spastische Zuckungen, Kiefersperre, Zähneknirschen, Zungenbiss, zittrige Zunge, Opisthotonus, Weinen
–nach dem Anfall: teilweise Bewusstlosigkeit, tiefer Schlaf, Gedächtnisverlust
■Harnwege
andauernder Harndrang
der Harn ist dunkelorange und riecht wie Pferde-Urin
vgl. Nit-ac: Urin riecht wie Pferdeurin
■Modalitäten
Verschlimmerung
–beim Aufstehen (alle Symptome)
■Beziehungen
Vergleiche: Art-v, Cic, Hyos, Stram, Bell, Op, Benz-ac, Nit-ac
Aceticum acidum
Essigsäure
■Miasmen
tuberkular, syphilitisch
■Indikationen
anämische, blasse Kinder oder alte Menschen
Beschwerden infolge von Drogen- und Alkoholabusus
diese Arznei zeigt wunderbare Resultate bei Patienten, die ihre Kraft und ihr Gedächtnis nach wiederholten Operationen verloren haben
neurologische Störungen nach Narkose
Magenkrebs, Magengeschwüre
Diabetes insipidus, Wassersucht
Diarrhoe, Lebensmittelvergiftung (besonders durch Wurstwaren)
Blutungen, Anämie, Schwäche
Lungentuberkulose
Marasmus von Kindern, v. a. des Gesichts, der Hände und Oberschenkel
Auslösende Faktoren
–Narkose, chirurgischer Schock und Anästhesie (Magen-Darmbeschwerden, Gedächtnisverlust, Entkräftung, neurologische Störungen, Reizhusten)
–Drogen und Alkohol
–Lebensmittelvergiftung, Wurstwaren, Kaffee
–Verletzungen
■Charakteristika
alle Beschwerden werden von unstillbarem Durst und Schwäche begleitet
■Aussehen
Gesicht blass, mager, wachsartig; schlaffe, hängende Muskeln
Abmagerung, vor allem von Gesicht, Händen und Oberschenkeln
schwacher, ausgelaugter Patient
■Gemüt
Verlust des Kurzzeitgedächtnisses
Sorgen um das Geschäft, Reizbarkeit
spricht ständig über seine Krankheit und macht sich Sorgen um die Familie, das Geld und die Zukunft
wenn seine Frau gewisse Dinge für sich behalten möchte, so beharrt er darauf, dass sie ihm diese mitteilt; dann brütet er darüber und macht sich unablässig Sorgen
■Magen / Abdomen
grosser, brennender, unstillbarer Durst (bei Fieber kein Durst)
Abneigung gegen Salziges
kann ausser Kartoffeln kein Gemüse verdauen
vgl. umgekehrt: Alum, Gran
kann Brot und Butter nicht verdauen
erträgt kein kaltes Wasser
stärkste Übelkeit mit Erbrechen; brennende Schmerzen im Magen mit eiskaltem Schweiss auf der Stirn; erbricht alle Getränke und Speisen
Übelkeit, starker Speichelfluss; übelriechendes Aufstossen oder heisses Aufstossen; erbricht jede Nahrung
vgl. heisses Aufstossen: Ars, Caust, Cop, Naja, Phos, Puls, Sulph
brennende Schmerzen in Magen und Brust, mit starken Blähungen; danach kalte Haut und kalter Schweiss auf der Stirn
saures Aufstossen und Erbrechen während der Schwangerschaft (Lac-ac)
Aszites
aufgetriebener Bauch
Gefühl, als ob der Bauch gesunken und nach innen gezogen wäre, < auf dem Rücken liegen, > auf dem Bauch liegen
■Rektum / Stuhl
Verstopfung mit grossem Durst
massive, stinkende Durchfälle, die zu Dehydratation und ödematösen Schwellungen der Beine führen
chronische Diarrhoe bei Kindern, mit starker Abmagerung
grosser Durst bei Durchfall
■Harnwege
Diabetes insipidus; grosse Mengen blassen Urins, mit extremer Müdigkeit und unstillbarem Durst
■Frau
starke Menstruationsblutung
Magenübersäuerung und saures Aufstossen während der Schwangerschaft
hellrote Blutungen nach Geburt
stillende Mütter: Brüste schmerzen, sind geschwollen, haben zu viel Milch; Milch ist dünn und sauer; Anämie bei stillenden Frauen
■Atemwege
ständiger Reizhusten nach Narkose, v. a. beim Einatmen
■Bewegungsapparat
Beinödeme, auch infolge von Leberproblemen oder Magenkarzinom
Rückenschmerzen > auf dem Bauch liegen
■Schlaf
starker Nachtschweiss; friert danach
kann auf dem Rücken nicht schlafen; schläft auf dem Bauch
■Modalitäten
Verschlimmerung
–auf dem Rücken liegen (Schlaflosigkeit, Bauchsymptome)
–nachts
–nach dem Essen (Magen)
–Gemüse (ausser Kartoffeln), Brot, Butter (Verdauung)
–kaltes Wasser (Magen)
–auf dem Rücken liegen (Bauchsymptome)
Besserung
–auf dem Bauch liegen (Schlaf, Rücken, Bauchsymptome)
–Ruhe
–tagsüber
■Beziehungen
Vergleiche: Apis, Ars, Carb-ac, Lac-d, Lac-ac, Ign, Op, Sep, Stram, Ran-b, Asar, Chin, Uran-n
gut geeignet als Folgemittel nach: Chin, Dig
Antidote: Nux, Tab
Antidot von: Acon, Asar
antidotiert zudem: Kaffee- und Wurstvergiftungen
■Vergleiche
Uranium nitricum
–indiziert bei Diabetes, Niereninsuffizienz, Hypertonie, Leberbeschwerden
–Abmagerung, Schwäche, Wasserretention, Aszites
–unstillbarer Durst
–Heisshunger
–starke Blähungen
Aconitum napellus
Echter Sturmhut – Blauer Eisenhut
Vorwiegend ein Akutmittel (ein sogenanntes 24-Stunden-Mittel); zu vergleichen mit einem «Wirbelsturm»: sehr rascher Verlauf, heftige Symptome.
■Miasmen
psorisch, tuberkular
■Indikationen
Frühstadien von Atemwegsinfekten, Grippe, Bronchitis, Pneumonie, Otitis, Halsweh, Tonsillitis, Husten, Entzündungen und fieberhaften Zustände
plötzliches Fieber nach Impfung, Fieber während dem Zahnen
Meningitis, Enzephalitis
Pleuritis
Konjunktivitis, Schneeblindheit
Zahnschmerzen
Harnwegsinfekte, Harnverhalten, Nierenkoliken, Harnblasenentzündung
Hitzschlag, Sonnenstich
Blutungen
Apoplex, Gesichtslähmung
Hexenschuss, Neuralgien
Angina pectoris, hypertone Krise
Mittel erster Wahl bei Herzinfarkt (C30 bis C200); es nimmt die Angst und den Schock, die akuten Herzbeschwerden werden besser
Verbrennungen 3. Grades, Erfrierungen
Schockzustand nach Unfall, Verletzung
Ertrinken
Tierbiss
Schleudertrauma
Lampenfieber, Angst vor Operation
Auslösende Faktoren
–kalter, trockener Wind, Kälte, Kälte nach Schwitzen, Durchzug
–Sonne: Hitzschlag, Sonnenstich
–Angst, Schreck (Ars, Bry, Arn, Caust, Gels; Op bei eher chronischen Folgen von Angst)
–Schock, z. B. wenn er Zeuge eines Unfalls gewesen ist
–Ärger
–Kummer
–Zahnung
–Operation
–unterdrückter Schweiss (durch plötzliche Abkühlung, wenn man verschwitzt ist)
■Charakteristika
Angst, Schock und Schreck; Unruhe mit Todesangst
Durst auf Kaltes
Überempfindlichkeit der Sinne (Geruch, Lärm, Musik, Berührung, Sicht)
akut, heftig, stark schmerzempfindlich; Schmerzen kommen plötzlich, brennend, oft mit Taubheitsgefühl
vgl. Schmerzcharakter:
Acon: brennende Schmerzen, oft mit Taubheitsgefühl
Bell: Schmerzen kommen und gehen plötzlich, sind nicht andauernd, oder pulsierende Schmerzen, z. B. bei Furunkel
Puls: Schmerzen kommen schnell und verschwinden langsam
hohes Fieber innerhalb kurzer Zeit
alle akuten Zustände sind gekennzeichnet von ausgeprägter Rötung, Kongestion und Hitze, wobei jedoch die Haut trocken bleibt; sobald Schweiss auftritt, ist Acon nicht mehr indiziert; Ausnahme: bei Schockzuständen oder bei Herzbeschwerden (Angina pectoris-Anfall oder Herzinfarkt) kann Acon sehr stark schwitzen
vgl. Bell: schwitzt, klebriger Schweiss
Rötung sämtlicher Körperöffnungen
■Gemüt
Angst, Schock und Schreck sind die wichtigsten Merkmale von Acon, ohne die dieses Mittel nicht in Frage kommt. Die Angst ist mit starker Unruhe und Besorgnis gepaart. Häufig entsteht eine Art Teufelskreis: Ein Angina-pectoris-Anfall führt zu Angst, die wiederum die Angina pectoris verstärkt
ruhelos, schreckhaft; psychische Unruhe führt zu körperlicher Unruhe
unerträgliche Schmerzen führen zu Verzweiflung, Weinen, Schreien. Der Kranke wirft sich im Bett hin und her, reagiert überempfindlich und übertreibt sein Leiden; sagt bald einmal „ich kann diese Schmerzen nicht ertragen, ich sterbe“
Acon ist ein Anti-Schock- und Anti-Angstmittel; bei Kindern kann z. B. Angst auslösend sein, wenn sie von den Eltern geschlagen oder in den Keller gesperrt werden
der Patient hat grosse Angst vor dem Alleinsein und will Gesellschaft; das Kind klammert sich an die Mutter und beruhigt sich, wenn sie es in den Arm nimmt
vgl. Cham: > in den Arm nehmen, aber ganz ruhig wird das Kind nicht
abwechslungsweises Verlangen, allein oder in Gesellschaft zu sein; aber allgemein > in Gesellschaft
eine weitere vorherrschende Angst ist die Todesangst
vgl. Todesangst: Calc, Ars, Apis, Arg-n, Bry, Cact, Cund, Caust, Cimic, Cocc, Coff, Cycl, Dig, Ferr-p, Fl-ac, Gels, Ign, Kali-c, Kali-i, Lac-c, Lyc, Med, Mosch, Nat-m, Lach, Nux-v, Op, Phos-ac, Phos, Plat, Psor, Puls, Rhus-t, Sec, Stram, Verat
redet vom Tod; sagt die Todesstunde voraus (Ars, Arg-n); ist überzeugt, sterben zu müssen, < wenn alleine. Panik und Angst vor einer Operation, wird sehr unruhig, ist überzeugt, bei der Operation sterben zu müssen
vgl. Todesangst wenn alleine: Kali-c, Ars, Phos, Arg-n, Bell
Todesangst während der Schwangerschaft
Angst während der Entbindung, das Kind sei gestorben
Angst vor Vergiftungen, der Zukunft, Menschenansammlungen, Dunkelheit, dem Überqueren einer Strasse, Gespenstern
finanzielle Ängste, Klaustrophobie
Lampenfieber, Prüfungsangst, Angst vor Wettkampf, mit grosser Unruhe
vgl. Lampenfieber:
Arg-n: zittrig, fühlen sich sehr schwach; haben plötzlich totale Black-outs, als ob sie den Prüfungsstoff noch nie gelesen hätten; Kopfweh mit dem Gefühl einer Vergrösserung des Kopfes, > fester Druck, > Kühle, > nach erbrochener Galle; ständig Durchfall, Urinieren, sitzen immer auf dem WC; plötzliches lautes Aufstossen; Durst auf (eis-)kalte Getränke
Gels: kein Durst; resigniert, apathisch, zurückgezogen, wollen nicht reden, wollen allein sein; überzeugt, es ohnehin nicht zu schaffen; jeder Versuch, sich zu konzentrieren, endet zwei Minuten später mit Einschlafen; zittrig, schlaflos vor Aufregung; Kopfweh, vom Nacken nach oben steigend bis zu den Augen, mit Ptose der Lider; Nacken ganz steif – versuchen immer wieder, ihren Nacken zu lockern; auch ständig auf dem WC; Schüttelfrost, Herzklopfen; oft Halsweh mit Heiserkeit
Ign: hysterische Nervosität oder Apathie; bei Störung reagieren sie jedenfalls sehr gereizt; Globusgefühl, > tief atmen; Gefühl von Leere im Magen, das auch nach dem Essen nicht vergeht; Kopfweh, als ob man mit einer langen Nadel von der einen (rechten) Schläfe zur andern stechen würde; nervöses Asthma, Heiserkeit, Halsweh vor Prüfungen
Lyc: sind äusserlich ruhig bzw. noch steifer, noch verkrampfter; haben Angst, zu versagen, nicht genug getan zu haben; während der Prüfung entspannen sie sich; bei Prüfungsangst alle möglichen Beschwerden: Fieber, Rückenschmerzen, Hexenschuss usw.
alle Sinne sind überempfindlich:
–Musik unerträglich, macht sie traurig
vgl. < Musik: Cham, Graph, Ambr, Sabin, Nux-v, Dig, Nat-p, Nat-c
vgl. Nat-m: < bei Kopfweh, > bei Trauer
vgl. Nat-s: < v. a. fröhliche Musik
vgl. Sep: v. a. unter Stress, Müdigkeit
vgl. Kreos: v. a. bei Schwangeren
–Reden, Lärm unerträglich (Bell, Ambr)
–Schmerzüberempfindlichkeit: dadurch sehr unruhig und die Symptome übertreibend
–Gehör-, Geruchs-, Berührungsüberempfindlichkeit
■Kopf
Schwindel
nach Aufenthalt in der Sonne oder in trockenem, kaltem Wind
beim Aufstehen aus dem Bett oder von einem Stuhl (Bry, Ferr, Nat-m, Phos, Rhus-t, Tab, Dig, Puls, Petr, Lyss, Ham, Glon, Chin)
beim Bücken oder Kopfschütteln
mit Tendenz, nach rechts zu fallen (bei Hypertonie)
mit Nasenbluten und verschwommener Sicht (bei Hypertonie, Apoplex)
Schwindel führt zu Ohnmacht und Übelkeit
Tendenz zur Ohnmacht beim Aufstehen oder Stehen; Apoplex-Symptome
Schwindel < Versuch aufzustehen oder den Kopf zu heben, Liegen auf der linken Seite, warmes Zimmer, > kühles Zimmer (und Fenster öffnen)
Kopfschmerzen
Kongestion im Kopf; Rötung des Kopfes, der Lippen, Augen und Ohren
starke Kopfschmerzen während Fieber; Kopf ist schwer, heiss, berstend
kongestive, pulsierende Kopfschmerzen
brennende Kopfschmerzen; Gefühl, als ob kochendes Wasser im Kopf sei
Kopfschmerzen, < Bewegung, Reden, aus dem Sitzen oder Liegen aufstehen, > im Freien
Hitzschlag, Sonnenstich
Hitzschlag mit brennenden, pulsierenden Kopfschmerzen und rotem, heissem Kopf. Gesichtshaut und Mund sind trocken. Starker Durst auf kaltes Wasser
■Augen
Auslösende Faktoren
–kalter Wind und Luftzug
–Fremdkörper im Auge
–zu viel Sonne; Skifahren ohne Sonnenbrille führt zu Schneeblindheit
–Masern, Scharlach
Indikationen
–Fremdkörper im Auge, z. B. durch Fahrradfahren; brennende Schmerzen, muss vom Fahrrad absteigen; Angst zu erblinden; > kalte Hand aufs Auge legen
–Blepharitis mit Trockenheits-, Hitze- und Fremdkörpergefühl in den Augen, z. B. in Verbindung mit Scharlach oder Masern
–Entropium mit akuter Verschlimmerung nach zu starker Sonnenexposition
–Glaukom
Symptome
–Rötung; grosse oder gerötete Augen
–Brennen wie Feuer oder Jucken und Brennen gleichzeitig
–Fremdkörpergefühl, Wundgefühl, Gefühl von Trockenheit und Hitze
–Berührungsempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit
–Gefühl, als ob das Auge nach vorne herausquellen würde
–Trockenheit im Auge oder nur wenig Tränenfluss
vgl. starker Tränenfluss: All-c, Euphr
–Ausfluss ist wässrig; sobald er schleimig wird, kommen andere Mittel in Frage (Puls, Kali-bi usw.)
–jammern, weinen, übertreiben; sind überzeugt zu erblinden
Modalitäten
< kalter Wind, Helligkeit, Licht, nachts, warmes Zimmer, Lesen, Bewegung, Tabak
> Kälte, kalte Hände, Halten der eigenen, kalten Hände auf das betroffene Auge
■Ohren
akute Otitis media als Folge von kaltem Wind, > kalte Hand am Ohr
rote Ohren
vgl. Bell: sehr berührungsempfindlich, erträgt keine Berührung am Ohr
sehr geräuschempfindlich, Musik ist unerträglich
folgt nach der Akutphase gelb-grünlicher Ausfluss, ist Puls häufig das Komplementmittel
■Gesicht
besorgter, ängstlicher Gesichtsausdruck
Lippen und Augen rot; ganzer Kopf rot und heiss oder alternierend blass und rot (Ferr, Lac-c, Bor, Chin, Glon, Ign, Mur-ac, Puls, Nat-c, Nat-p, Kali-c, Rhus-t, Zinc)
erbleichen beim Aufsitzen im Bett oder werden gelb; oder eine Wange rot, die andere blass (Cham, Ip, Cina, Caps, Lach, Mosch, Nux-v, Sulph, Rheum, Acet-ac)
vgl. Mosch: eine Wange blass und heiss, die andere rot und kalt
Gesichtsneuralgien vor allem links, sehr schmerzhaft (Brennen, Pulsieren, Jucken); einseitiges Taubheitsgefühl
Fazialisparese von kaltem Wind
■Mund
alles schmeckt bitter, ausser Wasser; bitterer Geschmack im Mund
unstillbarer Durst
Zunge dick weiss oder gelb belegt; taube, gelähmte Zunge
Zahnschmerzen durch trockene, kalte Luft, < im Freien
pochende, schiessende Zahnschmerzen; die Wange auf der betroffenen Seite ist geschwollen, rot und heiss
Zahnungsmittel, wenn die entsprechenden Begleitsymptome vorhanden sind
vgl. Zahnung:
Acon: meist verstopft; evtl. auch Durchfall; eine Wange rot, eine blass
Cham: Durchfall (als Ausschlusskriterium), ebenfalls eine Wange rot, die andere blass
■Hals
akute Angina innerhalb von Stunden z. B. nach Aufenthalt in kaltem, trockenem Wind
sehr rot, brennend, trocken; Verengungsgefühl
Mandeln sehen wie Pergament aus
kann nichts schlucken, sogar Reden ist schmerzhaft
■Magen / Abdomen
Gastritis durch Angst, Ärger
Gastritis nach eiskalten Getränken, wenn der Körper überhitzt ist (Kali-c, Nat-c, Coloc, Bry, Phos, Verat)
Erbrechen mit Todesangst; Erbrochenes ist gallig, schleimig, evtl. blutig
viel Durst auf kalte Getränke, trinkt häufig, in grossen Mengen, alle 10 Minuten ein Glas
vgl. Durst auf kalte Getränke:
Bry: trinkt seltener, grosse Mengen, alle 2 bis 3 Stunden ein Glas
Ars: trinkt häufig, kleine Mengen; alle 5 Minuten ein Schlückchen, nur um die Lippen zu befeuchten
kalte Getränke tun gut
vgl. Ars: wegen der stark brennenden Schmerzen verlangt Ars kalte Getränke, aber kalte Getränke führen zu Schüttelfrost (trotz des Fiebers) und verschlimmern u.a. die Magensymptome, daher mag Ars eher warme Getränke
Verlangen nach Bier
Bauchkolik mit brennenden, heftigen Schmerzen und Wundgefühl; berührungsempfindlicher Bauch; krampfartige Schmerzen, > nach vorne beugen, Windabgang
Hepatitis, besonders im Sommer als Folge von Hitzschlag. Stechende, brennende Schmerzen, Völlegefühl im Bauch, Durchfall < nach dem Essen, bitterer Geschmack im Mund. Grosse Unruhe und Hoffnungslosigkeit
■Rektum / Stuhl
bei Kindern wässriger Durchfall an heissen Sommertagen; das Kind ist unruhig, klagt viel, ist schlaflos
■Harnwege
Harnretention bei Angst, Schreck, Schock oder Beschimpfung, nach zu langem Aufenthalt in der Sonne. Hält sich die Genitalien mit den Händen. Schreit, sagt «Ich komme nicht durch», «Ich sterbe»
vgl. Staph: Harnretention infolge Katheterisierung, trockener Kälte oder Bad in kaltem Wasser (akute Zystitis)
vgl. Dulc: infolge Feuchtigkeit, Sonne (Dehydratation, Urinretention), keine Todesangst
Kreislaufschock, akutes Nierenversagen, Blutdruckabfall mit Anurie
Zystitis
–akute Zystitis nach Angst, zu viel Sonne, Kälte, kaltem Wind oder Schock
–zu Beginn der Miktion Schüttelfrost, > wenn Urin fliesst
–zu Beginn der Miktion Schüttelfrost, > wenn Urin fliesst
–starke, brennende Schmerzen während des Wasserlösens; Urin spärlich, evtl. blutig
vgl. Apis: Brennen und Stechen, schlimmer am Ende der Miktion (letzte Harntropfen besonders schmerzhaft)
vgl. Cantharis: Schmerzen vor, während und nach der Miktion
vgl. Staph: Schmerzen nach und zwischen den Miktionen
–grosser Durst auf kalte Getränke
–meist von Fieber begleitet
■Frau
Menstruation
–Amenorrhoe durch Schock, Kälte
–Menstruationsblut koaguliert sehr schnell
–Hitzegefühl in der Vagina während der Menses
Schwangerschaft / Entbindung
–drohender Abort durch Schock, Angst; mit hellroter Blutung
–





























