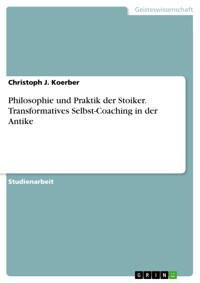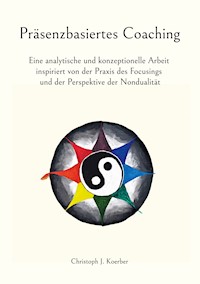
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nachdem der Autor ein Coaching- und Menschenverständnis darlegt, in dem die Präsenz des Begleitenden als zentraler Wirkfaktor bezeichnet werden kann, arbeitet er umfassend ihre tiefgreifende Bedeutung für menschliche Entfaltungsprozesse heraus. Dafür zieht er die Coaching- und Psychotherapieforschung zu Rate, Werke von Philosophen, Erkenntnisse der Neurowissenschaften sowie die Praxis des Focusings und die Perspektive der Nondualität. Seine Analyse kulminiert in der Integration von erlebensnaher Reflexion (z.B. Focusing) und nondualem Gewahrsein. Dieses Zusammenspiel helfe dem Klienten dabei, sich selbst im Ziehen und Zerren seines Lebens verstehen und akzeptieren zu lernen und damit seine Entwicklung zu ermöglichen. Von diesen Ergebnissen ausgehend konzipiert der Autor eine Weise des Miteinanders, die Präsenz in den ihr gebührenden Mittelpunkt des Coachings stellt, macht Vorschläge für ein präsenzkultivierendes Training sowie für eine neue Form von Coaching-Techniken - den Intraventionen. "Damit hat der Autor eine exzellente Bachelorarbeit vorgelegt, die von ihrer Tiefe eher an eine Dissertation erinnert." - aus dem Gutachten von Prof. Dr. Sven Sohr
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christel Utters gewidmet, deren Präsenz ich als so heilsam erfahren habe.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Danksagungen
Einleitung
Analyse
2.1. Coaching
2.1.1. Definition
2.1.2. Genese
2.1.3. Differenzierung
2.1.4. Verständnis
2.2. Präsenz
2.2.1. Herkunft
2.2.2. Stand von Coaching-Forschung und -Praxis
2.2.3. Forschung in der Psychotherapie
2.2.4. Sicht der Neurowissenschaften
2.2.5. Forschung zum Focusing
2.2.6. Praxis des Focusing
2.2.7. Perspektive der Nondualität
2.2.8. Focusing und Nondualität
2.2.9. Reflexion und Präsenz
Konzeption
3.1. Theorie
3.1.1. Präsenz als Basis
3.1.2. Präsenz als Ziel und Weg
3.2. Praxis
3.2.1. Kultivierung von Präsenz
3.2.2. Rahmen für Präsenz
3.2.3. Intraventionen
3.2.4. Interventionen
Diskussion
Nachwort
Anhang
A. Übungen für die Kultivierung von Präsenz
Kategorie: Kopf
Kategorie: Herz
Kategorie: Bauch
Kategorie: Gewahrsein
B. Liste von Intraventionen
Kategorie: Ausrichten
Kategorie: Halten
Kategorie: Durchdringen
C. Interventionen
Kategorie: Erkenntnis
Kategorie: Transformation
Kategorie: Stabilisierung
D. Liste Erlebensorientierter Fragen
E. Übung zur Entwicklung einer Absichtserklärung
F. Übersetzte Zitate in Originalsprache
Literatur
Vorwort
Das vorliegende Werk von Christoph J. Koerber basiert auf einer Bachelorarbeit im Studium „Life Coaching", das ich als Professor für Life Coaching und Positive Psychologie an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport anno 2022 begleiten durfte.
„Präsenz" ‒ was ist das? Der Autor, welcher der Idee des präsenzbasierten Coachings auf einer spannenden philosophischen Reise u.a. über den Taoismus zur existenziellen und humanistischen Psychologie sehr tiefgreifend und umfassend auf den Grund geht, bringt die Präsenz einfach auf den Punkt: „Ganz da sein". Angesichts der zunehmenden Zerstreutheit des hybriden Menschen im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung brilliert diese Antwort als Haltung durch ihre provokante und revolutionäre Kraft.
Doch der Autor bleibt bei den Analysen nicht stehen ‒ er geht noch weiter, indem er auf Grundlage des Focusing-Ansatzes ein präsenzorientiertes Miteinander konzipiert. Dieses denkt die Präsenz als Basis, Weg und Ziel und lädt mit dem Angebot zahlreicher Intra- und Interventionen zur Verkörperung und Kultivierung in der Praxis ein. Am Ende werden wir angehalten und inspiriert, „als fühlendes Wesen präsent zu sein", um uns „zu einem authentischen, bewussten und liebevollen Menschen zu entwickeln".
Auf besonderer Art und Weise vereint Christoph J. Koerber Theorie und Praxis in seiner Persönlichkeit. Seine geistige Größe offenbarte sich schon früh im Studium durch viele herausragende Arbeiten, u.a. über Carl Rogers, die Stille oder den Stoizismus (mit einer lateinischen Literaturliste), während seine Praxis durch Meditation und kraftvolle Präsenz geprägt ist.
In dem Geiste springt auch der Funke über, um wider den Zeitgeist für alternative Wege zu werben. Ein erfülltes Leben und Freude beim Lesen!
Prof. Dr. Sven Sohr Berlin, August 2022
Danksagungen
Ich bin dankbar dafür, dass meine Frau Salomé während der Entstehung der vorliegenden Arbeit so präsent mir mir war und mich mit all ihrer Liebe, Klarheit und Feinfühligkeit unterstützt, ermutigt und begleitet hat.
Ich bin dankbar dafür, dass Prof. Dr. Sven Sohr für mich während meiner gesamten Studienzeit stets offen, tatkräftig und mutgebend da war und mir Möglichkeiten aufgezeigt hat, die ich sonst nicht wahr genommen hätte. Ich bin dankbar dafür, dass Arno Katz mir und diesem Projekt so offen und hilfsbereit begegnet ist. Ohne diese beiden Männer hätte ich das Projekt nicht als Buch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Danke, dass ihr an mich an dieser Stelle geglaubt habt.
Ich bin dankbar dafür, dass meine Mama und mein Papa mich stets auf ihre Weise lieben und mich bei meinen Vorhaben mit ihren Stärken und Kenntnissen unterstützen.
Ich bin dankbar dafür, dass mir Annett Gantke zu einer Zeit, in der ich nicht wusste, wohin mit mir, einen Platz in ihrer Familie geschenkt und mich so warm wie ihr eigenes Kind willkommen geheißen hat.
Ich bin dankbar dafür, dass Christel Utters mit mir stets auf eine Weise präsent war, die jenseits aller Vorstellungen und Beschreibungen ist, und mich so lieb hatte, dass sie mich hinaus in mein eigenes Leben schickte.
Christoph J. Koerber Bad Salzdetfurth, November 2022
I. Einleitung
In unserer heutigen Arbeits- und Alltagswelt finden vor allem durchdachte Ideen, sichtbare Taten und starke Stories Beachtung. Damit einhergehend verstärkt sich die urmenschliche Tendenz, nur auf den äußeren Schein zu achten und vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Doch in der überaus komplexen und stets wandelnden Realität unserer Gesellschaft polarisieren Ansichten, die ein vereinfachtes und eindeutiges Bild einer Situation suggerieren, vor allem wenn sie mit einer oberflächlichen Gewissheit vorgebracht werden (Stelter, 2009). Um inmitten einer solchen "hyperkomplexen" Welt gesund leben zu können, braucht der Mensch Räume, in denen er offen seine widersprüchlichen Meinungen, irrationalen Ängsten und kommunikativen Schwierigkeiten thematisieren kann. In solchen Räumen für reflexive Selbsterforschung kann er sich auch existenziell tiefen Fragen widmen ‒ wie den aktuell sehr herausfordernden Themen der Identität, Einsamkeit, Ungewissheit und Sinnlosigkeit (Spinelli, 2010). Coaching kann als eine Antwort auf diesen Bedarf verstanden werden (Stelter, 2014; 2009).
Doch um das bieten zu können, darf sich ein Coach1 nicht hinter seiner Rolle verstecken und nur mittels seiner Techniken und Fähigkeiten wirken. Solch ein Angebot verlangt vom Coach letzten Endes, seine Zertifikate und Prozeduren beiseite legen zu können und einfach nur als Mensch mit einem anderen Menschen präsent zu sein‒ transparent, mitfühlend und wertschätzend (Stelter, 2014; Gendlin, 1990; Rogers, 1981). Als Mensch geht der Coach nämlich ebenfalls einen Weg, auf dem er sich existenziellen Problemen stellen muss, sich im optimalen Fall persönlich entwickelt und ganzheitlich reift. Erst indem der Coach selbst lernt, diesen Weg zu gehen, hat er das Recht verdient, seine Klienten durch das gleiche Gebiet zu begleiten (vgl. Silsbee, 2008). Wie ich im Verlauf der Arbeit argumentiere, ist die echte und ganze menschliche Präsenz einer der wichtigsten Faktoren, der das Gehen solch eines unbegreiflichen Weges in unserer heutigen Zeit möglich macht.
Auf meinem eigenen Weg begleitet mich seit über fünf Jahren eine tägliche Meditations-praxis (Taft, 2021; McLeod, 2016; 2013; Fenner, 2015; 2007) gepaart mit einem Interesse an Persönlichkeitsentwicklung, das zeitweise die Ausmaße eines Vollzeit-Jobs annimmt. Seit mehreren Jahren ergänze ich mein tägliches Methodenrepertoire mit den Körperübungen des Hatha Yogas (Bernard, 1968) und der selbstreflexiven Praxis des Focusings (Gendlin, 1981). Indem ich während dieser Praktiken alles, was in meiner Wahrnehmung auf kognitiver, emotionaler, körperlicher und spiritueller Ebene auftaucht, willkommen heiße und ihm einen Platz gebe, habe ich geübt, präsent zu sein. Vor diesem Hintergrund ist in mir eine Affinität zu wahrnehmungsorientierten und integrativ-ganzheitlichen Ansätzen des Begleiten von Menschen entstanden.
Das erste konkrete Forschungsinteresse für diese Arbeit fand ihren Ursprung in der Zeit, als ich neun Monate lang bei Christel Utters, einer Begleiterin für innere wie äußere Entwicklungsprozesse, verbracht habe (Utters & Simonis, 2022). Von ihr ließ ich mich ganzheitlich auf meinem menschlichen Entwicklungsweg begleiten. Mit ihr habe ich den Wert der Präsenz während Begegnungen neu schätzen gelernt. Für mich vereint Christel zwei scheinbare Polaritäten und gerade das hat mich zur vorliegende Arbeit inspiriert: Auf der einen Seite Meditation und das Erforschen der eigenen Innenwelt, auf der anderen Seite Effektivität und gemeinschaftliches Handeln ‒ Stille und Aktivität.
Zeitgleich hat sich mir die Frage gestellt, wie im Coaching nachhaltige und echte Entwicklungen gefördert werden. Ich habe nämlich bei Freunden, Bekannten und mir selber häufig beobachten können, dass nur das Durchdenken und Durchsprechen der eigenen Probleme trotz bester Absichten selten nachhaltige und verkörperte Veränderungen bewirken. Passend dazu fand ich immer mehr Bestätigung in der neurowissenschaftlich informierten Coaching-Forschung, dass es einer Integration des Unbewussten benötigt, damit sich unser Erleben und Verhalten verändern kann (Ryba, 2019; Siegel, 2018). Es müssen daher zusätzlich die Prozesse Aufmerksamkeit bekommen, die sich unbewusst im Körper und vor allem in der Brust- und Bauchgegend abspielen (Ryba, 2019; Gendlin, 2016). Mein Training einer ganzheitlichen Präsenz schien wie dafür gemacht.
Ziel dieser Arbeit ist es nun, den Begriff der Präsenz aus mehreren Perspektiven zu betrachten und die Bedeutung der Präsenz für Entwicklungsprozesse herauszuarbeiten. Dafür werde ich im Laufe der Arbeit Theorie und Forschung von Coaching (2.1.; 2.2.2.) und verwandten Disziplinen (2.2.1.; 2.2.3.; 2.2.4.; 2.2.5.) wie auch die Erfahrung der Präsenz (2.2.6.; 2.2.7.) analysieren und Präsenz in die reflexive Arbeit des Coachings integrieren (2.2.8.; 2.2.9.). Im Anschluss konzeptualisiere ich einen Coaching-Ansatz bestehend aus Theorie (3.1.) und Praxis (3.2.), der auf dem Fundament jener Analyse und Integration aufbaut.
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
2. Analyse
In diesem ersten Teil der Arbeit werden die beiden zentralen Begriffe Coaching und Präsenz (2.2) erläutert. Dafür wird der Leser durch deren jeweiligen Herkunftsgeschichte und in deren mitunter leisen wie unscheinbar-tiefen Wurzeln und Bedeutungen hinein geführt.
2.1. Coaching
Dieser Abschnitt unterteilt sich einerseits in drei allgemeine Ausführungen zum Coaching hinsichtlich seiner Definition, Genese (2.1.2.) und Differenzierung (2.1.3); und andererseits in eine spezifische Ausführung zum hier vertretenden humanistischen Coaching- und Menschenverständnisses (2.1.4).
2.1.1 .Definition
Wie so viele Texte zu Coaching beginnt auch dieser mit dem Thema der Definition. Dabei steht nicht nur das wissenschaftliche Interesse dahinter, sondern auch die grundlegende Frage der Identität des Coaches. Diese kennen die Frage nämlich nur zu gut 'Was denn Coaching eigentlich sei?' Bemüht, eine möglichst interessenweckende Beschreibung ihrer Tätigkeit zu formulieren und nachvollziehbar zu erklären, wie sie sich von ähnlichen Anbietern unterscheiden, hat jeder seine eigene Weise, Coaching zu definieren (Greif et al., 2018b). In ihrer Einleitung zu dem "Complete Handbook of Coaching" kritisieren Cox, Bachkirova und Clutterbuck (2010) die üblichen Definitionen von Coaching dahingehend, dass diese zwar das weite Feld beschreiben würden, es allerdings nicht wirklich von anderen helfenden Berufen abgrenzen könnten. Selber bieten sie für ihr Buch folgende Arbeitsdefinition an, in der sie abstrakt und doch präzise Coaching einen Rahmen geben und beschreiben, was es in jedem Fall mit sich bringen sollte:
"Coaching kann als ein Prozess der menschlichen Entwicklung betrachtet werden, der eine strukturierte, zielgerichtete Interaktion und den Einsatz passender Strategien, Instrumente und Techniken zur Förderung wünschenswerter und nachhaltiger Veränderungen zum Nutzen des Coachees und potenziell auch anderer Beteiligter umfasst" (Cox et al., 2010, S. 1, Übs. d. A.).
Dementsprechend ist Coaching kein haltloses Plaudern, sondern eine strukturierende und orientierende Interaktion für den besagten Prozess. Als Prozessexperte findet der Coach die passenden Mittel, um jenen zu begleiten, muss aber nicht Fachexperte für die spezifische Situation sein (siehe auch 2.1.4.).
Ähnlich wie in einer Psychotherapie können Klienten ihre individuelle Situation zusammen mit ihren Motiven, Zielen und Bedürfnisse sowie ihren Ängsten und inneren Konflikten sehr offen im geschützten Rahmen des Coachings reflektieren (vgl. Greif et al., 2018b). Wie in der Einleitung schon behauptet, wird Coaching Stelter (2009) zufolge dem besonderen Bedarf nach Räumen für diese "individuelle Reflexivität des Selbst" gerecht. Auf Stelter Bezug nehmend stellen Greif et al. (2018b) abschließend folgende Definition vor:
„Coaching ist eine intensive und systematische Förderung ergebnisorientierter Problem- und Selbstreflexionen sowie Beratung von Personen oder Gruppen zur Verbesserung der Erreichung selbstkongruenter Ziele oder zur bewussten Selbstveränderung und Selbstentwicklung. Ausgenommen ist die Beratung und Psychotherapie psychischer Störungen" (Greif, 2008, S. 59).
Demnach ist Coaching kein endloses Durchkauen und Grübeln, sondern mittels geeigneter Methoden ergebnisorientiert. Neben Zielerreichung sind mit Ergebnissen auch Entscheidungen oder Einsichten gemeint. Zudem wird im Coaching nur das angestrebt, was mit den Vorstellungen des Klienten über sein ideales Selbstkonzept übereinstimmt, also was selbstkongruent ist. Zur Abgrenzung von Coaching zur Psychotherapie ist mehr in 2.1.3. zu finden.
2.1.2. Genese
Um die Identität eines Coaches näher verstehen zu können, ist neben der Definition ein Blick auf den Anfang und Ursprung von Coaching wichtig. Als Coach (eigentlich englisch für Kutsche, später Kutscher) wurde umgangssprachlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts an Universitäten des angloamerikanischen Raums eine Person bezeichnet, die andere bei der Vorbereitung auf Prüfungen und sportlichen Wettbewerben unterstützt (vgl. Lippmann, 2013, S. 14). Mit Coaching wurde weit mehr als reines Training verstanden ‒ besonders während Wettkämpfen war eine umfassende Betreuung, Beratung und Motivierung des Klienten gemeint (vgl. Ryba, 2017, S. 6 f.).
Als der Begriff in den 1970er Jahren aus dem Sportbereich auf die Wirtschaft übertragen wurde, war er eng mit Spitzenleistung, Motivation und Wettbewerb verbunden (vgl. Lippmann, 2013, S. 14). Mitte der 1980er wurde Coach zum Schlagwort im deutschen Topmanagement, Mitte der 1990er zum "inflationären Container-Wort" der breiten Masse (Böning, 2005). In den letzten beiden Jahrzehnten lässt sich ein lang erhofftes (Spence, 2007; Weigel, 2002) Professionalisierungsbestreben verzeichnen (Böning, 2014, S. 22-27). In diesem Kontext zeigt Fietze (2011, S. 25) auf, dass Coaching-Verbände gegründet wurden, der Wissenschaftsbezug zugenommen und die
Coaching-Forschung begonnen hat, sich als eigenständiges Forschungsfeld zu begründen. Für eine differenziertere Geschichte des Coachings mit sieben Entwicklungsphasen wird auf Böning (2014, S. 22-27; 2005, S. 28-36) verwiesen.
Neben den durchaus bekannten Wurzeln des Begriffs und der Tätigkeit Coaching in den Wettbewerbs- und gewinnorientierten Feldern des Spitzensports und Business-Management, verorten einige Autoren weitere, eher verdeckte Wurzeln in der humanistischen und existenziellen Psychologie, die in den 1960er und 1970er Jahren durch das von Kalifornien ausgehende kulturelle Phänomen des Human Potential Movement (HPM) popularisiert wurde (Greif et al., 2018; Wildflower, 2013; Stelter, 2009; Grant, 2007). Mit der HPM ist eine formlose Ansammlung von Praktikern und Anbietern gemeint, die durch eine Überzeugung verbunden waren: 'Man muss nicht krank sein, um gesund zu werden' (Spence, 2007). Eklektisch wurde ein breites Spektrum an Selbst-Entwicklungsstrategien angeboten, darunter Encounter-Gruppen, Workshops und Trainings für persönliches Wachstum und das Experimentieren mit verschiedenen therapeutischen Methoden (Stelter, 2009).
Doch als die HPM nicht in der Lage war, sich selbst zu regulieren, häuften sich, Sensationslust, Fanatismus und ethische Grenzüberschreitungen (Spence, 2007). Zum Ende hin waren weder Interesse noch Bemühungen zu erkennen, die eigenen Praktiken und Programme in empirischer Forschung und theoretisch fundierten Begründungen zu fußen. Ohne Kritik-Fähigkeit und mit dem Vertrauensverlust der Öffentlichkeit, verlor sich die Bewegung (Weigel, 2002). Auch wenn die HPM nach einem raschen Aufstieg einen ebenso raschen Fall erlebt hatte, sei Spence (2007) zufolge das öffentliche Interesse an Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung weiterhin groß geblieben.
2.1.3. Differenzierung
Im Coaching gibt es keinen einheitlichen Ansatz, sondern eine interdisziplinäre Herangehensweise. Es hat sich aus den individuellen Situationen entwickelt, die die Praktiker erlebt haben (vgl. Rauen, 2003, S. 23f). Trotzdem lassen sich ein paar hilfreiche Unterscheidungen treffen: Segers et al. (2011, S. 205) unterscheiden die Weite und Tiefe eines Coachings nach dem erforderlichen Aufwand. Klar abgesteckt und konkret an eine Berufsrolle gebunden sind meist sogenannte "low-engagement agendas". Mehr Zeit und Aufwand erfordern dagegen die "high-engagement agendas", bei denen persönlichere Aspekte und mehr Lebensbereiche mit eingeschlossen sind. In einer ähnlichen Klassifizierung weisen Hawkins & Smith (2010, S. 236) darauf hin, dass Coaching bei geringem Aufwand und kurzfristigen Zielen mehr das Verhalten betreffe, zunehmend Emotionen mit einbeziehe und zuletzt für tiefgreifende Veränderungen die Werte und Grundannahmen einer Person thematisiere (siehe Abb. 1 auf Seite 9).
Es lassen sich folgende vier Unterteilungen machen (Hawkins & Smith, 2010; Cox & Jackson, 2010, S. 225; Segers et al., 2011, S. 205; Ryba, 2017, S. 12 ff.):
Beim Skills Coaching geht es darum, ein spezifisches Verhalten innerhalb weniger Wochen zu erlernen. Beispiel hierfür wären: in einer neuen Funktionsrolle Feedback geben zu können oder aktiv zuhören zu lernen.
Einzelne Fähigkeiten werden im Performance Coaching als Teil der mehreren Monate währenden Intervention gesehen. Im Sinne der ersten Wurzeln des Coachings liegt der Fokus nämlich ganz auf der Leistung des Coachees in seiner Organisation. Als Beispiele können die Teamentwicklung, der Umgang mit neuen beruflichen Aufgaben oder Positionen und die Entwicklung des Führungsstils genannt werden. Hierin spiegelt sich das auf den Business-Bereich reduzierende Begriffsverständnis von Coaching im deutschsprachigen Raum wider.
Statt sich nur nach äußeren Zielen und Standards zu richten, bezieht sich Developmental oder Life Coaching aus einer ganzheitlicheren Perspektive auch auf die komplexe Innenwelt des Klienten. Es braucht mehr Zeit und berührt diesen tiefer, wenn bewusst persönliche und langwährende Wünsche, Themen und Muster ergründet werden. Der Coach sieht seinen Klienten nicht mehr nur als Angestellten oder Führungskraft, sondern auch als Familienvater, alleinstehende Mutter oder als Mensch in einer Umbruchphase. Nachhaltige Verbesserungen der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens des Klienten stehen im Mittelpunkt (Grant & Cavanagh, 2010). Fillery-Travis und Lane (2006) sprechen von einer Therapie für Menschen, die keine Therapie benötigen (zitiert in Ryba, 2017, S. 13). Als Beispiel-Themen können Umgang mit Emotionen, Verbesserung der Life-Work-Balance oder eine berufliche Neuorientierung genannt werden. In ihrem Sammelband "Life Coaching" gehen Schmidt-Lellek und Buer (2011, S. 15) davon aus, dass sich hinter den beruflichen Themen von Fach- und Führungskräften oft Lebensthemen verstecken, die ebenfalls aufgegriffen werden müssten, wenn nachhaltige Veränderungen jener gelingen solle.
Im Transformational Coaching wird eine Veränderung des persönlichen Paradigmas des Klienten (seiner Überzeugungen, Werte, Annahmen, Erwartungen) hin zu einer integrationsfähigeren, differenzierteren, emotional reiferen "Daseinsweise" (way of being) angestrebt. Die Interaktion vertieft sich um Fragen, die die existenzielle Verbundenheit, Unsicherheit und Sinnlosigkeit der Dinge betreffen (vgl. Spinelli, 2010). Im Gegensatz zum herkömmlichen Coaching liegt der Schwerpunkt nicht in der Entwicklung und Verfeinerung von Handlungskompetenzen, sondern in der Entwicklung und Verfeinerung von Qualitäten des Seins (
Abschnitt 3.1
.). Neben philosophischen Erkunden und emotionsfokussierten Imaginieren findet auch das Embodiment, das Erleben des Körpers und der Empfindungen, einen gleichwertigen Platz (vgl. Hawkins & Smith, 2010; Sieler, 2010). Es profitieren vor allem Menschen von diesem Ansatz, die unter einem Druck lasten, sich radikal zu ändern und gleichzeitig intrinsische Motivation (von Innen heraus) dazu verspüren. Ein klassischer Anlass für solch eine umfassende und tiefgreifende Bestandsaufnahme des eigenen Lebens ist die Sinnkrise oder anders gesagt eine Krise der eigenen Identität, wie sie beim Eintreten in jede neue Lebensphase nicht unüblich ist (vgl. Rowan, 2010).
Es soll betont werden, dass bei diesem Coaching-Kontinuum die Übergänge fließend sind und für jeden Coaching-Anlass oder für jedes Thema die passende Tiefe gefunden werden muss.
ABB. I DAS COACHING-KONTINUUM
Quelle: Adaption von Hawkins & Smith (2010, S. 242).
Wenn im Coaching persönlichere und teils langwährende Probleme thematisiert werden, stellt sich die Frage nach der Abgrenzung zur Psychotherapie. Auch wenn sich viele "Coaching-Experten" für eine klare Trennlinie zwischen den beiden Verfahren aussprechen, gibt es bei genauerer Betrachtung einen erheblichen Überschneidungs-bereich (vgl. Grimmer & Neukom, 2010). Zum Beispiel sind nicht alle Traditionen der Psychotherapie vergangenheitsbezogen und ursachenorientiert. Und nicht in jedem Fall ist ein zukunftsfokussierter und lösungsorientierter Ansatz im Coaching hilfreich. Auch die Trennung von persönlichen und beruflichen Themen kann mit Hinblick auf die Coaching-Forschung nicht aufrecht erhalten werden. Denn personenbezogene Aspekte sind "allen bisherigenKenntnissen zufolge die häufigsten Ursachen für arbeitsbezogene Probleme im Coaching" (Ryba, 2017, S. 72). Wenn dem Unterschied zwischen psychisch krank oder gesund immer eine "mehr oder weniger willkürliche Bewertung" zugrunde liegt, kann man sich fragen, inwiefern solch eine Klassifizierung sinnvoll und einem Entwicklungsprozess überhaupt zuträglich ist (Ryba, 2017, S. 71). Für eine Vertiefung des Themas muss aufgrund der Kompaktheit der vorliegenden Arbeit auf Ryba (2017, S. 48-73) verwiesen werden.
Es kann jedoch festgehalten werden, dass Coach und Klient selbst die Grenzen ihrer Zusammenarbeit bestimmen (vgl. Ryba, 2017). Dynamisch und auf Augenhöhe können sie diese dem anpassen, was für beide möglich ist. Hohe Anteile von Selbsterfahrung während der Ausbildung und die damit einhergehende Persönlichkeitsentwicklung des Coaches werden dann relevanter, wenn tiefgreifende und langfristige Themen des Klienten angegangen werden sollen. Auch wenn dies vielleicht ursprünglich nicht das Ziel im Coaching war, können therapeutisch orientierte Prozesse häufiger für nachhaltige Veränderung notwendig sein, als angenommen (vgl. Ryba, 2019). Daher fordert Ryba neben anderen Autoren, dass Coaching-Aus- und Weiterbildungen die Absolventen besser auf die Begleitung solcher Prozesse und noch wichtiger auf die Grenzen ihres Coachings vorbereiten sollten (vgl. Grimmer & Neukom, 2010; Lippmann, 2013; Schmidt-Lellek, 2015; Ryba, 2017, S. 73).
Der in der Konzeption entwickelte Coaching-Ansatz zählt zum Transformational Coaching und widmet sich demnach existenziell tiefen Themen. Die Selbsterfahrung des Coaches und die Entwicklung einer reifen Daseinsweise sind damit von zentraler Bedeutung für meinen Coaching-Ansatz.
2.1.4. Verständnis
Bevor nun das Hauptanliegen dieser wissenschaftlichen Arbeit in den Mittelpunkt gerückt werden kann, bedarf es einer weiteren Orientierung im vielfältigen Feld von Coaching. Neben den ersten Wurzeln von Coaching im Sport und Business-Management mit Fokus auf Wettbewerb und Leistung finden sich die zweiten, selten explizit genannten, Wurzeln im personenzentrierten Ansatz und der humanistischen und existenziellen Psychologie wieder (vgl. Wildflower, 2013; Stelter, 2009; Spence, 2007; Grant, 2007). Vor allem von diesen zweiten humanistisch-existenziellen Wurzeln geht die vorliegende Arbeit aus. Anhand von fünf Annahmen soll daher kurz umrissen werden, was ihr für ein Coaching- und Menschenverständnis zugrunde liegt.
Die wohl wichtigste Annahme, sieht jeden Menschen großes, ungenutztes Potenzial in sich tragen und von Natur aus dazu neigen, dieses zu entwickeln (vgl. Joseph, 2010; Stober, 2006). Der Begründer des personenzentrierten Ansatzes, Carl Rogers, beschreibt als erster diese, im Vergleich zu den Theorien der psychodynamischen und verhaltenspsychologischen Schulen der 1950er Jahre, radikale Vorstellung von einer dem Menschen innewohnenden Aktualisierungstendenz (Sohr, 2008; Rogers, 1961). Auch Wachstums-tendenz in dieser Arbeit genannt, lässt sie sich als die Lebenskraft von Organismen (Lebendigkeit) beschreiben, die "selektiv (erhaltend und entwicklungs-orientiert), gerichtet (auf Autonomie, Selbstregulierung, Differenzierung, komplexe Organisation, Wechselseitigkeit, Entwicklung von konstruktiven und sozialen Lösungen, Wertsteigerung und Transparenz), ständig gegenwärtig und eine grundlegende, ganzheitliche Kraft und Funktionsfähigkeit [ist], auch wenn sie in den verschiedensten Bedürfnissen zum Ausdruck kommen kann" (Kriz & Stumm, 2003, S. 19). Was von Rogers als ein Axiom, als eine nicht beweisbare Überzeugung formuliert war, wird von anderen Autoren als ein wissen-schaftlich belegbares biologisches Konstrukt gesehen (vgl. Stumm & Keil, 2018, Kap. 1).
Die Theoretiker und Praktiker des personenzentrierten Ansatzes beschreiben weiter, dass wenn es der Kontext erlaubt, Menschen das wählen, was für sie langfristig und nachhaltig gut ist (vgl. Stober, 2006; Rogers, 1961; 1957). Demnach kümmert sich der Coach in erster Linie darum, einen Kontext zu entwickeln, in der die Aktualisierungstendenz seines Klienten unterstützt wird. Als Prozessbegleiter und Vermittler von Veränderungen deutet er nur die Richtung des Prozesses an, nicht die Richtung des Inhaltes. Letztere und auch das Gehen des Entwicklungsweges selbst obliegt dem Klienten (Grant & Cavanagh, 2010). In dem Sinne weisen Cox et al. (2010, S. 2 f.) darauf hin, dass sich Coaching weg von einer direktiven und anweisenden Tätigkeit hin zu einem überwiegend nicht-direktiven Ansatz verändert habe (für Näheres siehe nächste Seite Tab. 1).
TAB. I DIRECTIVES UND NICHT-DIRECTIVES COACHING
Direktives Coaching
Nicht-direktives Coaching
Der Coach benötigt Fachwissen/Kenntnisse über die Aufgabe
Der Coach benötigt Fachwissen/Kenntnisse über den Coaching-Prozess
Angetrieben von der Agenda des Coaches, der Organisation oder bestenfalls einer vereinbarten Agenda
Angetrieben von der Agenda des Klienten
Leistungsfähigkeit des Klienten (Tun)
Selbstverwirklichung des Klienten (Werden)
Erfüllung der von anderen gesetzten Standards
Erfüllung der vom Klienten gesetzten Standards
Quelle: Adaption von Cox et al. (2010, S. 3)
Im Rückblick auf sein Leben als Mitbegründer der existenziellen Psychotherapie schreibt Yalom (2017), "die verändernde Kraft [...] ist nicht intellektuelle Einsicht, nicht Interpretation, nicht Katharsis (Abreagieren, Anm. d. A.), sondern eine tiefe, authentische Begegnung zwischen zwei Menschen" (ebd., S. 247, Übs. d. A). Abgesehen von den zahlreichen Studien, die dies eindeutig für Psychotherapie bestätigen (Elliott et al., 2013), tut dies auch die aktuelle Coaching-Forschung: Statt Techniken, sei insbesondere die Beziehungsqualität zwischen Coach und Klient für den Coaching-Erfolg von ausschlag-gebender Bedeutung (De Haan, 2014; Kunze, 2016). Rogers (1957; 1961) beschrieb die drei Grundbedingungen einer entwicklungsförderlichen und heilsamen Beziehung – bedingungsfreie positive Beachtung, Empathie und Kongruenz. Bevor ich für mehr auf Abschnitt 2.2