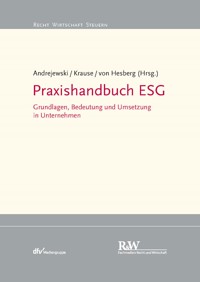
Praxishandbuch ESG E-Book
144,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Recht Wirtschaft Steuern - Handbuch
- Sprache: Deutsch
Das Handbuch gibt aus betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht einen Überblick über die Grundlagen, die Bedeutung und Umsetzung von Environment Social Governance (ESG) in Unternehmen. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen von ESG auf die Unternehmenspraxis. Das Werk soll Praktiker*innen aus diversen Unternehmensbereichen aufzeigen, was ESG für die einzelnen Unternehmensorgane und -abteilungen bedeutet und wie aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit ESG-Themen bewältigt werden können. Den Ausgangspunkt bildet der Allgemeine Teil, der eine Übersicht über die historische Entwicklung sowie eine Definition von ESG enthält. Darüber hinaus umfasst der Allgemeine Teil eine Darstellung der politischen und volkswirtschaftlichen Bedeutung des Themas sowie der (internationalen) rechtlichen Grundlagen von ESG. An den Bedürfnissen von Praktiker*innen orientiert, beleuchtet der Besondere Teil des Handbuchs schwerpunktmäßig die Bedeutung von ESG für Unternehmensorgane (Aufsichtsrat, CFO, COO, CSO) und verschiedene Unternehmensbereiche bzw. -abteilungen (Strategie, Compliance, Recht, Personal, Finanzen, Accounting/Interne Revision/Controlling/Reporting, Steuern, Beschaffung/Einkauf und Produktion). Daneben werden u.a. die Auswirkungen von ESG für strategische und Private Equity-Investor*innen, Ratingagenturen, Banken, Wirtschaftsprüfer*innen und Berater*innen behandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1206
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Praxishandbuch ESG
Grundlagen, Bedeutung und Umsetzung in Unternehmen
Herausgegeben von
Prof. Dr. Kai C. Andrejewski
Diplom-Kaufmann, Pullach
Dr. Nils Krause, LL.M. (Durham)
Rechtsanwalt, Hamburg
und
Dr. Moritz von Hesberg, MBA (UCT)
Rechtsanwalt, Hamburg
Bearbeitet von:
Prof. Dr. Kai C. Andrejewski; Dr. Thomas Becker; Christoph J. Böhringer; Anke Daßler; Lea Edelmann; Marc Großmann, LL.M. (USYD); Prof. Dr. Florian Haase, M.I.Tax; Dr. Nicolaus Heinen; Christian Hell; Isabel Hochgesand; Prof. Dr. Frank A. Immenga, LL.M. (Emory); Prof. Dr. Sarah Jastram; Philipp Junge; Prof. Dr. Christian Kaeser; Holger Knittel; Dr. Lukas Köhler; Dr. Nils Krause, LL.M. (Durham); Georg Lanfermann; Prof. Dr. Christian Mock; Dr. Isabella Niklas; Juliane Nowakowski; Marcus Rohrbach; Petra Sandner; Prof. Dr. Christoph Schalast; Jenny Schmigale, MBA; Maren Segelken; Prof. Dr. Thorsten Sellhorn; Katrin J. Selzer; Roman Strecker; Stephanie Vogl; Dr. Moritz von Hesberg, MBA (UCT); Sarah Katharina von Nordheim; Victor Wagner; Prof. Dr. Andreas Walter, LL.M.; Marcus A. Wassenberg; Martin Wilmsen, MBA; Sebastian Zank
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-8005-1826-5
© 2023 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main www.ruw.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Satzkonvertierung: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach
Druck und Verarbeitung: Beltz Bad Langensalza GmbH, 99947 Bad Langensalza
Vorwort
ESG – Environmental, Social and Governance oder der nicht immer ganz trennscharfe Begriff der Nachhaltigkeit bestimmen unsere täglichen Debatten in Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft. Dazu kommt die Fokussierung auf das Thema Klimawandel oder in unterschiedlicher Begrifflichkeit auch der Klimakrise. Das vorliegende Handbuch greift diese Aktualität auf. Zielsetzung des Handbuches ist es, eine Einordnung und Orientierung zum Thema ESG zu geben. Schon die Begrifflichkeit ist komplex. Bislang fehlte ein umfassendes Praxishandbuch zum Thema ESG in verschiedenen Sektoren und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Unternehmensbereiche im Markt. Dieses Werk möchte diese Lücke schließen und das komplexe Thema greifbar machen. Das Handbuch gibt aus betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht einen Überblick über die Grundlagen, die Bedeutung und Umsetzung von ESG in Unternehmen. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen von ESG auf die Unternehmenspraxis. Das Werk soll Praktikern aus diversen Unternehmensbereichen und Beratern aufzeigen, was ESG für die einzelnen Unternehmensorgane und -abteilungen bedeutet und wie aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit ESG-Themen bewältigt werden können. Eine Schwierigkeit, die bis zum letzten Tag bei der Anfertigung dieses Werkes geblieben ist, ist die große Dynamik der Regulatorik. Das Handbuch konzentriert sich im Wesentlichen auf ESG-Fragestellungen aus europäischer Sicht. Der New Green Deal der Europäischen Union treibt viele Themen und Betrachtungen. Es ist jedoch wichtig, zu verstehen, dass es auch unterschiedliche Sichtweisen und Rückkoppelungen aus anderen Wirtschaftsräumen gibt, die das Thema mitprägen. In den USA gibt es eine Diskussion um das Thema „woke capitalism“, welche Ausfluss der ESG-Fragestellungen ist. In Europa spricht die EU-Präsidentin von dem „man on the moon moment“, wenn sie ihren Green Deal positioniert. Hiermit zeigt sich, wie dynamisch sowohl die gesellschaftliche als auch die regulatorische Diskussion ist. In der Zeit der Erstellung des Handbuches haben sich viele Dinge weiterentwickelt und auch auf Ebene der Regulatorik sind viele Punkte in Frage gestellt worden. Diese konstante Weiterentwicklung und Diskussion verschiedener Strömungen werden in den nächsten Monaten ihre Dynamik behalten. Aktuell hat der französische Präsident Macron eine Regulierungspause bei Umweltauflagen eingefordert, damit die Wirtschaft den Green Deal besser verdauen kann. Er hält explizit fest: „Wir setzen um, was wir beschlossen haben, aber wir hören auf, noch mehr hinzuzufügen. Denn das Risiko, das wir eingehen, besteht im Grunde darin, dass wir bei der Regulierung am besten abschneiden und bei der Finanzierung am schlechtesten abschneiden.“ Die unterschiedlichen Vorhaben im Rahmen des Green Deals zeichnen sich durch unterschiedliche Geschwindigkeiten aus. Verbunden ist das mit industriepolitischen Zielsetzungen, die je nach Land und Wirtschaftsraum sehr differenziert ausfallen können. Selbst innerhalb der EU gibt es zwischen Frankreich und Deutschland hier ein klares Gefälle. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema ESG sind eine faktische, regulatorische und gesellschaftliche Perspektive einzunehmen. Diese Perspektiven sind niemals statisch, sondern entwickeln sich entsprechend weiter. Faktisch schreitet der Klimawandel voran. Hier ist es wichtig, dass Unternehmen verstehen, was passiert und wie sie darauf reagieren können. Es ist auch wichtig, unternehmensindividuelle Planung und generelle Entwicklungen im Zusammenhang zu denken. Regulatorisch ist der Blick nicht nur auf die Europäische Union, sondern ebenso auf die geopolitischen Rahmenbedingungen zu richten. Eine Taxonomie oder Carbon Border Tax kommen im Zusammenhang mit dem asiatischen oder amerikanischen Wirtschaftsraum zu grundlegend anderen Ergebnissen als ein rein europäischer Fokus. Um der Vielschichtigkeit des Themas gerecht zu werden, versammelt das Handbuch eine Vielzahl von unterschiedlichen Autoren. Die für die jeweiligen Kapitel verantwortlichen Autoren sind allesamt erfahrene Praktiker im Bereich ESG und bringen ihre Erfahrungen aus ihren jeweiligen Funktionen sowie Tätigkeitsfeldern in das Werk ein. Herausgeber wie Autoren wünschen sich, dadurch vielfältig die Unternehmenspraxis in verschiedenen Wirtschaftsbereichen für das Thema ESG zu beeinflussen. Es soll eine Arbeitsgrundlage über die beispielhaft angeführten Sektoren hinaus bilden. Den Ausgangspunkt dieses Handbuchs bildet der Allgemeine Teil, der eine Übersicht über die historische Entwicklung sowie eine Definition von ESG enthält. Darüber hinaus umfasst der Allgemeine Teil eine Darstellung der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung des Themas sowie der (internationalen) rechtlichen Grundlagen von ESG. An den Bedürfnissen von Praktikern orientiert, beleuchtet der Besondere Teil des Handbuchs schwerpunktmäßig die Bedeutung von ESG für Unternehmensorgane (Aufsichtsrat, CFO, COO, CSO) und verschiedene Unternehmensbereiche bzw. -abteilungen (Strategie, Compliance, Recht, Personal, Unternehmensfinanzierung, Accounting/Interne Revision/Controlling/Reporting, Steuern, Beschaffung/Einkauf und Produktion). Daneben werden u.a. die Auswirkungen von ESG für strategische und Private Equity Investoren, Ratingagenturen, Banken, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte behandelt. Alle im Buch verwendeten Begriffe verstehen sich geschlechterneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird teilweise auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet – entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat lediglich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. Ein Handbuch mit vielen Autoren ist ein komplexes Werk. Darüber hinaus war und ist der Bereich ESG weiter im Fluss, sodass alle Beteiligten bei der Entstehung des Werkes mit kurzfristigen und teilweise größeren Entwicklungen umgehen mussten. Daher gilt unser Dank allen sehr geschätzten Autoren, deren Geduld teilweise stark beansprucht wurde. Ohne ihren Langmut und ihre Unterstützung wäre dieses Werk nicht möglich gewesen. Der Dank der Herausgeber gilt zudem im besonderen Maße Dr. Konstantin Lainer, Clemens Schlotter, Yelena Nguema Gracia, Sunna Ratzmann und Katharina Wrage, die teilweise inhaltliche Vorarbeiten für dieses Werk geleistet wie aber auch die Entstehung technisch ausgezeichnet betreut haben. Schließlich bedanken wir uns sehr herzlich bei Patrick Orth, Gabriele Bourgon, Martina Koster, Tanja Brücker und Nadine Grüttner für die großartige verlagsseitige Begleitung bei der Entstehung dieses Handbuchs und die angenehme Zusammenarbeit. Wir hoffen sehr, dass dieses Handbuch positiv in der Unternehmenspraxis und dem Markt aufgenommen wird. Herausgeber wie Autoren sind zudem offen für Anregungen und Verbesserungsvorschläge für eine Weiterentwicklung dieses Werkes.
Hamburg/Pullach im Juli 2023
Kai Andrejewski
Nils Krause
Moritz von Hesberg
Autorenverzeichnis
Prof. Dr. Kai C. Andrejewski
ist seit Juni 2021 Vorstand Finanzen/Chief Financial Officer (CFO) der Sixt SE. Er arbeitete als Partner sowie zuletzt als Regionalvorstand/Managing Partner Region Süd für die internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Als Managing Partner betreute er namhafte und global tätige DAX- und MDAX-Unternehmen. Seit 2016 leitete er zusätzlich den KPMG Think Tank Audit Committee Institute mit dem Schwerpunkt ESG. 2011 wurde Andrejewski zum Professor für Accounting und Auditing an der Privaten Fachhochschule Göttingen berufen. Seine Lehrveranstaltungen fokussieren sich auf verschiedene Aspekte von ESG. Als Vorstand Finanzen verantwortet Kai Andrejewski bei SIXT die Ressorts Financial Performance, Group Accounting, Corporate Finance & Treasury, ESG, Recht, Group Controlling, Steuern, Investor Relations, Financial Projects, Governance & Controls und Internal Audit. Seit Februar 2023 ist er Aufsichtsrat und Prüfungsausschussvorsitzender der Deutschen Beteiligungs AG. Er ist das für ESG-Themen im Aufsichtsrat zuständige Mitglied. Eines der Kernthemen seiner Arbeit sind Aspekte und Wirkung der globalen Nachhaltigkeitsdiskussion und deren unternehmerische Folgen für Unternehmen und Finanzmärkte.
Dr. Thomas Becker
ist Leiter Nachhaltigkeit, Mobilität bei der BMW Group. Er verantwortet damit die Integration der Nachhaltigkeitsdimension in die Konzernstrategie. Vor der Übernahme dieser Rolle im Jahr 2019 hat er die weltweite politische Interessenvertretung des Unternehmens geleitet. Er ist Ökonom mit wirtschaftshistorischem Schwerpunkt und Autor des Buches „Autopolitik – Europa vor der T-Kreuzung“.
Christoph J. Böhringer
ist seit 2020 bei der Mast-Jägermeister SE in Wolfenbüttel mit seinem Team ein „Meister“ für alles, was Recht ist. Als gelernter Rechtsanwalt und langjähriger Unternehmensjurist im Corporate-Umfeld eines deutschen Großkonzerns hat er dort die Verantwortung für den Unternehmensbereich „Recht & Compliance“ übernommen. Jägermeister ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, das mit seiner ikonischen Marke im internationalen Wettbewerb steht und sowohl in der Beschaffung als auch im Vertrieb umfassend global vernetzt ist. Einer der zentralen Unternehmenswerte ist die Nachhaltigkeit, um Marke, Erfolg, Sozialleben und die umgebende Umwelt für die nachfolgenden Generationen zu bewahren. Dieser Aufgabe versucht der Autor gemeinsam mit seinem Team für Recht, Compliance, Markenschutz und Risikomanagement tagtäglich gerecht zu werden und steht dazu mit zahlreichen Co-Autoren dieses Handbuchs im Austausch.
Anke Daßler
ist Senior Vice President Controlling & Accounting bei der Evonik Industries AG. In dieser Funktion verantwortet sie konzernweit die interne und externe finanzielle Berichterstattung, in der zunehmend ESG-Aspekte integriert werden. Bis 2018 war sie als Partnerin, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Sie ist Mitglied in diversen Aufsichtsräten börsennotierter Gesellschaften. Anke Daßler hat Betriebswirtschaft an der Hochschule Mittweida (FH), der California State University (USA) und der ESMT Berlin studiert und als Betriebswirtin (FH) sowie Master of Business Administration (MBA) abgeschlossen.
Lea Edelmann
ist Wirtschaftsprüferin und Senior Managerin bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der ESG Assurance Expert Group. Ihre Passion und ihr Know-how liegen dabei vor allem in der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung großer kapitalmarktorientierter und börsennotierter Unternehmen. Zudem berät sie Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen bei der Implementierung und Umsetzung regulatorischer Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Als Wirtschaftsprüferin mit Erfahrung auch in der Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen treibt Frau Edelmann insbesondere die Integration der Prüfung nichtfinanzieller Informationen in die Prüfung der Finanzinformationen voran und bereitet große börsennotierte Unternehmen auf die Optimierung nichtfinanzieller interner Kontrollsysteme zur Erlangung hinreichender Prüfsicherheit vor.
Marc Großmann, LL.M. (USYD)
ist Rechtsanwalt im Bereich Corporate/M&A bei DLA Piper in Hamburg. Vor seiner Stelle bei DLA Piper war er in einer anderen internationalen Großkanzlei im gesellschaftsrechtlichen Bereich tätig. Er studierte Rechtswissenschaften in Regensburg und Berlin (Humboldt-Universität zu Berlin) und absolvierte einen Master of Law (LL.M.) an der University of Sydney.
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.Tax
ist Partner und Niederlassungsleiter im Hamburger Büro von Rödl & Partner. Er leitet das Beratungsfeld „Internationales Steuerrecht“ sowie die steuerliche Grundsatzabteilung der Kanzlei. Daneben ist er Professor für Deutsches, Internationales und Europäisches Steuerrecht an der IU Internationale Hochschule, Bad Honnef. Haase ist Autor mehrerer Lehr-, Fach- und Handbücher sowie von Kommentaren und mehr als 300 Beiträgen zum Steuerrecht. Er ist ein gefragter Redner auf nationalen und internationalen Fachtagungen und Kongressen.
Dr. Nicolaus Heinen
ist Leiter der ESG-Konzernstrategie bei der Deutsche Börse Group und koordiniert alle Nachhaltigkeitsaktivitäten und ESG-Produktinitiativen des Unternehmens. Vor seinem Wechsel zur Deutschen Börse war Heinen als Analyst für die Deutsche Bank und als Leiter Global Intelligence für die Linde AG tätig. Heinen ist Mitglied im Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung, Vorstandsmitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung, Dozent für Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik an der Universität Bayreuth und Autor mehrerer Wirtschaftsbücher.
Christian Hell
ist Partner bei EY im Bereich Strategy & Transactions. Seine Leidenschaft und Expertise liegen im facettenreichen Spannungsfeld nachhaltiger Entwicklung und ökonomischen Erfolgs. Dazu berät er Unternehmen seit mehr als 15 Jahren, hat Erfahrung in praktisch allen Sektoren und speziell im DAX-40-Umfeld. Herr Hell begleitet Unternehmen auf ihren individuellen Transformationspfaden und hilft ihnen dabei, ökologische und soziale Best Practices in Strategien, Governance, Prozessen und Berichterstattung zu kultivieren. Zu seinen aktuellen Arbeitsschwerpunkten zählen nachhaltige (Portfolio-)Strategien, ganzheitliche Zielsysteme samt integrierten Messungs-, Entscheidungs- und Steuerungsansätzen, Impact Valuation, CSRD-Umsetzung sowie Biodiversitäts- und Klimamanagement. Er ist bzw. war Mitglied in den Fachgremien zur Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards bei Organisationen wie ISSB, EFRAG, VTPC, CDSB, GRI, WBCSD, Value Balancing Alliance oder AccountAbility.
Isabel Hochgesand
ist Chief Procurement Officer bei der Beiersdorf AG. In dieser Funktion verantwortet sie die konzernweiten Ausgaben über die Einkaufsbereiche Rohstoffe, Packmittel, Marketingausgaben sowie Indirekte Materialien. Sie ist Mitglied des betriebsweiten Nachhaltigkeits-Führungsgremiums. Bevor Frau Hochgesand 2017 der Beiersdorf AG beigetreten ist, machte sie 25 Jahre bei Procter & Gamble Karriere. Sie war sowohl im Einkauf als auch in der Supply Chain tätig und arbeitete in Deutschland, USA und der Schweiz. Frau Hochgesand ist weiterhin Aufsichtsratsmitglied bei Ontex, Belgien, und Mitglied in diversen Frauen-Netzwerken. Frau Hochgesand ist verheiratet und Mutter von zwei Teenagern.
Prof. Dr. Frank A. Immenga, LL.M. (Emory)
ist Gründungsdirektor des Instituts für Compliance & Environmental Social Governance (ICESG), Inhaber einer Professur an der Hochschule Trier am Umwelt-Campus Birkenfeld und als Rechtsanwalt in Frankfurt am Main tätig.
Prof. Dr. Sarah Jastram
ist Inhaberin der Professur für Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit sowie allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hamburg School of Business Administration. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Themen ESG, Human Rights Management, Impact Measurement, Governance und künstliche Intelligenz. Die Ergebnisse der Forschung von Sarah Jastram sind in führenden internationalen Fachzeitschriften erschienen. Über ihre Tätigkeit als Professorin hinaus ist Sarah Jastram als Beraterin und Moderatorin im privaten und im öffentlichen Sektor tätig. Seit Januar 2021 gehört sie dem Nachhaltigkeitsbeirat des Unternehmens Porsche an.
Philipp Junge
ist Chief Operating Officer der OQEMA AG. Neben Vertriebsaufgaben, strategischer Entwicklung des europaweiten Spezialitätengeschäfts und der gruppenweiten Verantwortung für Logistik und Betriebe verantwortet er die Nachhaltigkeitsaktivitäten der OQEMA AG. Zuvor war Philipp Junge 14 Jahre bei LANXESS in Führungsfunktionen aktiv, zuletzt als Business Unit Leiter und Leiter der Vorstandsinitiative zu Elektromobilität und Kreislaufwirtschaft. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Roland Berger Strategy Consultants.
Prof. Dr. Christian Kaeser
ist Corporate Vice President und Global Head of Tax der Siemens AG. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und anschließender Promotion in Mainz war er zunächst für WTS tätig bevor er für die Siemens AG tätig wurde. Neben seiner Tätigkeit bei Siemens AG hat er eine Honorarprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien inne, ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der WTS AG und ist Mitherausgeber zahlreicher steuerrechtlicher Fachliteratur. Zudem ist er Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Beiräte.
Holger Knittel
ist als Managing Director seit 2017 bei der Citigroup in Frankfurt tätig. Er leitet das Investmentbanking-Geschäft in Deutschland und das M&A-Geschäft im deutschsprachigen Raum. Zuvor war er insgesamt 17 Jahre bei der Deutschen Bank tätig, zuletzt als Co-Head des M&A-DACH-Geschäfts. Holger Knittel hat einen Diplomabschluss der Universität Mannheim und einen MBA-Abschluss der Connecticut State University.
Dr. Lukas Köhler
ist seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag. Zunächst als klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion sowie u.a. Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung – seit 2021 als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten. Zudem ist er seit 2019 Generalsekretär der FDP Bayern und Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Nach seinem Studium der Philosophie in München, Manila und London schrieb er an der Hochschule für Philosophie in München seine Dissertation mit dem Titel „Die Repräsentation von Non-Voice-Partys in Demokratien“.
Dr. Nils Krause, LL.M. (Durham)
ist Partner im Hamburger Büro der internationalen Anwaltssozietät DLA Piper. Er berät inländische und ausländische Unternehmen/Investoren bei nationalen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen sowie in Fragen des deutschen Kapitalgesellschafts- und Konzernrechts. Ein besonderer Schwerpunkt seiner gesellschaftsrechtlichen Beratung liegt bei ESG-Themen. Er hat viele Jahre die deutsche Corporate/M&A-Gruppe der Sozietät geleitet und ist nunmehr als International Co-Head of Corporate Legal Products and Innovation für die weltweite Corporate-Gruppe neben seinem Tagesgeschäft tätig. Zusätzlich zu seiner anwaltlichen Tätigkeit ist er langjähriger Lehrbeauftragter für M&A an der Bucerius Law School in Hamburg und veröffentlicht regelmäßig zu verschiedenen Corporate/M&A-Themen. Er gehört dem Beirat des Ressorts Wirtschaftsrecht des Betriebs-Beraters an. Des Weiteren war er früher lange Jahre in einem Think Tank des Club of Rome zu Nachhaltigkeitsthemen aktiv.
Georg Lanfermann
ist Präsident des DRSC e.V. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Januar 2022 wurde er in den EFRAG Administrative Board gewählt und seit Februar 2022 ist er Vizepräsident dieses EFRAG Gremiums. Von 2005 bis Anfang 2021 war er Partner im Department of Professional Practice, der fachlichen Grundsatzabteilung der KPMG in Berlin, und beschäftigte sich im EU-Kontext mit Regulierungsfragen im Bereich Unternehmensberichterstattung, Abschlussprüfung und Corporate Governance – zuletzt insbesondere mit der Sustainable Finance Regulierung. Zuvor war er in den Jahren 2001 bis 2004 Abgeordneter Nationaler Sachverständiger bei der Europäischen Kommission im GD Binnenmarkt, Referat G4 „Rechnungslegung und Abschlussprüfung“ mit dem Schwerpunkt Europäische Reaktion zum US Sarbanes-Oxley Act und EU-Prüferrichtlinie 2006. Begonnen hatte er seinen beruflichen Werdegang bei Deloitte in 1994, wo er auch die Qualifikationen als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater erlangte.
Prof. Dr. Christian Mock
ist Inhaber einer Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Insolvenzrecht an der Hochschule Trier – Umweltcampus Birkenfeld. Zudem ist er Direktor des Birkenfelder Instituts für Ausbildung und Qualitätssicherung im Insolvenzwesen (BAQI). Seine Interessenschwerpunkte bilden das Wirtschaftsrecht, das Insolvenzrecht sowie das Recht der Nachhaltigkeit.
Dr. Isabella Niklas
ist Sprecherin der Geschäftsführung bei der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, der Konzernholding der Freien und Hansestadt Hamburg. In dieser Funktion ist sie Mitglied in diversen Aufsichtsräten. Hierzu zählen unter anderem die Aufsichtsräte der Hamburger Energiewerke GmbH, der HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG und der Hapag Lloyd AG. Vor ihrem Wechsel in die Geschäftsführung der HGV war sie bis 2018 als Partnerin und Rechtsanwältin in einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg tätig und hat Investoren, Banken sowie Projektentwickler in M&A-Transaktionen im Bereich der Erneuerbaren Energien beraten. Sie war Mitglied im Aufsichtsrat der PNE AG. Isabella Niklas hat Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg studiert und war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.
Juliane Nowakowski
hat sich in den letzten Jahren zu einer Expertin für Nachhaltigkeit in der Textilindustrie entwickelt. Mit ihrer Passion und Authentizität verantwortet sie als Head of Sustainability & Corporate Responsibility die 360°-Nachhaltigkeitsstrategie „BE PART“ bei TOM TAILOR, wo sie seit 2019 tätig ist. Im Jahr 2022 veröffentlichte TOM TAILOR seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht, welchen Nowakowski federführend erstellte. Juliane Nowakowski lebt in Hamburg, wo sie sich gemeinsam mit ihrer Weimaraner Hündin zuhause fühlt. Sie hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und einen Master in Wirtschaftspsychologie absolviert. Juliane Nowakowski ist eine inspirierende Persönlichkeit, die sich leidenschaftlich und transparent für eine nachhaltigere Textilindustrie einsetzt. Im Jahr 2023 wurde sie in das FUTURE WOMEN Netzwerk aufgenommen. Ihr Engagement und ihre Fachkenntnisse machen sie zu einer wichtigen Stimme und Antriebskraft für positive Veränderungen in der Branche.
Marcus Rohrbach
ist Wirtschaftsprüfer und Partner bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er prüft und berät große kapitalmarktorientierte Unternehmen im Bereich der finanziellen und nichtfinanziellen Berichterstattung. Über die letzten Jahre hat er Mandanten von der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie über die Operationalisierung in Prozessen und Systemen bis hin zum externen Reporting nach den jeweils anzuwendenden Standards begleitet. Aus der Erfahrung der Planung und Organisation von Prüfungen nichtfinanzieller Informationen bei multinationalen Konzernen ist er Ansprechpartner für Vorstände und Aufsichtsräte im DAX und M-DAX. Bei KPMG leitete er den Audit Sustainability Hub und treibt die Entwicklung eines integrierten Prüfungsansatzes für die künftige integrierte Unternehmensberichterstattung voran.
Petra Sandner
ist Chief Sustainability Officer der Helaba Gruppe und leitet das Sustainability Management. Sie ist damit zuständig für die strategische Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsprofils der Helaba Gruppe und die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Zuvor hat sie bereits mehrere strategische Projekte der Helaba geleitet und hat ihre Wurzeln im Kreditgeschäft. Im Bereich Asset Finance hat sie Kunden im asiatisch-pazifischen Raum betreut und Transaktionen strukturiert. Petra Sandner hat Betriebswirtschaft an der accadis Hochschule und der Newcastle Business School (GB) studiert und mit Bachelor sowie Master of Business Administration (MBA) abgeschlossen.
Prof. Dr. Christoph Schalast
ist Managing Partner und Gründer von Schalast Law | Tax sowie Professor für Mergers & Acquisitions, Wirtschaftsrecht und Europarecht an der Frankfurt School of Finance & Management. Dort initiierte er den Studiengang Master of Mergers & Acquisitions, dessen Direktor er bis heute ist. Schalast LAW | TAX ist Gründungsmitglied und Prof. Dr. Christoph Schalast Kurator des Bundesverbandes der Wirtschaftskanzleien in Deutschland (BWD), der als einer der ersten Verbände einen Nachhaltigkeits- und ESG-Arbeitskreis ins Leben rief. Bei dem internationalen Netzwerk Multilaw mit 90 Mitgliedskanzleien und 10.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten weltweit ist er Global Chair des Environment & Sustainability Committee.
Jenny Schmigale, MBA
ist seit 2013 als Head of Compliance & ESG für die Reederei Scandlines tätig, wo sie auch das Risikomanagement und die Interne Revision verantwortet. Davor war sie in der Internen Revision (Skandia, Berlin) sowie der Leitung IKS (Siemens und AXA, Paris) tätig. Sie engagiert sich in Fachverbänden und als Dozentin/Referentin. Jenny Schmigale hat Wirtschaftsinformatik studiert sowie einen Master of Business Administration (MBA) in der Spezialisierung Governance, Risk & Compliance abgeschlossen sowie Zertifizierungen als Interner Revisor.
Maren Segelken
ist Senior Procurement Development Manager Sustainability bei der Beiersdorf AG und verantwortlich für die Konzeptionierung und Implementierung der einkaufsbereichübergreifenden Lieferanten-Programme hinsichtlich Nachhaltigkeit. Vor dieser Rolle war sie im Logistikeinkauf sowie in der Supply Chain tätig.
Prof. Dr. Thorsten Sellhorn
ist Lehrstuhlinhaber am Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die IFRS, die Rolle von Rechnungslegungsinformationen an Kapitalmärkten sowie die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Er berät die IFRS Foundation (IFRS Advisory Council) und EFRAG (Academic Panel und Expert Working Group on European Sustainability Reporting Standards). Sellhorn ist Mitverfasser des Lehrbuchs „Internationale Rechnungslegung“ und Mitglied im Arbeitskreis Externe Unternehmensberichterstattung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft.
Katrin J. Selzer
ist als Senior Communication Managerin in der Unternehmenskommunikation der Beiersdorf AG tätig. In ihrer Zuständigkeit liegen die Planung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen, die sich auf die ökologischen Nachhaltigkeitsthemen und -fortschritte beziehen. Sie ist seit 2003 bei Beiersdorf tätig, zunächst in verschiedenen Marketing und Strategierollen bei NIVEA, seit 2014 in der Unternehmenskommunikation. Das Thema Nachhaltigkeit ist für sie nicht nur relevant im Job, sondern auch im Privaten ein wichtiges Anliegen, mit dem sie sich intensiv beschäftigt.
Roman Strecker
ist Vice President People bei der Fortum Group und verantwortet die Personalleitung der Corporate-Abteilungen der Gruppe, zu der neben der Personalabteilung selbst unter anderem die Abteilungen Finance, Legal und Sustainability gehören. Zuvor war er als Arbeitsdirektor für General Electric Deutschland tätig. Roman Strecker hat Rechtswissenschaften an der Bucerius Law School, Hamburg sowie der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne studiert.
Stephanie Vogl
ist Wirtschaftsprüferin und Senior Managerin bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der ESG Assurance Expert Group. Sie ist spezialisiert auf die Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung großer kapitalmarktorientierter Unternehmen. Als Wirtschaftsprüferin mit langjähriger Erfahrung in der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen und Nachhaltigkeitsberichten treibt Frau Vogl die integrierte Prüfung von Finanz- und Nachhaltigkeitsinformationen voran. Sie unterstützt zudem Unternehmen verschiedenster Größenklassen bei der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung (i. W. CSRD und EU-Taxonomie). Frau Vogl ist zudem Mitglied der IDWArbeitsgruppe „Prüfung der CSR Berichterstattung“.
Dr. Moritz von Hesberg, MBA (UCT)
ist Partner bei der internationalen Großkanzlei DLA Piper in Hamburg. Er berät deutsche und internationale Mandanten zu komplexen Cross-Border-Transaktionen sowie Corporate-Governance-Themen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit sowohl im M&A- als auch im Corporate-Governance-Bereich liegt dabei auf der Beratung zu Fragestellungen rund um das Thema ESG. Neben seiner Qualifikation als Anwalt hat Moritz von Hesberg einen Master of Business Administration der Universität Kapstadt erworben. Dort unterrichtet er auch als Gastprofessor im internationalen MBA-Programm mit einem Wahlkurs zu M&A. Zudem ist er in Beiräten verschiedener deutscher und südafrikanischer Unternehmen tätig und veröffentlicht regelmäßig zu Corporate- und ESG-Themen.
Sarah Katharina von Nordheim
leitet die Vermarktung und Vermietung der Personenbahnhöfe in Deutschland bei der Deutschen Bahn Station&Service AG. Vor ihrem Wechsel im Herbst 2022 hat sie die Strategieabteilung für Nachhaltigkeit und Umwelt der Deutschen Bahn AG aufgebaut und geleitet. In dieser Funktion entwickelte sie das Konzept der Grünen Transformation der Deutschen Bahn. Für ihre Tätigkeit im Rahmen dieser Position wurde sie vom Magazin „Capital“ in den Jahrgängen 2019 und 2020 als Top 40 Unter 40 in der Kategorie Management ausgezeichnet. Vom Handelsblatt und BCG wurde von Nordheim in die Vordenker:innen 2022 gewählt.
Victor Wagner
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechnungswesen und Wirtschafsprüfung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In seiner Forschung konzentriert er sich darauf, wie die neuen Berichterstattungsstandards zu Nachhaltigkeit von Unternehmen umgesetzt werden und wie diese Informationen von Stakeholdern verarbeitet werden.
Prof. Dr. Andreas Walter, LL.M.
ist Co-Managing-Partner bei Schalast Law | Tax und Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance. Er ist Professor für Recht an der iu Internationalen Hochschule und verantwortet den Studiengang Master of Banking and Capital Markets Law als akademischer Direktor an der Frankfurt School of Finance & Management. Er ist von Harvard und vom MIT zertifizierter Experte für Fintech und Blockchain und damit führender Rechtsanwalt zur Zukunftsgestaltung der Finanzindustrie. Beim internationalen Netzwerk Multilaw ist er Global Chair der Practice Group Banking & Finance.
Marcus A. Wassenberg
ist Finanzvorstand der KION Group AG. In dieser Funktion verantwortet er alle Finanzbereiche, die IT und Kapitalmarktkommunikation des Konzerns. Vor seinem Wechsel war er CFO und Arbeitsdirektor der Heidelberger Druckmaschinen AG und trieb maßgeblich die Sanierung des Unternehmens voran. Bis 2019 war Wassenberg CFO der Rolls-Royce Power Systems AG, wohin er aus seiner Rolle als Finanzvorstand bei Senvion wechselte.
Martin Wilmsen, MBA
ist Partner der Kanzlei Bryan Cave Leighton Paisner in Frankfurt. Sein Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich der Kreditfinanzierungen. Er begleitet sowohl Kreditnehmer als auch Kreditgeber insbesondere bei der Finanzierung im Hinblick auf Immobilienerwerb, -Refinanzierung und -Entwicklung. Darüber hinaus berät Martin Wilmsen in Bezug auf Corporate-Finanzierungen, Projektfinanzierungen und Finanzierungen von Public Private Partnerships (PPPs). Neben seinem juristischen Abschluss hält Herr Wilmsen auch einen MBA der International Real Estate Business School (IREBS) der Universität Regensburg. Darüber hinaus ist er Gründer des German ESG Forums und verfügt über umfangreiche Erfahrung zu grünen und ESG-konformen Finanzierungen. Insbesondere zum Thema Green Finance spricht Herr Wilmsen regelmäßig auf verschiedenen Branchenveranstaltungen und hat Aufsätze und Interviews in diversen Zeitschriften veröffentlicht.
Sebastian Zank
war international im Investment Banking tätig und verantwortet nun als Managing Director bei Scope Ratings die Analyse vornehmlich europäischer Kreditnehmer im Bereich Non-Financial Corporates. Als EFFAS Certified ESG Analyst® fördert er dabei die Implementierung von ESG-Kriterien in der Kreditanalyse. Daneben hält Zank eine Dozententätigkeit für Ratings an der International School of Management. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin mit Studienaufenthalten in Wien und Sydney erwarb er die Akkreditierung als CFA Charterholder.
Inhaltsübersicht
Teil 1 Allgemeiner Teil
§ 1 ESG im Zusammenhang gedacht – Abgrenzung, Grundlagen und GET-Welt
I. Einleitung
II. ESG und Nachhaltigkeit – Eine Abgrenzung
III. Grundlagen
IV. „GET“-Welt
V. Schlussbetrachtung
§ 2 Rechtsgrundlagen von ESG
I. Einleitung
II. ESG-Entwicklung in der Regulatorik
III. Wichtige europäische Rechtsgrundlagen
IV. Nationale Rechtsgrundlagen
V. Multi-Stakeholder-Initiativen und ihre Bedeutung
VI. Fazit
§ 3 Exkurs: ESG und Kartellrecht
I. Einleitung
II. Problemstellung
III. Kartellrechtliche Konfliktfelder
IV. Fazit
§ 4 Standortfaktor Nachhaltigkeit – worauf es jetzt ankommt
I. Einleitung
II. ESG und Standortattraktivität: Drei Wirkungsebenen
III. EU: Fokus auf Regulatorik
IV. USA: Primat des Marktes
V. Vereinigtes Königreich: Transparenz setzt Maßstäbe
VI. Asien: Unentschieden
VII. Ausblick: ESG bleibt ein Moving Target – EU könnte mit Kapitalmarktunion punkten
§ 5 ESG – Politische Dimension am Beispiel der Finanzmärkte
I. Einleitung
II. Bedeutung nachhaltiger Geldanalagen im politischen Kontext
III. Bedeutung von ESG für die deutsche Politik – Die Staatsziele
IV. Sustainable Finance und ihre Regulierung in der EU und Deutschland
V. Herausforderungen und Chancen in der Regulierung
VI. Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
VII. Fazit und Ausblick
§ 6 ESG – Wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen
I. Einleitung
II. ESG und Unternehmen
III. Fazit und Ausblick
§ 7 ESG-Berichterstattung – Konzept, ökonomischer Hintergrund und Entwicklung
I. Einleitung
II. Einführung der zentralen Begriffe
III. ESG-Berichterstattung als Informationsinstrument
IV. ESG-Auswirkungen und ESG-bezogene Risiken und Chancen
V. Herausforderungen und Grenzen der ESG-Berichterstattung
VI. Fazit
§ 8 Nachhaltigkeitsberichterstattung im Fokus der Regulatorik
I. Einleitung
II. Hohe Dynamik bei der Weiterentwicklung der Berichtspflichten
III. Corporate Sustainability Reporting Directive als Grundlage für verbindliche EU-Berichtsstandards
IV. EFRAG als europäischer Standardsetzer im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung
V. European Sustainability Reporting Standards („ESRS“) im Überblick
VI. „Global Baseline“ des International Sustainability Standards Board („ISSB“)
VII. Nächste Schritte zur Einführung der ESRS; ISSB-Agendakonsultation; Internationalisierung der SASB-Branchenstandards
§ 9 Nachhaltige Transformation – Ansätze für die Unternehmenspraxis
I. Einleitung
II. ESG-Regulatorik als Treiber für nachhaltige Transformation
III. Integrative und holistische Umsetzung in der Unternehmenspraxis
Teil 2 Besonderer Teil
§ 10 Allgemeine Bedeutung von ESG für Unternehmen in Deutschland
A. Rechtspflicht zu ESG-konformen Verhalten?
I. Einleitung
II. Gesellschaftliche Verantwortung im Zeitalter der Nachhaltigkeit
III. Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit
IV. Nachhaltige Corporate Governance
V. (Gesellschafts-)rechtliche Pflicht zu ESG-konformen Handeln
VI. Deutscher Corporate Governance Kodex
VII. Zukunftsvision European Corporate Governance
VIII. Zusammenfassung und Ausblick
B. Bedeutung von ESG aus Sicht des Aufsichtsrates
I. Einleitung
II. Einrichtung von ESG- und Nachhaltigkeitsausschüssen
III. Erfordernis einer Nachhaltigkeitsexpertise bei den Aufsichtsratsmitgliedern
IV. Zusammenfassung
C. Bedeutung von ESG aus Sicht des CFO
I. Einleitung
II. Finanzfunktion als Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg
III. Fazit
D. Bedeutung von ESG aus Sicht des COO am Beispiel Chemieindustrie und Chemiedistribution
I. Einleitung
II. Nachhaltigkeit und ESG in der Chemieindustrie und Chemiedistribution
III. Konkretisierung der ESG-Herausforderungen am Beispiel OQEMA
IV. Mögliche Hindernisse und Ausblick
E. Bedeutung von ESG aus Sicht des Leiters Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie
I. Die Herausforderung der Nachhaltigkeit in der Automobilbranche
II. Nachhaltigkeit bei der BMW Group
III. Die praktische Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie bei der BMW Group
IV. Die Etablierung digitaler Prozesse
V. Governance und Accountability von Nachhaltigkeit
VI. Organisation
VII. Mitarbeiterdimension
VIII. Marken- und Kundendimension
IX. Fazit
§ 11 Bedeutung von ESG für ausgewählte Unternehmensbereiche
A. Strategieabteilung
I. Einleitung
II. Allgemeine Bedeutung von ESG für die Unternehmensstrategie
III. Skizzierung Strategieprozess
IV. Festlegung der Umsetzung
V. Fazit
B. Compliance
I. Einleitung
II. ESG: Frischer Wind für Compliance?
III. Compliance und Compliance-Management-Systeme
IV. Anforderungen von ESG aus Compliance-Sicht
V. Integration von ESG-Anforderungen in das CMS
VI. Fazit
C. Rechtsabteilung
I. Einleitung
II. Was nun, Rechtsabteilung?
III. Auftrag im Unternehmen
IV. Fazit
D. Personalabteilung
I. Einleitung
II. Generelle Auswirkungen von ESG auf die Personalarbeit
III. Die S-Komponente von ESG in der Personalarbeit
IV. Fazit
E. Finanzabteilung und Unternehmensfinanzierung
I. Einleitung
II. Einordnung der Begriffe Sustainable Finance/Climate Finance/Green Finance
III. Produkte zur nachhaltigen Finanzierung
IV. Ausgewählte praktische Überlegungen in Bezug auf die genannten Produkte
V. Motive zum Abschluss nachhaltiger Finanzierungen („DN“-/„DG“-Sicht)
VI. Marktumfang und aktuelle Lage – Wie hoch ist der Marktanteil nachhaltiger Finanzierungen?
VII. Fazit
F. Unternehmenssteuerung und -berichterstattung
I. Einleitung
II. Verantwortung übernehmen – jenseits der Berichterstattung
III. ESG in der Unternehmenssteuerung und -berichterstattung
IV. Messbarkeit von ESG – Implementierung aussagekräftiger KPIs
V. Aktuelle Herausforderungen und Grenzen
VI. Fazit und Ausblick
G. Interne Revision
I. Einleitung
II. ESG als neue Aufgabe und Rolle für die Interne Revision
III. Das Audit Universe und der Prüfungsplan
IV. Prüfung oder Beratung?
V. Fazit
H. Steuerabteilung und Steuerplanung
I. Einführung
II. Status quo der ESG-nahen Transparenzregeln auf internationaler, EU- und nationaler Ebene mit (mittelbarer) Relevanz für das Steuerrecht
III. Weitere „inoffizielle“ Transparenzinitiativen der jüngeren Zeit
IV. Strategische Ausrichtung der Steuerabteilung anhand von ESG-Kriterien?
V. Fazit
I. Beschaffung und Einkauf
I. Einführung
II. ESG in Beschaffung und Einkauf
III. Fazit und Ausblick: Best-in-Class Procurement
J. Produktion am Beispiel Textilindustrie
I. Einführung
II. Dimensionen und Abgrenzung von ESG in der Textilproduktion
III. Instrumente zur Umsetzung und Sicherstellung von ESG in der Textilproduktion
IV. Herausforderungen und Learnings in der praktischen Umsetzung von ESG
V. Externe Anforderungen: Pflicht versus intrinsische Verantwortung
VI. Fazit
§ 12 Bedeutung von ESG für M&A und Private Equity Investoren
I. Einleitung
II. Relevanz von ESG für Private Equity
III. Der Einfluss von ESG als Treiber für M&A von Private Equity
IV. Berücksichtigung von ESG im M&A-Prozess
V. Zusammenfassung
§ 13 Bedeutung von ESG für Ratingagenturen
I. Einleitung
II. Zunehmende Bedeutung von ESG für Kreditvergabe und Kreditrisiko
III. Kreditratings und Abgrenzung zu Nachhaltigkeitsratings
IV. Unterschiedliche Ansätze der ESG-Integrierung
V. Einfluss von ESG-Faktoren auf das Kreditrating
VI. Herausforderungen und Hürden
VII. Fazit
§ 14 Bedeutung von ESG für Banken
I. Einleitung
II. Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie einbeziehen
III. Transformationsfinanzierung
IV. Sektorstrategien: von Ausschlüssen hin zur zielgerichteten Portfoliosteuerung
V. Fazit
§ 15 Bedeutung von ESG für Wirtschaftsprüfer
I. Einleitung
II. Aktuelle Rechtslage zur nichtfinanziellen Berichterstattung durch Unternehmen
III. Rolle des Abschlussprüfers bei der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung
IV. Fortentwicklung der Prüfungsmethodik zur Berücksichtigung der nichtfinanziellen Berichterstattung
V. Weg zur integrierten Abschlussprüfung
VI. Fazit
§ 16 Bedeutung von ESG für Berater am Beispiel Rechtsmarkt
I. Einleitung
II. Dimension ESG in der Rechtsanwaltskanzlei als Unternehmen
III. Dimension ESG als Beratungsgegenstand
IV. Fazit
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Autorenverzeichnis
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Teil 1 Allgemeiner Teil
§ 1 ESG im Zusammenhang gedacht – Abgrenzung, Grundlagen und GET-Welt
I. Einleitung
II. ESG und Nachhaltigkeit – Eine Abgrenzung
1. Abgrenzung
2. Entwicklung des heutigen ESG-Begriffes
3. Nachhaltigkeit im Sinne der unternehmerischen Verantwortung
4. CSR und ESG
III. Grundlagen
1. Ein wenig Ethik
a) Wahrheit und Demokratie
b) Begriff der Wahrheit
c) Finanzielle Wahrheiten
d) Nichtfinanzielle Wahrheiten
e) Grundlagen der Legalität und Unabhängigkeiten
f) Qualitative Wahrheiten nicht nur am Kapitalmarkt
2. Legalität und Legitimität
3. Risiko breiter gedacht
IV. „GET“-Welt
1. Einleitung
a) „GET“ it
b) Klima und Kapital – Nachhaltigkeit als Systemfrage
2. Geopolitik
3. ESG in der „GET“-Welt
a) Abgrenzung
b) Faktischer Klimawandel
c) Regulatorischer Klimawandel
d) Gesellschaftlicher Klimawandel
e) Fehlende Berücksichtigung des Klimawandels an den Kapitalmärkten – die nächste Finanzkrise?
4. Technologie
V. Schlussbetrachtung
§ 2 Rechtsgrundlagen von ESG
I. Einleitung
II. ESG-Entwicklung in der Regulatorik
1. Zentrale historische Ereignisse auf dem Weg zum heutigen ESG-Verständnis
a) Club of Rome: Grenzen des Wachstums (1972)
b) Brundtland-Bericht (1987)
c) Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung und Agenda 21 (1992)
d) Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC von 1992)
e) Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte
f) Agenda 2030
g) „Sustainable Finance“-Aktionsplan der EU-Kommission
h) „European Green Deal“
2. Ursprung der Begrifflichkeit „ESG“
3. Rolle des International Sustainability Standards Board („ISSB“) und der Normensetzung in Abgrenzung zur globalen und europäischen Regulatorik
4. Zusammenfassung
III. Wichtige europäische Rechtsgrundlagen
1. Aktuelle Entwicklungen der EU-Taxonomie
2. Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“)
3. Änderung der Referenzwert-Verordnung (Benchmark-VO)
4. Änderungs-Verordnung der Delegierten Verordnung der MiFID II (Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU)
5. EU-Emissionshandelssystem („EU-ETS“, alternativ auch „EU-EHS“)
6. EU-Klimaschutzverordnung
8. Ausblick auf geplante Änderungen
a) Vorschlag einer Corporate Sustainability Reporting Directive („CSRD“)
b) Vorschlag für eine EU-Ökodesign-Verordnung
c) Vorschlag für eine Verordnung über Batterien und Altbatterien
d) EU-Sozialtaxonomie
IV. Nationale Rechtsgrundlagen
1. Öffentliches Recht
a) Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten („LkSG“)
b) Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz („TEHG“)
c) Brennstoffemissionshandelsgesetz („BEHG“)
d) Maßnahmen zur Reduktion von Abfall und Plastik
2. Steuerrecht: Fokus auf Transparenz zur Förderung nachhaltiger Investitionen
a) Offenlegungsvorschriften von DAC 6
b) Umsetzung der CSR-Richtlinie
a) HGB, AktG, SEAG und GmbHG
b) WpHG – Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
4. Arbeitsrecht
a) Umsetzung der Whistleblower- oder auch Hinweisgeber-Richtlinie (EU) 2019/1937 durch Hinweisgeberschutzgesetz
b) Erstes und Zweites Führungspositionen-Gesetz (FüPoG I und II)
c) Entgelttransparenzgesetz („EntgTranspG“)
d) Gesetz zur Umsetzung einer EU-Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union im Bereich des Zivilrechts
e) Sonstige arbeitsrechtliche Regelungen
5. Exkurs: Wettbewerbsrecht
6. Exkurs: Vergaberecht
7. Sonstige relevante Rechtsgrundlagen, insbesondere Lauterkeitsrecht – Greenwashing als Verstoß gegen das UWG
V. Multi-Stakeholder-Initiativen und ihre Bedeutung
1. Funktionsweise und Bedeutung
2. Unterschied zu Global Framework Agreements („GFA“)
3. Entwicklung des Multi-Stakeholder-Ansatzes durch die „Global Redesign Initiative“ des Weltwirtschaftsforums
4. Herausforderungen von Multi-Stakeholder-Initiativen
5. Chancen von Multi-Stakeholder-Initiativen
6. Responsible Business Conduct – OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Alignment-Prozess der OECD
a) Rolle und Funktion der OECD in der globalen Wirtschaft
b) Relevanz für Multi-Stakeholder-Initiativen und der OECD-Alignment-Prozess
7. Relevanz von Multi-Stakeholder-Initiativen in Deutschland
8. Zusammenfassung
VI. Fazit
§ 3 Exkurs: ESG und Kartellrecht
I. Einleitung
II. Problemstellung
III. Kartellrechtliche Konfliktfelder
1. Kartellverbot
a) Wettbewerbsbeschränkung
b) Ausnahme vom Kartellverbot
c) Zwischenfazit
2. Missbräuchliche Verhaltensweisen
3. Fusionskontrolle
IV. Fazit
§ 4 Standortfaktor Nachhaltigkeit – worauf es jetzt ankommt
I. Einleitung
II. ESG und Standortattraktivität: Drei Wirkungsebenen
1. Mikroebene: Besser fundierte Investitionsentscheidungen
2. Mesoebene: Wettbewerb um Transparenz
3. Makroebene: Marktwirtschaft und Momentum
III. EU: Fokus auf Regulatorik
IV. USA: Primat des Marktes
V. Vereinigtes Königreich: Transparenz setzt Maßstäbe
VI. Asien: Unentschieden
VII. Ausblick: ESG bleibt ein Moving Target – EU könnte mit Kapitalmarktunion punkten
§ 5 ESG – Politische Dimension am Beispiel der Finanzmärkte
I. Einleitung
II. Bedeutung nachhaltiger Geldanalagen im politischen Kontext
III. Bedeutung von ESG für die deutsche Politik – Die Staatsziele
IV. Sustainable Finance und ihre Regulierung in der EU und Deutschland
V. Herausforderungen und Chancen in der Regulierung
VI. Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
VII. Fazit und Ausblick
§ 6 ESG – Wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen
I. Einleitung
II. ESG und Unternehmen
1. Strategische Motive für ESG
a) Von der Shareholder-Theorie zu ESG
b) Rechtlicher Zwang zur Durchsetzung von ESG
2. Auswirkungen von ESG auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen
a) ESG und die finanzielle Leistung von Unternehmen
b) Attraktivität für Investoren
3. Herausforderungen und Gefahren
III. Fazit und Ausblick
§ 7 ESG-Berichterstattung – Konzept, ökonomischer Hintergrund und Entwicklung
I. Einleitung
II. Einführung der zentralen Begriffe
III. ESG-Berichterstattung als Informationsinstrument
1. Elemente der Unternehmensberichterstattung
2. ESG-Rechnungslegung (Impact Accounting)
3. Bewertung und Monetarisierung
IV. ESG-Auswirkungen und ESG-bezogene Risiken und Chancen
1. ESG-Auswirkungen
a) Umweltfragen
b) Soziale Fragen
c) Fragen der Governance
2. ESG-bezogene Chancen und Risiken
V. Herausforderungen und Grenzen der ESG-Berichterstattung
VI. Fazit
§ 8 Nachhaltigkeitsberichterstattung im Fokus der Regulatorik
I. Einleitung
II. Hohe Dynamik bei der Weiterentwicklung der Berichtspflichten
III. Corporate Sustainability Reporting Directive als Grundlage für verbindliche EU-Berichtsstandards
IV. EFRAG als europäischer Standardsetzer im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung
V. European Sustainability Reporting Standards („ESRS“) im Überblick
VI. „Global Baseline“ des International Sustainability Standards Board („ISSB“)
VII. Nächste Schritte zur Einführung der ESRS; ISSB-Agendakonsultation; Internationalisierung der SASB-Branchenstandards
§ 9 Nachhaltige Transformation – Ansätze für die Unternehmenspraxis
I. Einleitung
II. ESG-Regulatorik als Treiber für nachhaltige Transformation
1. Normative Kraft des Faktischen
2. Blaupause für das nachhaltig transformierte Geschäftsmodell
III. Integrative und holistische Umsetzung in der Unternehmenspraxis
1. Destillieren wichtigster Werttreiber und Verzahnung mit Strategie und Planung
2. Einbettung von Nachhaltigkeit in die Steuerung mit Key-Performance-Indikatoren („KPIs“) und Zielen sowie in die Entscheidungsfindung
a) KPIs und Ziele
b) Entscheidungsfindung
3. Ausgestaltung des Betriebsmodells – organisatorische Strukturen und Prozesslandschaft
4. Verankerung von ESG-Themen im Aufsichtsrat und in den Governance-Systemen
a) Verankerung von ESG-Themen im Aufsichtsrat
b) Die Verankerung von ESG-Themen in den Governance-Systemen
5. IT-Lösungen für ESG und verknüpfte (Daten-)Analysen
6. Verknüpfung von ESG mit der Equity Story
Teil 2 Besonderer Teil
§ 10 Allgemeine Bedeutung von ESG für Unternehmen in Deutschland
A. Rechtspflicht zu ESG-konformen Verhalten?
I. Einleitung
II. Gesellschaftliche Verantwortung im Zeitalter der Nachhaltigkeit
III. Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit
IV. Nachhaltige Corporate Governance
1. Situation bei der GmbH
2. Situation bei der AG
3. Situation im Falle des Nichtvorhandenseins einer CSR-Klausel in der Satzung: Recht zu ESG-konformen Handeln?
V. (Gesellschafts-)rechtliche Pflicht zu ESG-konformen Handeln
1. Situation bei der Aktiengesellschaft
2. Situation bei anderen Gesellschaftsformen
VI. Deutscher Corporate Governance Kodex
VII. Zukunftsvision European Corporate Governance
VIII. Zusammenfassung und Ausblick
B. Bedeutung von ESG aus Sicht des Aufsichtsrates
I. Einleitung
II. Einrichtung von ESG- und Nachhaltigkeitsausschüssen
1. Aufgabenbereich
2. Prüfungspflicht hinsichtlich nichtfinanzieller Erklärungen
3. Prüfungspflicht hinsichtlich der Erklärung zur Unternehmensführung
4. Thematische Verflechtungen bei den Ausschüssen
5. Vorsitz und Größe des Ausschusses
6. Gender-Diversität
III. Erfordernis einer Nachhaltigkeitsexpertise bei den Aufsichtsratsmitgliedern
IV. Zusammenfassung
C. Bedeutung von ESG aus Sicht des CFO
I. Einleitung
II. Finanzfunktion als Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg
1. Der CFO als Steward
2. Der CFO als Operator
3. Der CFO als Strategist
4. Der CFO als Catalyst
III. Fazit
D. Bedeutung von ESG aus Sicht des COO am Beispiel Chemieindustrie und Chemiedistribution
I. Einleitung
II. Nachhaltigkeit und ESG in der Chemieindustrie und Chemiedistribution
III. Konkretisierung der ESG-Herausforderungen am Beispiel OQEMA
1. Der CO2-Fußabdruck
2. Wesentlichkeitsanalyse
IV. Mögliche Hindernisse und Ausblick
E. Bedeutung von ESG aus Sicht des Leiters Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie
I. Die Herausforderung der Nachhaltigkeit in der Automobilbranche
II. Nachhaltigkeit bei der BMW Group
1. Management als Membranfunktion zwischen Außen- und Innenwelt
2. Der CO2-Fußabdruck in der Lieferkette
3. Politik und Globalisierung als Bestandteile der Nachhaltigkeitsstrategie
4. Integration statt „Add On“
III. Die praktische Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie bei der BMW Group
IV. Die Etablierung digitaler Prozesse
V. Governance und Accountability von Nachhaltigkeit
VI. Organisation
VII. Mitarbeiterdimension
VIII. Marken- und Kundendimension
IX. Fazit
§ 11 Bedeutung von ESG für ausgewählte Unternehmensbereiche
A. Strategieabteilung
I. Einleitung
II. Allgemeine Bedeutung von ESG für die Unternehmensstrategie
1. Interne Voraussetzungen: Haltung, Unternehmenskultur und Purpose
2. Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie oder Nachhaltigkeit als Unternehmensstrategie
III. Skizzierung Strategieprozess
1. Umfeldanalyse
2. Bewertung der Ergebnisse der Umfeldanalyse
3. Leitfaden der Nachhaltigkeits-Politik festlegen
4. Definition von Nachhaltigkeitszielen
IV. Festlegung der Umsetzung
1. Organisatorische Verortung der Verantwortung für die Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen
2. Umsetzungsmaßnahmen
3. Governance
4. Steuerung der KPIs
5. Berichterstattung und (interne/externe) Kommunikation
V. Fazit
B. Compliance
I. Einleitung
II. ESG: Frischer Wind für Compliance?
III. Compliance und Compliance-Management-Systeme
IV. Anforderungen von ESG aus Compliance-Sicht
1. Der (stetig steigende) rechtliche Rahmen
2. Selbstverpflichtungen
V. Integration von ESG-Anforderungen in das CMS
1. Kultur/Ziele
2. Organisation
3. Risiken
4. Programm
5. Schulung und Kommunikation
6. Überwachung und Verbesserung
VI. Fazit
C. Rechtsabteilung
I. Einleitung
II. Was nun, Rechtsabteilung?
1. Die Ausgangslage und die praktischen Herausforderungen
2. Abteilungsinterne Due Diligence
III. Auftrag im Unternehmen
1. Wie gestaltet sich die Risikoanalyse?
2. Auswirkung auf das Vertragswesen
3. Ausarbeitung von unternehmensinternen Richtlinien
4. ESG im Rahmen der Due Diligence bei M&A-Transaktionen
5. Verantwortung zur Beratung
6. ESG Litigation
IV. Fazit
D. Personalabteilung
I. Einleitung
II. Generelle Auswirkungen von ESG auf die Personalarbeit
1. Relevanz von Krisen für die gestiegene Bedeutung von ESG
2. Die ESG-Strategie als zukünftiger Schwerpunkt der Personalarbeit
3. Mission und Vision Statement
4. Employer Branding
5. Einbindung von ESG in die Unternehmenskultur
III. Die S-Komponente von ESG in der Personalarbeit
1. Bereits anerkannte soziale ESG-Anforderungen
2. Weitere mögliche soziale ESG-Maßnahmen
IV. Fazit
E. Finanzabteilung und Unternehmensfinanzierung
I. Einleitung
II. Einordnung der Begriffe Sustainable Finance/Climate Finance/Green Finance
1. Verschiedene Begriffsebenen
2. Historische Entwicklung
3. Zusammenfassung und Festlegung des Fokus im Rahmen dieses Kapitels (nachhaltige Finanzierungen aus Sicht eines Darlehensnehmers)
III. Produkte zur nachhaltigen Finanzierung
1. Darlehen
2. Nachhaltige Anleihen
IV. Ausgewählte praktische Überlegungen in Bezug auf die genannten Produkte
1. Green Default (Green Loan, Social Loan)
2. Kündigungsrecht bei Margin Ratchet (Festzins/variables Darlehen) („SLL“)
3. Datenbeschaffung und Reporting
4. Etwaige Interessenskonflikte
V. Motive zum Abschluss nachhaltiger Finanzierungen („DN“-/„DG“-Sicht)
1. Reputation
2. Druck der Anteilseigner und/oder Investoren
3. Marktkonforme oder sogar bessere Renditen durch Investitionen, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien getätigt wurden?
4. Überholte Geschäftsmodelle
5. Aufbau von Know-how und Best Practices
VI. Marktumfang und aktuelle Lage – Wie hoch ist der Marktanteil nachhaltiger Finanzierungen?
1. Anleihen
2. Darlehen
VII. Fazit
F. Unternehmenssteuerung und -berichterstattung
I. Einleitung
II. Verantwortung übernehmen – jenseits der Berichterstattung
III. ESG in der Unternehmenssteuerung und -berichterstattung
1. Überblick
2. Elemente des Kreislaufs einer ESG-Unternehmenssteuerung
3. Reifegrade einer integrierten Unternehmenssteuerung und -berichterstattung
IV. Messbarkeit von ESG – Implementierung aussagekräftiger KPIs
1. Überblick über die Messbarkeit von ESG-Aspekten
2. Steuerung und Berichterstattung nachhaltiger Produkte und Services
3. Steuerung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen
4. Nachhaltigkeit bei Investitionsentscheidungen
5. Weitere ESG-KPIs in der Steuerung und Berichterstattung
V. Aktuelle Herausforderungen und Grenzen
1. Inhaltliche Aspekte
2. Prozessuale und IT-bezogene Aspekte
3. Berichterstattung inklusive Abschlussprüfung
VI. Fazit und Ausblick
G. Interne Revision
I. Einleitung
II. ESG als neue Aufgabe und Rolle für die Interne Revision
1. Die Aufgaben der Internen Revision in Hinblick auf ESG
2. Die Unabhängigkeit der Internen Revision
3. Umsetzung von ESG-Themen: eine Aufgabe für die Interne Revision?
III. Das Audit Universe und der Prüfungsplan
IV. Prüfung oder Beratung?
1. Prüfung
2. Beratung
3. Deep Dive „Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung“
4. Weitere Aspekte
V. Fazit
H. Steuerabteilung und Steuerplanung
I. Einführung
II. Status quo der ESG-nahen Transparenzregeln auf internationaler, EU- und nationaler Ebene mit (mittelbarer) Relevanz für das Steuerrecht
1. Initiativen von supranationalen Regelungsgebern
2. Initiativen der Europäischen Union
3. Nationale Initiativen
III. Weitere „inoffizielle“ Transparenzinitiativen der jüngeren Zeit
IV. Strategische Ausrichtung der Steuerabteilung anhand von ESG-Kriterien?
V. Fazit
I. Beschaffung und Einkauf
I. Einführung
II. ESG in Beschaffung und Einkauf
1. Klassische Einkaufsverantwortung bei „Social“ und „Governance“
2. Erste Schritte zum E – „Environmental“
3. Aktuelle Nachhaltigkeitsagenda
4. Strategischer Aufbau von Einkaufsstrukturen
III. Fazit und Ausblick: Best-in-Class Procurement
1. Generelle Einkaufsstandards/-prozesse anpassen
2. Ganzheitliches Lieferantenmanagement bezüglich Emissionen etablieren
J. Produktion am Beispiel Textilindustrie
I. Einführung
II. Dimensionen und Abgrenzung von ESG in der Textilproduktion
1. Umweltspezifische Dimensionen
2. Sozialspezifische Dimensionen
3. Governance-Dimensionen
III. Instrumente zur Umsetzung und Sicherstellung von ESG in der Textilproduktion
1. Environment
2. Social
3. Governance
IV. Herausforderungen und Learnings in der praktischen Umsetzung von ESG
1. „Transparency is Key“ – Transparenz als Basis für eine nachhaltige Produktion
2. Spagat zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit in der Produktion und Profitabilität
V. Externe Anforderungen: Pflicht versus intrinsische Verantwortung
VI. Fazit
§ 12 Bedeutung von ESG für M&A und Private Equity Investoren
I. Einleitung
II. Relevanz von ESG für Private Equity
III. Der Einfluss von ESG als Treiber für M&A von Private Equity
1. Berücksichtigung von ESG im Rahmen von Unternehmensstrategien
2. Einfluss von ESG auf Finanzierung
3. Einfluss von ESG auf Unternehmensperformance und Bewertung
IV. Berücksichtigung von ESG im M&A-Prozess
1. Selektions- und Screeningprozess von Akquisitionsunternehmen
2. (Vendor) Due Diligence
V. Zusammenfassung
§ 13 Bedeutung von ESG für Ratingagenturen
I. Einleitung
II. Zunehmende Bedeutung von ESG für Kreditvergabe und Kreditrisiko
III. Kreditratings und Abgrenzung zu Nachhaltigkeitsratings
IV. Unterschiedliche Ansätze der ESG-Integrierung
V. Einfluss von ESG-Faktoren auf das Kreditrating
VI. Herausforderungen und Hürden
VII. Fazit
§ 14 Bedeutung von ESG für Banken
I. Einleitung
II. Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie einbeziehen
1. Der Handlungsdruck ist groß
2. Geschäftsumfeld und Rahmenbedingungen analysieren
3. Langfristige Perspektive
4. Messung der Zielerreichung
III. Transformationsfinanzierung
1. Investitionsbedarfe für die Transformation
2. Technologischer Wandel: Investitionsvolumina und Risiko steigen
3. Sustainable-Finance-Produkte
a) Marktstandards für nachhaltige Finanzierungen
b) Marktentwicklung
c) Sustainable-Finance-Beratung
4. ESG in der Risikoanalyse
a) Klima- und Umweltrisiken
b) Scoring-Modelle zur Beurteilung von ESG-Risiken
IV. Sektorstrategien: von Ausschlüssen hin zur zielgerichteten Portfoliosteuerung
1. CO2 als Steuerungsgröße für das Kreditportfolio
a) Berechnung der finanzierten Emissionen
b) Portfolioanalyse unter Dekarbonisierungsaspekten
c) Paris Agreement Capital Transition Assessment („PACTA“)
d) Science-based Target Initiative („SBTi“)
e) Portfoliosteuerung Richtung Net Zero
2. SDGs als Steuerungsgröße für das Kreditportfolio
3. Green Asset Ratio („GAR“) als Steuerungsgröße für das Kreditportfolio
a) Taxonomiefähigkeit
b) Taxonomiekonformität
4. Selbstverpflichtungen des Finanzsektors zu mehr Nachhaltigkeit
a) Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen („UNEP FI“)
b) Equator Principles („EP“)
V. Fazit
§ 15 Bedeutung von ESG für Wirtschaftsprüfer
I. Einleitung
II. Aktuelle Rechtslage zur nichtfinanziellen Berichterstattung durch Unternehmen
1. CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz
2. EU-Taxonomie-Verordnung
3. CSRD
III. Rolle des Abschlussprüfers bei der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung
IV. Fortentwicklung der Prüfungsmethodik zur Berücksichtigung der nichtfinanziellen Berichterstattung
1. Status quo der inhaltlichen Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung
a) Inhaltliche Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung außerhalb der Abschlussprüfung
b) Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung innerhalb der Abschlussprüfung
2. Ausblick
V. Weg zur integrierten Abschlussprüfung
VI. Fazit
§ 16 Bedeutung von ESG für Berater am Beispiel Rechtsmarkt
I. Einleitung
II. Dimension ESG in der Rechtsanwaltskanzlei als Unternehmen
1. Soft Law vs. Hard Law
2. Zertifizierungen
3. Netzwerke, Directories und Interessenvereinigungen
4. Umsetzung
5. Wirkungen
III. Dimension ESG als Beratungsgegenstand
1. Zunehmende ESG-Gesetzgebung
2. Minimierung von ESG-Risiken
3. Reichweite der Beratungspflicht
IV. Fazit
Definitionsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Sachverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
2DII
2 Degrees Investing Initiative
ABl.
Amtsblatt
ABl. EU
Amtsblatt der Europäischen Union
ACM
Authority für Consumers and Markets
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AktG
Aktiengesetz
AO
Abgabenordnung
APLMA
Aisa Pacific Loan Market Association
ARUG
Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie
ASEAN
Association of Southeast Asian Nations
AVV Klima
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen
B2B
Business to Business
BAFA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BANF
Bestellanforderung
BAT
Best Availabe Techniques
BB
Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie
BeckOK
Beck’scher Onlinekommentar
BeckOK GG
Beck’scher Onlinekommentar zum Grundgesetz
BEHG
Brennstoffemissionshandelsgesetz
BEPI
Business Performance Environmental Initiative
BEPS
Base Erosion and Profit Shifting
BfJ
Bundesamt für Justiz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGH
Bundesgerichtshof
BilanzRL
Bilanzrichtlinie
BilMoG
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilRUG
Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BKR
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
BMU
Bundesministerium für Umwelt
BSCI
Business Social Compliance Initiative
BT
Bundestag
BT-Drucks.
Drucksache des Deutschen Bundestags
BTAR
Banking Book Taxonomy Alignment Ratio
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BWD
Bundesverband der Wirtschaftskanzleien Deutschland
CAPEX
Capital Expenditures
CB
Compliance Berater (Zeitschrift)
CBAM
Carbon Border adjustment mechanism
CbCR
Country-by-Country-Reporting
CDP
Carbon Disclosure Project
CDSB
Climate Disclosure Standards Board
CEAP
Circular Economy Action Plan
CEFIC
Verband der europäischen chemischen Industrie
CFO
Chief Financial Officer
CGT
Common Ground Taxonomy
CH4
Methan
CLP
Classification, Labelling and Packaging
CMS
Compliance-Management-System
CO2e
Carbon Dioxide Equivalent
COO
Chief Operating Officer
COP
Conference of the Parties
COP-26
UN-Klimakonferenz in Glasgow 2021
COP-27
UN-Klimakonferenz in Scharm asch-Schaich
CSA
Corporate Sustainability Assessments
CSDDD
Corporate Sustainability Due Diligende Directive
CSDDD-E
Entwurf der Corporate Sustainability Due Diligence Directive
CSR
Corporate Social Responsibilty
CSR-RUG
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz
CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive
CSRD-E
Entwurf der Corporate Sustainability Reporting Directive
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
D&I
Diversität und Inklusion
DAC 6
EU-Richtlinie über grenzüberschreitende Steuergestaltungen
DCGK
Deutscher Corporate Governance Kodex
DEHst
Deutsche Emissionshandelsstelle
DEI
Diversity, Equity und/oder Inclusion
DelVO
Delegierte Verordnung
DG
Darlehensgeber
DIIR
Deutsches Institut für die Interne Revision
DN
Darlehensnehmer
DNK
Deutscher Nachhaltigkeitskodex
DNR
Deutscher Naturschutzring
DNSH
Do no significant harm
DR
Delegierte Rechtsakte
DrittelbG
Drittelbeteiligungsgesetz
DRS
Deutscher Rechnungslegungsstandard
DRSC
Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.
EBA
Europäische Bankenaufsicht
EBITDA
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
ED
Exposure Drafts
ED ESRS
Entwurft der European Sustainability Reporting Standards
EFFAS
European Federation of Financial Analyst Societies
EFRAG
European Financial Reporting Advisory Group
EFRAG SRB
EFRAG Sustainability Reporting Board
EIB
Europäische Investitionsbank
EIM
Environmental Impact Measurement
EntgTranspG
Entgelttransparenzgesetz
EP
Equator Principles
ERP
Enterprise Ressource Planing
ESEF
European Single Electronic Format
ESG
Environmental Social Governance
ESMA
European Securities and Markets Authority
ESRG
European Sustainability Reporting Guidelines
ESRS
European Sustainability Reporting Standards
ETR
Effective Tax Rate
EU-EHS
EU-Emissionshandelssystem
EU-ETS
EU Emissions Trade System
EU-Tax-VO
EU-Taxonomie-Verordnung
EU-ZuVO
Verordnung über die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten
EUGBS
European Green Bond Standard
EuGH
Europäischer Gerichtshof
Eurodad
European Network on Debt and Development
EUV
Vertrag über die europäische Union
EWKFondsG-E
Entwurf des Einwegkunststofffondsgesetzes
EWKVerbotsV
Einwegkunstoffverbotsverordnung
EWSA
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
EZB
Europäische Zentralbank
f.
folgende
ff.
fortfolgende
FCA
Financial Conduct Authority
FEM
Facility Environmental Module
FinDatEX
Financial Data Exchange Templates
FISG
Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität
Fn.
Fußnote
FMCG
Fast Moving Consumer Goods
FNG
Forum Nachhaltige Geldanlage
FONAP
Forum Nachhaltiges Palmöl
FoStoG
Fondstandortgesetz
FSC
Forest Stewardship Council
FSLM
Facility Social and Labor Module
FüPoG I
Erstes Führungspositionen-Gesetz
FüPoG II
Zweites Führungspositionen-Gesetz
GAP
Gemeinsame Agrarpolitik
GAR
Green Asset Ratio
GATJ
Global Alliance for Tax Justice
GBP
Green Bond Principles
GCCG
German Code of Coporate Governance
GenG
Genossenschaftsgesetz
GET
Geopolitik, ESG und Technologie
GFA
Global Framework Agreement
GFANZ
Glasgow Financial Alliance for Net Zero
GG
Grundgesetz
GHG Protocol
Greenhouse Gas Protocol
GLP
Green Loan Principles
GmbH-gebV
GmbH mit gebundenem Vermögen
GmbHG
Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GOTS
Global Organic Textile Standard
GRESB
Global ESG Benchmark for Real Assets
GRI
Global Reporting Initiative
GRS
Global Recycled Standard
GSSB
Global Sustainability Standards Board
GUF
Global Union Federation
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG
Geldwäschegesetz
HFKW
teilfluorierte Kohlenwasserstoffe
HinSchG-E
Hinweisgeberschutzgesetz-Entwurf
HY
High-Yield
IAS
International Accounting Standards
IASB
International Accounting Standards Board
IASE
International Standard on Assurance Engagements
IBA
International Bar Association
ICC
International Chamber of Commerce
ICESG
Instititut für Compliance & Environmental Social Governance
ICMA
International Capital Market Association
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland
IEA
International Energy Agency
IFA
Initial Factory Assessment
IFC
International Finance Corporation
IFRS
International Financial Reporting Standards
IIA
Institute of Internal Auditors
IIRC
International Integrated Reporting Council
IKS
Internes Kontrollsystem
ILO
International Labour Association
InsO
Insolvenzordnung
IOSCO
Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
IPPF
International Professional Practices Framework
IPSF
International Platform on Sustainable Finance
ISO
International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung)
ISSB
International Substainability Standards Board
ITW
Initiative Tierwohl
IWA
Impact-Weighted Accounts
KI
Künstliche Intelligenz
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KPI
Key Performance Indicators
KrWG
Kreislaufwirtschaftsgesetz
KSG
Bundesklimaschutzgesetz
KWG
Kreditwesengesetz
LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
LEH
Lebensmitteleinzelhandel
LkSG
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
LMA
Loan Market Association
LSTA
Loan Syndications and Trading Association
LULUCF
Land-use, Land-use-change and Forestry
M&A
Mergers and Aquisitions
MAR
Marktmissbrauchsüberwachung
MaRisk
Mindestanforderungen an das Risikomanagement
MAS
Monetary Authority of Singapore
MiFID II
Markets in Financial Instruments Directive
MitbestG
Mitbestimmungsgesetz
MLI
Multilateral Instrument
MMCF
Man-Made Cellulosic Fibers
MNE
Multinational Enterprises
MSA
Media and Stakeholder Analysis
MSI
Multi-Stakeholder-Initiative
MüKo-AktG
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz
MüKo-HGB
Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch
MüKo-UWG
Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht
N2O
Distickstoffmonoxid
NACE
Nomenclature of Economic Activities
NAP
Nationaler Aktionsplan
NDC
Nationally determined contributions
NEGU
Next Generation EU
NFRD
Non Financial Reporting Directive
NGFS
Network for Greening the Financial System
NGO
Non-governmental organization
nIKS
nichtfinanzielles internes Kontrollsystem
NJW
Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR
NJW-Rechtsprechungsreport (Zeitschrift)
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
OCS
Organic Content Standard
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
OWiG
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PA
Pariser Klimaschutzabkommen
PACTA
Paris Agreement Capital Transition Assessment
PBC
Peoples Bank of China
PCAF
Partnership for Carbon Accounting Financials
PCR
Post-Consumer Recycling
PCW
Pre-Consumer-Waste
PE
Private Equity
PESTEL
Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal
PFC
perlfluorierte Kohlenwasserstoffe
PIW
Post-Industrial-Waste
PLM
Produktlebenszyklusmanagement
PMN
Professional Management Network
PRB
Principles for responsible Banking
PRI
Principles for responsible Investment
PSF
Platform on Sustainable Finance
PSI
Principles for Sustainable Insurance
PTF-ESRS
Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards
RACI
Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RCS
Recycled Content Standard
REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
ROA
Return on Assets
ROI
Return on Investment
ROSC
Report on the Observance of Standards and Codes
Rn.
Randnummer
RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil
RWS
Responsible Wool Standard
SAC
Sustainable Apparel Coalition
SAI
Social Accountability International
SAQ
Self-Assessment Questionnaire
SASB
Sustainability Accounting Standards Board
SBG
Sustainability Bond Guidelines
SBM
Strategy and Business Model
SBP
Social Bond Principles
SBT
Science Based Targets
SBTi
Science Based Target initative
SC
Significant Contribution
SCCS
Supply Chain Certification Standard
SD-KPIs
Sustainable Development Key-Performance-Indicators
SDG
Sustainable Development Goals
SE
Societas Europaea
SEAG
Statut über die Europäische Gesellschaft (Societas Europaea)
SEC
US Securities and Exchange Comission
SEC
United States Securities and Exchange Commission
SF6
Schwefelhexafluorid
SFDR
Sustainable Finance Disclosure Regulation
SHEQ
Safety, Health, Environment, Quality
SLB
Sustainability-Linked Bonds
SLBP
Sustainability-Linked Bond Principles
SLL
Sustainability-Linked Loans
SLP
Social Loan Principles
SMETA
Sedex Member Ethical Trade Audit
SoCMS
Social Compliance-Managementsystem
SOX
Sarbanes Oxley Act
SPT
Sustainability Performance Targets
SR TEG
Sustainable Reporting Technical Expert Group
SRB
Sustainability Reporting Board
SSM
Single Supervisory Mechanism (Einheitlicher Bankenaufsichtsmechanismus)
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TBL
Tripple Bottom Line
TCFD
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
TCO2
Total Carbon Dioxide
TEG
Technical Expert Group
TEHG
Treibhaus-Emissionshandelsgesetz
TfS
Together for Sustainability
THG
Treibhausgas
TSC
Technical Screening Criteria
UN
United Nations, Vereinte Nationen
UN PRI
United Nations Principles for Responsible Investment
UN-FCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
UN-SDG
United Nations Sustainable Development Goals
UNDP
United Nations Development Programme
UNEP
United Nations Environment Programme
UNEP FI
Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
UNGC
United Nations Global Compact
UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights
USD
US-Dollar
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VBA
Value-Balancing Alliance
VC
Venture Capital
VCI
Verband der Chemischen Industrie
VDBO
Dutch Association of Investors for sustainable Development
VUCA
Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
WBCSD
World Business Council for Sustainable Development
WEF
Weltwirtschaftsforum
WM
Wertpapier-Mitteilungen – Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
WpHG
Wertpapierhandelsgesetz
WRI
World Ressources Institute
WWF
World Wildlife Fund
ZHR
Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZWW
Zentrum zur Weiterbildung und Wissenstransfer





























