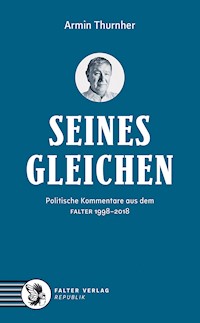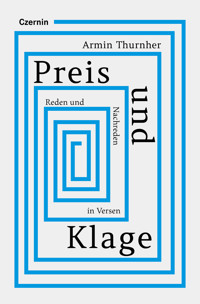
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Preisrede ist ein diskreditiertes Genre, beinhaltet sie ja zumeist freundlich gemeinte Verlogenheiten. Doch Armin Thurnher verblüfft als Laudator das Publikum mit Elogen in Hexametern und belebt so dieses missbrauchte Genre neu. In »Preis und Klage« sind nicht nur seine Lobpreisungen versammelt, sondern auch Nachrufe, satirische und an politischen Jubeltagen verfasste Hexameter. Die längeren und kürzeren Gedichte in »Preis und Klage« ergeben nicht nur das Bild einer anderen Seite von Thurnhers Schreiben, sondern auch ein Panorama österreichischen Geisteslebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Armin Thurnher
PREIS UND KLAGE
Reden und Nachreden in Versen
Armin Thurnher
PREIS UND KLAGE
Reden und Nachreden in Versen
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Thurnher, Armin: Preis und Klage. Reden und Nachreden in Versen / Armin Thurnher
Wien: Czernin Verlag 2024
ISBN: 978-3-7076-0841-0
© 2024 Czernin Verlags GmbH, Wien
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Autorenfoto: Irena Rosc
Druck: Finidr, Český Těšín
ISBN Print: 978-3-7076-0841-0
ISBN E-Book: 978-3-7076-0842-7
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
INHALT
Vorwort
LOBPREISUNGEN
Produktives Rätsel | Alfred J. Noll
Lob des Lotsen | Lothar Knessl
Schacht der Geschichte | Peter Huemer
Buchwerfer | Lojze Wieser
Gegen den Stream | Sven Hartberger
Prinz-Eugen-Straßen-Reich | Herbert Ohrlinger
Sprezzatura | Benedikt Föger
Nimmermüde Recherche | Florian Klenk
TOTENKLAGEN
Die Versäumte | Lida Winiewicz
Störrischer Sternblick | Karl Katzinger
Kälte und Wärme | Rudolf Burger
Spontaner Fels | Jan Tabor
König im Exil | Oswald Wiener
Ernst Blochs Erbe | Burghart Schmidt
Goscherte Freiheit | Rubina Möhring
Herausfordernd immer | Erhard Busek
Resistentia minor | Josef Ramaseder
Mann in Schwarz | Hermann Nitsch
Ironie und humaner Glutkern | Willi Resetarits
Wohlwollend flüchtig | Hans Magnus Enzensberger
Eleganz und Melancholie | Ulrich Weinzierl
Überflugmeister | Peter Weibel
Rausch der Küche | Reinhard Gerer
Klar und kantig | Werner Korn
Film und Festigkeit | Kurt Mayer
Mitleid und Hybris | Christian Pilnacek
Bürger und Arzt | Werner Vogt
Fürst der Menschenrechte | Karl Schwarzenberg
GEMISCHTE EMPFINDUNG
Als Österreich Europa wurde
Zum 50-jährigen Maturajubiläum
An Österreich. Zum Nationalfeiertag 2020
Nationaler Anredner | Karl Nehammer
Menschgewordene Ruhe | Josef Egger
Falter-Kalender | Lisa Kiss
Elegie auf mich selbst
VORWORT
In welcher Versart Taten edler Helden
und Könige zu singen sich gezieme,
hat uns Homer gezeigt.
Horaz, Ars Poetica,
übersetzt von C. M. Wieland
Schon in der Mittelschule vermochte ich mich in Hexametern recht gut auszudrücken. Nicht nur im hohen Ton großer Epen, sondern durchaus auch parlando. Die sechshebigen Zeilen flossen nicht so schnell wie Prosa, aber sie flossen. So waren meine Schulkollegen auch nicht wirklich erstaunt, als ich ihnen zum 50-jährigen Maturajubiläum ein paar Hexameter vortrug. Schon bei der eigentlichen Maturafeier im Jahr 1967 hatte ich das Gleiche getan; damals noch eher humoristisch.
Das Publikum des Falter musste ebenfalls ab und zu mit Hexametern rechnen, bei ganz hohen Gelegenheiten, etwa nach der – damals gar nicht sicheren, am Ende aber mit Zweidrittel-Mehrheit überwältigenden – Zustimmung der österreichischen Bevölkerung zum EU-Beitritt.
Trotzdem schien es nicht ohne Risiko, eine Laudatio in Versform öffentlich vorzutragen, obgleich doch die Taten eines edlen Helden zu besingen waren. Mir waren prosaische Preisungen aber fad geworden, und das Objekt der anstehenden Lobrede, der Falter-Anwalt und Freund Alfred J. Noll, zog bereits, wie mir bekannt wurde, Erkundigungen ein, ob ich eh etwas Ordentliches zu seiner Preisung abliefen würde, einem Staatsakt im Steinsaal des Bundeskanzleramts.
Das gab den Ausschlag, es einmal zu wagen. Ich setzte mich hin und schrieb nicht nur Hexameter, sondern auch Preisstrophen in Form sapphischer Oden (hier nicht enthalten), schickte dem Ganzen zur Warnung des Publikums aber doch Folgendes voraus: »Nach dem Ende der Demokratie blieb im alten Griechenland als einzige zugelassene Gattung die Prunkrede übrig, die Rhetoren wurden von Kämpfern um politische Fragen zu Künstlern, zu gefeierten Stars, die von Stadt zu Stadt reisten, edel kostümiert, umgeben von einem Tross voller Spaßmacher und Schausteller. Ihr Kennzeichen war die Charis, die Anmut, von der das Wort Charisma stammt.
›Das Erste ist also, auf deine äußere Erscheinung die größte Aufmerksamkeit zu verwenden und immer schön angezogen zu sein. Sodann musst du fünfzehn oder höchstens zwanzig Wörter jeder Gattung auswendig lernen und dir so geläufig machen, dass sie dir immer wie von selbst auf die Zunge kommen … mit diesen schießt du bei jeder Gelegenheit auf die Leute los …‹ So beschreibt der Schriftsteller Lukian satirisch eine Endphase der attischen Redekunst, den Stil des Attizismus. Wer fühlte sich bei dieser Passage nicht an einige unserer politischen Protagonisten erinnert?
Der Makel, unpolitisch gewordener Ersatz zu sein, haftet seither jeder Lob- und Preisrede an. In dieser Verlegenheit sieht sich, wer eine Preisrede zu halten hat. Der heute zu Preisende entgeht der aufgestellten Falle gewöhnlich, indem er Kritik unter sein Lob mischt und dieses damit umso wertvoller macht. Ich möchte heute einen anderen Weg versuchen. Ich werde meine Hymne nicht abschwächen, sondern sie in gebundener Rede halten.«
Das Publikum reagierte zuerst verblüfft und applaudierte nach einer Schrecksekunde begeistert. Das gab mir Mut, weiter so zu verfahren. Auch bei Lothar Knessl und Peter Huemer leitete ich meine Verse noch vorsichtig prosaisch ein. Später legte ich einfach los.
Zu Knessl sagte ich: »Wie soll man einen ehren, der nicht nur ein Autor ist, sondern nur halb insgeheim auch ein Dichter? Ich habe den Verdacht, dass der Auftrag auch deswegen an mich erging, weil darin sich die – allerdings nicht ausgesprochene – Hoffnung verbarg, ich würde eine Form finden, die dem Jubilar angemessen wäre.
Ich habe es jüngst einmal gewagt, das diskreditierte Genre der Lobrede durch den Versuch zu retten, die Versform wiederzubeleben; in der avanciertesten Lyrik sind derzeit vermehrt Rückgriffe auf antike Formen zu beobachten. Als Amateur der Poesie bin ich unsicher, aber gewiss, mich mit Knessl, wenn nicht auf dem gleichen Dampfer, so doch auf dem gleichen Ozean zu befinden. Als Dilettanten sind mir strengere Formen gerade recht, um ein missbrauchtes Genre wie die Preisrede wiederzubeleben, diese glatte Piste freundlich gemeinter Verlogenheiten. Im Vergleich zu Pindar’schen Versmaßen, zu alkäischen und asklepiadischen Strophen kommt der Hexameter einigermaßen zu Fuß daher; doch mag er mir helfen, Geschwätzigkeit zu vermeiden, womit ich Knessls Temperament hoffentlich entgegenkomme. Die Schwierigkeiten dabei sind vermutlich entfernt jenen verwandt, die zeitgenössische Komponisten beim Schreiben einer Fuge empfinden würden. Ich tröste mich damit, dass es eben einem Gebrauchsgenre dient, in dem die Prosa bessere Dienste, also schlechtere Arbeit leistet als das Versmaß, das Gedanken ordnet und diszipliniert. Ich will sie also wagen, die Form des hexametrischen Preislieds. In der Hoffnung auf Ihr Verständnis halte ich mich dabei, wie Sie hören werden, an die aufgeweichte Klopstock’sche Form des Hexameters. Wer verträgt schon zum 90. Geburtstag einen Daktylenregen!«
Bei der Rede auf Peter Huemer ergänzte ich: »Ich habe mich nämlich entschlossen, ab heuer meine Preisreden nur mehr in Versform abzufassen, und zwar in Hexametern. Ich bin mir der Gefahr der Verwildgansung bewusst, nehme sie aber in Kauf.
Aus mindestens fünf Gründen: Erstens kann der Spezialfall der etwas in Verruf gekommenen Preisrede ein wenig formale Disziplin vertragen. Zweitens stellte ich fest, dass die gebundene Rede bei der Zuhörerschaft mehr Aufmerksamkeit beansprucht als Prosaisches. Drittens interessiert sich die mediale Öffentlichkeit in Österreich für meine Reden sowieso nicht, man braucht also keine mundfertigen Zitate anzubieten. Viertens ist es eine Herausforderung für mich, auch in dieser Form zu sagen, was ich will. Fünftens zeigt es dem Preisträger, dass ich mir für ihn wenigstens ordentlich Mühe gegeben habe.
Die Versform verlangt bei manchem wörtlichen Zitat kosmetische Eingriffe wie leichte Umstellungen, dafür bitte ich um Verständnis. Ebenso bitte ich Sie und den Geehrten um Nachsicht, sollte ich Ihnen mit meinem Versuch auf die Nerven gehen.«
Dem ist wenig hinzuzufügen, außer vielleicht – da aus Anlass der vollkommen zu Unrecht skandalisierten Trauerrede auf Christian Pilnacek sogar ins Treffen geführt wurde, allein die Tatsache eines Trauergedichts stelle bereits eine Respektlosigkeit dar –, dass ich Texte in gebundener Rede vielmehr als einen Versuch betrachte, Respekt auszudrücken, sei es in Lob oder Klage; eine Anstrengung, die Gepriesenen und Beklagten gleichermaßen gilt.
Der erwähnte Skandal blieb die Ausnahme. Obwohl ich bei jeder Elegie fürchtete, die Gefühle von Hinterbliebenen zu verletzen, wurde mir meist Dankbarkeit zuteil. Wofür wieder ich mich bedanke. Es tut mir leid, dass diese Sammlung von Klagereden nicht vollständig ist; manchen Nachruf habe ich aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, in Versen auszuführen. Wichtige Freunde starben, ehe ich mit Elegien begonnen hatte. Nicht alle hier elegisch Besungenen waren Freude, aber alle standen mir nahe. Lese ich dieses wachsende Mausoleum, wird mir klar, es stellt nicht nur eine Klagemauer dar, sondern auch den vergeblichen Versuch, dem eigenen Ende ein Wehr entgegenzusetzen.
Die hier versammelten Texte sind entweder öffentlich gehaltene Reden oder unter dem Titel »Elegie« veröffentlichte, in meinem 2020 begonnenen Blog »Seuchenkolumne« erschienene Artikel. Obwohl Elegien klassischerweise in Distichen abgefasst werden (ein Beispiel findet sich doch im Buch), stand das jahrtausendealte Genre von Anfang an auch anderen Versmaßen offen. Einige der berühmtesten Elegien erschienen bekanntlich teilweise in Blankversen.
Für das Wagnis, ja die Zumutung, den hymnischen Ton zugunsten eines prosaischen Stils zu verschmähen und den heroischen Hexameter gleichsam journalistisch zu gebrauchen, bitte ich um Verzeihung. »Wir machen es, obwohl sie uns alle dafür prügeln werden«, sagte der Verleger Benedikt Föger, als ich ihm das Manuskript anbot. Ich, in diesem Plural mit eingeschlossen, bin sicher, er hat recht. Umso mehr danke ich ihm, dass er das Buch trotzdem gemacht hat, und dem Team des Verlags, das sich der nicht ganz einfachen Aufgabe stellte.
Die Texte wurden höchstens in Details verändert; die Sammlung ist beinahe vollständig. In Teil drei finden sich Texte, die sich nicht an öffentliche Personen richten oder sich nicht ins Schema »Preis / Klage« fügen.
A. T.
Oberhöflein, 1.11.2023
LOBPREISUNGEN
Sie priesen glänzende Reihen
Himmlischer Jünglinge selig
Friedrich Gottlieb Klopstock,
Der Messias
PRODUKTIVES RÄTSEL
ALFRED J. NOLL*
Lasst mich zuerst bedenken das Wesen des Publizierens;
fremd bleibt’s uns Östreichern meist; die anderen, denken wir,
werden’s für
uns schon machen. Wir schieben’s auf sie und denken
uns gleichmütig
stolz unser Teil und lassen die anderen reden. Das nennen wir
nationalen Charakter. So leben in einer Abschiebe-
Demokratie in mancherlei Sinn wir. Wie anders unser
Preisträger! Öffentlich sei die Demokratie oder gar nicht,
Alfred Noll braucht niemand das zu erklären. Immer
offen Stellung zu Fragen von Recht und Unrecht nimmt er.
Staat und Verfassung sind seine Themen, die Philosophie des
Rechts Fundament, der Gesellschaft Fortschritt ständige Absicht.
Als wir einander zum ersten Mal trafen, sagte sogleich er,
Recht sei Gerechtigkeit nicht. Naturgemäß ging’s um ein Vorhaben,
eines, das niemals endet, man nennt’s die Verbess’rung des Landes.
»Sisyphusmühe« höhnen es manche, hohl tönt ihr Hohn, und so
lasset sie höhnen; wir bleiben beim Schönen, bleiben bei Alfred!
Schön? Eleganz des Widerstands, linkshändig leicht geführte
Schläge, bekanntlich entscheiden just diese. Der Plumpheit der
Rechten, dem
Grauen der Guten, Fadesse der kompromittierten Mitte, was
soll man dagegen versuchen, als elegant zu denken?
Öffentlich elegant zu denken? Sich zeigen, in Fragen, die
alle betreffen? Vor Publikum? Da zieh’n die meisten den Mief
vor, die
Lufthoheit unter dem Stammtisch, so nannt’ es Franz Schuh.
Aber nicht Alfred
Noll. Rhetorik, die Kunst, vor Publikum sein Interesse zu
artikulieren, ist nicht Artistik oder Narzissmus. Nein.
Frisch und frech seinen Standpunkt vertreten, vor Publikum, unsere
Alten nannten es Politik. Lasst mich preisen also in
diesem Sinn den Homo politicus Alfred Noll. Vor dem
Richter glänzt er mit improvisiertem Argumentieren,
macht uns zu Zeugen der Fertigung seiner Gedanken. Manchen
Rechtsstreit hast du gewonnen für uns und gegen die Rechten,
grundsätzlich argumentiertest du immer, auch das wäre wohl eines
Preises würdig für Publizistik; Foren findest du
überall, in den Medien zumal. Ich erinnere, wie du das
Präsidentenamt zur Debatte stelltest, mit Manfried
Welan früh uns auf das Problem verwiesest. Wie du in
Fragen der Raubkunst, von Koalitionen oder des Rundfunks, von
Ärztestreik oder Flüchtlingsverfahren das Wort nahmst.
Nun aber
kommen wir zur Kultur und zum Preis des heutigen Tages. Zwar
etwas gewunden scheint die Begründung der Jury; Nolls Wirken
mache den Ruf nach der Ultima Ratio obsolet; aber
feiner scheint mir das Ziel des Gepreisten. Er sieht’s dialektisch und
will durch sein Öffentlich-Denken anderer Denken verändern.
Schaulaufen nennt man die Farce des öffentlichen Erscheinens;
besser träf’s Saulaufen! »Säue« doch heißt der Jargon jene Themen,
die er durchs Dorf treibt. Noll nimmt am Treiben nicht teil,
wohl aber
zielt er bisweilen auf so eine Sau und erlegt sie präzise. Der
Kampf um Subtilität streut leider oft Perlen vor Säue, und
oft verkommt er zum Ringkampf mit Säuen; ist er auch
schlüpfrig, nicht
immer kann man und will man ihn fliehen. Alfred schon gar
nicht. Als
Ringer spielt er fünf Rollen. Herausgeber, erstens,
Gesprächspartner
zweitens, Autor drittens, viertens Public Person und
fünftens Jurist. Es fallen oft viertens und fünftens zusammen; der
Autor spielt mit hinein. Doch scheint mir nicht recht, dass er den
anderen gegenüber scheinbar zurücktritt. Fruchtbar in
allem ist Noll, Herausgeber Walther Rodes, Stifter des
gleichnam’gen Preises, Spiritus Rector von Zeitschriften, helfende
Hand für Filmproduzenten, Radio-Befrager von Schreibenden,
Stütze Verlegern, Einsprecher, in Verfassungsdebatten
Argumentenfregatte, Fernsehperson für Panels,
Talkshows und alle Formate, Autor von Fachbuch um Fachbuch,
kundiger Kommentator und Rechtsphilosoph. Wir staunen.
Selbst auf das Digitale lässt er sich ein und postet, als
gäb’ es kein Morgen; das, lieber Alfred, macht mir ein wenig
Sorgen; nicht des Hohns aller Twitteranten und Facegebookten
wegen; auch brauchen die digitale Sphäre wir jenseits des
Social-Medellín-Kartells. Aber Zeit! Woher kommt sie?
Gieße sie nicht in die Lethe aus Null und Eins! Die lockt mit der
Lust des Narziss, und alles und nichts vergisst sie … was tu ich?
Loben will ich, nicht Mahnen! Ja, vieles könnt ich noch nennen,
was zum Kulturpreisgekrönten dich Publizisten empfiehlt.
Doch bei
all dem schien mir der Schriftsteller unziemlich unterschätzt.
Vom
Autor Noll lasst also mich reden. Fünf Bücher möchte ich
nennen, von einunddreißig auf Wikipedia. Deshalb die
Sorge um deine Zeit! Wann schriebst du all das? Ein Rätsel. Wer
führt die Kanzlei? Halbjährlich erscheinen derweil deine
Bücher. Das
Buch »Antigone« nenn’ ich als Erstes. »Recht wider Recht« im
Drama des Sophokles. Schien auch der Untertitel dunkel, war’s
einfach doch. Die Jungfrau stand auf der Seite des alten
Rechts, und Kreon, der Herrscher, auf Seiten des Staats,
der Moderne.
Klar, dass Noll Antigone darin den Beistand verweigert.
Klug und subtil war’s, gelahrt und keineswegs psychologisch.
»Kannitz« – damit verblüfftest du uns literarisch. Der Autor
habe einen Beruf und betätig’ sich doch publizistisch: Im
Falter der Rezensent, sonst ohne Neigung zu hiesigen
Schreibern, merkt an, man unterhalte sich besser bei diesem
»rechtsphilosophischen Kammerspiel« als bei »manchem
Erzählprofi«.
Mochte schon sein, doch nebenbei ging es um eine Parabel.
Kannitz erhält vom Juden Hoffer dessen Vermögen zur
treuen Verwaltung, da dieser Hoffer das Land verlassen muss,
Neunzehnsiebenunddreißig. Hoffer verunglückt, dem ratlosen
Kannitz, einem Beamten, bleibt alles. Wie ihm geschieht, weiß
der genauso wenig, wie danach der Staat etwas wusste, von
dem, was ihm blieb. Die Rückgabe von Geraubtem, für Noll war’s
Work in progress, mit wechselndem Fortschritt, nicht ohne Fortüne.
Nun aber zu was ganz and’rem. Wie unpassend hier diese Floskel!
Heidegger – bête noire mit den schwarzen Heften – Noll macht ihn
platt: von Anfang an Nazi, Antisemit bis zum Ende – nach
fünfundvierzig kein Wort der Distanz. Ein Buch wie
ein Hammer.
Rechten Werkmeister nanntest du ihn, den Faschisten, wer
hinfort ihn
schwurbelnd zitiert, kann nicht sagen, er hat nicht gewusst, was
er tut. Selbst
Gegner loben Sorgfalt und Wahl von Nolls Zitaten. Die
brechen gleich Räubern hervor, wie es Walter Benjamin lehrte,
jäh und entwaffnend. Mord mit wissenschaftlichen Mitteln.
Noch eins. Noll lebt sich ein in die Zeit seiner Protagonisten. In
unserer, sagt er, ist’s fade, was Denken betrifft vor allem.
»Unsre Musik«, entfuhr’s ihm verblüfft, als von Couperin ich was
spielte. Mit »uns« meint’ er sich und John Locke, den englischen
Vater des
Liberalismus. Ihn kritisiert er in seinem neuesten
Buch, John Locke, den Patron aller Freiheit, vornehmlich privaten
Eigentums. Wo diese hinführt, wo jene herkommt, wissen wir
besser dank Noll nun. Solche Bücher schreibt er, um klassische
Texte sich anzueignen, und bildet so sich und uns mit.
Unsere Zeit, nôtre temps, den Titel trägt einer der schönsten
Tänze Chopins; unter Blumengirlanden Kanonen, sagt man –
die Mazurka spiel ich ein andermal dir. Antigone,
Kannitz, Heidegger, Locke – erst vier Bücher sind’s? In Arbeit