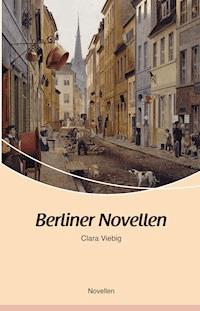Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Clara Viebig zeigt sich in diesem Roman als Meisterin der Erzählkunst. Farbig und voller Leben schildert sie jene Zeit des Umbruchs, in der alter Standesdünkel und moderne Aufklärung, schwerfällige Bürokratie und idealistische Zukunftsträume aufeinander prallen. Vom Mönchsleben im Prümer Kloster über die Straßenszenen beim Einzug des neuen Kurfürsten in Trier bis zu den Gelagen des geflüchteten französischen Adels auf Kosten ihres kurfürstlichen Verwandten, entfaltet Clara Viebig einen fesselnden Bilderbogen über die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts in unserer Region.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Prinzen, Prälaten und Sansculotten
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Der Text entspricht, außer geringfügigen orthographischen Korrekturen, dem der Erstausgabe von 1931, verlegt bei der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart.
I.
Um die zwei hochragenden Türme der Abteikirche Prüm stäubte Schnee. Kein richtiger weicher Winterschnee mehr, der Türme und Dächer, Häuser und Höfe, Ställe und Mauern, all die ausgedehnten Baulichkeiten und Gärten der Abtei in fleckenloses Weiß hüllte und auch das Städtchen Prüm, das wie ein gehorsames Kind zur gebietenden Herrin aufblickte, gleichsam in Watte packte. Schon zeigte die Februarsonne Kraft und leckte am Weiß, bis es zu schmutzigem Grau wurde in zähem Brei; aber den Wind hier oben bändigen, das konnte sie noch nicht. Der fauchte und pustete und rüttelte mit kräftigen Händen am schweren eisenbeschlagenen Tor, das den Vorhof des Klosters verschloß. Zugig und kühl war es hier auf dem Rücken der Eifel, darum ließen die Mönche, wenn’s auch drinnen bei ihnen gut warm war – mächtige Kloben brannten – ihr Haar wachsen. Man sah kaum mehr eine blanke Tonsur und die vorgeschriebene Rasur. Wenn das dem Prior Eusebius so recht war, wen ging’s dann etwas an?!
Der Prior saß heute in seinem Sorgenstuhl mit umwölkter Miene; er verdaute, aber nicht wie sonst in schläfrigem Behagen. Und doch war das Mittagsmahl recht gut gewesen, ein echt sonntägliches: Erbsensuppe mit Pökelbeilage, Pastete, Rindfleisch, als Beiessen allerlei Saures; und Leber und Bratwurst, Kalbsbraten, Schweinekopf, Brustkern und Westfälischer Schinken, je nach Wahl.
Dem Prior war’s trocken im Mund: pfui Teufel, der Schinken war zu salzig gewesen. Und hart. Nie und nimmer aus Westfalen bezogen – ein ganz gemeines Eifeler Schwein. Auf die Knie mit dem Koch – acht Tage lang jeden Morgen um vier Uhr sechs Rosenkränze mit nackten Knien auf den eiskalten Fliesen vorm Altar des heiligen Benediktus!
Er schluckte, er hatte bitteren Geschmack auf der Zunge: mochte der von Sankt Maximin, der von Sankt Mattheis, von Sankt Marien und Sankt Gervasius, sie alle, die da auf einem Haufen zu Trier hockten, die Äbte, die Pröbste, die Dechanten, die hohe und niedere Klerisei des ganzen Ober- und Niedererzstiftes, gehorsam ja sagen zu allem, was der neue Herr nun aufbringen würde, er, der Abt von Prüm, hatte seinen eigenen Kopf. Nun, da der Alte verstorben war – Gottlob, der Johann Philipp hatte sich nicht viel gekümmert! – nun war es an der Zeit, höchste Zeit, die Rechte der gefürsteten Abtei Prüm auf Selbstverwaltung durchzusetzen. Wer wußte denn, was der neue Kurfürst für einer war! Eile tat not, verbrieft und versiegelt mußten die Rechte sein, damit dem gar nicht erst der Gedanke kam, es könnte mit der Selbstverwaltung der Abtei sich vielleicht doch anders verhalten. Aber da wollte das Domkapitel, das jetzt in der Zwischenzeit als Statthalter regierte, einem Schwierigkeiten machen?! Es stieß dem Prior Eusebius sauer auf. Heute morgen, ja, heute morgen war ein Schreiben des Oberchorbischofs, des Freiherrn von Schmidtburg, bei ihm eingetroffen, worin ihm, ohne seiner vorangegangenen Proteste auch nur Erwähnung zu tun, kurz mitgeteilt wurde, daß Abgesandte demnächst erscheinen würden, um im Namen des Domkapitels von der Abtei Besitz zu ergreifen. Daß sie der Teufel hole!
Eusebius war aufgesprungen und riß jetzt am Klingelzug: wie konnte der Lümmel sich nur unterstehen und den Pökel so scharf machen! »Zu trinken«, herrschte er den herbeigeeilten dienenden Bruder an. Aber auch einige Becher besten Graachers löschten ihm den Brand nicht, er war zu wütend. Erbärmlich genug, daß die weltlichen Beamten der Abtei und die Gemeinden, die zu ihr gehörten, bereits der Statthalterschaft den Eid der Untertänigkeit geleistet hatten – er, der Konvent, tat das nicht! Und wenn es ihm gehen sollte, wie einstmals dem Prior Kosmas Knauff, dem tapferen Kämpfer gegen die Einverleibung der Abtei ins Erzstift – Bewaffnete hatten den aus dem Mittagsschlaf gerissen, in Schlafrock und Pantoffeln in einen Wagen geworfen und mit siebzehn Mönchen auf dem Ehrenbreitstein bei Koblenz eingelocht – auch er, der Prior Eusebius, war fest entschlossen, nicht nachzugeben, sich aus allen Kräften zu widersetzen: »Wir verweigern den Einlaß.« – –
Am hellichten Mittag des folgenden Tages schon schlug es ans große Tor, daß dessen Eisenbeschläge dröhnten. Der Bruder Pförtner, der verstohlen durchs Fensterchen lugte, fragte erst gar nicht, wer draußen sei, er sah’s ja: Soldaten. Und einer stand breitbeinig vornean und verlangte großschnäuzig Einlaß: »Im Namen der Statthalterschaft!«
Einlaß – erzwingt ihn euch, wenn ihr könnt! Der Prior hatte gut vorgesorgt. In dieser Nacht, als das Städtchen schlief und alles rundum, hatten die Mönche, ob dick oder dünn, ob alt oder jung, ob schwerfällig oder behende, ob flink oder träge, alle hatten Steine heranschleppen müssen vom nahen Steinbruch. Sie hatten ihr langes Gewand gehoben, es zusammengefaßt und dahinein gepackt, wie die Weiber in eine Schürze. Und der gestrenge Prior fuhr alle paar Augenblicke unter sie, schwang das Strickende mit den Knoten, das er um seinen stattlichen Leib trug: »Voran gemacht, flink, noch flinker, immer voran gemacht! Wer am fleißigsten schleppt, darf morgen ausschlafen, braucht nicht in die Frühmesse!« Das ließen sie sich denn gesagt sein, schleppten und schleppten, rannten in den Hof, schütteten aus und rannten wieder zum Steinbruch zurück, mühten sich und schwitzten, und der Mond goß ihnen sein kühles Silber auf die zugewachsenen Tonsuren. So schleppten sie, bis der Mond schlafen gegangen war und der Morgenstern hinter Frühgewölk blinzelte.
Aber jetzt lagen nun auch im Klosterhof mächtige Steinhaufen, lagen da hübsch sortiert: große Brocken und kleinere Brocken, recht kantige Steine. Man brauchte nur zuzulangen je nach Bedarf. Und eine Brustwehr hatten sie errichtet, von der aus man gut schleudern konnte über die Mauer.
Und nun rächten sich die Konventualen für die ausgestandene Mühsal der Nacht. Wie beim Springtanz am Fest der springenden Heiligen, so hüpften sie vor und zurück und wieder vor und zurück, Stein auf Stein sauste über die Mauer, polterte nieder und traf oft hart. Den Stürmenden wurde es ungemütlich, auf so etwas waren sie nicht gefaßt. Schon taumelte hier einer, taumelte dort einer, griff sich an den Kopf oder an Schulter und Bein und hinkte zurück. Blut tropfte warm und rot in zertretenen schmutzigen Schnee.
Der befehlende Offizier fluchte zornrot: ausräuchern, ausräuchern das verfluchte Nest! Aber die Soldaten wollten so recht nicht heran. Manch einer von ihnen war hier in der Gegend zu Haus: weh, die frommen Brüder! Wenn einem das nur nicht gerechnet wurde zur Sünde!
Der Angriff wurde matter und matter, aber lebhafter, immer lebhafter die Verteidigung. Der Koch hatte heut seinen großen Tag, die gestrige Ungnade hatte sich gewandelt in höchste Gunst. Denn was an Kesseln und Kasserollen in der Klosterküche vorhanden war, hatte er übers Feuer gehängt, eine Glut gemacht, daß die Essen rauchten. Bottiche, Zuber, Eimer wurden geschleppt: kochendes Wasser, viel kochendes Wasser. Die Unterköche und Bratenwender, die Kapaunenstopfer, Gänsemäster und Käsebereiter, Forellenfänger und Bienenzüchter, alle trugen zu. Eimer flogen von Hand zu Hand wie bei Feuersgefahr, die große Spritze wurde in Richtung gebracht. Und der Prior ließ spritzen.
Nicht lange, und der Waffenstillstand begann. Der Bevollmächtigte hatte zum Rückzug blasen lassen.
Drinnen im Kloster jubelten sie: gesiegt, wir haben gesiegt! So waren sie nun drei Tage lang fröhlich, als seien sie alle voll Weines. Und das waren sie auch, denn der Prior hatte ein Faß freigegeben, ein großes und gutes. Er selber aber verblieb in Sorge: was nutzte ihm der Widerstand und sein Sieg, schon war der neue Herr nicht mehr fern, er war schon unterwegs. Und ein Kurfürst war der, mit einer Verwandtschaft so hoch und allmächtig, wie sie noch keiner hier vor ihm gehabt hatte. Wie wäre auch ohne solche Verwandtschaft dieses Prinzlein von Sachsen, dieser junge Mensch, der kaum in den Priesterstand getreten war, zu seiner hohen Würde gekommen? Seine Mutter war mit Österreich nah verbunden, eine Base der Maria Theresia – da war nichts zu wollen. Sein älterer Bruder der Schwiegersohn von Maria Theresia, da war erst recht nichts zu wollen. Ein Kuhhandel, ein ganz gemeiner Kuhhandel! Das schrieb auch sein Freund, der Abt Gerold von Sankt Maximin – ein Bote hatte ihm eben ein geheimes Briefchen von dem gebracht – »Österreich hat sich dadurch nun sicheren Sitz und Stimme in Deutschland erkauft. Auch Seine Heiligkeit hat starke Pression auf diese Wahl ausgeübt, selbstverständlich nur, um sich Österreich dadurch gefällig zu erzeigen.«
Der Prümer kniff blinzelnd die Augen zu und lächelte schlau, als er das las: ob sich Seine Heiligkeit da nicht doch irrte? War das sicher, daß Maria Theresias Sohn, der Kaiser Joseph, für den seiner Mutter erwiesenen persönlichen Gefallen, nun Seiner Heiligkeit ein willfährigerer und untertänigerer Diener sein würde? Doch das Lächeln verging ihm bald wieder: was gingen Kurtrier die Machenschaften der Großen an und was die hohe Verwandtschaft? Was hatte eigentlich so ein sächsischer Prinz hier im Erzstift zu suchen? Bisher waren die Kurfürsten immer aus dem geistlichen Adel des Erzstiftes selber gewählt worden. Warum hatten sie nicht den Boos von Waldeck gewählt, einen von hier, das wäre doch natürlicher und einzig richtig gewesen. Aber feige Gesellen, feige Gesellen! Eusebius begann laut zu schelten. Das Trierer Domkapitel hatte sich einschüchtern lassen. Sie hatten sich nicht getraut, bei der Protektion einen anderen zu wählen. »Denn entzückt ist man von der Wahl durchaus nicht«, schrieb der Maximiner. »Leicht wird der Neue es auf keinen Fall haben.«
Nein, das würde er auch nicht, dafür würde man schon sorgen. –
Es verschlug dem streitbaren Prior aber doch ein wenig den Atem, als ihm anderen Tages, da er kaum vom lang ausgedehnten Morgenschlaf erwachte, bekannt wurde, daß unten im Städtchen sich Soldaten einquartiert hatten, ganz heimlich während der Nacht. Und noch Hunderte kämen nach. Man sah sie schon herankriechen, ein Heerwurm, das Ende nicht abzusehen. Und Kanonen hatten sie mit. Die Soldaten des Kurfürsten waren da, die Kurtrierer Garde.
Der Prior riß die Augen groß auf: was, der Neue schon da?! Und schon Wind von der Sache bekommen? Und Truppen gegen ihn heraufgeschickt? Sapperlot, schnell bei der Hand, ganz tüchtig! Er grinste grimmig und fühlte etwas wie leise Bewunderung. Trotz aller Jugend doch schon ein Mann. Ob es klug war, dann weiter so die Zähne zu zeigen? Er war sich unschlüssig. Wenn das wirklich solch ein Energischer war, wie er es nach dieser ersten Probe zu sein schien, war es am Ende doch besser, man trat nicht zu eigenmächtig auf, sondern fügte sich – wenigstens scheinbar. Was man nachher tat, das würde sich finden. Wenn er dann in Trier zur Huldigung war – darum herumkommen würde er ja wohl nicht – dann konnte er mit dem Maximiner und den anderen Konfratres alles eingehend besprechen. Von nagenden Zweifeln, was am besten zu tun sei, hin- und hergezerrt, ging der Prior hinab in den Klosterhof.
Hier lagen noch Steine genug, die Spritze war auch da. Und die Mönche standen alle herum und wisperten erregt; als sie ihren Prior erblickten, verstummten sie.
Was war los, was hatten sie hier zu flüstern?
Soldaten! Soldaten, vom Kurfürsten geschickt! Einer war auf den Turm gestiegen, der berichtete aufgeregt: »Soldaten, Soldaten, nicht zu zählen! Und Kanonen!«
Was nun, aufmachen oder nicht aufmachen? Der Prior Eusebius kratzte sich hinter den Ohren: »Daß dich, daß dich!« Was sagten denn seine Mönche dazu?
Die einen waren fürs Aufmachen, die anderen dafür, erst Bedingungen zu stellen, denn was man erleben würde, wenn die Soldaten hier einbrächen, das wäre furchtbar. Denen war nichts heilig. Die Zellen wurden durchstöbert, kostbare Meßgewänder, herrliche Altardecken – Werke frommer Hände – herausgerissen aus den Schränken der Sakristei, der Kirchenschatz geplündert. Weh, und wenn sie dann erst in die Keller kamen! Die Fässer aufgeschlagen, ausgesoffen, und was sie nicht mehr trinken konnten, auslaufen lassen. Nein, besser man hielt sich so lange, bis es gelang, einen flinken Boten in die Nachbarschaft, ins Luxemburgische hinüberzuschicken, dort die nächste treugesinnte Truppe holen zu lassen zum Entsatz für die bedrängte Abtei.
Der Prior nickte zu diesem Vorschlag, aber sein Rücken war krumm, der alte streitbare Geist schien auf einmal von ihm gewichen. Als der kecke Koch wieder von »Spritzen« sprach und etliche der Brüder nach ihren Wurfgeschossen schielten, stand der Prior gesenkten Hauptes im Klosterhof – der Wind spielte mit seinen Haaren, es durchfuhr ihn frostig – und sagte kein Wort.
Da faßte die Mönche große Angst, sie liefen in die Kirche und warfen sich da auf die Knie. Die Orgel fing an zu brausen, flehende Stimmen erhoben sich; immer lauter, immer dringlicher angstvoller Chorgesang, murmelnde Bittgebete. Dazu das dumpfe Anschlagen der großen Glocke und das immerwährende Zetern der kleinen. Wie bei Feuersgefahr: zu Hilfe, zu Hilfe! –
Draußen wurden Kanonen in Stellung gebracht. Der Befehlshaber, den das Domkapitel diesmal geschickt, der Herr von Sohlern, lief erregt auf und ab: wozu noch so lange zaudern, Geplärr und Gebimmel anhören? Wenn sie nicht folgten, jetzt nicht gleich gutwillig aufmachten, dann der alten Abtei einen Kanonenschuß in den Bauch, daß sie übern Haufen fiel. Es sollte ihnen nicht so glücken wie das erstemal. Schon hob er die Hand, um das Zeichen zum Abprotzen zu geben, als es aus einiger Entfernung laut schrie: »Halt!« Und nochmals: »Halt, halt!« Einen Reiter sah man heranjagen, der ließ ein weißes Tuch flattern: »Befehl vom Kurfürsten, nicht schießen!«
Seine Kurfürstliche Gnaden waren beim Abt von Klausen zu Gast, dort war ihm zu Ohren gekommen, was hier oben geschah. Alle Feindseligkeiten sollten sofort eingestellt werden, das Militär hatte abzurücken.
Der von Sohlern fluchte, als er das eigenhändige Schreiben des neuen Kurfürsten las. Höchstderselbe wünschte nicht inmitten von Unfrieden seinen Einzug zu halten – ›nach diesem werden wir in gerechter Beilegung aller Schwierigkeiten der beleidigten Abtei Genugtuung zuteil werden lassen‹.
Der Prümer aber, als er solches zu hören bekam, rieb sich die Hände: ha, das Domkapitel würde eine schöne Nase kriegen! Schon war sein Rücken kein bißchen krumm mehr, er stand wieder ganz gerade. Und dann lächelte er, ein Lächeln, bei dem sich die Mundwinkel ein wenig verächtlich nach abwärts bogen. Am liebsten hätte er aus vollem Halse, triumphierend, laut herausgelacht: haha, also so einer, nur so einer war der Neue?!
II.
Als Klemens Wenzeslaus, jüngster Sohn des Kurfürsten Friedrich August von Sachsen und durch des Vaters polnische Königskrone auch königlicher Prinz von Polen und Litauen, noch ein Vierjähriger war, zeigte er nach Meinung seiner Mutter schon das an, zu dem er berufen war. Er kratzte nicht, er schlug nicht, wehrte sich nicht ungebärdig, stampfte nicht mit den Füßen, war in den Krankheiten, die er durchmachen mußte, geduldig, bei Spielen nicht wild, bei Vergnügungen nicht laut und zu seiner jüngeren Schwester Kunigunde von nachgiebiger Zärtlichkeit. Ein selten liebes Kind, zudem von so hübschem Äußeren, daß keiner seiner vier älteren Brüder ihm auch nur im geringsten gleichkam. Auch die vier älteren Schwestern kaum, obgleich sie als schöne Prinzessinnen bekannt waren. Die Mutter hatte drei von ihnen denn auch schon gut verheiratet, als der kleine Klemens Wenzeslaus noch in seinen seidenen Kniehöschen und reich besticktem Fräckchen über die spiegelnden Parketts des Dresdener Schlosses trippelte. Maria Amalia war vermählt mit dem König von Neapel, Maria Anna mit dem Kurfürsten Maximilian von Bayern, Maria Josepha mit dem Dauphin Ludwig von Frankreich.
Der junge Prinz lernte leicht und lernte gern. Als er älter wurde, beschäftigte er sich ebenso eingehend mit den Wissenschaften wie einer, der davon leben muß. Mit aller Bildung seiner Zeit ausgerüstet, präsentierte sich der sächsische Prinz an den ihm verwandten Höfen. Nicht nur bei den Schwestern war er gern gesehen. Da seine Mutter sehr dafür war, daß er viel reiste, kam er überall herum; die stolze Mutter, Maria Josepha von Österreich, hätte ihn am liebsten selber überall herumgezeigt, war er doch der Sohn, von dem sie sich am meisten versprach. Am österreichischen Hofe übernahm ihre Base und Freundin, Maria Theresia, höchst selber seine Präsentation, sie schenkte dem jungen Neffen mit dem noch mädchenhaft zarten Gesicht und den schönen schwarzen Augen ihre ganz besondere kaiserlich-königliche Huld. Sie lobte der Mutter die Bescheidenheit des jungen Mannes und dessen kluge Zurückhaltung, die dennoch durchschimmern ließ, daß er viel gelernt hatte.
Trotzdem der Prinz am österreichischen Hofe so gern gesehen war, war es ihm doch nicht gelungen, die Hoffnungen seiner jüngsten Schwester Maria Kunigunde auf eine Heirat mit dem Vetter Joseph – oder war es die Kaiserkrone, die sie lockte? – zu verwirklichen.
»Du hättest mehr für die Gundel tun müssen«, sagte die Mutter. Warum hatte er den kaiserlichen Vetter nicht öfter einmal die Miniatüre sehen lassen, die der berühmte sächsische Hofmaler Dieterich kürzlich von der in erster Jugendschöne prangenden Prinzessin auf Elfenbein gemalt hatte? Er hätte diese entzückende Miniatüre im Busen tragen und bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit unterm Jabot vorrutschen lassen können; Joseph hätte sich sicher verliebt. Der Sohn sah die Mutter verwundert an: solch kleine Listigkeit der Frau Mutter zu tadeln, gedachte er nicht – welche Mutter täte nicht alles im Interesse der Tochter? – aber er, wie sollte er auf so etwas kommen?!
Klemens Wenzeslaus kam auch nicht darauf, daß er für die Damen am Hofe besondere Anziehungskraft hatte, sowohl in Wien wie beim Schwager Maximilian in München. Manch heimlich sehnsüchtiges Blicken galt ihm. Die französischen Schönen aber zeigten es ganz offen und ungeniert; es lockte die großen Damen am Versailler Hofe als etwas Neues und ihrem schon Müdegewordensein als erregender Kitzel, diesen jungen Prinzen das Spiel der Liebe zu lehren.
Liebe – Liebe –?! War es Liebe, was Klemens Wenzeslaus empfand, als er zum erstenmal seine Lippen auf das zarte Händchen der Komtesse de Marlinières drückte? ‹La Merveilleuse‹ wurde sie nur genannt – w ar sie denn nicht auch ein Wunder von Schönheit und Anmut? Vierzehn Jahre erst, die jüngste, aber auch die Schönste von allen Damen, die am Hof Ludwigs XV. glänzten, schöner als die Pompadour es jemals gewesen war, schöner als alle anderen Mätressen. Der Prinz fühlte ein Zittern, ein rasch aufflammendes Begehren, als sie nach einem Tanz ihre viel bewunderten tiefblauen Augen mit einem seltsamen Blick lange in die seinen senkte, und mit einem Lächeln, das ihren lieblichen Mund noch lieblicher machte, wie ein zärtliches Kind schmeichelte: »Vous êtes très-aimable, mon prince.« Sie trug durchs lose gebauschte, weiß gepuderte Haar eine Rosengirlande geschlungen – Rosen im Schnee – so sah er sie in Gedanken immerfort. Aber seine Schwester, die Dauphine, hätte es doch nicht nötig, gehabt, ihn zu warnen, er fühlte es selber: hüte dich! Wer war und woher stammte la Merveilleuse? War sie wirklich die Tochter des Grafen von Marlinières oder war sie seine Geliebte – oder am Ende gar beides? Was wußte man vom Grafen von Marlinières, besaß der wirklich die großen Güter in der Bretagne, von denen er Wunderdinge fabelte? Niemand hatte die je gesehen. Und ein Spieler war er auch. Jedenfalls war die schöne Merveilleuse bestimmt, die nächste Favoritin des Königs zu werden. –
Nie hatte Klemens Wenzeslaus sich in einen Liebeshandel so tief verstrickt, daß der nicht leicht zu lösen gewesen wäre. Merkwürdig, daß er heute, jetzt, als er von Mainz aus über den Hunsrück fuhr, um am gleichen Abend noch die Abtei Klausen im Moselgebiet zu erreichen, an derlei längst vergessene und begrabene jugendliche Sündhaftigkeiten denken mußte. Er war fest davon überzeugt gewesen, als er die Weihen erhalten hatte, alles Weltliche und jeden Gedanken daran abgestreift zu haben. Nichts mehr von dem Menschen war an und in ihm, der er einstmals gewesen war. Es machte ihn fast stutzig, daß ihm heute, nun er dem Antritt seiner hohen Berufung entgegenging, einer Berufung, die ihn nicht nur zu höchsten geistlichen Würden erhob, sondern ihm neben der Mitra auch die Kurfürstenkrone aufs Haupt setzte, daß ihm zu solcher Stunde manches wieder aufstieg, was weit, weit hinter und unter ihm lag.
Wer kann für Gedanken? Sie sind zudringlich wie die Fliegen des Sommers, man scheucht die von sich, und sie kommen doch wieder und wieder, kleben sich an Stirn und Hände und quälen. Ja, quälen! Klemens Wenzeslaus fuhr sich über die Stirn. In das Hufeklappern der vier Pferde vorm Reisewagen, die auf dem steinigen Boden der Straße – eine Straße, eigentlich nicht Straße zu nennen – ein ständiges hartes Klippklapp machten, mischte sich ihm das Knattern von Gewehrfeuer, das flüchtende Trappeln unzähliger Menschen- und Pferdebeine und fern das dumpfe Dröhnen der Geschütze, alles so, wie er es als kaiserlich-königlicher Feldmarschalleutnant auf dem Rückzug aus der Schlacht bei Torgau gehört hatte.
Ihn überlief’s: oh, das war schrecklich gewesen! Stürzende Gäule, stürzende Menschen, die, auf dem Boden liegend, verwundet, halb zertreten, doch noch zu kämpfen versuchten. Sterbende – Blutgeruch – Pulverdampf – Ächzen und wildes Schreien – und in sich selber, als einzig klar Empfundenes: du taugst nicht hierher, wär’ nur alles vorbei! –
Er war in der Schlacht von Torgau gestürzt; nicht verwundet, aber vom fallenden Pferd beinahe zu Tode gequetscht worden. Langes, sehr langes Krankenlager, viele Wochen dumpfen Hindämmerns. In halber Bewußtlosigkeit schwebende Gestalten, Blumenranken im lose gebauschten gepuderten Haar – ah, Rosen im Schnee, Rosen im Schnee! Und andere Gestalten: die Gundel, die Mutter – oder waren es Engel an seinem Bett?
Die fromme Mutter betete ständig am Lager des Sohnes, und auch die pflegenden Nonnen beteten Tag und Nacht. Nach dieser schweren Niederlage war es Maria Josepha leicht geworden, den Sohn für den geistlichen Stand zu gewinnen. Warum denn auch nicht geistlich werden? Der eben dem Tod Entronnene, vom sanften Dämmer der Genesung noch Umdunkelte, empfand es wie eine Wohltat: Friede im Schoß der Kirche, Friede mit Gott und den Menschen. Es war alles schon vorbereitet, es wurde ihm recht bequem gemacht.
Wie rasch war dann doch alles gegangen! Der auf dem holprigen Wege in schleudernder Kalesche ständig Geschaukelte lächelte in sich hinein: eine Karriere, eine große Karriere, und so leicht gemacht wie ein Spiel. Kaum, daß er genesen, schon die erste Tonsur und ein Wählbarkeitspatent für irgendein deutsches Bistum. Das Freisinger Domkapitel wählt ihn zum Bischof; neun Tage danach ist er auch Bischof von Regensburg. Mit fünfundzwanzig Jahren dann – ein sehr junger Bischof – Koadjutor von Augsburg. Der Tod nimmt dem bisherigen Inhaber dieses Sitzes sogleich den Stab aus der Hand, und er wird nun Fürstbischof von Augsburg, erhält auch zugleich ein Wählbarkeitspatent für Kurtrier. Aber noch ehe seine Wahl zum Koadjutor daselbst sich vollzieht, macht der alte Johann Philipp von Kurtrier die Augen zu, und die Bestätigungsbulle für Klemens Wenzeslaus trifft ein – nun ist der junge Koadjutor Erzbischof.
Auszeichnung auf Auszeichnung, Erhöhung auf Erhöhung, wie ein goldener Regen hat sich’s über ihn ergossen. In einem leichten Schauer schließt der Lächelnde die Augen. Und dann beruft ihn Joseph II. – römischer König und deutscher Kaiser – läßt sich von ihm trauen mit der bayrischen Prinzessin, der Schwester des Kurfürsten Maximilian; und Josephs Bruder, den Erzherzog Leopold, muß er auch trauen mit der Infantin von Spanien. Große Familienfestlichkeiten an den verschiedenen Höfen – alle sind sie mit ihm und untereinander verwandt – glanzvolle Tage, rauschende Nächte – und nun, und nun?! Das Höchste, was er erreichen kann, hat er erreicht: Erzbischof und Kurfürst, geistlicher und weltlicher Herrscher zugleich. Und erst achtundzwanzig! Die Haare noch braun und dicht, die Augen noch scharf und ungetrübt. Wo war einer in so jungen Jahren schon auf gleicher Höhe wie er?! Ein Hochgefühl hob des Kurfürsten Brust und jagte rotes Blut in das ein wenig bleiche Gesicht, das fein war und edel, mit hoher Stirn und klugen Augen. Was würde er nicht noch alles schaffen können – erschaffen! Bildung auch denen bringen, denen sie bis jetzt nicht gebracht worden war. Die Schulen verbessern, auch ins entlegenste Dorf Lehrkräfte setzen, Gymnasien und Universität auf eine höhere Stufe heben, allzu üppigen Klöstern etwas wegstreichen und überheblichen Adel beschränken. Bessere Wege bauen, damit die Menschen, die fernab wohnten – ein unwillkürlicher lauter Ruf entfuhr ihm.
Der Wagen hatte sich plötzlich zur Seite geneigt – krach – der Kutscher peitschte auf die Pferde, die zogen auch an, aber nun abermals: krach, krach. Geschrei. Auf die Seite gestürzt lag der Reisewagen in einem tiefen Wasserloch, gerade noch, daß der hohe Herr herausspringen konnte. Die vier Pferde, erschreckt, entsetzt, bäumten sich, schlugen die Luft mit den Vorderhufen, versuchten umsonst festen Grund zu fassen, rutschten ab und schnaubten wild. Schon lag das eine Deichselpferd, nun das zweite, die Vorspanngäule rissen sich los – Deichsel zerbrochen, Stränge zerrissen, wie toll geworden jagten die Pferde über die Heide, Enden des Zaumzeugs hinter sich dreinschleifend.
Klemens Wenzeslaus war beim hastigen Sprung auf die Knie gefallen, elastisch war er aber bereits wieder auf, ehe jemand ihm half. Da stand er barhäuptig, der Wind der ungeschützten Höhe riß ihm das Barett vom Kopf und wehte ihm den Puder aus den Haaren. Mit vielem Lamentieren putzten die Kammerdiener, die auf den Karrenrädern des offenen Gepäckwagens sicherer gefahren waren, an dem beschmutzten Reisemantel von Hochdero Kurfürstlichen Durchlaucht herum.
Dem Offizier der Begleitmannschaft hatte der Schrecken die Sprache verschlagen: wie würde er nun vorm Domkapitel bestehen, das ihm, gerade ihm in Erkenntnis seiner persönlichen Bravour und adligen Herkunft die Auszeichnung von Hochdero Abholung hatte zuteil werden lassen. »Haben Kurfürstliche Gnaden auch keinen Schaden genommen?« brachte er endlich heraus.
Klemens Wenzeslaus lachte, schlank, fast jünglinghaft stand er: keine Besorgnis, ihm war nichts geschehen. Aber man würde nun wohl zu Fuß gehen müssen bis zum nächsten Dorf, wo man den Schaden reparieren lassen konnte.
Der Offizier stammelte etwas von: kein Dorf, kein Stellmacher, von Reparatur keine Rede. »Halten zu Gnaden, Kurfürstliche Durchlaucht, diese Wege sind eigentlich keine Wege.«
Das waren ja entsetzliche Zustände, viel schlimmere, als man sich vorstellen konnte! Zustände, wie er sie noch nirgendwo angetroffen! Fröstelnd zog Klemens Wenzeslaus den weiten Mantel fester um sich und drückte das Barett wieder aufs Haupt. Ohne daß er selber die Füße setzte, wurde er vorangeblasen.
Schweigend zog das Gefolge hinterher. Mehrere Soldaten der Eskorte waren zurückgeblieben und mühten sich bei dem umgestürzten Reisewagen.
Daß es hier noch so kalt war! Kein treibendes Gräschen, winterhart noch der Boden, so weit man sehen konnte, öde Heide und sumpfige Moore und schier undurchdringlich scheinende Wäldermassen. Die Füße stolperten im dürren Gestrüpp.
»Frieren Kurfürstliche Durchlaucht auch nicht?« wagte der Hauptmann zu fragen.
Klemens Wenzeslaus schüttelte stumm verneinend den Kopf. Ihm war nicht mehr kalt, steigender Unwille hatte ihm warm gemacht und machte ihm immer noch wärmer. Also so hatte man hier gesorgt: keine Fahrstraße angelegt, nicht einmal ein geebneter Weg zum Gehen! Armes Land! Und Windbruch im Walde, riesige Stämme lagen umgestürzt und versperrten modernd den Weg. Keine Durchforstung, keine Sorge für den kostbaren Wald. Und was war hier geschehen zur Orientierung des Wanderers, der Reisenden, die Waren zu befördern hatten? Nicht einmal Wegweiser. Und wo waren Dörfer und Äcker? Nichts, gar nichts war da. Von Menschen keine Spur.
Und doch hörte man jetzt plötzlich dünnes Geläut, ein Kirchtürmchen spießte aus Wälderkronen spitz wie eine Nadel. Der Angelus läutete, der Kurfürst bekreuzigte sich. Gott sei Dank, hier wohnten also doch Menschen, die beim Himmel Trost suchten in ihrer erbärmlichen Abgeschiedenheit! –
Das Dorf war noch erbärmlicher, als er’s erwartet hatte. Hütten aus Lehm zusammengepatzt, Dächer aus Schindeln, klaffende Lücken mit Moos verstopft, winzige Fensterchen mit Lumpen verhangen. Die Jauchgrube dicht vorm Haus noch gefroren, trotzdem der dampfende Mist durch Fensterchen oder Tür daraufflog. Ein ärmlicheres Dorf hatte er niemals gesehen.
Aber selbst hier hatten die Menschen gehört: ein neuer Herr kommt ins Erzstift. Nun war er schon da – heute – hier! Sie waren aus ihren Höhlen, die nur der Brodem der zusammengedrängten Familie und der Dunst des Viehs heizte, herausgelaufen. Da standen die Männer nun an ihren Misthaufen, die Mütze demütig in der Hand, und die Weiber mit den zugebundenen Köpfen, nackte Füße in derbgenagelten Schuhen, bleichwangige, dickköpfige Kinder am Halse oder am Rock, lehnten am Eingang und gafften mit offenen Mäulern. Ein paar Dreiste rührten verstohlen von hinten an den pelzverbrämten Mantel.
Der Kurfürst trat beim Pfarrer unter, der hatte die einzige menschenwürdige Behausung. Aber ärmlich war sie auch und roch nach Schimmel und kalter Feuchte. Das Pfarrerchen versank bald vor Ehrfurcht und Rührung, daß der Durchlauchtigste Herr so gnädig und leutselig zu ihm sprach. Ja ja, die Gemeinde war schon arm, aber doch noch nicht so arm wie andere Gemeinden; die so weit abwohnen, die sind alle arm. Und gar so klein war seine Pfarre auch nicht, das Nachbardorf gehörte noch dazu. Zwei Stunden war’s bis dahin, wenn man sich auskannte. So hielt er denn sonntags die Frühmesse hier und die Predigt dort, oder die Frühmesse dort und das Hochamt hier. Im Winter war freilich der Besuch bei Kranken und Sterbenden ein wenig umständlich, wenn der Schnee hoch lag und die Wölfe frech waren.
War es möglich, solch eine Existenz?! Und in den Klöstern wurde geschlemmt! Klemens Wenzeslaus schlug sich vor die Stirn, er konnte die Mühsal solchen Lebens gar nicht fassen. Dem Pfarrerchen beide Hände auf die Schultern legend, sprach er: »Ich gebe Ihm eine bessere Pfarre!«
Der arme Pfarrer verzog das Gesicht erschrocken: hatte er sich etwa beklagt? Nein, nein, er klagte doch nicht, er war ja so zufrieden hier, so glücklich, er wollte gar nichts anderes haben, um Gottes willen nicht, dreißig Jahre war er nun hier, jung hergekommen, alt hier geworden, ganz verwachsen mit allem und allen. Oh, nie mehr würde er sich woanders eingewöhnen! Angstvolles Wasser trieb es ihm in die Augen, er knickte tief ein: wenn Hochdero Gnaden ihn hierbelassen wollten, er bitte untertänigst darum.
»So bleib Er!« Der Kurfürst wandte sich ab, gerührt und verdrossen zugleich: welch ein Tiefstand, gar keine Kultur! Ganz anders mußten die Geistlichen vorgebildet werden, blöde Bauernjungen zu Priestern zu machen, das war wider den Zweck. Er wartete sehnlich darauf, wieder fortzukommen. Mit großen Schritten durchmaß er den engen Raum, ihn beklemmte das hier.
Draußen harrte die Menge, Männer, Weiber, alte und junge, und Kinder. Drinnen war Er! In ehrfürchtigem Schweigen verharrten sie, aber sie drängten näher und näher der Haustür zu in großer Erwartung.
Klemens Wenzeslaus war ans Fenster getreten, viele Augen starrten ihn an. Da ging er hinaus und prallte fast zurück vor dem Geruch der Armut, der ihn selbst hier in der freien Luft empfindlich traf. Und so vieles seinen Schönheitssinn Beleidigende hatte er noch niemals beisammen gesehen. Wie waren die Gesichter dieser Menschen mager und hart gegerbt! Die Weiber, obwohl sie alle alt schienen, hatten noch Säuglinge an der Brust, selbst Mädchen, fast Kinder noch, sahen schon so alt aus. Und es gab da welche mit vereiterten Augen und viele mit einem Kropf. Schrecklich, so häßlich zu sein! Seine Stirn zog sich zusammen: kamen die Soldaten mit seinem Wagen denn immer noch nicht?
O diese Armen! Er fühlte Mitleid, erhob die Hand und machte das Zeichen des Kreuzes über sie: »Dominus vobiscum.« Aber sie rührten sich nicht. Was erwarteten sie denn, was wollten sie noch außer seinem Segen? Fast verlegen wandte er sich, um ins Haus zurückzutreten, da faßte ein Weib, vor ihm niederkniend, nach seinem Mantel, er mußte stehenbleiben. Und zwei, drei, vier Weiber, alle streckten auf einmal ihre Hände aus, hielten sie bittend wie Opferschalen, in die der reiche Mann sein Scherflein legen soll.
Ach, die bettelten?! Es enttäuschte ihn etwas. Nervös suchte er in seinen Taschen.
Der erste Regen von Münzen löste einen Jubelschrei aus. Nun zeigte auf einmal die stumpfe Menge, die bis dahin so bewegungslos verharrt, lebhafte Bewegung. Die Gesichter der Weiber röteten sich, auf einmal waren die gar so häßlich nicht mehr, sie zeigten ein verschönendes Lachen: Geld! Selbst die kleinsten der Kinder hielten ihre Händchen hin.
Ach, er wünschte diesem armen Volk ja mehr, viel mehr zu geben als solch geringe Schätze. Klemens Wenzeslaus hatte alles verteilt, was er an Geld bei sich hatte. Nun wandte er sich ab mit einem erlösten Seufzer: Gott sei Dank, dort kam ja endlich sein Reisewagen!
Aber es war nicht möglich einzusteigen. Die Kalesche hinkte wie ein lahmer Gaul. Pferde durfte man sich gar nicht getrauen vorzuspannen, Soldaten zogen und schoben die Kutsche. Aber auch auf dem offenen Gepäckwagen zu sitzen, gelüstete den Herrn nicht: war denn kein Pferd für ihn da? »Ich werde reiten!«
Der Offizier bot gehorsamst sein Pferd an: der Wallach ginge tadellos und wäre fromm, wenn der Herr Kurfürst dem die Ehre antun wollten? Er hielt selber die Steigbügel.
Mit einiger Mühe schwang sich der Kurfürst hinauf. Der Wallach war hoch, auch hinderte ihn sein weiter, langwallender Mantel. Der Kammerdiener zupfte an dem herum. Der Hauptmann stand Todesangst aus: die Sache würde doch gut ablaufen?
Aber nun saß er richtig. Und nun ging es, ging sogar sehr gut. Klemens Wenzeslaus fühlte eine geheime Lust; seit seiner Krankheit war er nicht mehr geritten: es war doch herrlich, dies warme pulsende Leben unter sich zu fühlen. Er ließ sein Pferd traben und schlug dann, als der Boden weich wurde, einen Galopp an. In seiner Seele war ein stetes Auf und Nieder: oh, diese armen Menschen, die er eben verlassen hatte! Das arme alte Pfarrerchen! Aber der Mann hatte vielleicht recht, bei guter Jahreszeit war es am Ende ganz schön hier oben. Alter Buchen- und Eichenbestand, Bäume so hoch, als trügen sie auf ihren Wipfeln den Himmel. Und stärkende Luft. Ihm kam die Landschaft auf einmal nicht so öde mehr vor. Zur guten Jahreszeit ging es den Leuten hier auch besser, ihre Kühe kalbten, ihre Hühner legten Eier, der Wald brachte Beerenobst, sie machten Heu und hatten leichtere Verbindung mit der Welt. Es nahm ihm eine Last von der Seele, als er das dachte. Er ließ den Wallach die Hacken fühlen, so daß der unruhig sprang.
»Wenn Serenissimus die hohe Gnade hätten«, erklang die Stimme des Hauptmanns, »den Gaul etwas fester in die Zügel zu nehmen. Die Luft wird mild, man merkt schon die Mosel. Gleich geht es steil hinab.«
»Ich verstehe zu reiten.« Das klang ziemlich ungnädig. Klemens Wenzeslaus fühlte sich korrigiert, und das ärgerte ihn. Freilich, es war nur gut gemeint von dem Menschen.
In der Tat, es war hier ein heikles Reiten. Schiefriger Schotter prasselte unter jedem Huftritt, oft setzte sich das Pferd beinahe auf die Hinterbeine. Aber das gab dem Reiter die gnädige Stimmung wieder. Nur wie man da mit einem Wagen hinauf und hinunter wollte, das setzte ihn in Verwunderung, die Straße war ja wie mit Steinplatten beschlagen – nun, solcher Tierschinderei sollte ein Ende gemacht werden!
Der Februartag fing an, sich seinem Ende zu neigen. »Die Weinberge«, erklang plötzlich die Stimme des Hauptmanns in ein langes Schweigen hinein. »Sehen Kurfürstliche Durchlaucht?« Hölzerne Stöcke waren ringsum aufgetaucht wie ein Heer von Speeren. »Nicht allzulang mehr, und wir haben Piesport erreicht, unseren berühmten Weinort an der Mosel; schon sieht man in der Ferne die Krümmung des Flusses. Wenn es dunkelt, sind wir in Klausen.«
Und das war auch gut. Denn jetzt fühlte Klemens Wenzeslaus, daß er lange nicht mehr geritten war.
III.
Ein paar Tage Rast waren in der Kanonie Klausen vorgesehen. Der Kurfürst wünschte, sich in Sammlung und stiller Andacht an diesem würdigen Ort würdig vorzubereiten. Klausen, wo in der Kirche des heiligen Eberhard das wundertätige Bildnis der schmerzhaften Mutter Gottes, die alle Schmerzen des Leibes und der Seele heilt, hängt, wird seit Hunderten von Jahren viel besucht. Scharen von Wallfahrern mit Kreuzen und Fahnen, mit frommen Gesängen und Litaneien ziehen heran, wenn die Apfelbäume ums Kloster rosig blühen, oder wenn um Mariä Geburt die Früchte dran reifen und das grüne Gras mit dem zarten Lila der Herbstzeitlosen bestickt ist. Jetzt war es ganz still hier. Die Stille, die Klemens Wenzeslaus gewünscht hatte, und die ihn doch fast peinvoll berührte. War man nicht wie begraben hier? Der Abt war freilich schon alt, in den Runen seines Gesichtes stand nichts mehr vom Leben. Ein sehr frommer Greis, ein sehr würdiger Greis. Als der Alte auf der Schwelle des Eingangs stand, sich tief vor seinem Gast verneigend, zog Klemens Wenzeslaus ihn empor und küßte ihn mit dem Bruderkuß. Aber es durchschauerte ihn, als seine Lippen etwas berührten, das kühl war, schier ohne Blut und wie Pergament.
Es war keine erfreuliche Nachricht, die ihn hier empfing. Kaum daß der Kammerdiener Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht den weiten Reisemantel abgenommen hatte, brachte der Abt diese Nachricht vor: zu Prüm auf der Eifel tobte ein Krieg. Wie damals Kosmas Knauff, so hatte der jetzige Prior es auch versucht, durch offenen Widerstand seine Rechte durchzusetzen.
Klemens Wenzeslaus fuhr auf.
»Vergebens hat der Oberchorbischof von Schmidtburg im Auftrage des statthaltenden Domkapitels Unterwerfung verlangt«, sprach ruhig die alte, kühle Stimme weiter. »Es ist, Gott sei’s geklagt, zu offenen Feindseligkeiten gekommen. Die Konventualen haben sich gegen den Befehlshaber, den Herrn von Sohlern, und seine Soldaten mit Steinwürfen verteidigt. Jetzt fahren die Angreifer Kanonen hinauf. Ich verstehe meinen Bruder Eusebius nicht« – der Alte schüttelte den Kopf – »ich verstehe aber auch das nicht: Kanonen vor einem Hause Gottes!«
Wie, Militär war nach Prüm geschickt worden, man hatte eine Belagerung der Abtei in Szene gesetzt? Und alles das, ohne seine Befehle erst einzuholen? Klemens Wenzeslaus stieg das Blut zu Kopf: das war ebenso ungebührlich vom Domkapitel, wie es ungebührlich vom Prümer Abt war. Und welch ein schlechtes Omen für den Beginn seiner Regierung – brennender Hader im eigenen Haus! Und ein lächerliches Schauspiel noch dazu, nicht nur Blamage für das Domkapitel und den Abt, nein, auch eine Blamage für ihn selber! Er war aufgesprungen, stieß den schweren Sessel hinter sich zurück, daß der polternd umstürzte, und ging in großer Erregung auf und nieder: höchste Zeit, daß er kam, eine junge Kraft. Sie waren allzu selbstherrlich geworden unterm alten Johann Philipp, sie mußten jetzt erst lernen, wer Herr ist. Seine Lippen bebten, immer rascher wurde sein Hin und Her.
Der Greis sah es mit müden Augen: ach, der war jung, noch viel zu jung! Einen älteren hätten sie wählen sollen und einen, der mit den Verhältnissen hier besser Bescheid wußte; der Domherr Boos von Waldeck wäre dem Prümer besser gewachsen gewesen und auch dem Domkapitel. Selbstherrlich, überheblich waren sie alle – ja, ja, er kannte sie, vor ihm, dem Alten von Klausen, taten sie sich ja keinen Zwang an. Mühsam erhob er sich aus dem Altväterstuhl, seine zittrigen Hände stützte er dabei auf den Tisch, stand so, vorgebeugt, eine ganze Weile und sah dem Heftigen mit seinem trüben Lächeln zu: ach, ach, der würde viel Mühe haben! So war mit dem Geist hier nicht zu rechten. Der dort war jung, kam aus der Ferne, der mußte viel, ach, sehr viel erst noch lernen! Der Greis murmelte vor sich hin, so, als spräche er zu sich selber, und lugte dabei doch nach dem Zornigen: »Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram!« Und dann nach einer Weile ängstlichen Beobachtens, noch eindringlicher und sanfter: »Ecce quam bonum et quam jucundum, habitare fratres in unum!« Hatte der Kurfürst das gehört?
Ja, der hatte das gehört und – verstanden.
Der Abt von Klausen schlief, die Augen waren ihm schon zugefallen, als er noch beim Nachtimbiß dem hohen Gast gegenübersaß. Der Kurfürst winkte lächelnd dem Bruder ab, der, erschrocken, den Greis wecken wollte. Sie sollten den alten Mann doch schlafen lassen. Schlafen, schlafen, wer das doch auch könnte! Die Nachricht von Prüm hatte Klemens Wenzeslaus sehr erregt.
Er war zwar müde, alle Glieder taten ihm weh, und doch wünschte er, daß man ihm noch die Kirche aufschließe. Die bloßen Füße in Sandalen, eine brennende Fackel in der Hand, glitt ein junger Bruder lautlos vor ihm her. Über dem Klosterhof schimmerte matt der besternte Himmel. Ah, welch schöne Nacht! Klemens Wenzeslaus fühlte ihre kühlen Hände beruhigend auf seiner noch immer glühenden Stirn. War es in solch einer friedlichen Nacht, in deren Schweigen die himmlischen Sterne ihren ewigen Weg zogen, unnahbar groß und erhaben, nicht eine Entweihung, an Menschenkleinlichkeit und Menschengezänk zu denken? Er fühlte sich nicht wert dieser Nacht, weil er solches Denken noch nicht loswerden konnte. Ach, wenn er erst drinnen sein würde in der Abgeschlossenheit der Kirche, ganz ins Gebet versenkt vorm Altar der Wundertätigen, dann würde das abfallen, was ihn jetzt quälte; Schmerzen waren es ja auch. Ach – er fühlte heiße Sehnsucht – allein sein im Dämmerschein der ewigen Lampe! Bekennen, daß man sich selbst noch unwert fühlt, damit man – er schrak zusammen.
Ein Schatten war hinter ihm hergeglitten, er hörte plötzlich verlegenes Räuspern und eine verlegene Stimme: »Halten zu Gnaden, mein Auftrag lautet, Höchstdenselben keinen Augenblick aus den Augen zu lassen, Höchstdenselben wohlbehütet und sicher in Trier abzuliefern. Es geht bereits auf Mitternacht, Kurfürstliche Durchlaucht, die Sicherheit ist nicht sehr groß hier in dieser Einsamkeit!«
Widerlich, der Hauptmann mit seiner Eskorte! »Legen Sie sich schlafen, ich bin hier ganz sicher.«
»Verzeihen, Kurfürstliche Gnaden – ich hafte mit meinem Kopf.«
Sie standen an der Kirchentür. Hastig riß der Kurfürst dem jungen Fackelträger den Kirchenschlüssel aus der Hand, schloß schnell auf und ebenso schnell wieder hinter sich zu: mochten sie nun die Pforte von außen bewachen. Jetzt war er allein, Gott sei Dank! Seine Schritte hallten im leeren Raum. Sein Schatten fiel groß vor ihn auf gespenstisch beleuchtete Steinplatten, um dann schnell wieder zu verschwinden in schwarzen Tinten. Sehr weit leuchtete das rötliche Licht der Ewigen Lampe nicht, es blieb vieles ganz unerhellt. Er tappte und suchte, stieß an Bänke und stolperte – aber da, da, wo von den Sternen draußen ein mildes Leuchten durchs Kirchenfenster fiel, da, überm Seitenaltar, das wundertätige Bildnis!
Hier hatten schon viele gekniet, Gesunde und Kranke, Mühselige und Beladene, Alte und Junge, Bürger und Bauern, einfältiges Volk, wie er es heute oben im Walde gesehen. Die Stufen vor dem Altar waren abgewetzt von fromm-küssenden Lippen, der Boden zeigte ausgehöhlte Vertiefungen von ungezählten Knien. Nun kniete auch er auf dem niedrigen Bänkchen hier: »Benedicta es tu, virgo Maria!« Sehnsüchtig sah er hinauf in das Antlitz, das göttlich war, umgeben vom gelben Mond des Heiligenscheins, und doch menschlich war in der sanftfraulichen Lieblichkeit, mit der es niederblickte auf das winzige Kindlein im Heiligenschein. Hier, hier fühlte sich Klemens nicht als Kurfürst mehr und hoher Würdenträger, hier war auch er nur ein Mensch wie alle anderen und einer, der sich unklar bewußt war, daß der Weg, den er zu gehen hatte, nicht glatt sein würde. Bisher war ihm alles geebnet gewesen, alles so bequem gemacht worden von günstigem Schicksal und von Menschen, die in ihm alle Vollkommenheit sahen. Er dachte an seine Mutter, für sie war er immer der Auserwählte gewesen. An seine Schwester – auch Maria Kunigunde hielt mehr von ihm als von allen anderen. Aber war er denn wirklich so vollkommen? Nein. Er würde sich mühen, es zu werden. So, daß er am Schluß seiner Tage sagen durfte: »Ich habe mein Bestes getan. Und siehe, es war auch das Beste.«
»Zu dir komme ich, o allerseligste Jungfrau Maria, und falle vor deinem Gnadenbild auf die Knie nieder«, betete er andächtig. Starr sah er hinauf in das unbewegt scheinende Antlitz. Er betete lange. So lange, bis seine starrenden Blicke verschwammen. –
Die Sterne draußen waren erloschen, denn der Mond war aufgezogen und schien weit heller als sie. Ein Strahl seines silbernen Lichtes glitt durchs Fenster und huschte zuckend über das Marienantlitz – lächelte sie? O ja, sie lächelte, ihre Lippen bewegten sich. Siehe, jetzt hob sie den Finger: »Selig sind die Sanftmütigen. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen.« –
Und er, er war heute in Zorn geraten, war aufgefahren, daß polternd sein Stuhl niederstürzte?! Nicht wie ein Würdiger hatte er sich benommen, nicht wie ein Kurfürst und Erzbischof. Dessen schämte er sich jetzt, schämte sich vor dem würdigen Greis und vor sich selber. Durfte ein wahrer Christ, ein wahrer Diener der Kirche so unbeherrscht sein? Geduldig, geduldig, sanftmütig, sanftmütig – wer, wer sagte das immerfort!? Verwirrt sah der Erwachende um sich. Kein Mondlicht mehr, alles erloschen. Ins Dunkel zurückgewichen das heilige Bild.
Klemens Wenzeslaus fuhr sich über die Stirn und Augen: war er eingeschlafen gewesen, hatte geschlafen vor übergroßer Müdigkeit sogar hier im Knien? Er hatte geträumt. Mühsam stand er auf: ach, wie war er doch müde und völlig steif! Es fror ihn. Die Ewige Lampe gab noch einigen Dämmerschein, mühselig fand der Übernächtigte sich zur Pforte. –
Die draußen hatten lange auf ihn warten müssen. Der Hauptmann saß auf der obersten Stufe der Kirchentreppe: ach, es war kein leichtes Geschäft, Fürsten zu hüten. Das nächstemal würde er sich nicht zu solcher Abholung drängen. Auf der untersten Stufe lagerten die Soldaten. So hatten die Kriegsknechte Stunde auf Stunde verbracht, hatten unterm blanken Sternenhimmel die Nacht sehr kalt gefühlt, denn sie hatten nichts Warmes über sich; gähnten und fluchten der Laune des hohen Herrn, noch um diese nachtschlafende Zeit Andacht halten zu wollen. Der Klosterbruder, der sich auch nicht getraut hatte fortzugehen, lehnte gegen die Kirchenpforte und schlief im Stehen, wachte nur einmal auf, als das glühende Pech seiner Fackel ihm auf den nackten Fuß tropfte; er stieß die gegen die Erde, daß sie erlosch, und schlief weiter.
Sie schliefen alle, nur der Hauptmann nicht. Ob der da drinnen, der sich so sicher fühlte, nichts wußte vom Prümer Krieg und von den Krawallen zu Trier? An allen Mauern und Ecken klebten da Aufrufe: »Rache an allen Feinden der Abtei Prüm, Rache! Rächt die Gewalttaten des Domkapitels! Plünderung der Domherrenhäuser dafür! Mit dem von Sohlern wird angefangen. Rache, Rache!« Das hatten die Studenten angestiftet, die vom Jesuitenkollegium, die oft in der Prümer Abtei fette und fröhliche Ferien genossen hatten. Aber ganz Trier nahm ihre Partei.
Grau dämmerte schon der Morgen, als der Kurfürst die Kirche verließ. Die Wächter schliefen alle, halb umgesunken, steif geworden vom nächtlichen Tau. Nun schlief auch der Hauptmann. Klemens Wenzeslaus rührte ihn an die Schulter: »Kommen Sie, wir gehen jetzt schlafen!« So lange hatten sie hier auf ihn warten müssen? Es war in seinem Ton etwas um Entschuldigung Bittendes.