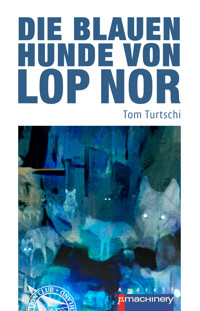5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Handbuch für Astronauten regelt das "Protokoll Delta Bravo" die Begegnung mit außerirdischen Lebensformen: "Handeln Sie situativ und den Umständen entsprechend." Wie unterschiedlich Menschen und künstliche Intelligenzen diesen Passus auffassen, zeigt sich, als Commander Skidmark in einer First-Contact-Situation in ganz unerwartete Konflikte mit seiner virtuellen Kollegin EVE gerät, die Entscheidungen aufgrund statistischer Bewertungen trifft. Künstliche Intelligenzen sind ein durchgängiges Thema in Tom Turtschis Erzählungen. Häufig sind es Kriminalgeschichten, die fatale Seiteneffekte von KI-Systemen aufdecken: Ein Entwickler kommt einer beunruhigenden Tendenz in einem Softwaresystem auf die Spur, das Konsumentenverhalten nicht nur prognostiziert, sondern auch manipuliert. Ein Ermittler versucht hinter die glänzende Imagefassade eines Hightech-Unternehmens und das Geheimnis einer Fehlcharge künstlicher Lebensformen zu kommen, die die neurotische Vorstellung entwickelt haben, echte Menschen zu sein. Ein Kriegsreporter gerät im Nahen Osten in einen Konflikt hinein, der durch den Einsatz militärischer KI völlig entgleist ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tom Turtschi
Protokoll Delta Bravo
Erzählungen
Mit einem Nachwort von
Michael K. Iwoleit
Cutting Edge 3
Tom Turtschi
PROTOKOLL DELTA BRAVO
Erzählungen
Cutting Edge 3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Dezember 2023
Cutting Edge @ p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Tom Turtschis »Icehunter« aus der Serie »The Shape of Things to Come« (2020) wurde aus einem Bild schwarz eingefärbten Teigs für Ravioli von stoeckerselig – art and collaboration mittels einer Kombination von Markov-Zufallsfeldern und Convolutional Neural Networks für die Bildsynthese – einer API von Chuan Li – erzeugt. Die Verbindung von Alltagserleben und generativer Bilderzeugung führt zu visuellen Welten, die zwischen Synthetischem und Organischem, Strukturellem und Gegenständlichem, Abstraktem und Konkretem oszillieren.
Layout: global:epropaganda
Umschlaggestaltung: Tom Turtschi
Lektorat: Michael Iwoleit
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: Schaltungsdienst Lange oHG, Berlin
Verlag: Cutting Edge @ p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
the-cutting-edge.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 357 4
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 747 3
Faites Vos Jeux
Eine kleine Unachtsamkeit, und alles ist vorbei. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Im Bruchteil einer Sekunde straft mich das Schicksal ab und nimmt mich aus dem Spiel. Ich habe meine Chancen gehabt. Mein Kontingent an Handlungsmöglichkeiten ist ausgeschöpft – jetzt gibt es kein Abenteuer mehr zu bestehen, keine Quest mehr zu lösen. All mein Begehren, alle Sehnsüchte helfen nicht, mich zurück ins Game zu kämpfen. Auch Wille und Wollen sind nutzlos geworden. Rien ne va plus, das Rad stoppt, die Kugel kullert ins falsche Nummernfach und ich muss mich mit dem Unvermeidlichen abfinden.
Was bleibt mir?
Annas Garten und die Sterne.
Einige Zahlen.
Ein Countdown: exakt 234 Sonnenaufgänge, Mittage, Nächte und ein letzter Morgen. Meine Tage sind gezählt, der Zeitpunkt meines Todes ist gesetzt.
Ich kappe den Funk. Schalte das Display im Helm ab. Die verbleibende Zeit mag ich nicht mit einer KI verbringen, die keine Ahnung hat, was Sterben für einen Menschen bedeutet.
Ich schließe die Augen und sehe den Knaben in der Dachmansarde.
Er liegt auf einer schwarz-weiß karierten Decke. An den Wänden Bilder von engelhaften Mädchen, in sphärische Nebel getaucht. Daneben diverse Devotionalien, um sich im Kreis seiner Freunde Respekt zu verschaffen: Laserschwerter, Totenschädel, Poster mit grotesken Aliens und klingonischen Kampfschiffen.
Er gähnt, schiebt seinen Hund zur Seite.
Er dimmt die LEDs runter, betrachtet im Geviert des Dachfensters den Sternenhimmel. In dem Feld namenloser Punkte erkennt er Aldebaran, seitlich darunter die Achse des Orion, an der sich übers Kreuz Beteigeuze und Riegel spiegeln. Er weiß noch nicht viel über die Sterne, aber an diesen leuchtenden Diamanten kristallisiert sich seine Sehnsucht. Er betrachtet die Achse: Was müssen das für magische und verheißungsvolle Orte sein, die sich Alnitak, Alnilam und Mintaka nennen? Jeden Abend bricht er zu den Sternen auf, manchmal auf kleinen Vehikeln mit Pedalantrieb, dann wieder auf großen Sternschiffen, die ganze Städte und riesige Gärten beherbergen.
Die feuchte Nase stupst ihn an die Backe. Das übergeht er noch. Als Paffo in den Waschgang schaltet und mit der Zunge sein Gesicht traktiert, setzt er sich unwirsch auf. Dem bettelnden Blick vermag er nicht zu widerstehen, auch wenn die Reise an diesem Abend nur in den Park führen wird – Aldebaran muss warten.
Später hat er versucht, in dem Planquadrat die Sterne zu zählen. Und verärgert festgestellt, wie die Sterne immer wieder verschwinden, wenn er den Blick direkt auf sie richtet.
Ich öffne die Augen.
Ich sehe die Sterne. Nur der Junge und der Hund sind verschwunden.
Check: Ich bin noch da.
Mein Name: Jaron Prokop.
Meine Funktion: Ice Hunter im Kuipergürtel. Ich kartiere und klassifiziere außerhalb der Neptunbahn Asteroiden für die Jianxi Exomining Group.
Korrektur: Habe klassifiziert und kartiert. Ich, Jaron Prokop, heute ohne Funktion. Von mir bleibt ein Bewusstseinsknoten in Zeit und Raum, ein Klumpen Sternenstaub aus 10 hoch 28 Atomen, um den sich das Universum dreht.
200 und drei Tage. Herzfrequenz 93. Hat der Puls bis vor wenigen Momenten wie ein Paukenschlag im Hirn gedröhnt, kehrt jetzt die Stille zurück. Die Erinnerung an Paffo beruhigt mich. Ich fühle seine ungebrochene Zuneigung, das Feuchte seiner Stupsnase. Der Puls fällt auf 80.
Ich werde die Zahlen nicht los.
Es ist wie ein Zwang: Wenn sich dem Auge nichts bietet, das gezählt werden könnte, achte ich auf den Puls oder weiche auf abstrakte Dinge aus. Zahlen waren immer meine Offenbarung, durch die mir das große Ganze zugezwinkert hat. Dabei bin ich im Herzen ein Träumer geblieben, mehr als alles andere. Nur habe ich alles auf eine Nummer gesetzt, um den Traum zu leben. Nicht nach Aldebaran führte deine Reise, kleiner Junge. Gerade mal den Rand des Planetensystems hast du erreicht, den äußeren Gürtel, den Vorhof der Oortschen Wolke, hinter der die Dinge zum Zählen in unendliche Weite rücken.
Tag 202.
Ich will mich nicht beklagen, ich habe die Wahl selber getroffen. Ich habe den Aufbruch dem Verharren vorgezogen. Ich wollte meine Theorie verifizieren. Ich wollte wissen, ob meine Berechnungen stimmen – und dazu gab es keine bessere Chance als diesen Job. Im Grunde hat eine innere Berufung mich zum Ice Hunter gemacht. Ich wollte Antworten, mir und der Welt etwas beweisen, etwas bewirken. Ja, ich bezahlte einen Preis: Mein Alltag als Astrophysiker wurde eine einsame, endlose Abfolge aus Arbeit und Pflicht, ein zermürbender Kreislauf immer gleicher Tätigkeiten. Auf Haumea, einem kleinen Eisklumpen jenseits des Neptun, dem letzten Außenposten der Menschheit, habe ich drei Jahre lang geforscht, gemessen und gerechnet, den Konzern mit Datenmaterial versorgt. Ein Erbsenzähler – ein Teil von mir führte entschieden kein Leben als Träumer und Fantast. Dabei habe ich jede Gelegenheit genutzt, um nach Planet neun Ausschau zu halten, in den Nächten den Datenstream der Teleskope gehackt, alte Aufzeichnungen auf die Server des Konzerns geleitet, um mir die notwendigen Lücken und Zwischenräume zu verschaffen.
Ich war clever und berechnend und hatte immer wieder Glück. Mein Faible für Zahlen, gekoppelt mit Zielstrebigkeit und Disziplin, hat mir das Schicksal gefügig gemacht, aber genauso spielte mir oft der Zufall in die Hände. Immer wieder war mir am Roulettetisch das notwendige Quäntchen Glück beschieden, ohne das jeder Einsatz gnadenlos ins Leere läuft.
Tag 201.
War mein Leben erfüllt? Erfolgreich vielleicht, aber erfüllt? Ich bin mir nicht sicher, welche Maßstäbe ich anwenden soll. Ich habe mich redlich geschlagen, niemanden grob fahrlässig hintergangen und beim Ranking der Jianxi Exomining Group oft Bestnoten erzielt.
Habe ich etwas verpasst? Du hast alles verpasst, höre ich Ron. Mit deinem Ehrgeiz, alles und immer noch etwas mehr in deine Zeit zu pressen, hast du alles verpasst. Vor lauter Zählen hast du alles versäumt, was zählt …
Warum bei Wega bin ich wieder auf dem Mars, eile durch die Kuppel mit den exotischen Pflanzen? Warum zum Teufel taucht Ron vor mir auf und nagelt mich fest, Ron, der alte Streuner? Er wirft mir vor, wie ich mit meinem Eifer und Pflichtbewusstsein alles daran setzte, mich aus der unerträglichen Leichtigkeit des Seins davonzustehlen. Ron, der Penner und Philosoph aus dem Habitat von Noctis Labyrinthus. Er sitzt bei den Lüftungsschächten, lässt seinen Blick über die Leute schweifen, die vor den vertikalen Gärten vorbei hetzen. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, Tag für Tag dieselbe Szene. Er kratzt sich am Stoppelbart, haut mich an und weist mich zurecht: Was treibt dich zu dieser Eile, mein Freund? Ich habe immer darüber bestimmt,wie ich meine Zeit verbringe – das ist das Wichtigste überhaupt!
Klar, in seiner Währung habe ich mein Guthaben leichtsinnig verzockt. Er hat sich nie durch Pflicht und Notwendigkeit kompromittieren lassen. Ich hingegen war immer ein Getriebener meiner Aufgaben. Die Tage wurden durch Agenda und Checklisten diktiert und getaktet, die Leidenschaft kuschte sich brav in freie, nächtliche Stunden. Ron war ein Punk, ich ein fleißiges Arbeitstier voller Pflichtgefühl. War es Ängstlichkeit, Unvermögen? Eine Stärke? Ein notwendiger Kompromiss, um meine persönliche Forschung zu ermöglichen? Oder schlicht und einfach mein Naturell – hatte ich je eine andere Wahl?
Ich mag nicht bilanzieren. Bitte keine Milchbuchrechnung: Positiv- und Negativposten, was spielt das für eine Rolle? Unterm Strich ist das Leben immer ein Verlustgeschäft. Am Ende stehen der Konkurs und die Liquidation.
Jetzt habe ich keine Pflichten mehr, dafür jede Menge Zeit. Ein Guthaben von 200 Tagen, Ron! Faites Vos Jeux, ein letzter Einsatz, lass die Kugel rollen – aber setze nicht mehr auf die Zahlen: Auf welche Nummer du auch wettest, du bist draußen. Nicht mehr zählen, erzählen werde ich jetzt, auch wenn ich der Einzige bin, der zuhört.
Ich glaube, in den letzten Tagen will ich meine Fantasie zwischen den Sternen spazieren führen, wie damals in der Mansarde, sie ausschweifen und streunen lassen wie Paffo, den alten Kumpel, meinen kleinen, übermütigen Hund. Ich werde ihm zusehen, wie er in Pfützen hüpft und herumtollt, bis er seine Schnauze in meine Hände legt, sich schüttelt und mich von oben bis unten bekleckert. Ich werde ihn die Staffel seiner Lieblingsbäume abarbeiten lassen und mich amüsieren, wie er die Erde hinter dem Spielplatz umpflügt, wo er Monate zuvor einen Knochen gefunden hatte. Wer weiß, vielleicht hilft mir seine Lebensfreude und seine Zuversicht, und auch ich werde in den letzten Tagen den Knochen finden, den ich ein Leben lang gesucht habe.
Ich werde dich besuchen, Anna, noch einmal in deinem Garten herumschlendern, den Rundgang abschreiten, den wir vor langer Zeit immer zusammen gegangen sind. Beim Brunnen den fallenden Tropfen zusehen, entlang der Gemüsebeete und Beeren, vorbei am Glashaus, den Blumenrabatten, dem Gehege der Hühner und den Ställen der Schafe, bis zum windschiefen Bretterverschlag, wo du dir neben dem Geräteschuppen einen Meditationsraum eingerichtet hast.
Tag 184 – aber das ist egal, er gleicht aufs Haar all den anderen Tagen.
Beinahe jedenfalls.
Hoch über mir ziehen die Himmelskörper ihre Kreise, ein Reigen aus Punkten und Schlieren mit wundersamen Namen, wie ein Notenblatt für eine lautmalerische Wortmelodie, das in meinem Kopf die Mythen der Menschheit anklingen lässt – Silbengeklimper, Sphärenmusik, mein Tag Nummer 184:
Der Wassermann taucht unten weg und zwischen den Hörnern des Steinbocks schiebt sich die Sonne von oben ins Visier. Ein stecknadelgroßer Punkt, nicht sonderlich hell, trotzdem ein untrügliches Zeichen des anbrechenden Tages. Morgenröte legt sich über die Dunkelheit, Myriaden silbriger Punkte werden zu einem Lichtfirnis verrührt und verstrichen. Die Finsternis wird langsam übertüncht. Kurz nach ein Uhr fällt der Sagittarius-Arm in mein Blickfeld, ein horizontales, breites Band: Wie eine gestische Malerei strahlt das Band in gelben Schlieren und roten Tupfern, mit Pinselstrichen aus allerschwärzestem Kohlenstoffschwarz gepflügt. Hier draußen, wo unsere Sonne eine schmalbrüstige Mitstreiterin, auf ihr wahres Maß zurechtgestutzt ist, wirkt das Lichtspektakel der Sternwolken imposant und halluzinativ. Ich weiß, dort hinter Sagittarius, zwischen Norma und Scutum, wo die Ekliptik die Scheibe der Milchstraße schneidet, liegt das Zentrum unserer Galaxie. Nur interessiert mich das eigentlich nicht. Das Wissen nimmt sich in diesem Moment neben der Macht der Impression recht kümmerlich aus. Ich kann mich nicht sattsehen, verfolge das stille Lichtspektakel über der Hochebene meiner Brust, bis sich auch Antares zwischen den Gipfeln meiner Magnetstiefel hinter den Horizont zurückzieht.
Die Dämmerung streckt sich über die Leier bis zu Virgo und Boötes hin, dann grundieren nur noch einzelne silberne Spritzer die dunkle Leinwand, und das Haar der Berenike hebt sich vor tiefstem Schwarz ab.
Mitternacht.
Ich warte auf Haumea. Mit seinen beiden Monden, seinem Silberschleier …
Vor hundert Tagen, kurz nach dem Unfall, dauerte die Passage Haumeas von zwei Uhr fünfzig bis drei Uhr dreißig: Zuerst fiel Hi’iaka, der große Mond, wie ein Fallbeil über mein Sichtfeld und kappte das Panorama. Dann tauchte Haumea auf, eine faustgroße Kartoffel. Noch konnte ich auf der matten Oberfläche die lang gezogenen Täler zwischen den Gebirgsketten der Eisberge erkennen und auf der südlichen Hochebene den Sideriuskrater, der drei Jahre vor meinem Fenster lag: An seinem Rand stand die Station, ein kleiner Kubus, flankiert von zwei Teleskopen und den Treibstofftanks – mein karges Zuhause …
Heute muss ich Denebola vorüberziehen lassen, bis Haumea gegen halb vier Uhr erscheint: Als geschrumpelte Ackerbohne schiebt sich der Planetoid an mir vorbei. Der Mond ist nicht größer als eine Erbse. Von Tag zu Tag ist er weiter entfernt, bald wird er nur noch als Punkt über mein Sichtfenster huschen.
Auch das Shuttle entgleitet mir. Wie Hauma wird es von Tag zu Tag kleiner. Ein kurzes Aufblitzen, wenn das Metall die Sonne reflektiert, das ist alles, was ich von ihm noch zu sehen kriege.
Hinter Castor und Pollux kündet der silbrige Flickenteppich das Auftauchen des Orion-Spiralarmes an.
Dieser Spiralarm ist nicht zu vergleichen mit dem Spektakel, der das Band vor dem Zentrum der Milchstraße geboten hat. Dicht gepunktet, mit einzelnen roten Nebeln, aber die goldene Pracht und die Dynamik von Sagittarius fehlen. Dafür entschädigt mich Orion: Die lang gezogene Schliere aus rotem Nebel in der Form einer Augenbraue, darunter zeichnet ein runder Farbfleck Auge und Pupille, mit einem seitlichen Glanzlicht. Und drei Tränen: Alnitak, Alnilam und Mintaka perlen aus dem Auge. Sieht Orion mich kreisen? Mach dir keine falschen Hoffnungen, mein Junge – aber immerhin hast du Orion aus dem Geviert des Dachfensters befreit. Du bist ihm näher gekommen, auch wenn sich die Distanz nicht merklich verringert hat.
Dann sehe ich einen Fluss, der sich seinen Lauf durch den schwarzen Grund bahnt, am Ufer das Lichtmeer einzelner Städte. Ich stelle mir vor, bei Rigel eine Dschunke nach Achernar zu besteigen, und fahre entlang der gepunkteten Linie den Eridanus hoch, folge dem Flusslauf bis zur Quelle, in einem großen Bogen um Fornax herum und beobachte, wie am Ufer die Lichter spärlicher werden.
Zwischen Deneb Kaitos und dem Kopf des Fisches erwarte ich die Erde. Ich kann sie nicht entdecken, ohne meine Instrumente. Zu entrückt, zu klein, in diesem Himmelskarussell, von meiner Warte aus.
Und bereits springt der Wassermann von oben ins Visier, die Sonne im Schlepptau … Tag 185 bricht an.
Ich sitze im Zentrum, und das Universum dreht sich um mich. Tag für Tag.
Paffo bellt.
Der Junge muss lachen.
Natürlich ist das vermessen und anmaßend – aber wiegt sich nicht jeder in der Illusion, Mittelpunkt der Welt zu sein?
Erinnere dich an unsere Philosophie der Wurst, Paffo. Wenn die alte Dame mit der Deutschen Dogge im Park auftauchte, dem schwarzen Monster mit der Darth-Vader-Visage und den speicheltriefenden Lefzen, der dir deine Bäume streitig machte und dich über den Rasen und durch das Unterholz jagte – was haben wir uns gesagt? Auch jeder Egomane ist nur eine kleine Wurst, die beim einen Zipfel beginnt und am anderen Ende aufhört. Ganz egal, ob du ein schmächtiges Frankfurter Würstchen oder eine vollfette Mortadella aus durch den Wolf gedrehtem Schweinefleisch bist, das Ende kommt bei jedem. Es gibt keinen Grund für Überheblichkeit.
Bald wird meine Illusion platzen wie eine Seifenblase, alle Vermessenheit wird implodieren, und ich treibe als lebloser Brocken durch die Leere, bis mich in einigen Millionen Jahren Varuna oder Eris oder Pluto in ihren Bann ziehen werden.
Sache ist: Das Universum steht still.
Ich drehe mich.
Drifte als Stück Treibgut haltlos durch das All, rotiere um die eigene Achse, die Füße fahren hoch, der Kopf fällt nach hinten. In den ersten Tagen war mir speiübel. Die Drehrichtung suggerierte ein permanentes Fallen auf den Rücken. Ein Drehimpuls in der Gegenrichtung wäre entschieden angenehmer gewesen. Zuerst schloss ich die Augen, öffnete sie nur für Momente, von Tag zu Tag immer etwas länger, bis sich mein Innenohr an die Kreiselbewegung gewöhnt hatte.
Ich kreise mit Rückwärtsdrall. Alle 2 Minuten und 23 Sekunden fährt mir die Sonne über den Kopf und wirft ein blasses Morgenlicht auf meine Brust.
Ich bin ein Himmelskörper mit verdammt kurzen Tagen. Mein siderischer Tag, eine vollständige Umdrehung um mich selber, dauert keine zweieinhalb Minuten. Die verbleibenden 173 Tage ergeben 585 Minuten in der alten Zeitrechnung. Dann geht mir der Sauerstoff aus, kurz darauf wird das Batteriepack entleert sein und die Temperaturregelung versagen. Aber die große Kälte wird mich nicht mehr kümmern.
Ich will nicht mehr rechnen, dabei bleibe ich. Würde ich rechnen, blieben in der neuen Zeitrechnung neun Stunden und 45 Minuten. Wenn ich träume, freue ich mich auf das kommende halbe Jahr. Ein letzter Frühling, ein letzter Sommer. Was werden sie mir bringen?
Tag 172.
Du kauerst bei den Rabatten, setzt Stecklinge. Dein rotes Haar glitzert im schüchternen Licht des Vorfrühlings: Für mich ist dein Haar die erste Blüte im Garten, und ich weiß, ich werde sie den ganzen Sommer über verfolgen, werde dich besuchen, so oft ich nur kann, bis in den Herbst, wenn du die Erde mit Mulch zur Winterruhe bettest.
Der alte Strandkorb am runden Wasserbecken. Der Hahn ist verrostet. Er lässt sich weder öffnen noch schließen. Beständig fallen einzelne Tropfen in die Wanne. Das muss so sein, erklärst du, das ist der Herzschlag des Gartens, schau nur, was der Einschlag eines einzelnen Tropfens bewirkt, die Delle und die Eruption, die Fontäne, die er aufwirft, die konzentrischen Kreise, die sich ausbreiten und vom Rand des Beckens wieder zurück schwappen, sich mit den Wellen des nächsten Tropfens überlagern. Das ist mein Meer, ich setze mich in den Strandkorb und habe die Weite des Ozeans vor mir.
Tag 171.
Der harsche Winter kippt unvermittelt in sommerliche Hitze. Das Klima hat die Zwischentöne auf wenige Tage reduziert. Der Alant explodiert. Seine rhabarbergroßen Blätter tauchen aus dem Nichts auf. Auch die Eselsdistel und die Karde schießen dem Himmel entgegen, als gälte es, einen Wettstreit zu gewinnen.
Ich sehe, wie du mir aus dem Blütenmeer entgegenläufst, meine Hand packst und mich aufgeregt zu dem Beet mit dem Muskatellersalbei schleppst: Die Taubenschwänzchen sind zurück! Ehrfürchtig folge ich dem fingerkuppengroßen, haarigen Insekt, das vor den Blüten wie ein Kolibri verharrt und seinen langen Rüssel in die Dolden und Kelche taucht. In der nächsten Sekunde schießt es zur benachbarten Blüte – in fünf Minuten besucht es mehr als hundert Blüten, erzählst du. Ist es nicht erstaunlich, wie die wenigen Neuronen in seinem Hirn diesen präzisen Schüttelflug hinkriegen? Luftakrobaten, und Langstreckenflieger: Sie sind zweitausend Kilometer aus dem Süden über die Berge hergeflogen. Ich glaub’s nicht! Seit Jahren habe ich kein Taubenschwänzchen mehr gesehen – jetzt kommen sie zurück!
Tag 169.
Du stellst eine Leiter auf. Weit und breit kein Baum, keine Mauer. Verblüfft schaue ich zu, wie du den Vorschlaghammer packst, mitten in dem Beet zwei Eisenrohre in die Erde rammst, eine Handvoll Kabelbinder aus der Plastikhülle zupfst und die Holzstiege mit den sieben Sprossen an den Stangen befestigt.
Das ist eine Himmelsleiter, höre ich dich. Die ersten Sprossen ins Paradies. Damit du weißt, in welche Richtung du dich aufmachen musst, wenn du mal tot bist!
Später im Jahr verstehe ich den Zweck der Leiter. Eine Kletterpflanze mit herzförmigen Blättern und blauen Blütenkelchen rankt sich hoch, Sprosse um Sprosse, in erstaunlichem Tempo. Jeden Tag öffnen sich mit den ersten Lichtstrahlen unzählige trichterförmige Blüten, um bereits kurz vor dem Mittag wieder zu verwelken. Es ist die japanische Asagao, erklärst du, Ipomea Nil. Sie wird auch Morning Glory genannt. Es gibt keine zartere und anmutigere Blüte. In ihr zeigt sich alle Schönheit und Vergänglichkeit des Lebens.
Um die Leiter ein Busch aus lanzenlangen Blättern, die Blütenstände auf hohen Stilen. Handgroße, sternförmige Blüten mit sechs spitzigen Fingern – es sind Feuerlilien. Der Kelch leuchtet orangefarben wie eine Flamme, gefasst vom Dunkel der bordeauxroten Blütenblätter, gleich darüber die ultramarinblauen Tupfer der Asagao – vor all dem Grün ein berauschendes Farbspektakel.
Tag 167.
Ich baue Früchte, Gemüse und Getreide an, sagst du, aber die Blumen sind genau so wichtig. Poesie ist Arbeit an der Zukunft.
Du hast hart geschuftet, dein Garten war lange nicht nur Zauber und Kontemplation. Es gab Jahre, da hast du Dämme gegen die Fluten und Mauern gegen die Hangrutsche errichtet. Du hast Netze gegen die tobenden Unwetter mit ihren Hagelzügen gespannt, und es gab Jahre, da hast du Bewässerungssysteme verlegt, um die Dürreperioden zu überbrücken. Du hast dich gegen das entartete Klima gestellt, kampfbereit wie eine Mutter, die alles für das Gedeihen ihres Sprösslings tut.
Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dein Werk zu würdigen wusste. Ich wollte nicht verstehen, warum du nach draußen geflohen bist, weg von mir, weg von der Zivilisation, in eine Kommune von Ausgeschlossenen, in das Abseits eines wuchernden Dschungels. Aber du warst ein Magnet. Ich suchte dich auf, so oft mir möglich war, und irgendwann verstand ich deine Absichten.
Du hast mich gelehrt: Permakultur ist ein Kreislauf der Stoffflüsse. Nichts wird zugeführt, nichts abgezweigt. Der Dünger für die Pflanzen steuern die Tiere bei, die Pflanzen ernähren die Tiere. Ein ausgeklügeltes System von Nachbarschaften, wo alle einander dienen. Ich erkannte und bewunderte die Eleganz dieses Prinzips.
Hier draußen war ich den Sternen näher gekommen, aber im Herzen ist dein Garten mein Sehnsuchtsort geworden. Auf dem Mars, später in dem Jahr auf Ceres, habe ich immer wieder die grünen Lungen aufgesucht. Auch wenn die sterilen Parks unter den Glaskuppeln und die vertikalen Gemüseplantagen wenig mit dem wilden Überschwang deines Gärtchens gemein hatten, waren es Orte, wo ich mich dir und einem verlorenen Paradies nahe fühlte. Auf Haumea blieb mir eine kleine Zentrifuge, ein Inkubator für lächerliche Grünalgen, Pilze, Moose.
Tag 163.
To be honest: Ich war nie ein Gärtner.
Für mich gab es gerade mal Bäume, Büsche, Gemüse, Blumen. Habe ich auf die Apfelbäume gezeigt, hast du von Berlepsch, Bismark, Goldparmäne, dem Schönen von Kent gesprochen. Die Tomaten hießen bei dir Indigo Rose, Purple Dragon, Andenhorn und Marmande. Die Unterscheidung von Vögeln und Insekten bereitete mir keine Mühe, die Differenzierung in Schädlinge und Nützlinge kriegte ich nie wirklich auf die Reihe, zumal bei dir auch das herkömmliche Unkraut immer wieder im Kochtopf landete.
Wenn ich vermessenerweise für einmal meinen Schlendergang durch den Garten, mit einer Harke oder Sense bewaffnet, gegen einen zielstrebigen Schritt getauscht hatte, voller Enthusiasmus, dir an die Hand zu gehen, war ich bestimmt auf Setzlinge getreten, habe beim Mähen die Karde oder den Muskatellersalbei erwischt. Du warst eine nachsichtige Gärtnerin, trotzdem war ich ständig leicht traumatisiert von der Vorstellung, mich auf deiner Arche wie ein Elefant im Porzellanladen zu bewegen.
Tag 158.
Du hattest dich abgesetzt, warst ins Niemandsland außerhalb der Gated Community gezogen und hast deine Arche seetauglich gemach, um in dieser stürmischen Zeit zu bestehen. Du hattest ein Leben unter den Privilegierten verabscheut. Nie konntest du es mit deinem Gewissen und den Prinzipien eines anständigen Lebens vereinbaren. Die allgemeine Übereinkunft, die verbleibenden Ressourcen unter einem Fünftel der Menschen zu verteilen, schien dir ein Hohn.
Natürlich war mir klar, nicht alle Dinge in unserer Welt standen zum Besten. Es gab einmal eine glücklichere Zeit, die goldene Epoche des Kapitalismus und der Globalisierung, wo das Wirtschaftswachstum immer mehr Menschen aus der Armutsfalle befreite, wo Waschmaschinen, Staubsauger und Kühlschränke die Frauen entlasteten, die Gewalt über zwei Jahrhunderte zurückging und der Bildungsstand weltweit gehoben wurde. Mit den zur Neige gehenden Ressourcen wurden diese Menschen wieder rigoros ausgeschlossen, mit digitalen Fesseln, Zäunen und Mauern, Gewalt und Repression.
Deine Entscheidung, auf die andere Seite der Mauer zu ziehen, habe ich respektiert, aber anfangs sowenig gutgeheißen, wie du meinen Aufbruch zu den Sternen. Du hast mich bezichtigt, Handlanger eines Apartheidsystems zu sein. Ich sah in deiner Flucht einen Rückzug in eine rückwärts gewandte Utopie. Wenn wir etwas bewirken wollen, dann aus dem Inneren des Systems heraus, mit den Mitteln und Möglichkeiten dieser Zeit. Mein Platz ist nicht in der Wildnis. Alle Forschung und Innovation geschieht diesseits der Mauer, und ich war überzeugt, nicht darauf verzichten zu können, wenn wir als Spezies überleben wollen.
Du hast das anders gesehen. Stunden sind wir durch den Garten geschlendert, saßen im Strandkorb, haben diskutiert. Ich habe alle Gelegenheiten genutzt, in die Wildnis aufzubrechen, um dich zu sehen. Drei- oder viermal im Jahr habe ich einen Gleiter gechartert und dich für einige Tage besucht. Auf dem Flug über die Wälder habe ich gestaunt, wie gleichgültig der Natur der Klimawandel war. Sie hatte sich bestens angepasst und große Gebiete zurückerobert. Über die neun Jahre bis zu meiner Abreise habe ich verfolgt, wie du deinen Garten gehegt und gepflegt hast, und bewundert, wie er dich ernährt hat, physisch und geistig.
Ich war nie ein Gärtner. Ich fühlte immer deutlicher, es war keine Option, in deinem Garten Wurzeln zu schlagen. Mich zog es zu den Sternen.
Das hast du akzeptiert. Ich denke, du hast es sogar verstanden. Ich werde nie vergessen, wie du den Maler Franz Marc zitiert hast, der von der Front kurz vor seinem Tod an seine Frau Maria geschrieben hatte, die zu Hause im Ried zu den Rehen und dem Garten schaute: Was ich im Sternenhimmel sehe, ist wohl was Ähnliches wie das, was du in Blumenbeeten siehst; wenn Du Sternenhimmel und Blumenbeete vergleichst, wirst du wohl verstehen, was ich mit meiner Sternenliebe meine.
Nicht gebilligt hast du meinen Entschluss, bei der Jianxi Exomining Group anzuheuern. Du stehst beim Glashaus und ereiferst dich, das Gesicht beinahe so rot wie dein Haar. Der Konzern ist für dich der Inbegriff des Teufels. Es ist die verkehrteste Politik, dozierst du, die fehlenden Ressourcen der Erde auf dem Mars zu schürfen, seltene Erden und Coltan im Asteroidengürtel zu suchen. Wachstum und Expansion waren für 200 Jahre der Garant für Fortschritt, bis sie uns in den Kollaps geführt haben – und es hat jeder Kultur das Genick gebrochen, wenn sie ehemals erfolgreiche Strategien nicht überwinden und den veränderten Umständen anpassen konnte. Was willst du dort draußen? Ein pervertiertes System zu den Sternen tragen? Ist das dein Ernst, dich beim Großkapital zu verdingen – um einem Phantom nachzujagen?
Einem Phantom nachjagen? Der Vorwurf schmerzt, Anna, heute noch. Ich hatte eine Vision und glaubte daran.
Wir schaffen die Welt mit unserer Vorstellungskraft, sie ist nicht einfach da. So wie es nicht möglich ist, im Atom die Bahn des Elektrons exakt zu bestimmen: Heisenberg hat gezeigt, wie die Bahn erst entsteht, indem sie mathematisch beschrieben wird. Er hat dem Atom eine Form gegeben, die uns Menschen zugänglich ist. Information und Form sind die Grundsubstanzen, nicht Materie oder Energie. Die Beschreibung mittels der Mathematik formt und erschafft das Atom, genauso wie meine Berechnungen Planet neun um die Sonne kreisen lässt.
Durch die Form nimmt die Welt Gestalt an. Form ist die Grundlage, vorab im Kleid der Information, die alle Materie durchwirkt. Mich hat immer fasziniert, dass der lateinische Begriff »informare« ursprünglich Gestalt geben, formen und bilden bedeutete. Also Design – das ist viel mehr, als Daten aus der Natur zu ziehen: Informieren bedeutet kreieren. Es gibt die Welt nur, weil wir sie erfinden und gestalten. Auch dein Garten gäbe es ohne deine schöpferischen Hände nicht. Wir sind Künstler, Anna!
Die Gravitationssignatur ist eindeutig: Am äußeren Rand unseres Planetensystems muss ein Gewicht existieren, das die Himmelsmechanik in Gang hält. Ein Brocken von fünf bis zehn Erdmassen, der unsere Sonne auf einem elliptischen Orbit in 20.000 Jahren umkreist.
Der äußerste Planet ist der Eisriese Neptun, der in einem Abstand von 30 Astronomischen Einheiten um die Sonne umrundet, also in der dreißigfachen Distanz von der Erde zur Sonne. Angrenzend liegt der Kuipergürtel mit Abertausenden Eisklumpen, in 30 bis 50 Astronomischen Einheiten. Weiter haben wir zwei Dutzend Exoten wie Sedna identifiziert, die in einer ganz anderen Ebene als alle übrigen Planeten um die Sonne schwingen und weit in die Oortsche Wolke abtauchen, bevor sie sich uns wieder nähern. Nur ein Gegengewicht kann sie auf ihrer Bahn halten – Planet neun. Er kommt der Sonne nie näher als 200 Astronomische Einheiten, und sein entferntester Punkt beträgt das Sechshundertfache der Distanz Erde – Sonne. Ich habe seine exzentrische Bahn berechnet – die große Frage ist, wo genau er sich auf seiner Reise befindet.
Ich habe dir erklärt, wie es uns gelingt, Exoplaneten bei weit entfernten Sternen aufzustöbern, warum aber der Vorhof unseres eigenen Systems im Dunkeln bleibt. Exoplaneten werden in Indizienprozessen überführt, durch indirekte Techniken – das funktioniert in unserer stellaren Nachbarschaft nicht. Von der Erde aus müssen wir die kalten Gesellen im Kuipergürtel mit Teleskopen optisch ausfindig machen. Nur gibt es da draußen verdammt wenig Licht. Es ist die Suche der Nadel im Heuhaufen, nachts, bei Stromausfall. Die Aussicht, in die Nähe des Tatortes zu reisen, steigerte die Aussicht beträchtlich, Planet neun auf seiner dunklen Tour zu überführen, – ich konnte nicht widerstehen, Anna.
Ich versprach dir, vorsichtig zu sein. Mich nicht von meinem Arbeitgeber vereinnahmen lassen. Es gab keine andere Möglichkeit, von der Erde aufzubrechen und meine Berechnungen an der Realität zu testen. Die staatlichen Mittel für Grundlagenforschung waren längst gestrichen, die NASA liquidiert, ihr Know-how von wirtschaftsstarken Konsortien übernommen. Einem Spezialisten für Orbitaldynamik konnte sich keine bessere Gelegenheit bieten als der Job bei der Jianxi Exomining Group. Ich wollte dran bleiben, die Existenz von Planet neun beweisen. Das alleine war meine Vision, meine Bestimmung, der Sinn meines Daseins.
Tag 103. Habe ich richtig gezählt? Plötzlich rauscht die Zeit im Flug vorbei …
Die einsamen Jahre auf Haumea …
Es sollte mir nicht gelingen, Planet neun aufzuspüren.
Ich versuchte, meine Berechnungen zu präzisieren, die Position einzugrenzen. In den Nächten richtete ich das Orbitalteleskop auf verdächtige Stellen, wertete in den frühen Morgenstunden die Aufnahmen aus. Meine Berechnungen wiesen ein Konfidenzniveau von 99,6% auf, aber selbst diese hohe Wahrscheinlichkeit nützte nichts: Da draußen war nichts, einfach nichts.
Ich weiß, das Nichts ist die statistische Norm. Alles andere ist die unwahrscheinlich große Ausnahme. Das All besteht fast ausschließlich aus Zwischenraum und Leere, aus riesigen Voids, genauso die Atome: Wäre das Atom ein Fußballstadion, würden einige Elektronen auf den äußeren Zuschauerrängen den reiskorngroßen Kern im Anspielkreis betrachten, aber es fände kein Spiel statt – nichts als gähnende Langweile. Teilt man das Reiskorn weiter in seine Bestandteile, bis es nichts mehr zu teilen gibt, landen wir bei den Quarks, die von acht unterschiedlichen Gluonen zusammengeklebt werden. Mich hat immer ein Grauen gepackt, dass unsere Berechnungen nur stimmen, wenn wir für diese letzten Elementarteilchen eine Masse von null einsetzen – sonst fällt das Standardmodell, die ganze Theorie der Materie, in sich zusammen. Es ist erstaunlich, dass ich mich auf einen Stuhl setzen kann, nicht einfach durch das umfassende Nichts durchfalle – wenig erstaunlich ist hingegen, dass ich am Ort, wo sich Planet neun befinden sollte, nichts als Leere finde.
Waren meine Berechnungen nicht korrekt? Übersah ich etwas? Ich begann zu zweifeln. Was berechtigte mich zu der Annahme, ich würde ein Andrew Wiles sein, dem der Beweis des letzten Satzes von Fermat gelingt, nachdem sich dreihundert Jahre lang die schlausten Köpfe mit dem Problem befasst haben und der Beweis als unmöglich galt?
Ich bin aufgebrochen und immer weiter gezogen. Von Mars nach Ceres, die lange Reise nach Haumea. Ich bin der Lösung nicht näher gekommen, hatte gerade die ersten zwei Schritte auf einer Marathonstrecke zurückgelegt.
Was nützt schon eine große Vision, wenn man am eigenen Mittelmaß scheitert? Alles aufrichtige Bemühen hat mich nicht über die eigenen Grenzen hinausgebracht – das ist die Wahrheit.
Im zweiten Jahr auf Haumea begann ich die Tatsache zu akzeptieren, dass da kein Planet war. Aber ich gab vorerst nicht auf. Etwas musste die Himmelsmechanik im Gleichgewicht halten – und wenn kein Planet da draußen kreiste, so gab es die Möglichkeit eines primordialen Schwarzen Lochs. Bereits Stephen Hawking hatte über diese kleinen Schwarzen Löcher nachgedacht, die kurz nach dem Urknall entstanden sein mussten. Scholz und Unwin hatten die Theorie eines Schwarzen Lochs von ungefähr fünfzehnfacher Erdmasse für Planet neun ins Spiel gebracht. Lange war ich skeptisch, ob eine Hypothese durch eine noch sehr viel unwahrscheinlichere Hypothese gestützt werden kann. Aber in meiner Verzweiflung begann ich, nicht nur im optischen, Infrarot- und Mikrowellenbereich Ausschau zu halten. Ich observierte in meinen Planquadraten nun auch Röntgenstrahlung, Gammastrahlung und andere hochenergetische Emissionen. Ich suchte verdächtige Stellen nach Effekten einer Mikrogravitationslinse ab. Wenn ein solches Schwarzes Loch vor einem Stern vorbeizieht, lenkt es dessen Licht durch die eigene Schwerkraft für kurze Zeit um – das hätte ich beobachten müssen.
Nichts.
Immer wieder war ich der Junge in der Dachmansarde: Die Sterne verschwanden, sobald ich meinen Blick auf sie richtete.
Tag 94.