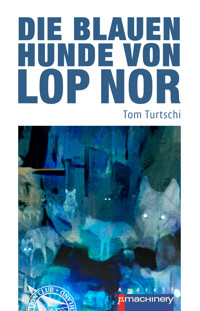
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Martin Eberhard hat im Labor mit der »Blue Dragon®« eine Tomate entwickelt, die gegen die weltweit grassierende Tomatenseuche resistent ist. Er reist für den Konzern nach Xinjiang, um bei der Lop Nor Potash Company die Beimischung des notwendigen Zusatzstoffes in den Dünger zu begleiten. China zeichnet für achtzig Prozent der weltweiten Tomatenproduktion verantwortlich, die industrielle Herstellung des Düngers muss vor Ort erfolgen. Der Direktor der Düngemittelfabrik lässt Eberhard warten. Auf Betriebsführungen staunt er über den riesigen Industriekomplex mitten in der Wüste. Über hundert Kilometer lange Kanäle, die die Sole zum Werk führen, Salzbecken mit der vierfachen Fläche der Stadt Paris, gigantische technologische Anlagen. Die Wüste fasziniert ihn, genauso seine forsche Reisebegleiterin. Sie fahren durch imposante Landschaften, besuchen die Ruinen untergegangener Kulturen entlang der Seidenstraße. Sie treffen auf die Krater der Atomtest aus den Sechzigerjahren, auf illegale Goldschürfer, die in der verstrahlten Erde nach dem Glück suchen. Zunehmend beginnt er an seiner Wahrnehmung zu zweifeln: Die Wüste narrt ihn mit Trugbildern, die Absichten seiner Reisebegleiterin werden immer undurchsichtiger. In der alten Ruinenstadt Loulan erscheinen ihm die blauen Hunde von Lop Nor. Sie konfrontieren ihn mit den Auswirkungen seiner Forschung und schicken ihn auf einen Trip durch die Geschichte der Farbe Blau. Die Zeitreise führt ihn vom Mittelalter über die Industrialisierung zum ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Schliesslich muss er sich dafür verantworten, was die Spezies Mensch mit dem blauen Planeten angestellt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tom Turtschi
Die blauen Hunde von Lop Nor
AndroSF 190
Tom Turtschi
DIE BLAUEN HUNDE VON LOP NOR
AndroSF 190
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2023
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Tom Turtschi
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Regula Turtschi, Sieglinde Geisel
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN des Hardcovers: 978 3 95765 352 9
ISBN des Paperbacks: 978 3 95765 352 9
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 753 4
»… die Blaue Note erklingt und da sind wir, im Azur der durchsichtigen Nacht.«
Georges Sand, Impressionen und Souvenirs
Im Zelt
Alles ist in Blau getaucht, auch wenn ich die Augen öffne: Ich stecke in einem blauen Schlafsack, die Tasche am Fußende, die Wand des Zeltes, die Kleider am Mittelgestänge, der Verband an meiner linken Hand – alles schimmert blau.
Aus halb geschlossenen Augenwinkeln verfolge ich, wie Sahkila das Tuch in den Eiskübel tunkt, auswringt und mir auf die Stirn legt.
Blau …, stöhne ich. Ein blauer Albtraum, was passiert mit mir? Diese blauen Blitze, ein unablässiges Wetterleuchten im Kopf. Ich weiß echt nicht, womit ich mich angesteckt habe.
Du hast Fieber, Martin.
Die Plane des Zeltes ist ockerfarben, nicht wahr? Die Heizfläche des Gasbrenners glüht rot, das weiß ich. Wenn ich an die flatternde Decke schaue, sehe ich ein arktischblaues Meer, bei steifem Wellengang. Der Heizstrahler flimmert Türkisblau wie ein Eisberg. Du bist eine blaue Fee, ganz unwirklich … Was ist mit mir los?
Du hast Fieber, Martin! Du fantasierst. Meine Oma würde sagen, du spazierst durch das Blau hinter dem Himmel. Das Fieber wird sich legen, ganz bestimmt. Ein Albtraum dauert nicht ewig, da mach dir mal keine Sorgen. Ruh dich aus, versuch zu schlafen.
Ich schließe die Augen – und da sind sie wieder! Ein ganzes Rudel, einer prescht auf mich zu, schnappt nach meiner Hand. Die Hunde, Sahkila, mich verstören diese leuchtenden Köter! Blaue, beißende Hunde – was soll dieser Unsinn? Träume ich, verliere ich den Verstand?
Tust du nicht! Sie haben dich gebissen, aber keine Panik, ich habe die Wunde verarztet. Ist halb so schlimm.
Ich befühle den Verband. Meine Hand schmerzt. So oft mich die Wüste genarrt hat, dieser Schmerz ist keine Fata Morgana. Sahkila hat recht, Hirngespinste verursachen keine infektiösen Bisswunden. Hologramme sind zahnlos, Projektionen beißen nicht. Aber was …
Quäle dich nicht. Du musst dich jetzt erholen. Morgen sieht alles anders aus, wir werden uns darum kümmern, wenn du wieder bei Kräften bist.
Wenn ich versuche zu schlafen, schießen sie hinter den Ruinen von Loulan hervor und hetzen mich durch die Nacht …
Es ist vorbei, Martin! Sie sind fort, das ganze Rudel, sie haben sich in die Berge davon gemacht. Entspann dich.
Ich schließe die Augen. Sahkila streichelt mir über die Wangen, ich fühle ihre Lippen auf meiner Stirn. Nach dem Kuss legt sie erneut die kalte Kompresse auf. Ich höre sie aufstehen, dann den Reißverschluss beim Zelt, hoch und runter.
Was vorbei – in meinem Kopf ist alles gegenwärtig! Der Traum kennt nur das Präsens, alles findet gleichzeitig statt, die ganze Geschichte, dieser Augenblick, die Zukunft, mir platzt der Schädel … nichts ist vorbei, gar nichts. Sobald ich die Augen schließe, kommen die Hunde und treiben mich durch die stürmische Nacht, blaue Blitze tauchen die Wüste in ein gespenstisches Licht. Immer wieder spule ich die Reise ab, Tag für Tag bis zur Begegnung mit den Hunden heute Abend, dann quälen mich wild geschnittene Sequenzen, im schnellen Vorlauf, wirr. Ich stehe mitten im Gewitter, unerbittlich suchen die blauen Blitze meinen Kopf. Ich versuche verzweifelt, einen sicheren Unterstand zu finden. Atme regelmäßig. Fixiere im Geist den Punkt zwischen den Augen. Biete meinem Hirn Muster und Reihen an, zähle. Beschwöre dein Gesicht herauf, Sahkila, deinen Körper, deine Wärme, wie du zu mir unter die Decke schlüpfst … keine Chance. Immer wieder schlagen die Blitze ein und brennen alle anderen Bilder weg. Immer wieder sitze ich im Airbus der Lufthansa, der auf der Startbahn West in Frankfurt steht, gerade die Triebwerke aufdreht, und hebe zu meiner Chinareise ab. Und Augenblicke später schrecke ich hoch und merke, dass ich aus einem Fiebertraum erwache, der sich von der Wirklichkeit nicht unterscheiden lässt.
Anreise
Ich sitze in einer Maschine der China Southern Airlines, Flug 6974 von Shanghai nach Ürümqi. Endlich verschwindet auf dem Monitor die Karte mit der Flugroute und weicht der Aufforderung, uns anzuschnallen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, diesen Moment jemals zu erleben: geschlagene drei Tage unterwegs für sechzehn Stunden Flugdauer. Ich habe die Reise vor allem damit verbracht, in Transithallen auf das Boarding zu warten.
Beim Landeanflug auf Ürümqi spähe ich durch die Luke, beobachte die ausgedehnten Felder im Abendlicht, grüne Rechtecke im Ocker der Wüste, die sich stellenweise verdichten und sich wie ein Quilt um die Millionenmetropole schmiegen. Hier in der Dsungarei befinden sich die Versuchsplantagen mit unserer Tomate. Ich werde sie auf der Rückreise besuchen – vorerst geht es weiter, mitten in der Nacht mit dem Anschlussflug von Ürümqi über Korla bis Qiemo. Ohne Abstecher zum Flughafen transportiert uns ein Bus direkt zur Maschine. Ich sehe, wie sie bereits mit dem Gepäck beladen wird. Bete, dass meine Koffer den Transfer genauso reibungslos wie ich geschafft haben.
Der schnelle Umstieg war eine Mogelpackung: Es dauert bis in die frühen Morgenstunden, bis wir die Starterlaubnis erhalten. Ich nicke immer wieder ein, aber nach dem Abheben ringe ich mein Schlafbedürfnis nieder. Ich will die letzte Etappe nicht verpassen. Ich wechsle den Platz und setze mich für die restlichen vierhundert Kilometer an ein Fenster auf der linken Seite der fast leeren Boeing 737, in der Hoffnung, einen Blick auf das große Ohr in der Lop Nor zu erhaschen. Mehr als alle Reiseberichte hatte mich in den letzten Wochen das Satellitenbild meines Reiseziels fasziniert: Das Gelände zeichnet ein riesenhaftes Ohr in den Sand, mit einem türkisfarbenen Anhänger im Ohrläppchen. Das Ohr ist die tektonische Hinterlassenschaft eines ausgetrockneten Wüstensees, eine weißliche Verfärbung von abgelagerten Sedimenten im beigen Wüstenboden; der Schmuck, einige lose rechteckige Glitzerplättchen, wird von den gigantischen Kaliumbecken der Lop Nor Potash Company gebildet. Bei der imposanten Anlage handelt es sich um den größten Düngerproduzenten Chinas, mit dem ich die Details für die Produktionsanlage besprechen soll.
Wir fliegen viel zu weit westlich, der gelbbraune Sand der Taklamakan erstreckt sich bis zum Horizont. Ich blinzle gegen Osten Richtung Mongolei, wo das Tarimbecken mit der Lop Nor endet und in die Kumtag-Wüste übergeht. Das große Ohr bleibt Ahnung, irgendwo in der Spalte des anbrechenden Tages zwischen Himmel und Erde verkrochen.
Ich grapsche in meiner Reisetasche nach dem kleinen Buch mit dem blauen Kunststoffeinband, Il Millione von Marco Polo. Ich lese seine Beschreibung, wie die Bevölkerung von Qiemo samt Vieh für Tage in die Wüste flüchtete, wenn fremde Heere durch die Stadt zogen. Kein Reisebericht auf der Höhe der Zeit, aber ich lasse mich gerne durch seine Wunder der Welt in andere Epochen und Wirklichkeiten entführen. Ich mag diese Balance aus Fact und Fiction, bei der ich nie exakt weiß, was Tatsache ist und wo die Flunkerei beginnt. Doch ich bin zu erschöpft, um lange mit Marco Polo auf der Seidenstraße zu wandeln. Ich ordere bei der Stewardess einen Kaffee, klappe den Laptop auf. Gehe noch einmal die wichtigen Stellen in den Dokumenten durch, die ich mir für das Meeting zusammengestellt habe. Die Sachlage ist mir vertraut, ich habe schon Jahre an der resistenten Tomate getüftelt, bevor das Virus neunzig Prozent der weltweiten Ernte vernichtet hat. Trotz aller Faktenkenntnis ist mir bei diesem Job nur halb wohl, ich bin kein Außendienstler und verfüge weder über Verhandlungserfahrung noch ein besonderes diplomatisches Geschick.
Ich arbeite für einen Basler Saatgut- und Düngerproduzenten, der vor einigen Jahren von ChemChina übernommen wurde. Ich konnte nicht ganz nachvollziehen, warum der Konzern gerade mich aus dem Labor abbestellte, warum ich aus Europa anreisen sollte – einer unserer Vertreter aus Shanghai wäre geeigneter gewesen, um den Aufbau der industriellen Anlage zu begleiten. China ist Fremdland für mich. Ob mein bescheidener kultureller Background reichen würde, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, erschien mir fragwürdig. Mein Vorgesetzter meinte, entscheidend sei, nicht bloß einen Diplomaten oder Juristen zu schicken, sondern einen gestandenen Chemiker mit fundierten Kenntnissen, der wusste, welche Hürden beim Schritt des Verfahrens aus dem Labor in die Produktion zu erwarten waren und der die Möglichkeiten vor Ort beurteilen konnte. Die Zeit drängte, die Beimischung der Zusatzstoffe für unsere virusresistente Tomate gestaltete sich einigermaßen heikel – und der Zeitdruck durfte nicht zu einer fehleranfälligen Produktionsstraße führen. Wir können uns weder Pannen noch Abstriche bei der Qualität leisten, meinte mein Vorgesetzter.
Einige Tage rang ich mit mir.
Fachlich hatte ich keine Bedenken, und ich traute mir zu, mit den Chemikern vor Ort zurechtzukommen. Mehr Sorgen bereitete mir die politische Situation. Ich las einige Berichte über die autonome Republik Xinjiang: Die Zustände dort verhießen keine entspannte Urlaubsreise. Wer begibt sich freiwillig in das weltweit größte Gefangenenlager? Und wie sollte ich vor mir selber rechtfertigen, dorthin zu reisen, um mit den Wächtern zu paktieren?
Schließlich fügte ich mich.
Einerseits aus Pflichtgefühl. Die Bedeutung dieser Reise verstand ich durchaus. Es geht um die Nahrungsmittelsicherheit der Weltgemeinschaft – der Zufall hatte mir eine Aufgabe zugespielt, die sich als systemrelevant erweisen könnte. Ich durfte mich nicht davor drücken.
Andererseits erleichterte mir die Firma die Zusage mit einem Zückerchen. Nach den Verhandlungen sollte ich zwei Wochen Urlaub erhalten, für Streifzüge durch die Taklamakan. Die Gelegenheit, etwas Wüstenluft zu schnuppern, konnte ich mir schlecht entgehen lassen.
Ich bin der Letzte der Dutzend Reisenden, die der Boing 737 entsteigen. Zähneklappernd schreiten wir mit unseren scheppernden Rollkoffern entlang der Wachposten zur Halle des Qiemo Yudu Airport. Die kleine Gruppe wirkt auf mich keineswegs so feindlich, wie Marco Polo das einfallende Heer in Qiemo beschrieben hat, doch beim Sicherheitscheck wird uns deutlich zu verstehen gegeben, dass man in Xinjiang Reisende grundsätzlich lieber als Invasoren denn als Gäste sieht. Reisepass, Visum, Smartphone und die Papiere mit der Einladung der Lop Nor Potash Company verschwinden mit einem Beamten in einem Hinterzimmer. Für die Gesichtserkennung werde ich eine halbe Ewigkeit in einen 3-D-Scanner gesetzt, es folgen eine Speichelprobe und ein Pikser in den linken Zeigefinger für die Blutentnahme. Beim Anal-Swab muss ich mir mit einem Wattestäbchen im Darm herumrühren lassen. Dann werde ich angehalten, den Inhalt meiner Koffer vor den Augen dreier Beamter auszubreiten. Ein zweistündiges Prozedere, bis ich registriert und als gesund deklariert samt meinen Sachen passieren darf.
Die Reisebegleiterin empfängt mich in der Ankunftshalle. Ich hatte eine gestrenge Chinesin in Uniform erwartet, die mir als Aufsicht zugeteilt würde, und übersehe die junge Frau im ersten Moment, die das Pappschild mit dem Namen Martin Eberhard in die Luft streckt.
Ich habe gelesen, der Kontakt von Einheimischen mit Ausländern würde rigoros unterbunden. So staune ich nicht schlecht, dass ich hier von einer bildhübschen Turkmenin abgeholt werde. Sahkila Tursan, sie stellt sich mit einem einnehmenden Lächeln vor. Schulterlanges schwarzes Haar, ein ebenmäßiges, beinahe arabisches Gesicht, volle Lippen, eine markante, lang gezogene Nase, dunkle Augen. In den Ohrläppchen zwei blaue Schmucksteine. Kein Schleier, sie ist gekleidet wie ein modernes Mädchen in Istanbul, lässiger Pullover, Jeans, ein etwas zu großer grauer Mantel, Halstuch mit Karomustern.
Vor dem Ausgang hieve ich meinen Koffer auf eine Sitzbank und grapsche Pullover, Handschuhe und Mütze hervor. Ich konnte mir nie recht vorstellen, wie es an einem Ort, wo im Sommer die Temperatur auf über vierzig Grad Celsius klettert, Ende November bitterkalt sein kann. Nach dem kurzen Gang vom Flugzeug zum Hangar zweifle ich nicht mehr daran, steifer Wind, die Temperatur nur wenig über dem Nullpunkt – die zweihundert Meter haben gereicht, um mir den Arsch abzufrieren.
Am Taxistand vorbei folge ich Frau Tursan auf das Parkfeld zu einem chinesischen Offroader. Ein weißer Beijing BJ80, auf der Seite prangt das Firmenlogo der SDIC, drei rote Quadrate, die gekippt auf einer Ecke stehen und sich überlappen. Der Fahrer steigt aus, ein untersetzter, nicht mehr ganz junger Chinese mit schütterem Haar, penibel von Ohr zu Ohr drapiert. Er grüßt knapp, verstaut meine Koffer und setzt sich rasch wieder hinter das Steuer in die Wärme. Li Wang, stellt ihn Frau Tursan vor, öffnet die Beifahrertür und bittet mich, einzusteigen.
Qiemo liegt südlich vom Flughafen, ich sehe die altehrwürdige Stadt leider nicht. Der chinesische Chauffeur nimmt die nordwestliche Ausfallstraße Richtung Roqiang. Wir fahren entlang des mäandernden Laufes des Qiemo-Flusses einige Kilometer durch Plantagen und ausgedehnte Baumwollfelder, dann Sand, Sand, Sand. Die Dünen sind mit Hecken aus Steppengras und struppigen Büschen überzogen, angeordnet in einem streng geometrischen Raster. Die schachbrettartige Bepflanzung sei eine Maßnahme gegen die Desertifikation, erklärt Frau Tursan, der Sand wälze sich von Jahr zu Jahr mehr auf die Stadt und Plantagen zu. Dann die endlose ockergelbe Weite, ohne jede Vegetation, reine Form und Farbe. Geschwungene Wellenmuster, die sanft ansteigenden Luvseiten der Dünen, nach dem Grat steil abbrechend – ein Thema in unzähligen Variationen. Die Wellen eines Meers, in dem die Zeit stillsteht. Eine Landschaft, wo der Geist mit dem großen Ganzen verbunden ist: Alle Weltreligionen sind in Wüsten entstanden. Ich fühle die innere Erregung, die mich immer beim Anblick von Wüstenlandschaften packt. Ich bin froh, den Job angenommen zu haben und hier zu sein. Auch wenn es anstrengend werden dürfte, die Wüste wird alle Widrigkeiten als nichtig erscheinen lassen.
Wir fahren auf der makellos geteerten Straße, der Fahrer hat das Radio aufgedreht, seltsame Songs und Kommentare auf Mandarin. Ich versuche, den Singsang auszublenden, und lasse mich von der vorbeiflitzenden Gegend berauschen. Rufe die Erinnerung an den Bildband wach, den ich als sechzehnjähriger Junge von meinem Paten geschenkt erhalten hatte, Otl Aichers »Gehen durch die Wüste«. Der berühmte Designer packte jedes Jahr seinen Rucksack mit dem Nötigsten und verließ für einige Wochen die Agentur in Rotis, um in die Sahara aufzubrechen und alleine ein Stück Wüste zu durchqueren. Die Wüste als Raum der Reduktion und Konzentration – seine Beschreibung hat mich nie mehr losgelassen.
Die Verhandlungen mit der Lop Nor Potash Company würden hoffentlich nach einigen Tagen abgeschlossen sein, und es sprach nichts dagegen, einen Wüstentrip anzuhängen und zwei Wochen auf den Spuren von Sven Hedin und Aurel Stein durch die Taklamakan zu streifen. Freundlicherweise anerbot sich die Potash Company, mir ein touristisches Angebot zu buchen und mir Fahrer und Wagen zu stellen. Meine Firma hatte darauf bestanden, dass ich den Trip selbst bezahle und Urlaubstage dafür einsetze, Geschenke von Partnerfirmen werden nicht toleriert.
Ich weiß es zu schätzen, dass Frau Tursan mich nicht in der Art übereifriger Reisebegleiter mit Informationen zutextet, sondern mich meinen Träumereien überlässt. Wenn ich eine Frage an sie richte, speist sie mich nicht mit Standardfloskeln ab, ihre Bemerkungen sind intelligent und sachkundig.
Wir gleiten durch die endlose Weite. Wind und Wetter lassen über die Zeit alles Geformte zu Staub und Sand erodieren, Leben ist hier fehl am Platz. Ich sage laut: Ich habe gelesen, Taklamakan heißt »Wüste des Todes« oder »Platz ohne Wiederkehr«. Begibst du dich rein, kommst du nie wieder raus.
Frau Tursan lacht, lehnt sich zwischen den Sitzen nach vorne und beteuert, sie werde schon aufpassen, dass sie mich wieder heil am Flughafen abliefere. Etymologisch sei die gängige Übersetzung von Taklamakan übrigens falsch: Das uigurische Wort Takli sei eine Ableitung des türkischen Wortes Tohlak, was Pappel bedeute. Taklamakan heiße viel mehr das Land der Pappeln. Im Tarimbecken, heute die zweitgrößte Sandwüste der Welt, hätten sich vor 2000 Jahren riesige Baumbestände befunden. Bevor das Klima gekippt sei, hätten sich alte Hochkulturen entlang der Seidenstraße entwickelt, Städte in blühenden Oasen inmitten von Pappelwäldern.
Wir passieren einen Kontrollposten. Zwei Polizeifahrzeuge am Straßenrand, ein Schlagbaum mitten im großen Nichts. Ein Uniformierter winkt mit einer Kelle, der Fahrer hält an. Die Pässe werden kontrolliert, meine Einreisepapiere ebenfalls. Es dauert ewig, bis der Beamte mit unseren Dokumenten zurückkommt. Frau Tursan mahnt mich zur Geduld, ich solle mich besser damit abfinden, auf der S 235 sei die Anzahl der Kontrollposten hoch.
Es folgen zwei weitere Kontrollen, eine Streife, dann winkt uns ein Militärfahrzeug zur Seite. Die Soldaten behandeln uns wie entlaufene Sträflinge, ruppig und herablassend, aber schließlich lassen sie uns passieren.
Wir erreichen Ruoqiang.
Li Wang lässt uns vor dem Loulan-Hotel aussteigen. Ein brutalistischer Klotz in Zuckerbäckerfarben, die Wände mit rosa Quadern gemauert, unterbrochen von orangefarbenem Gesims und einem Eingangsportal, das chinesischen Tempeln nachempfunden ist. Sterile Eingangshalle, glatt polierter Stein an Boden und Wänden, goldene Zierleisten beim Counter. Die gepuderte Rezeptionistin passt perfekt zum Inventar. Sie bewegt sich, stelle ich erleichtert fest – sie ist also nicht aus Porzellan. Wir tauschen unsere Pässe gegen die Schlüssel. Der Concierge packt die Koffer auf ein Rollgestell, rollt das Gepäck in den Aufzug. Frau Tursan will auf den Chauffeur warten, ich nicke. Wir verabreden uns für das Abendessen, dann ziehe ich mich auf das Zimmer zurück.
Tashmamat Soup and Noodle
Auf dem kurzen Fußmarsch zum Restaurant hat Frau Tursan den Mantelkragen hochgeschlagen und die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Sie hastet mir voraus. Ich versuche, nicht zurückzufallen. Plötzlich bemerke ich, dass überall Kameras angebracht sind. Keine Kreuzung und kein Straßenzug, wo nicht mindestens eine Kamera an einer Laterne oder Hausecke montiert wäre. In einer dunklen windgeschützten Nische wartet Frau Tursan, bis ich zu ihr aufgeschlossen habe. Ich zeige meine Irritation über ihr Tempo und deute fragend auf eine Kamera an der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja, vernehme ich aus dem Schlitz zwischen Mütze und Kragen, hier werde eben für Sicherheit gesorgt, kaum Kriminalität, ausländische Gäste brauchten sich nicht zu ängstigen. Ich glaube, einen schnippischen Unterton in ihrer Stimme zu hören, schiele zu ihr hinüber, kann im diesigen Licht aber nicht beurteilen, ob ich da eine leise Kritik an der Ordnungsmacht vernommen habe. Wirklich verdammt eisig heute Abend, sagt sie, schlägt den Kragen noch höher und eilt davon. Ich haste dem flatternden Mantel hinterher, bis sie nach rechts ausschert und durch eine blecherne Tür verschwindet. Seitlich über einem schmalen Oberlicht ein schiefes Schild mit der Aufschrift Tashmamat Soup and Noodle.
Wir betreten das Lokal. In dem Kalksteinbau mit den Fensterschlitzen über unseren Köpfen und dem rohen Zementboden hätte sich genauso gut eine mechanische Werkstatt einquartieren können. Der Wirt hatte alles gegeben, um den Ort mit Herzblut und viel synthetischem Pomp nach seinen ästhetischen Vorstellungen aufzuhübschen. Wir sind die ersten Kunden an diesem Abend. Hinter dem Küchentresen winkt der weißbeschürzte Koch und bedeutet uns mit einer Geste, Platz zu nehmen. Frau Tursan führt mich an einen Tisch unweit des Eingangs und bietet mir den Platz bei der Wand an. Das ist ein Logenplatz mit bester Sicht in die Küche, sagt sie. Tashmamats Kochkünste seien für das Auge mindestens so spektakulär wie für den Gaumen. Action Cooking in Reinkultur, keiner bereite die Speisen kunstfertiger zu als Tashmamat.
Ich konsultiere die Speisekarte, vergleiche die vergilbten Bildchen der Gerichte miteinander. Ich bin unschlüssig. Frau Tursan empfiehlt Uygur Chuzma-Lagman, ein hiesiges Nationalgericht, das auch ihre Mutter immer gekocht habe. Frische Nudeln, nicht geschnitten oder durch ein Sieb gepresst, wie das bei uns im Westen gemacht werde, sondern aus dem Teig gezogen. Eine Soße aus Gemüse und Ziegenfleisch. Warum nicht? Ich lasse mich gerne überraschen.
Wir bestellen, das Spektakel beginnt.
Der Koch zupft einen Klumpen Teig aus der Schüssel. Er zieht ihn in die Länge, versetzt der Wurst einen Drall, wie wenn ein Mädchen ihr Springseil in Schwung bringt. Er pappt die beiden Enden zusammen, und die Energie des Dralls überträgt sich in die hängende Wurst, sie verquirlt sich wie die Stränge eines Seils. Die linke Hand packt das untere Ende, er zieht die armdicke Wurst erneut auf die doppelte Länge, gibt eine Prise Drall zu, legt die Enden aufeinander, und der gefaltete Strang wickelt sich erneut von oben nach unten um sich selbst. Der Koch verrichtet die Handgriffe in einem atemberaubenden Tempo, ein ums andere Mal, in perfekter Symmetrie: Einmal greift die rechte, das nächste Mal die linke Hand den unteren Zipfel der Wurst. Es gibt dafür keine Notwendigkeit, außer dem Wunsch nach der choreografisch perfekten Abfolge einer Bewegung. Ballett des Handwerks, Artistik des Meisters. Nach einer halben Minute verpasst er dem Teig zum letzten Mal eine Eigendrehung, dann legt er den Strang auf den Tisch, kappt mit dem Messer die beiden Enden, wirft die Zipfel zurück in die Teigschüssel, schabt mit den Händen Mehl auf der Arbeitsfläche zusammen und reibt den Strang damit ein. Legt die Rolle zu einem offenen Kreis, packt die beiden Enden mit der Linken, die gegenüberliegende Seite der Schlaufe mit der Rechten und zieht den Teig auseinander, soweit seine Arme reichen. Er klappt die beiden Enden aufeinander, dehnt die Schlinge auf die doppelte Länge, immer wieder von Neuem, aus zwei entstehen vier, dann acht immer dünnere Spaghetti, und dank des exponentiellen Wachstums dauert es keine fünf Atemzüge, bis der Koch einen ordentlichen Packen Nudeln zur Seite legt. Er erinnert mich an die Wollstränge meiner Oma, als sie für ihre Strickprojekte jeweils meine Arme ruhigstellte, um sie als Haspel zu nutzen.
Ich staune.
Wenn ich mir ausmale, was bei dieser leichthändigen Vorführung alles schieflaufen kann, dann grenzt die Fertigkeit dieses Koches an Zauberei.
Zwanzig Jahre Übung reichen, meint Frau Tursan. Zauberei sei nicht nötig. Zwanzig Jahre Übung von Tashmamat plus tausend Jahre kultureller Erfahrung, welche Konsistenz der Teig aufweisen muss, damit er gezogen werden kann. Fingerspitzengefühl, die Kenntnis der Kräfte, die den Teigling dehnen, ohne ihn zu zerreißen. In dieser einen Minute Action Cooking kondensiere das Wissen eines Jahrtausends, erklärt mir Frau Tursan, der ganze kostbare Schatz unserer Vorfahren. Sie macht ein strenges Gesicht: Bedenken Sie, die Italiener haben uns immerhin die Pasta abgekupfert! Marco Polo hatte sich alles gemerkt, Industriespionage im ausgehenden Mittelalter! Sie zuckt mit den Schultern, blickt nach unten wie eine beim Schummeln ertappte Göre, lächelt mich mit schräg gestelltem Kopf schelmisch an. Na ja, das stimmt wohl nicht ganz, auch wenn wir Uiguren uns das so erzählen. Nicht wir haben es erfunden, Nudeln wurden in Europa und Asien schon in Steinzeitgräbern entdeckt. Marco Polo brachte im dreizehnten Jahrhundert bloß Lagman-Rezepte nach Venedig und popularisierte die Speise im Westen.
Was soll’s, beschwichtige ich sie, jedes Volk braucht seine Legenden. Ich lasse mir gerne vorgaukeln, hier an der Wiege der Pasta gelandet zu sein.
Der Koch schnippelt das Gemüse, dünstet Zwiebeln an, gibt das Ziegenfleisch zu, löscht mit Bouillon ab und lässt die Soße auf kleinem Feuer köcheln. Ich folge den Handgriffen des Kochs, Abschmecken, Würzen, erneutes Kosten. Die Eleganz seiner Verrichtungen bietet Hochgenuss für einen Augenmenschen.
Aus einer Schale neben der Spüle greift er drei pralle Tomaten, schnippelt sie in Zentimeter große Stücke und streicht sie mit dem Messer vom Brett in den Kochtopf.
Ich stutze.
Tomaten? Wo um aller Welt hat er Tomaten her? Frische Tomaten sind unbezahlbar, das Virus hat im letzten Jahr beinahe die gesamte globale Ernte vernichtet, und unser neues Produkt, die Blue Dragon®, wird erst in einigen Versuchsanlagen in Ürümqi angebaut, und diese drei Tomaten waren rot, nicht blau …
Frau Tursan bemerkt meine Erregung.
Ich deute zum Koch und formuliere mein Erstaunen: Wir konnten in unseren Labors bei keiner einzigen bekannten Sorte eine Virusresistenz nachweisen. Und solche makellosen Tomaten ohne Runzeln und braune Flecken habe ich seit Jahren keine mehr gesehen. Wie ist das möglich?
Sie schiebt ihre Augenbrauen nach oben, legt die Stirn in Falten, zuckt mit den Schultern. Dann winkt sie den Koch zu uns an den Tisch.
Er wischt sich die Hände an einem Tuch trocken, hört zu, nickt, stopft das Tuch in den Gürtel seines Schurzes, lacht und beginnt zu erzählen. Die Tomaten habe er aus dem Garten seiner Mutter. Genau genommen aus dem Einmachglas, die Mutter habe die Ernte des Herbstes konserviert. Er freue sich sehr, uns in dieser schwierigen Zeit ein authentisches Gericht servieren zu können, ohne Tomaten schmecke sein Chuzma-Lagman nicht halb so gut.
Die Seuche habe den Garten glücklicherweise bisher verschont. Die Tomaten seien stark. Eine alte Sorte, den Garten und die Pflanzen habe seine Mutter von seiner Oma und diese wiederum von ihrer Mutter übernommen, viele Generationen zurück.
Den Namen der Sorte habe ich noch nie gehört, der Koch sagt, er bedeute die Perlen Mohameds.
Gerne hätte ich mehr über den Garten der Mutter des Kochs erfahren, offenbar ist Virusresistenz kein Alleinstellungsmerkmal unserer Blue Dragon®. Eine autochthone Sorte, unterhalb unseres Radars. Das ist bedeutsam. Leider eilt der Koch zurück in die Küche, um die Gasflamme unter dem brodelnden Topf zurückzustellen.
Der Garten – liegt er am Rande von Rouqiang? In einer kleinen Oase im Umland? Weit kann er nicht sein, wenn der Koch die Tomaten heute geholt hat. Welche Eigenschaften weist diese Tomate zudem auf, bezüglich Geschmack, Konsistenz, Lagerfähigkeit?
Ich langweile Frau Tursan mit meinem Monolog. Peinlich berührt versuche ich, ihr meine Erregung verständlich zu machen. Das Tomatenvirus ist eine immense Bedrohung, ich habe die vergangenen Jahre mit einem Team hochdotierter Molekular- und Mikrobiologen, Immunologen und Chemiker an der Lösung gearbeitet und wurde hierhergeschickt, um die letzten Hürden zu beseitigen, damit unsere resistente Pflanze im großen Stil auf den Plantagen angebaut werden kann.
Frau Tursan winkt ab. Lassen Sie uns nicht die Probleme dieser Welt wälzen, nicht heute Abend.
Ich entschuldige mich.
Sie lächelt: Ist schon okay.
Während wir auf die Nudeln warten, muss ich mich zwingen, nicht unentwegt in ihre schwarzen Augen zu starren. Ich bin neugierig, wer mir gegenübersitzt. Ich suche krampfhaft nach einem Ansatzpunkt, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Aber mein Kopf ist leer wie die Wüste. Ich kenne das: Wenn ich mich bei schönen Frauen angestrengt um meine Wirkung bemühe und mit Charme und Witz brillieren will, werde ich total verstockt. Verstopft wie eine Ketchupflasche, wo sich der Pfropfen im falschen Moment löst und ich mit einem Redeschwall bestimmt die ganze Stimmung versaue. Verlegen wende ich mich von ihr ab, senke den Blick, betrachte die Musterung des bordeauxroten Brokattischtuchs unter der Glasscheibe unseres Tischs, gleite über das Laminat mit den Speisen, schweife über die ausgebleichten Kunstdrucke an den Wänden, den rotstichigen Schnee auf den Gipfeln von Karakorum und Kunlun, um erneut auf ihrem bildschönen Gesicht zu landen.
Die Nudeln, knappe drei Minuten in kochendem Wasser gegart, sind überraschend bissfest, der Sugo schmackhaft, die Tomaten erstaunen mich mit ihrem komplexen Aroma zwischen Wassermelone und Ananas. Ich genieße es, die Frucht dieses bedrohten Nachtschattengewächses für einmal auf der Zunge anstatt in der Petrischale zergehen zu lassen. Allerdings ist das Gericht recht ölig, wir benötigen reichlich Fettlöser, zuerst Bier, schließlich einige Gläschen Maotai, den chinesischen Hirseschnaps.
Das Lokal ist überheizt, es ist stickig, eine Mischung aus scharfen Gewürzen, Frittieröl und Rosenwasser hängt in der Luft. Ich öffne die oberen Knöpfe an meinem Hemd, Sahkila legt ihren Überwurf zur Seite, zieht kurz darauf ihren Pullover aus. Sie trägt ein schwarzes Tanktop. Mich irritiert ihre freizügige Kleidung, irgendwie ist da eine Schicht zu viel gefallen. Die schmalen Träger des BHs ziehen über die Schultern, die Brüste buchten das ärmellose Shirt. Auf dem linken Oberarm zwei kreisrunde Narben. Impfungen?
Shakila!, sagt sie und streckt mir ihr Glas mit dem Maotai entgegen. Ich fühle mich ertappt: Habe ich wieder gestarrt?
Ich heiße Sahkila …
Ich lächle verlegen, hebe mein Glas. Martin, freut mich!
Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Nutzen wir die Tage, die wir vor uns haben! Auf eine spannende Reise!
Die Hitze und der Maotai lassen das Eis schmelzen, bald sind wir in ein inniges Gespräch vertieft.
Sie stammt aus einem Dorf nördlich der Taklamakan. Der Vater ist Lehrer, ein gläubiger Muslim, sie schildert ihn als weltoffenen, friedfertigen Mann mit großem Herzen. Sie habe eine glückliche Kindheit verbracht, mit Freunden und Freundinnen unter blühenden Tamarisken, sie sei im Schatten der Pappeln herumgetollt, habe in den Feldern geholfen und wie die Jungs die Schule besucht. Ich versuche, mir vorzustellen, wie es ist, in der Kargheit einer Oase aufzuwachsen. Ich erzähle von meinem Vater, ein weltgewandter und erfolgreicher Geschäftsmann mit klaren Prinzipien. Meine Mutter spielte in fast schon klischierter Weise den Gegenpart, in ihrer vergeistigten und zerbrechlichen Art kümmerte sie sich fürsorglich um mich. Eine Helikoptermama, die ihren Sohn im Auto in die Schule chauffierte, in Malkurse. Ich habe meine Kindheit nicht auf Sportplätzen verbracht, sondern mit Mama endlos Museen und Galerien abgeklappert. Unter Mamas Fittichen wurde ich zu einem einsamen und traurigen Jungen, erst im Studium in München und später in Basel wurde ich geselliger, fand erste Kumpels, eine Freundin.
Sahkila wird wortkarg, als ich mich für ihre Ausbildung und die Studienjahre interessiere. Ich erfahre gerade mal, dass sie als Jugendliche ein Internat in der Nähe von Ürümqi besucht hat. Allerdings kann sie ihre Enttäuschung nicht verbergen: Ihr Berufswunsch Archäologie ist nicht in Erfüllung gegangen. Wie gerne hätte sie die Wiege ihrer Kultur erforscht, die frühen Besiedlungen in der Taklamakan, die prosperierenden Wüstenstädte entlang der Seidenstraße, aber hier gebe es eben keine freie Berufswahl. Sie sei auf Journalistik ausgewichen, da waren Studienplätze frei, und schließlich sei sie in der Touristik gelandet. Schicksalsergeben zuckt sie mit den Schultern.
Mich bekümmert der nachdenkliche Zug um ihre Augen. Ich möchte verhindern, dass sie weg driftet aus der gerade errungenen Unbeschwertheit dieses Abends, will sie aufheitern. Sahkila, sage ich, ist denn immer so klar, welche Wünsche uns bekommen, welche Ziele die erstrebenswerten sind? Ich habe ein Semester Kunstgeschichte studiert, dann aufgrund der fehlenden Berufsperspektiven und des Drängens meines Vaters zur Chemie gewechselt. Irgendwie ist es Zufall, welche Neigungen schließlich in ein Berufsleben münden. Oder es ist ein Versehen. Heute denke ich, mit dem Wechsel wird es seine Richtigkeit gehabt haben. Als Kunsthistoriker säße ich heute kaum mit dir in diesem Lokal, und womöglich wäre meine erste Berufung in einem Geldjob verkümmert. Chemie ist okay, im Grunde finde ich es genauso spannend, der Natur auf die Schliche zu kommen und herauszufinden, wie die Stoffe miteinander interagieren. Und ich kann etwas Produktives für die Gesellschaft leisten. Auch Touristik ist okay, da begegnest du immerhin lebenden Menschen und nicht nur Mumien.
Sie lacht, prostet mir zu. Du hast keine Ahnung, wie schön Mumien sein können!
Museum Ruoqiang
Nein, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie schön Mumien sein können.
Aber nach dem bezaubernden Abend und einer erholsamen Nacht zeigt Sahkila mir am nächsten Morgen die Schöne von Loulan. Das Museum ist einen Steinwurf vom Hotel entfernt, ein Muss für Möchtegern-Archäologinnen und Beinahe-Historiker.
Die Schöne von Loulan empfängt uns an der Hausfassade neben dem Eingang. In doppelter Lebensgröße tritt sie als Halbrelief aus der Mauer. Feingliedrig, in ein wallendes Gewand mit spitz zulaufender Kapuze gehüllt, schwebt sie über dem Boden und richtet ihren Blick auf die Erdlinge, die die Treppe zum Museum hochsteigen. Als Fee würde sie vorzüglich auf das Cover eines Fantasyromans passen, die Interpretation der berühmten Mumie ist mir etwas zu süßlich geraten. Dennoch nicke ich Sahkila zuliebe anerkennend, sie schwärmt von der künstlerischen Raffinesse, lobt die Lebensechtheit der Bewegung und die Lebendigkeit des Faltenwurfs.
Der Eintritt kostet nichts, nur das Handy müssen wir vorweisen, damit Identität und Gesundheitsattest kontrolliert werden können.
Das Museum ist nicht für ausländische Gäste gedacht, alle Schildchen sind auf Chinesisch gehalten. Hilflos streune ich zwischen Vitrinen mit Tonscherben, Holzstückchen und Metallklingen herum. Sahkila führt mich im ersten Saal zu einem riesigen Stadtmodell. Es zeigt Loulan. Die Stadtmauer umfriedet eine quadratische Fläche, die von einem diagonal verlaufenden Flüsschen in zwei Hälften geteilt wird. Mehrere Brücken verbinden die lose Ansammlung von Häusern, Plätzen, Tiergehegen und Bäumen. Mir fallen Sakralbauten auf, ein buddhistischer Stupa. Sahkila erklärt, das hier sei eine Rekonstruktion der Ruinen, die Sven Hedin und Aurel Stein Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts im Wüstensand entdeckt haben. Sie redet sich in Fahrt: Im Nordwesten Chinas brach um das Jahr 200 vor Christus eine Periode hoher Temperaturen und starker Niederschläge an. Die Flüsse, die in den See Lop Nor mündeten, wurden zu breiten Strömen. Sie entsalzten das Wasser des Wüstensees, ließen ihn über das Ufer treten und schufen damit große Feuchtgebiete, die landwirtschaftlich genutzt werden konnten. Am Nordwestufer entstand Loulan. Die Oasenstadt lag an der Schnittstelle zweier Mächte: Den Süden dominierte das Reich der Han-Chinesen, der Norden wurde von Xiongnu beherrscht, einem Stammesverband zentralasiatischer Reiternomaden. Beide bedrängten die Metropole an der Transitroute zwischen Asien und Europa. Die meiste Zeit seiner fünfhundertjährigen Geschichte verbrachte Loulan schließlich unter chinesischer Herrschaft. Das änderte allerdings nichts an der kulturellen Ausrichtung nach Westen: Die blühende Handelsstadt an der mittleren Seidenstraße pflegte einen produktiven Austausch mit dem Nahen Osten.
Die fortschreitende Klimaveränderung leitete nach dem Jahr 300 den Niedergang der chinesischen Garnisonsstadt ein. Nach einer Periode anhaltender Trockenheit mussten die Städte an der mittleren Route der Seidenstraße wegen der Dürre aufgegeben werden. Das Kippen des Klimas wurde durch die Übernutzung der vorhandenen Ressourcen befördert, insbesondere durch das unbedachte Abholzen der Pappelwälder. Die ersten Umweltgesetze der Menschheit wurden von der Stadtverwaltung von Loulan erlassen, erzählt Sahkila: Die Behörden reglementierten den Gebrauch von Wasser und Holz. Wer einen ausgewachsenen Baum entwurzelte, wurde mit der Busse eines Pferdes bestraft. Und wer einen Baum in der Wachstumsphase fällte, musste mit dem Wert einer Kuh geradestehen. Doch die Maßnahmen erfolgten zu spät, und gegen die Laune des Flusses Tarim, der den See Lop Nor speiste, waren die Behörden machtlos: Um das Jahr 300 änderte er seinen Lauf, und die Besiedlung musste aufgegeben werden.
Im Saal mit den Mumien führt mich Sahkila zu der Schönen von Loulan. Mit der C14-Methode wurde ihr Alter auf dreitausendachthundert Jahre bestimmt, sagt Sahkila. Die Kaukasier lebten demnach bereits über tausend Jahre in der Gegend, bevor Loulan in den Geschichtsbüchern der Han auftauchte. Wir steigen vier Stufen empor auf ein altarartiges Gebilde aus schwarzem Stein. In den Boden eingelassen, unter einer dicken Glasscheibe, liegt sie da. Ihr Körper ist in grobe Tücher gewickelt, ein juteartiger Stoff in den Farben des Wüstensandes, an den Rändern ausgefranst. Die spitz zulaufende Kapuze umhüllt das Gesicht wie die Robe einer Nonne, nur der Federschmuck passt nicht recht ins Bild. Das lange dunkelbraune Haar ist vom Scheitel zu den Ohren gekämmt, ein schmaler Streifen lugt unter dem Stoff hervor und rahmt das ebenmäßige Antlitz.
Die junge Frau hat ihre Anmut für die Ewigkeit bewahrt. Mit geschlossenen Augen ruht sie seit Jahrtausenden, als würde sie bei einem Nickerchen neue Kräfte sammeln. Ich betrachte die glatte Haut, die lang gezogene Nase und die schmalen Lippen, die ausgeprägten Wangenknochen. Dabei beschleicht mich das unbehagliche Gefühl, sie könnte jeden Moment die Augen öffnen und den Spanner ertappen. Mein tastender Blick erscheint mir übergriffig. In meinem Kopf überblende ich die Gesichter, wahrscheinlich wegen der markanten Wangenknochen: Mir ist, als würde ich Sahkila beim Schlafen zusehen. Sahkila ähnelt der antiken Schönheit frappant. Mein Vergleich amüsiert sie, sie wischt mein Kompliment lachend beiseite. Auf mein Insistieren gesteht sie immerhin eine Typenähnlichkeit zu: Klar doch, sie ist unsere Urmutter, wir Frauen tragen alle ihre Gene in uns! Wenn auch eine tragische Mutter, sagt sie, und ihre Miene verfinstert sich, die junge Frau ist bei einer Fehlgeburt gestorben. Der Fötus ist immer noch in ihrem Bauch, in den Stofffetzen zwischen ihren Beinen haben die Forscher eingetrocknetes Blut gefunden.
Wir setzen unseren Rundgang durch das Museum fort. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich anstelle der Objekte immer häufiger auf das Gesicht von Sahkila konzentriere, das sich in den Vitrinen spiegelt. Sie wäre eine brillante Archäologin geworden. Alle Zurückhaltung und Schüchternheit ist von ihr abgefallen, jeder Stofffetzen, jedes Holzstück wird zum Anlass eines begeisterten Referates. Ich höre ihr gerne zu. Ihre Geschichten beseelen die vertrockneten Artefakte, verbinden die vergangenen Zeiten mit der Erfahrungswelt unserer Gegenwart. Die tanzende Mimik ihres Gesichts haucht den Dingen Leben ein, durch die Spiegelung im Vitrinenglas überlagern sich ihre Züge mit den Gegenständen auf dem schwarzen Samt. Dank ihrer Schilderungen reicht ein unscheinbares Schriftstück, um mir die Nöte und Sehnsüchte eines Menschen zu vergegenwärtigen, der seit zweitausend Jahren tot ist: Ein Kaufmann, den seine Geschäfte in den Westen nach Samarkand führten, schreibt seinem Bruder in Loulan, schickt Grüße aus der Fremde und spricht darüber, wie sehr er seine Verwandten vermisse, beklagt sich über die wirtschaftliche Situation seiner Familie und schildert sein Leiden ob der Tatsache, dass seine Kinder nicht sonderlich erfolgreich sind. Ein Mensch wie du und ich, sagt Sahkila, der mit den Bedingungen seiner Zeit rang und sich bemühte, das Beste daraus zu machen.
In einer Vitrine mit Grabbeilagen aus dem Xiaohe-Friedhof findet sich ein Ensemble mit fünf Hunden. Tiere in der Größe von Kinderhänden aus Lapislazuli: eine anmutige Hündin, ein stolzes Männchen, drei verspielte Welpen. Ich staune, wie detailliert die winzigen Skulpturen gearbeitet sind.
Der Zauber blauer Dinge
Sind das dieselben Hunde, die gestern Abend durch Loulan streunten?
Hörst du mir zu, Sahkila?
Du hast sie gesehen, in den Ruinen des Regierungspalastes, wie sie durch ein Loch in der Mauer schlüpften, ein ganzes Rudel, einer ist auf mich zugekommen, hat mich in die Hand gebissen … Warum sagst du nichts? Bitte schweige nicht, deine Stimme verleiht mir Halt.
Eben noch habe ich dich gehört, jetzt nichts als das Keuchen der Wüstengeister, der Wind rüttelt am Zelt, die Planen flattern im spärlichen Schimmer des Heizstrahlers. Da hängen meine Kleider, darunter das Gepäck, die Schuhe am Fußende des Schlafsacks … aber du bist nicht da.
Ich schließe die Augen.
Horche nach dem Wind.
Wetterleuchten, Blitze zucken durch meinen Kopf … Wieder sehe ich die Hunde, die steinerne Lapislazuli-Familie aus dem Museum in Ruoqiang, die Meute von gestern Abend … vielleicht sind es auch ganz andere Hunde, ich sitze am Wegrand, den Duft von Vergissmeinnicht in der Nase, die Hunde tollen auf einer Wiese voller Blumen, einer löst sich aus der Gruppe, rennt über das Feld zu mir, schmiegt sich an meine Beine und legt den Kopf auf meinen Oberschenkel.
Ich kraule ihn zwischen den Ohren, streichle über sein blaues Fell – und halte plötzlich das steinerne Figürchen aus dem Museum in der Hand. Ich betrachte es von allen Seiten, den Kopf, den Rücken, den Bauch, bewundere den Reichtum der Details in diesem Stück Lapislazuli, das krause Fell, die schlaffen Ohren, die kleinen Pfoten. Ich zwinkere mit den Augen und schon sind die Details verschwunden, das Blau hat sie getilgt, wie eine ausrollende Welle eine Zeichnung im Sand. Ich dringe in das Blau ein, erliege seinem Sog, falle in die Farbe und werde von ihr durchdrungen wie eine Qualle vom Wasser. Eine tiefe Ruhe erfasst mich.
Wer kann sich schon dem Zauber blauer Dinge entziehen, diesen mit der Farbe des Himmels und des Meeres getünchten Dingen, deren Anstrich alle Kanten und Ecken und Flächen verflüssigt und die Dunkelheit der Tiefe an die Oberfläche spült. In der Archäologie der Seele ist Blau die unterste Schicht, verborgen unter den Sedimenten der Geschäftigkeit.
Blaue Hunde, blaue Blumen … blaue Dinge: Raststätten für die Melancholie einer suchenden Seele.
Ich sitze mit verschränkten Beinen in einem Garten in Kyoto. Der Wind trägt den dumpfen Klang eines Holzfischs zu mir, den Gesang der Mönche. Ich öffne die Augen, blinzle in die aufgehende Sonne. Im Gegenlicht ein Blütenkelch. Fünf Blütenblätter falten sich zu einem Trichter, der sich gegen oben öffnet, als möchte er das ganze Blau des Himmels einfangen.
Was uns die Rose, bedeutet den Menschen in Japan die Trichterwinde. Ipomoea nil, hier nennt man die flüchtige Schönheit Asagao, das Morgengesicht. Ihre lavendelfarbigen Blüten öffnen sich im Morgengrauen und falten sich an warmen Tagen bereits nach dem Mittag wieder zusammen. Das schnell wachsende Gewächs umgarnt in einem Tag rasch mal einen kniehohen Gegenstand, die japanische Dichterin Kaga no Chiyo musste ihren Eimer der Umarmung der blauen Blume überlassen: Da mir mein Schöpfeimer / Von der Ranke der Winde geraubt wurde / Bat ich um Wasser.
Ein Samurai hörte von der Schönheit des verschwenderisch blühenden Asagao im Garten des Teemeisters Sen-No-Rikyu. Er beschloss, den Garten zu besichtigen. Als er dort ankam, konnte er keine einzige Asagao entdecken. Wütend betrat er das Teehaus des Meisters – und sah in einer Schale eine einzige atemberaubende Asagao, ein blaues Wunder. Siehe, sagte Meister Rikyu zum Samurai: Wenn du die Schönheit dieser perfekten Blüte erfasst, weißt du mehr, als dir die Pracht des ganzen Gartens jemals hätte vermitteln können.
Ein Morgen in Tokyo. Ich stehe neben dem Kishibojin-Tempel auf dem Asagao-Ichi-Markt, hier wird jedes Jahr zu Ehren der Trichterwinde ein Markt abgehalten. Es geht auf die Sommerferien zu, eine Lehrerin kauft Samen, um sie an ihre Schüler zu verteilen. Sie sollen die Samen in die Erde stecken, die Pflanze pflegen und über ihr Gedeihen Tagebuch führen. Ich sehe einen Jungen, er sitzt vor der Haustür neben dem Blumentopf, unter ihm tobt die Stadt. Der Junge zählt mit ernstem Gesicht die Blüten, notiert geflissentlich Zahl und Datum in sein Schulheft.
Blaue Blumen … bei uns in Europa haben die Dichter die Kornblume und die Wegwarte besungen.
Er sah nichts als die blaue Blume, berichtet Novalis von Heinrichs Traum, und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit.
Für Novalis stand die blaue Blume für die Verbindung von Natur, Mensch und Geist. Sie symbolisierte das Streben nach der Erkenntnis der Natur und des Selbst. Die Wegwarte, einst Symbol der Wanderschaft und Sinnbild für unser Fernweh und für die Sehnsucht nach Transzendenz, ist von den Rändern unserer Straßen verschwunden. Auch die Kornblume hat sich aus den Weizenäckern der Agraringenieure verabschiedet, ich weiß Sahkila, du hast recht mit deinen Anwürfen, ich sühne meine Schuld in dieser Nacht …
Warum lässt du mich alleine?
Ich stelle mir vor, wie du mich in deine Arme schließt und an dich drückst. Wie ich dich küsse.
Am Ufer des Euphrat, unweit des Palastes an der Nordflanke Babylons, stand das Tor der Ischtar, eine von zwei Türmen flankierte Passage in der Umfriedung der antiken Metropole. Die Glasur aus Kobalt- und Kupferoxiden auf den gebrannten Lehmziegeln tauchte die Mauer in ein intensives Blau. In dem Blau tummelten sich goldene Tiere und göttliche Fabelwesen: die Löwen der Ischtar, die Stiere des Wettergottes Adad, die krallenfüßigen Drachen des Stadtgottes Marduk. Das strahlende Blau symbolisierte einen Streifen Himmel über Babylon, ein irdisches Gegenstück für die Prozession des Königs mit seiner Geliebten und dem ganzen Gefolge. Wenn sich meine Zunge zwischen deine Lippen schiebt, durchschreite ich das Tor zum Himmel, wie einstmals Nebukadnezar, ich fühle mich entrückt und hellsichtig, als hätte ich die Pforten der Wahrnehmung durchschritten, von der Huxley sprach.
Ich möchte dir die blaue Blume zeigen – die Morning Glory ist verwelkt, Wegwarte und Kornblume sind verschwunden. Auch du bist nicht da, du schließt mich nicht in deine Arme, du stößt mich weg …
Habe ich alles falsch gemacht? Nach den Sternen gegriffen und bin über den Stein vor meinen Füssen gestolpert? Lass mich aufstehen und weiter gehen, die Taklamakan ist kein Ort der Einkehr, sie ist ein Gelände der Entgrenzung.
Ich spaziere hinter dem Himmel, unentwegtes Blau, allüberall. Ich bin ein Pilger und vermesse die Strecke in Körperlängen, ich falte die Hände, knie nieder, strecke mich aus, ziehe den Körper zu den Händen, stehe auf – Etappe um Etappe. Keine Reise in Sternschiffen, ich bin das Maß aller Dinge, lass mich nicht überheblich werden.
Lop Nor Potash Company, die Kanäle
Nach den Baumwollfeldern von Fujielian zweigt Li in die Ebene ab, die sich Meer des Todes nennt. Wir verlassen die Straße G315, die sich im Süden der Taklamakan am Fuß der Berge entlangzieht, und fahren in das große Nichts. Die Tektonik verändert sich: Die mäandernden Gräben, die das Wasser der Berge vor Zeiten in den grauen Grund des abschüssigen Geländes gezogen hat, verschwinden, sie weichen einer ebenmäßigen gelben Fläche. Sand bis zum Horizont, kein Baum, kein Gebüsch, kein einziger Vogel im flirrenden Blau über uns. Nicht einmal die Bewegung unseres Fahrzeugs verändert das Antlitz dieser Landschaft. Sand, Sand, Sand. Ich sitze allein im Fond des Wagens, Sahkila hat auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Ich recke mich, um im Rückspiegel ihren Blick zu erhaschen. Sie döst, an die Tür gelehnt hängt sie im Gurt, den Kopf auf die rechte Schulter gelegt, die Lider geschlossen. Ich muss an unseren gestrigen Museumsbesuch denken.
Die Straße führt in den ausgetrockneten Salzsee. Wir fahren oben an der Ohrmuschel über den Rand in das große Ohr, passieren die Stelle, wo die Küstenlinie verlaufen sein muss. Nach den Satellitenbildern habe ich eine Senke erwartet. Sahkila wacht auf und erklärt, das ehemalige Seebecken sei nur zwei, maximal drei Meter tief gewesen, bei einer Ausdehnung von fünftausend Quadratkilometern. Das erklärt, warum ich keinen Abhang sehe. Ich bemerke eine Veränderung der Oberfläche: Der Sand weicht einer ausgetrockneten Salzschicht, eine schorfige Ebene aus metergroßen Scherben. Diese Textur aus Platten und Schwundrissen reicht bis zum Horizont. Die Wüste ist maßlos, jede tektonische Erfindung wird ins Endlose repetiert.
Li stoppt. Wir steigen aus. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke hoch, schiebe ihn kurz darauf auf Brusthöhe herunter, nestle in der Innentasche nach der Sonnenbrille. Einige Schritte abseits der Straße drehe ich mich zu Sahkila um und frage sie, ob nicht die Gefahr besteht, dass wir durch die Salzkruste durchbrechen. Als Junge war ich einmal durch die Eisschicht des Riehenteichs gebrochen, der Schock des eisigen Wassers hatte sich tief in meinem Körper festgesetzt, mehr noch als die Angst, von den vollgesogenen Kleidern in die Tiefe gezogen zu werden. Li lacht, hier nicht, radebrecht er in schlechtem Englisch, es gebe zwar morastige Stellen, wo die aufgeweichte Schicht unter den Füssen nachgebe, aber das sei im Norden, nicht hier. Er bückt sich, hebt einen faustgroßen Stein auf, reicht ihn mir und fordert mich auf, ein Stück aus der Kruste zu brechen. Ich tue ihm den Gefallen und hämmere auf das Salz, er amüsiert sich köstlich über meinen hilflosen Versuch. Salz ist hart wie Eisen, grinst er.
Wir sitzen wieder im Wagen, fahren in nordöstlicher Richtung über das Teerband, das die schorfige Kruste in zwei Teile schneidet. Bald verschwindet das Salz und weicht dem Sand, der helle und dunkle Streifen auf den Seegrund zeichnet, quer zur Piste, wie bei einer Schichttorte. Das Salz hatte beim höchsten Pegelstand ein weißes Band in die Landschaft gezogen, bei dieser letzten Höhenlinie verlassen wir den ausgetrockneten See an der Stelle, wo das große Ohr im Ohrläppchen ausläuft.
Links tauchen die Salzbecken auf, wir haben das Areal der Potassium Salt Base Lop Nor erreicht.
Ein Meer aus rechteckigen Bassins, Tausende von Fußballfeldern groß. Eine seltsam leblose Wasserfläche ohne Möwen, ohne Schiffe, nicht einmal einen Wellengang kann ich ausmachen, bestenfalls kräuselt die laue Brise die Oberfläche. So imposant die Ausmaße, so enttäuschend ist die Farbe: Nicht im Entferntesten strahlt das Wasser in dem intensiven Türkisblau, das auf den Satellitenfotos diesen »Ohrschmuck« halluzinativ funkeln ließ. Eine gelblich-beige Brühe und einzelne, zur Hälfte getrocknete Felder: ein Gemenge aus grauen Lachen, Sand und weißen Schlieren. In der Ferne entdecke ich dann doch mehrere Stellen, in denen sich das Blau des Himmels spiegelt, gleich einem Versehen, als hätte sich ein Stück Poesie in dieses Industriegelände verirrt.





























