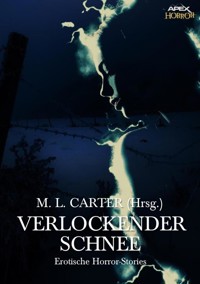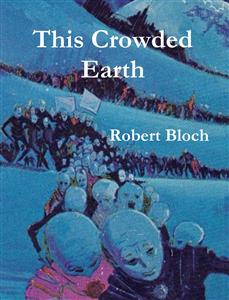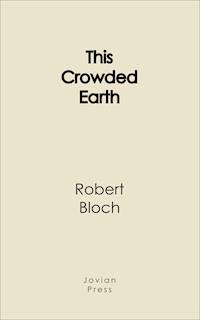9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Alle kennen den Film, aber keiner das Buch. Und es ist einfach großartig. Die junge Mary Crane soll für ihren Chef 40.000 Dollar zur Bank bringen. Sie beschließt, stattdessen bei ihrem Verlobten in einem anderen Bundesstaat ein neues Leben anzufangen. Auf dem Weg dorthin verfährt sie sich aber. Es wird schon dunkel, und an der Rezeption des abgelegenen Motels begrüßt sie ein schüchterner Mann mittleren Alters. Sein Name ist Norman Bates. «Psycho» erschien erstmals 1959 und wurde knapp ein Jahr später von Alfred Hitchcock meisterhaft verfilmt. Der Roman wurde mit dem Edgar Allan Poe Special Award ausgezeichnet und sein Autor über Nacht weltberühmt. Die vorliegende Neuübersetzung stellt unter Beweis, dass dieser Höhepunkt der Spannungsliteratur auch im 21. Jahrhundert noch unübertroffen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Ähnliche
Robert Bloch
Psycho
Mit einer Nachbemerkung des Autors
Über dieses Buch
Alle kennen den Film, aber keiner das Buch. Und es ist einfach großartig.
Die junge Mary Crane soll für ihren Chef 40000 Dollar zur Bank bringen. Sie beschließt, stattdessen bei ihrem Verlobten in einem anderen Bundesstaat ein neues Leben anzufangen. Auf dem Weg dorthin verfährt sie sich aber. Es wird schon dunkel, und an der Rezeption des abgelegenen Motels begrüßt sie ein schüchterner Mann mittleren Alters. Sein Name ist Norman Bates.
«Psycho» erschien erstmals 1959 und wurde knapp ein Jahr später von Alfred Hitchcock meisterhaft verfilmt. Der Roman wurde mit dem Edgar Allan Poe Special Award ausgezeichnet und sein Autor über Nacht weltberühmt. Die vorliegende Neuübersetzung stellt unter Beweis, dass dieser Höhepunkt der Spannungsliteratur auch im 21. Jahrhundert noch unübertroffen ist.
Vita
Robert Bloch (1917–1994) gilt als einer der besten und berühmtesten Science-Fiction- und Horror-Autoren des 20. Jahrhunderts. Nachdem er sich in frühen Jahren von seinem Vorbild H. P. Lovecraft löste, avancierte er rasch zu einem erfolgreichen Verfasser phantastischer Erzählungen und Romane. Darüber hinaus schrieb er Vorlagen und Drehbücher für Radio, Fernsehen und Kino. Für sein Werk wurde er u. a. mit dem Hugo Award, dem Bram Stoker Award und dem World Fantasy Award ausgezeichnet.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1959 unter dem Titel «Psycho» bei Simon & Schuster, New York.
Die Übersetzung folgt der 35th Anniversary Edition (Gauntlet Publications: Springfield 1994), die noch unter Mitarbeit des Autors entstand, deren Erscheinen er jedoch nicht mehr erlebte. Die Nachbemerkung entstammt ebenfalls dieser Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2022
Copyright © 2012 by Golkonda Verlag GmbH, Berlin
Copyright der Übersetzung © 2012 by Hannes Riffel
«Psycho» Copyright © 1959 by Robert Bloch
«Nachbemerkung» Copyright © 1994 by Robert Bloch
Lektorat Andy Hahnemann
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung ullstein bild - TopFoto
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01334-6
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Inhaltsübersicht
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Nachbemerkung
10 % dieses Buches sind Harry Altshuler gewidmet,
der 90 % der Arbeit getan hat.
Eins
Norman Bates hörte ein Geräusch und erschrak zutiefst. Klopfte da jemand gegen die Fensterscheibe?
Ruckartig hob er den Kopf, bereit aufzuspringen. Das Buch rutschte ihm aus den Händen in seinen stattlichen Schoß. Dann wurde ihm klar, dass es lediglich der Regen war – der spätnachmittägliche Regen, der gegen das Wohnzimmerfenster prasselte.
Norman hatte nicht bemerkt, dass es angefangen hatte zu regnen oder dass es bereits dämmerte. Im Wohnzimmer war es inzwischen recht düster geworden, und bevor er weiterlas, streckte er den Arm aus und schaltete die Lampe ein.
Es war eine altmodische Tischlampe mit einem verschnörkelten Glasschirm und einem Kristallrand. Mutter hatte sie schon, so weit er zurückdenken konnte, und sie lehnte es strikt ab, sich eine neue anzuschaffen. Ihm war das nur recht: Er lebte seit vierzig Jahren in diesem Haus, sein ganzes Leben lang, und von vertrauten Dingen umgeben zu sein, hatte etwas Wohltuendes, Beruhigendes. Hier war alles ordentlich und am rechten Platz; Veränderungen gab es nur dort draußen. Viele davon waren nicht ungefährlich. Einmal angenommen, er ginge den Nachmittag über spazieren. Auf einer einsamen Nebenstraße oder sogar in den Sümpfen. Und es finge an zu regnen – was dann? Klitschnass und im Dunkeln müsste er nach Hause stolpern. Dabei konnte man sich den Tod holen! Und wer wollte schon im Dunkeln draußen sein? Hier drin im Wohnzimmer, mit einem guten Buch als Gesellschaft, war es viel netter.
Der Lampenschein fiel auf sein rundliches Gesicht, spiegelte sich in seiner randlosen Brille und hob, als er sich wieder über sein Buch beugte, die rosafarbene Kopfhaut unter dem sich lichtenden sandfarbenen Haar hervor.
Ein wirklich faszinierendes Buch – kein Wunder, dass er nicht bemerkt hatte, wie rasch die Zeit verstrichen war. Norman hatte sich in Das Reich der Inka von Victor W. von Hagen vertieft. Was für eine Fundgrube skurriler Fakten und Informationen! Die Beschreibung des Cachua zum Beispiel, des Siegestanzes, bei dem die Krieger einen großen Kreis bildeten und sich wie eine Schlange wanden. Norman las:
Getrommelt wurde auf dem Körper des Feindes: Die Haut wurde ihm abgezogen und über dem Bauch als Schwingungsmembran aufgespannt. Der ausgehöhlte Leichnam übernahm die Rolle des Klangkörpers, wobei die Töne aus dem geöffneten Mund drangen – bizarr, aber effektiv.
Norman lächelte und gönnte sich dann den Luxus eines behaglichen Schauders. Bizarr, aber effektiv – eine treffliche Beschreibung! Das musste man sich einmal vorstellen! Einen Menschen bei lebendigem Leibe zu häuten, um die Haut als Trommelfell zu benutzen! Wie genau stellten sie das bloß an? Trockneten sie die Haut, um sie haltbar zu machen? Und über was für eine Mentalität mussten diese Leute verfügt haben, um auf eine solche Idee zu verfallen?
Die Vorstellung war nicht unbedingt appetitlich, doch als Norman die Augen halb schloss, konnte er sie fast vor sich sehen: eine Schar nackter Männer in Kriegsbemalung, die unter der barbarisch heißen Sonne in wilder Verzückung tanzten, während ein altes Weib vor dem Kadaver kauerte und auf dem aufgeblähten Körper eines Toten unermüdlich den Rhythmus vorgab. Der verzerrte Mund des Leichnams war mit Knochenklammern weit aufgesperrt worden. Das Dröhnen der Trommelschläge hallte durch den Bauch, fand seinen Weg die welke Luftröhre hinauf und trat mit ganzer Macht aus der toten Kehle aus.
Für einen Moment konnte Norman es fast hören, und dann fiel ihm ein, dass auch der Regen seinen Rhythmus hat und Schritte …
Tatsächlich nahm er die Schritte wahr, ohne sie zu hören; wann immer Mutter das Zimmer betrat, waren seine Sinne besonders geschärft, so vertraut war ihm alles. Er musste nicht einmal den Blick heben, um zu wissen, dass sie da war.
Genau genommen sah er auch gar nicht auf; stattdessen tat er so, als würde er weiterlesen. Mutter hatte in ihrem Zimmer geschlafen, und er wusste, wie griesgrämig sie nach dem Aufwachen sein konnte. Also war es am besten, zu schweigen und zu hoffen, dass sie nicht allzu üble Laune hatte.
«Norman, weißt du, wie spät es ist?»
Er seufzte und schloss das Buch. Das würde nicht einfach werden: Allein schon die Frage war eine Provokation. Mutter musste an der Standuhr in der Diele vorübergekommen sein. Sie hätte selbst nachschauen können, wie viel Uhr es war.
Trotzdem, es war sinnlos, sich deswegen zu streiten. Norman warf einen Blick auf seine Armbanduhr und lächelte. «Kurz nach fünf», sagte er. «Mir war gar nicht bewusst, dass es schon so spät ist. Ich habe gelesen …»
«Meinst du, ich hab keine Augen? Ich kann doch sehen, was du getan hast.» Jetzt stand sie drüben am Fenster und starrte in den Regen hinaus. «Und ich kann auch sehen, was du nicht getan hast. Warum hast du das Schild nicht angeschaltet, als es dunkel wurde? Und warum bist du nicht unten im Büro, wo du hingehörst?»
«Na ja, es hat angefangen, stark zu regnen. Bei diesem Wetter ist eh niemand unterwegs.»
«Unsinn! Genau dann musst du mit Gästen rechnen. Vielen Leuten ist es unangenehm, im Regen Auto zu fahren.»
«Aber hier kommt doch sowieso keiner vorbei. Alle nehmen den neuen Highway.» Norman entging nicht die Verbitterung, die sich in seine Stimme schlich und ihm den Hals hinaufkroch, bis er sie fast schmecken konnte. Er gab sich alle Mühe, sie hinunterzuschlucken, aber dafür war es bereits zu spät; er musste sie ausspeien. «Ich hab dir doch damals schon gesagt, was uns bevorsteht, wenn sie den Highway verlegen. Als nur eine Handvoll Leute davon wussten – unter anderem wir, Mutter –, hättest du das Motel verkaufen können. Für einen Apfel und ein Ei hätten wir am neuen Highway ein Stück Land bekommen können, und näher an Fairvale wäre das auch gewesen. Wir hätten ein neues Motel, ein neues Haus und würden Geld verdienen. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Nie hörst du auf mich. Immer geht alles nur nach deiner Nase. Du widerst mich an!»
«Tatsächlich, mein Junge?» Mutters Stimme war trügerisch sanft, aber Norman ließ sich dadurch nicht täuschen. Nicht wenn sie «mein Junge» zu ihm sagte. Vierzig Jahre war er jetzt alt, und sie sagte noch immer «mein Junge» zu ihm; und so behandelte sie ihn auch, was alles noch schlimmer machte. Wenn er nur seine Ohren verschließen könnte! Aber er musste ihr zuhören, und das wusste er auch, er musste ihr immer und immer wieder zuhören.
«Tatsächlich, mein Junge?», wiederholte sie, noch leiser dieses Mal. «Ich widere dich an? Da irrst du dich aber. Nicht ich widere dich an – du widerst dich selbst an. Deshalb hockst du auch immer noch hier rum, mitten im Nichts an dieser Nebenstraße. Habe ich nicht recht, Norman? Du hast einfach keinen Mumm. Hast nie welchen gehabt. Jedenfalls nicht genug, um dein Elternhaus zu verlassen. Oder um dir irgendwo eine Anstellung zu suchen. Oder um zur Armee zu gehen oder dir ein Mädchen anzulachen …»
«Das hättest du mir doch gar nicht erlaubt!»
«Da hast du recht, Norman, ich hätte es dir nicht erlaubt. Aber wenn du nur ein halber Kerl wärst, hättest du es trotzdem getan.»
Er wollte sie anschreien, ihr erklären, dass sie im Irrtum war, aber er konnte es nicht. Denn das, was sie ihm sagte, war genau das, was er sich seit Jahren wieder und wieder selbst gesagt hatte. Sie hatte recht. Sie hatte ihm immer Vorschriften gemacht, aber natürlich hätte er ihr nicht immer gehorchen müssen. Mütter sind manchmal allzu besitzergreifend, aber nicht alle Kinder lassen sich das gefallen. Nicht alle Witwen unterhielten mit ihren einzigen Kindern eine so komplizierte Beziehung. Es war genauso gut seine Schuld. Denn er hatte keinen Mumm.
«Du hättest darauf bestehen können, weißt du», fuhr sie fort. «Du hättest uns ein neues Grundstück suchen und das hier zum Verkauf anbieten können. Aber nein, du hast nur herumgejammert. Und ich weiß auch, warum. Du hast mich nie getäuscht, nicht eine Sekunde. Du wolltest überhaupt nicht umziehen. Du wolltest nicht von hier weg, und du willst es auch jetzt noch nicht. Du bist dazu gar nicht in der Lage, hab ich nicht recht? Genauso wenig wie du erwachsen werden kannst.»
Er konnte sie nicht anschauen. Nicht wenn sie solche Sachen zu ihm sagte. Aber er wusste auch nicht, wo er sonst hinschauen sollte. Die mit Perlen verzierte Lampe, die schweren, alten, mit Nippes überladenen Möbel, all die vertrauten Gegenstände hier im Zimmer waren ihm plötzlich zuwider, eben weil sie ihm so vertraut waren; wie die Einrichtung einer Gefängniszelle. Er starrte zum Fenster hinaus – doch dort draußen waren nur der Wind und der Regen und die Finsternis. Er wusste, dass es für ihn kein Entkommen gab. Nirgendwo gab es ein Entkommen vor der Stimme, die ihm in den Ohren dröhnte wie die Trommel des Inkaleichnams in dem Buch; die Trommel der Toten.
Er hielt das Buch fest umklammert und versuchte sich auf die Seiten zu konzentrieren. Vielleicht wenn er ihr keine Beachtung schenkte und so tat, als sei er völlig gefasst …
Aber es wollte ihm nicht gelingen.
«Schau dich doch an!», rief sie (domm – domm – domm – die Trommel dröhnte, der entstellte Mund schrie unentwegt). «Ich weiß, warum du dir nicht die Mühe machst, das Schild anzuschalten. Du bist heute nicht mal nach unten gegangen, um das Büro aufzuschließen. Du hast es gar nicht vergessen. Du willst überhaupt nicht, dass jemand kommt, du hoffst, dass sie fortbleiben.»
«Schon gut!», murmelte er. «Ich geb’s ja zu. Ich verabscheue das Motel. Ich habe es schon immer gehasst.»
«Da steckt mehr dahinter, mein Junge.» (Da war es wieder, hallte aus dem Rachen des Todes heraus – domm, domm, domm.) «Du verabscheust Menschen. Weil du Angst vor ihnen hast, hab ich nicht recht? Schon immer, seit du ein kleiner Knirps warst. Du verkriechst dich lieber und liest. So war das vor dreißig Jahren, und heute ist es nicht anders. Du versteckst dich hinter deinen Büchern.»
«Es gibt Schlimmeres. Du selbst hast mir das immer gesagt. Wenigstens bin ich nie losgezogen und in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Ist es da nicht besser, zu lesen und sich fortzubilden?»
«Fortbilden? Hah!» Er spürte, dass sie hinter ihm stand und auf ihn herabstarrte. «Das nennst du fortbilden? Mir machst du nichts vor, mein Junge, keine Sekunde. Das konntest du nie. Wenn du wenigstens die Bibel lesen würdest oder etwas Vernünftiges. Aber ich weiß nur zu gut, was für Sachen du liest. Schund. Und Schlimmeres.»
«Zufälligerweise handelt es sich hier um eine Geschichte der Inka-Zivilisation …»
«Aber natürlich! Wahrscheinlich randvoll mit irgendwelchen Scheußlichkeiten über diese schmutzigen Wilden, wie schon dieses Buch über die Südsee, das du mal hattest. Du hast wohl gedacht, davon wüsste ich nichts? Hast es oben in deinem Zimmer versteckt, wie den ganzen Schmutz, den du immer liest …»
«Psychologie ist nicht schmutzig, Mutter!»
«Psychologie nennt er das! Erzählt seiner Mutter wer weiß was für Sauereien und will ein Psychologe sein! Allein die Vorstellung, dass ein Sohn zu seiner eigenen Mutter geht und so was sagt!»
«Aber ich hab doch nur versucht, dir den Ödipuskomplex zu erklären. Ich dachte, wenn wir uns beide mit dem Problem auseinandersetzen und versuchen, es zu verstehen, dann ändert sich vielleicht alles zum Besseren.»
«Ändern, mein Junge? Nichts wird sich je ändern. Du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst, und bleibst trotzdem, wer du bist. Ich muss mir das obszöne Geschwätz nicht anhören, um zu wissen, was mit dir los ist. Das begreift sogar ein achtjähriges Kind! Deine Spielkameraden haben es damals schon begriffen. ›Muttersöhnchen‹ haben sie dich genannt, und das warst du auch. Und wirst es immer sein. Ein zu groß geratenes, fettes Muttersöhnchen!»
Der Trommelschlag ihrer Worte betäubte ihn, der Trommelschlag in seiner eigenen Brust. Er drohte an der Gemeinheit in seinem Mund zu ersticken. Gleich würde er in Tränen ausbrechen. Norman schüttelte den Kopf. Dass sie immer noch in der Lage war, ihn so weit zu bringen, nach all der Zeit! Aber es würde kein Ende nehmen, sie würde niemals damit aufhören, es sei denn …
«Es sei denn was?»
Gütiger Himmel, konnte sie jetzt schon seine Gedanken lesen?
«Ich weiß, was du denkst, Norman. Ich weiß alles über dich, mein Junge. Mehr, als du dir auch nur annähernd vorstellen kannst. Ich kenne sogar deine Träume. Du denkst, du würdest mich am liebsten töten, habe ich nicht recht, Norman? Aber das kannst du nicht. Weil dir der Mumm fehlt. Weil ich schon immer die Stärkere von uns beiden war. Deshalb wirst du dich auch nie von mir befreien können, selbst wenn du es wirklich wolltest. Aber eigentlich willst du es ja auch gar nicht. Du brauchst mich nämlich, mein Junge. Habe ich nicht recht?»
Norman stand auf, ganz langsam. Er durfte ihr jetzt nicht gegenübertreten, noch nicht, sonst würde er die Beherrschung verlieren. Erst musste er sich wieder ein wenig beruhigen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Denk nicht über das nach, was sie sagt. Du musst den Tatsachen ins Auge blicken. Sie ist eine alte Frau und nicht ganz richtig im Kopf. Wenn du ihr weiterhin zuhörst, wird dich das auch noch in den Wahnsinn treiben. Sag ihr, dass sie in ihr Zimmer gehen und sich ins Bett legen soll. Dort gehört sie schließlich hin.
Und sie soll sich besser beeilen, denn wenn nicht, erdrosselst du sie dieses Mal mit ihrer eigenen Halskette …
Mit einer Erwiderung auf den Lippen wollte er sich gerade umdrehen, als der Summer ertönte. Jemand war am Motel vorgefahren und wollte ein Zimmer.
Ohne zurückzublicken, ging Norman in die Diele, nahm den Regenmantel vom Bügel und eilte in die Nacht hinaus.
Zwei
Es hatte schon eine ganze Weile ununterbrochen geregnet, bevor Mary es bemerkte und die Scheibenwischer einschaltete. Zur gleichen Zeit knipste sie auch die Scheinwerfer an; es war recht plötzlich dunkel geworden, und die Straße vor ihr war nur noch ein verschwommener Fleck zwischen den Bäumen.
Bäume? Sie konnte sich nicht erinnern, dass es hier, als sie diese Strecke das letzte Mal gefahren war, Bäume gegeben hätte. Allerdings war das im vergangenen Sommer gewesen, und sie war am helllichten Tag in Fairvale eingetroffen, munter und erfrischt. Jetzt war sie, nachdem sie achtzehn Stunden lang ununterbrochen am Steuer gesessen hatte, todmüde. Aber an diese Bäume konnte sie sich trotzdem nicht erinnern.
Erinnern – das war das Schlüsselwort. Jetzt fiel ihr alles wieder ein, wenn auch undeutlich, wie sie vor einer halben Stunde gezögert hatte, als sich die Straße gabelte. Das war es: Sie hatte die falsche Abzweigung genommen. Und jetzt war sie hier, Gott weiß wo, und es regnete in Strömen und war stockdunkel …
Reiß dich zusammen. Du kannst es dir nicht leisten, in Panik zu geraten. Das Schlimmste ist vorbei.
Ganz sicher: Das Schlimmste war vorbei. Das Schlimmste hatte sie gestern Nachmittag hinter sich gebracht, als sie das Geld gestohlen hatte.
Sie hatte im Büro von Mr Lowery gestanden, als der alte Tom Cassidy das große grüne Bündel Scheine hervorgeholt und fächerförmig auf dem Schreibtisch ausgebreitet hatte. Sechsunddreißig Banknoten mit dem Bild des fetten Mannes, der wie ein Lebensmittelgroßhändler aussah, und acht weitere mit dem Gesicht des Leichenbestatters. Grover Cleveland und William McKinley. Sechsunddreißig Tausender plus acht Fünfhunderter machten zusammen vierzigtausend Dollar.
Tommy Cassidy hatte sie einfach so hingeblättert und erklärt, damit sei der Handel abgeschlossen. Er würde seiner Tochter ein Haus zur Hochzeit schenken.
Mr Lowery tat so, als wäre das auch für ihn völlig alltäglich, während er die Papiere fertig machte. Aber nachdem der alte Tommy Cassidy gegangen war, wurde er doch ein wenig aufgeregt.
Er raffte die Scheine zusammen, stopfte sie in einen braunen Umschlag und verschloss ihn. «Hier», sagte er und reichte ihr das Geld. «Bringen Sie das auf die Bank. Es ist gleich vier Uhr, aber Gilbert lässt Sie bestimmt noch eine Einzahlung vornehmen.» Er hielt einen Moment inne und starrte sie an. «Was ist los, Miss Crane – geht es Ihnen nicht gut?»
Vielleicht hatte er bemerkt, wie sehr ihr die Hände zitterten, seit sie den Umschlag an sich genommen hatte. Aber das spielte keine Rolle. Sie wusste, was sie sagen würde, auch wenn es sie selbst überraschte, als sie die Worte tatsächlich aussprach.
«Mr Lowery, ich glaube, ich bekomme wieder einen meiner Migräneanfälle. Eigentlich wollte ich Sie sowieso fragen, ob ich mir nicht den Rest des Nachmittags freinehmen darf. Mit der Post sind wir durch, und die Formulare für diesen Abschluss können wir erst am Montag ausfüllen.»
Mr Lowery schenkte ihr ein Lächeln. Er war guter Laune – und warum auch nicht? Fünf Prozent von vierzigtausend Dollar waren zweitausend Dollar. Er konnte es sich leisten, großzügig zu sein.
«Natürlich, Miss Crane. Zahlen Sie noch das Geld ein, und dann können Sie nach Hause gehen. Soll ich Sie fahren?»
«Nein, schon in Ordnung. Ich komme zurecht. Mit etwas Ruhe …»
«Das ist genau das Richtige. Dann sehen wir uns am Montag. Nur keine Hektik.»
Von wegen ›Nur keine Hektik‹. Lowery brachte sich für jeden zusätzlichen Dollar halb um, und für weitere fünfzig Cent würde er jeden seiner Angestellten über die Klinge springen lassen.
Aber Mary Crane lächelte ihn freundlich an, drehte sich um und ging hinaus. Sie würde für immer aus seinem Büro und seinem Leben verschwinden. Und die vierzigtausend Dollar würde sie mitnehmen.
Eine solche Gelegenheit bot sich einem nicht jeden Tag. Und manchen Menschen bot sie sich nie. Mary Crane hatte über siebenundzwanzig Jahre auf ihre Chance gewartet.
Ihre Träume vom College hatten sich mit siebzehn verflüchtigt, als ihr Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Stattdessen war Mary ein Jahr auf die Wirtschaftsschule gegangen und hatte dann gearbeitet, um ihre Mutter und ihre kleine Schwester Lila zu unterstützen.
Ihre Hochzeitsträume hatten sich mit zweiundzwanzig Jahren in Luft aufgelöst, als Dale Belter einberufen worden war. Schließlich wurde er auf Hawaii stationiert, und es dauerte nicht lange, bis er ihr in seinen Briefen von einem anderen Mädchen schrieb. Bald hörte er ganz auf zu schreiben. Als die Heiratsanzeige eintraf, war er ihr bereits gleichgültig gewesen.
Außerdem war ihre Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich krank gewesen. Sie brauchte drei Jahre, um zu sterben, während Lila in einer anderen Stadt aufs College ging. Mary hatte darauf bestanden, unter allen Umständen, aber das bedeutete, dass sie die ganze Last schultern musste. Tagsüber arbeitete sie in Lowerys Maklerbüro, die halbe Nacht wachte sie bei ihrer Mutter, und so blieb nicht viel Zeit für irgendetwas anderes.
Nicht einmal genug Zeit, um zu bemerken, wie die Zeit verstrich! Als ihre Mutter schließlich an einem letzten Schlaganfall starb, musste sie sich um die Beerdigung kümmern. Und um Lila, die von der Schule nach Hause kam und eine Anstellung suchte. Und als sie irgendwann in den großen Spiegel schaute, sah sie sich unvermittelt einer Mary Crane gegenüber, deren Gesichtszüge abgehärmt und ausgezehrt waren. Sie hatte etwas nach dem Spiegelbild geworfen, und der Spiegel war in tausend Stücke zerborsten, und da wurde ihr bewusst, dass auch sie kurz davorstand zu zerbrechen. In tausend Stücke.
Lila war großartig gewesen, und Mr Lowery hatte sich um das Haus gekümmert. Nachdem alles geregelt war, blieben ihnen noch ungefähr zweitausend Dollar in bar. Lila bekam einen Job in einem Schallplattenladen in der Stadt, und sie zogen gemeinsam in eine kleine Wohnung.
«Und jetzt fährst du erst einmal in Urlaub», hatte Lila ihr erklärt, «und zwar mit allem Drum und Dran. Nein, keinen Widerspruch! Du sorgst seit acht Jahren für die Familie, und es ist an der Zeit, dass du dich einmal ausruhst. Ich möchte, dass du eine Reise unternimmst. Eine Kreuzfahrt vielleicht.»
Also hatte Mary eine Kabine auf der S.S. Caledonia gebucht, und nach einer Woche in karibischen Gewässern hatte das abgehärmte, ausgezehrte Gesicht aus ihrem Spiegel wieder etwas Farbe angenommen. Sie sah wieder wie ein junges Mädchen aus (jedenfalls keinen Tag älter als zweiundzwanzig, wie sie sich einredete), und was noch wichtiger war, wie ein junges Mädchen, das sich frisch verliebt hatte.
Es war keine wilde, leidenschaftliche Verliebtheit wie bei Dale. Und auch keine Mondschein-Romanze, wie es sich für eine Kreuzfahrt gehörte.
Sam Loomis war gute zehn Jahre älter, als Dale Belter damals gewesen war, und er war eher ein ruhiger Typ. Sie glaubte, endlich ihre Chance gefunden zu haben – bis er ihr ein paar Dinge unmissverständlich klarmachte.
«Eigentlich reise ich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, weißt du», erklärte er ihr. «Da gibt es diese Eisenwarenhandlung …»
Und dann hatte er ihr seine Lebensgeschichte erzählt.
Sam stammte aus einer kleinen Stadt namens Fairvale im Norden. Dort hatte er in der Eisenwarenhandlung seines Vaters gearbeitet, wobei er immer davon ausgegangen war, dass er das Geschäft erben würde. Vor einem Jahr war sein Vater gestorben, und der Steuerberater hatte ihm die Hiobsbotschaft überbracht.
Sam erbte das Geschäft, das ja, aber auch rund zwanzigtausend Dollar Schulden. Das Gebäude war mit einer Hypothek belastet, der Lagerbestand war mit einer Hypothek belastet, selbst die Versicherung war mit einer Hypothek belastet. Sams Vater hatte ihm nie erzählt, dass er regelmäßig ein Großteil seines Geldes auf der Pferderennbahn gelassen hatte. Blieben nur zwei Möglichkeiten: Insolvenz anmelden oder die Schulden abarbeiten.
Sam Loomis entschied sich für den zweiten Weg. «Das ist ein solides Geschäft», erklärte er. «Reich wird man damit nicht, aber wenn man es ordentlich führt, lassen sich damit acht- bis zehntausend Dollar im Jahr verdienen. Und wenn es mir noch gelingt, ein breiteres Angebot von Landmaschinen anzubieten, vielleicht sogar mehr. Über viertausend habe ich bereits abbezahlt. Keine zwei Jahre, und ich bin schuldenfrei.»
«Aber das verstehe ich nicht – wenn du Schulden hast, wie kannst du dir dann eine solche Reise leisten?»
Sam grinste sie an. «Die habe ich bei einem Wettbewerb gewonnen, der von einem der Landmaschinenhersteller gesponsert wurde. Die Reise war mir schnurz, ich wollte ja nur meine Gläubiger auszahlen. Und da schreiben die mir plötzlich, dass ich in meiner Region den ersten Platz belegt habe. Erst hab ich versucht, eine Barabfindung auszuhandeln, aber darauf haben sie sich nicht eingelassen. Die Reise oder gar nichts, haben sie gesagt. Nun ja, es ist ein ruhiger Monat, und ich habe einen ehrlichen Angestellten. Also dachte ich mir, da kann ich genauso gut mal kostenlos Urlaub machen. Und hier bin ich nun. Und du auch.» Er grinste und seufzte dann. «Ich wünschte, das wäre unsere Hochzeitsreise.»
«Sam, warum denn nicht? Ich meine …»
Aber er seufzte erneut und schüttelte den Kopf. «Wir müssen warten. Es kann noch zwei oder drei Jahre dauern, bis alles abbezahlt ist.»
«Ich möchte nicht warten! Das Geld ist mir egal. Ich kann meine Anstellung kündigen und in deinem Laden arbeiten …»
«Und auch dort schlafen, wie ich?» Er brachte ein weiteres Lächeln zustande, aber es wirkte nicht fröhlicher als das Seufzen. «Ganz recht. Ich hab mich im Hinterzimmer eingerichtet. Die meiste Zeit lebe ich von gebackenen Bohnen. Die Leute erzählen sich, dass ich geiziger bin als unser Bankdirektor.»
«Aber warum?», fragte Mary. «Wenn du anständig lebst, dauert es vielleicht nur ein Jahr länger, um alles abzubezahlen. Und währenddessen …»
«Währenddessen muss ich in Fairvale leben. Das ist ein netter Ort, aber auch klein. Jeder kennt jeden. Solange ich mich anstrenge, respektieren mich die Leute. Sie kaufen bei mir ein, wann immer es geht. Sie wissen alle, was los ist, und sie wissen es zu schätzen, dass ich mein Bestes gebe. Pa hatte einen guten Ruf, trotz allem. Den möchte ich behalten. Für mich. Fürs Geschäft. Und für uns, für unsere Zukunft. Verstehst du das nicht?»
«Die Zukunft.» Mary seufzte. «Zwei oder drei Jahre hast du gesagt.»
«Es tut mir leid. Aber wenn wir heiraten, möchte ich, dass wir ein echtes Zuhause haben und uns ein paar Sachen leisten können. Wir werden einen Kredit aufnehmen müssen. Im Moment halte ich die Lieferanten so lange wie möglich hin. Und sie lassen sich darauf ein, weil sie wissen, dass ich mit allem, was ich verdiene, meine Schulden bei ihnen abbezahle. Das ist nicht leicht, und es ist auch nicht angenehm. Aber ich weiß, was ich will, und mit weniger werde ich mich nicht zufriedengeben. Hab ein wenig Geduld, Liebling.»
Also geduldete sie sich. Aber erst nachdem sie sich – mit Wort und Tat – alle Mühe gegeben hatte, ihn umzustimmen.
Das war der Stand der Dinge, als die Kreuzfahrt zu Ende ging. Und so blieb es auch für über ein Jahr. Vergangenen Sommer hatte Mary ihn besucht; sie hatte den Ort begutachtet, den Laden und die Zahlen im Kontobuch, die belegten, dass Sam weitere fünftausend Dollar abbezahlt hatte. «Nur noch elftausend», hatte er ihr stolz erklärt. «Noch zwei Jahre, vielleicht sogar weniger.»
Zwei Jahre. In zwei Jahren würde sie neunundzwanzig sein. Sie konnte es sich nicht leisten, einen Rückzieher zu machen. Einen Mann wie Sam Loomis würde sie so schnell nicht wieder finden. Also lächelte sie und nickte und fuhr nach Hause zurück.
Sie ging weiter ihrer Arbeit in Lowerys Maklerbüro nach und schaute zu, wie ihr Chef bei jedem Verkauf fünf Prozent einstrich. Sie schaute zu, wie er unsichere Hypotheken aufkaufte und zwangsvollstrecken ließ, wie er verzweifelten Hausbesitzern halsabschneiderische Angebote machte, um beim Wiederverkauf einen fetten Gewinn einzufahren. Die Leute kauften und verkauften unablässig. Lowery spielte lediglich den Mittelsmann und berechnete beiden Parteien allein dafür eine Provision, dass er sie zusammengebracht hatte. Er leistete nichts, was seine Existenz gerechtfertigt hätte. Und trotzdem war er reich. Er würde keine zwei Jahre benötigen, um Schulden in Höhe von elftausend Dollar abzuarbeiten. Manchmal verdiente er in zwei Monaten so viel.
Mary hasste ihn, und sie hasste viele der Käufer und Verkäufer, mit denen er Geschäfte machte, weil sie ebenfalls reich waren. Dieser Tommy Cassidy gehörte zu den Schlimmsten – ein Unternehmer, der stinkreich war, seit auf seinen Grundstücken Öl gefördert wurde. Eigentlich musste er keinen Finger mehr krumm machen, aber er tätigte nebenbei immer wieder Immobiliengeschäfte, witterte den Geruch von Not und Angst, bot niedrig und verkaufte hoch. Für seinen Profit ging er über Leichen.
Er dachte sich nichts dabei, als er vierzigtausend Dollar in bar hinblätterte, um seiner Tochter als Hochzeitsgeschenk ein Haus zu kaufen.
Ebenso wenig wie er sich etwas dabei gedacht hatte, als er eines Nachmittags einen Hundertdollarschein auf Mary Cranes Schreibtisch gelegt und ihr vorgeschlagen hatte, mit ihm übers Wochenende einen «kleinen Ausflug» nach Dallas zu unternehmen.