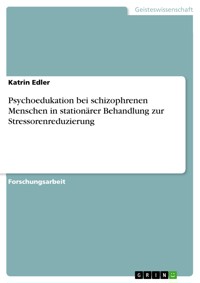
Psychoedukation bei schizophrenen Menschen in stationärer Behandlung zur Stressorenreduzierung E-Book
Katrin Edler
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Psychologie - Beratung und Therapie, , Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Forschung ist die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen. Da es sich hierbei um vielschichtige Krankheitsbilder handelt, die je nach Art und Ausprägung sehr individuelle Verläufe nehmen, sind die jeweiligen Therapieformen und methodischen Herangehensweisen ebenfalls sehr unterschiedlich. Um dem zur Verfügung stehenden Zeitrahmen gerecht zu werden, liegt der Fokus auf dem Krankheitsbild der Schizophrenien. Des Weiteren ist es wichtig, die aktuelle Lebenssituation zu berücksichtigen. Daher beschränkt sich das Forschungsgebiet auf stationär betreute Klienten. Von besonderem Interesse ist es herauszufinden, welche methodischen Zugänge im eben genannten Arbeitsfeld dominieren und wie praxisrelevant diese für die Soziale Arbeit sind. Hierbei wird es aufgrund der Fülle von Konzepten als erforderlich angesehen, nochmals eine Eingrenzung auf die Methode der Psychoedukation vorzunehmen. Sie stellt einen wichtigen Bestandteil eines integrativen Therapiekonzeptes dar oder allgemeiner gesehen, enthält jeder psychiatrisch-psychotherapeutische Umgang mit den Betroffenen auch psychoedukative Elemente. Daher scheint hier ein sehr realer Bezug zwischen Forschungsgegenstand und Arbeitspraxis herstellbar. Welche Kompetenzen liegen überwiegend im Verantwortungsbereich der Sozialen Arbeit? Gibt es methodisch abzugrenzende Schwerpunkte zwischen Therapeuten anderer Berufsgruppen und SozialarbeiterInnen? Nehmen die Klienten die Methode der Psychoedukation als hilfreich wahr, und welchen Stellenwert hat aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit den SozialarbeiterInnen in diesem Zusammenhang?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Fragestellung/Erkenntnisinteresse/Forschungsgegenstand
1.1 Forschungsgegenstand und forschungsleitende Fragestellung
1.2 Relevanz der Fragestellung für die Soziale Arbeit
1.3 Reflexion der Fragestellung unter forschungsethischen Gesichtspunkten
2. Forschungsstand
2.1 Aktueller Stand der Forschung
2.2 Folgerungen für die Studie
3. Methodologische Positionierung: qualitative/quantitative Studie
3.1 Grundannahmen und Prinzipien quantitativer und qualitativer Forschung
3.2 Folgerungen für die Studie
4. Forschungsdesign, Erhebungs- und Auswertungsmethoden
4.1 Forschungsdesign
4.2 Methoden der Datenerhebung und Auswertung
4.3 Begründung der Methodenwahl
5. Konzeptualisierung, Operationalisierung und Hypothesenbildung
5.1 Grundlage der Psychoedukation und deren zentrale Konzeptionen
5.2 Operationalisierung des Forschungsgegenstands
5.3 Hypothesenbildung
6. Stichprobe und Feldzugang
6.1 Grundgesamtheit und Möglichkeiten der Stichprobenbildung
6.2 Feldzugang und Zielgruppenansprache
6.3 Reflexion des Feldzugangs und der Zielgruppenansprache
Literaturliste
1. Fragestellung/Erkenntnisinteresse/Forschungsgegenstand
1.1 Forschungsgegenstand und forschungsleitende Fragestellung
Gegenstand dieser Forschung ist die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen. Da es sich hierbei um vielschichtige Krankheitsbilder handelt, die je nach Art und Ausprägung sehr individuelle Verläufe nehmen, sind die jeweiligen Therapieformen und methodischen Herangehensweisen ebenfalls sehr unterschiedlich. Um dem zur Verfügung stehenden Zeitrahmen gerecht zu werden, liegt der Fokus auf dem Krankheitsbild der Schizophrenien. Des Weiteren ist es wichtig, die aktuelle Lebenssituation zu berücksichtigen. Daher beschränkt sich das Forschungsgebiet auf stationär betreute Klienten.
Von besonderem Interesse ist es herauszufinden, welche methodischen Zugänge im eben genannten Arbeitsfeld dominieren und wie praxisrelevant diese für die Soziale Arbeit sind. Hierbei wird es aufgrund der Fülle von Konzepten als erforderlich angesehen, nochmals eine Eingrenzung auf die Methode der Psychoedukation vorzunehmen. Sie stellt einen wichtigen Bestandteil eines integrativen Therapiekonzeptes dar (vgl. Goldbeck 2004, S. 78) oder allgemeiner gesehen, enthält jeder psychiatrisch-psychotherapeutische Umgang mit den Betroffenen auch psychoedukative Elemente (vgl. Bäuml; Pitschel-Walz 2005, S. 8). Daher scheint hier ein sehr realer Bezug zwischen Forschungsgegenstand und Arbeitspraxis herstellbar. Welche Kompetenzen liegen überwiegend im Verantwortungsbereich der Sozialen Arbeit? Gibt es methodisch abzugrenzende Schwerpunkte zwischen Therapeuten anderer Berufsgruppen und SozialarbeiterInnen? Nehmen die Klienten die Methode der Psychoedukation als hilfreich wahr, und welchen Stellenwert hat aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit den SozialarbeiterInnen in diesem Zusammenhang? Diese und andere Fragen führen zu folgender forschungsleitenden Fragestellung:
„Kann in der Praxis der Sozialen Arbeit die Methode der Psychoedukation bei schizophren erkrankten Menschen in stationärer Behandlung eine Reduzierung der Stressoren bewirken?“
1.2 Relevanz der Fragestellung für die Soziale Arbeit
Psychisch erkrankte Menschen sollten unter gleichen Voraussetzungen eine Ermöglichung und Gewährleistung des Rechts auf Teilhabe und einer autonomen Lebensführung haben. Aus dieser Sichtweise heraus sind therapieunterstützende Maßnahmen entsprechend der individuellen Ressourcen der Klienten möglichst niederschwellig und subsidiär anzulegen. Hauptziele der Psychoedukation für die Betroffenen und deren Angehörigen sollten die Förderung eines selbstverantwortlichen Umgangs mit den Symptomen sein, und für die Professionellen die Förderung der Selbstkompetenz der Klienten und Angehörigen (vgl. Bäuml; Pitschel-Walz 2008, S. 4).
Aber kann Soziale Arbeit dies durch ihre Interventionen wirksam unterstützen, und wie erfolgreich sind diese Maßnahmen, wenn gleichzeitig Psychiater und andere Therapeuten in die Behandlung eingebunden sind? Der Kosten-/Finanzierungsdruck im Sozial- und Gesundheitswesen erfordert von unserer Profession ständige Rechtfertigung der Wirksamkeit unserer Leistungen, ansonsten drohen Kürzungen. Daher zielt diese Untersuchung darauf ab, hier die besonderen Kompetenzen der Berufsgruppe zu erfragen und ihren Anteil an Therapie(miss-)erfolgen darzustellen.
1.3 Reflexion der Fragestellung unter forschungsethischen Gesichtspunkten
Unter forschungsethischen Gesichtspunkten ist es wichtig, dass den Befragten Ziel und Zweck des Forschungsgegenstands erläutert wird. Zum einen sollten Forscher begründen können, warum Forschung auf diesem Gebiet überhaupt für notwendig erachtet wird. Zum anderen sollte das Ziel der Forschung transparent gemacht werden (vgl. Schnell; Heinritz 2006, S. 21/22). Für die Soziale Arbeit sollte es daher erforderlich sein, ihre originären Kompetenzen bei der Erkennung lebensweltlicher Ressourcen zu nutzen und wirksame Methoden in der Arbeit mit den Klienten abzuleiten. Schließlich ist die Wirksamkeit der Maßnahmen zu evaluieren. Die Fragestellung soll genau dies zum Ziel haben.





























