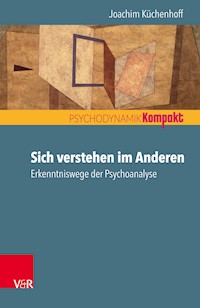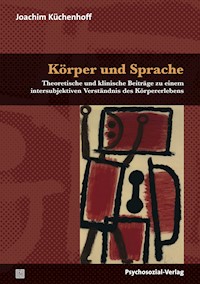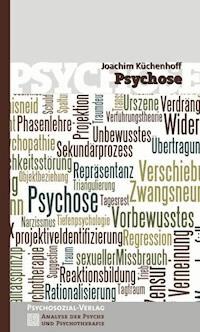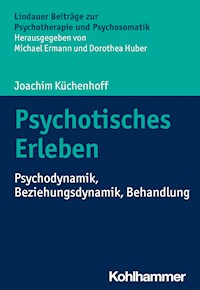
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Psychose ist ein schwerwiegendes psychisches Leiden, bei dem der Bezug zur Wirklichkeit verloren gehen kann und Denk- und Wahrnehmungsstörungen, Wahnvorstellungen und eine veränderte Gefühlswelt das Erleben beherrschen können. Psychotisch erlebenden Menschen therapeutisch gerecht zu werden, setzt voraus, die existentielle Bedrohung, die der drohende Selbstverlust darstellen kann, zu würdigen und zu verstehen. Respekt und Engagement werden als grundlegende Haltung in der Beziehungsarbeit eingeführt. Um sie umzusetzen, sind Praxiskonzepte verschiedener in der Psychosentherapie erprobter Therapieverfahren nützlich. Anhand klinischer Beispiele werden diese im Buch anschaulich dargestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1. Vorlesung Grundlagen – das psychotische Erleben in der Außen- und in der Innensicht
Verantwortung und Psychotherapie mit psychotisch erlebenden Menschen
Stigmatisierung
First-person Account
Die allmähliche Entwicklung psychotischen Erlebens
Grunderfahrungen des Lebens
Der Körper und das eigene Selbst
2. Vorlesung Psychodynamik und Beziehungsdynamik des psychotischen Erlebens
Die Nähe-Distanz-Dilemmata
Dilemmata der Selbst-Objekt-Differenzierung in der Psychose
Therapie auf der Suche nach dem Selbst im psychotischen Erleben
Sprachzerstörung – die Suche nach dem Selbst in den Worten
Die Suche nach dem Selbst in der Negativsymptomatik
Haltung: Respekt und Engagement
3. Vorlesung Die psychoanalytisch fundierte therapeutische Haltung in der Psychosenpsychotherapie
Psychotisches Erleben und psychoanalytische Technik
Hören mit dem dritten oder dem vierten Ohr
Rêverie
Archivierung und Rekonstruktion von Geschichte
Herstellung einer triangulierten therapeutischen Beziehung
Wiederherstellung struktureller Fähigkeiten
Anwendungen und praktische Hinweise
4. Vorlesung Weitere therapeutische Verfahren
Verhaltenstherapie
Kognitive Therapie
Metakognitives Training
Kognitive Remediation
Mindfulness-Therapie und die Akzeptanz-und-Commitment-Therapie
Systemische Therapien
Psychopharmakologie und Psychotherapie
Modelle der Integration von Psychoanalyse und Psychopharmakologie
Beziehungsdynamik der Psychopharmaka-Verordnung
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik als Hilfsmittel zur Reflexion der psychodynamischen Aspekte der Psychopharmakologie
Schlussfolgerungen
5. Vorlesung Klassifikationen und ihre Grenzen; Manie und Depression
Klassifikation und diagnostische Inventare
Von ICD-10 zu ICD-11
Manie und Depression
Zum Abschluss noch einmal: Engagement in der Psychotherapie
Literatur
Stichwortverzeichnis
Personenverzeichnis
Lindauer Beiträge zur Psychotherapie und Psychosomatik
Herausgegeben von Michael Ermann und Dorothea Huber
Michael Ermann, Prof. Dr. med. habil., ist Psychoanalytiker in Berlin und em. Professor für Psychotherapie und Psychosomatik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Dorothea Huber, Professor Dr. med. Dr. phil., war bis 2018 Chefärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der München Klinik. Sie ist Professorin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität, IPU Berlin, und in der wissenschaftlichen Leitung der Lindauer Psychotherapiewochen tätig.
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/lindauer-beitraege
Der Autor
Prof. Dr. med. Joachim Küchenhoff ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychoanalytiker. Er ist emeritierter Professor der Universität Basel und ehemaliger Direktor der Erwachsenenpsychiatrie der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Baselland sowie Gastprofessor und Aufsichtsratsvorsitzender der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Er ist außerdem Wissenschaftlicher Beirat u. a. der Lindauer Psychotherapiewochen.
Joachim Küchenhoff
Psychotisches Erleben
Psychodynamik, Beziehungsdynamik, Behandlung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-043519-3
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-043520-9epub:ISBN 978-3-17-043521-6
1. VorlesungGrundlagen – das psychotische Erleben in der Außen- und in der Innensicht
Verantwortung und Psychotherapie mit psychotisch erlebenden Menschen
In der zweiten Woche der Lindauer Psychotherapie-Wochen 2022 stand das Thema »Verantwortung« im Zentrum. Auch wenn unsere Vorlesung als klinische Vorlesung, die sich dem psychotischen Erleben widmete, nicht unmittelbar mit dem Rahmenthema verbunden zu sein schien, so war doch die Verantwortung zu betonen, die Psychiater und Psychiaterinnen, Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gerade den psychotisch erlebenden Patientinnen und Patienten gegenüber haben.
Verantwortung in der Psychotherapie mit psychotisch erlebenden Menschen
·Ein therapeutisches Angebot machen
·In der Therapie flexibel bleiben
·Die Therapie auf die Bedürfnisse der Patientengruppe abstimmen
·Alle, auch chronisch Kranke behandeln und sich nicht von einer falsch verstandenen Rentabilität leiten lassen
·Zeugnis für unterversorgte Patientengruppen ablegen
·Sich betreffen und berühren lassen und die ethischen Konsequenzen ziehen
Viele Patientinnen und Patienten, mit denen wir uns in dieser Vorlesung befassen wollen, kommen nicht von allein und aus eigenem Antrieb in die Psychotherapie. Vielleicht wissen sie mit dem Angebot gar nichts anzufangen, vielleicht hindert sie eine unsägliche Angst, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen. Anders als bei den Menschen, die uns aufsuchen, stehen wir in der Verantwortung, die Patienten allererst von uns aus anzusprechen. Wir können nicht passiv bleiben, wir können nicht abwarten. Nein, wir müssen ein Angebot machen.
Zu unserer Verantwortung gehört aber auch, dass wir ein Angebot überhaupt haben und vorhalten. Viele der Patienten, über die wir sprechen werden, sind Stolpersteine im Praxisbetrieb. Keineswegs ist es selbstverständlich, dass sie gewissenhaft und regelmäßig zu den vereinbarten Zeiten kommen. Wir müssen also flexibel sein, und das fällt uns Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten außerordentlich schwer. Wir haben es viel lieber, wenn wir ungestört unsere fest vereinbarten Termine abspulen können.
Für unser Sicherheitsgefühl ist es uns wichtig – und die Psychotherapieforschung zeigt ja auch, wie notwendig es ist – dass wir an unserem Verfahren, das wir gelernt haben und das uns leitet, festhalten. Viele psychotisch erlebende Patienten aber fügen sich nicht in das Schema, dass unser Therapieansatz vorgibt. Oder aber es braucht neben dem therapeutischen Gespräch noch die soziale Integration, die Wiedereingliederungsmaßnahme, eine Regelung der Rentenversorgung etc. Wir müssen also nicht nur im praktischen Alltag, sondern auch in unseren theoretischen Konzepten flexibel sein. Hier wird besonders deutlich, dass nicht die Patienten dem Verfahren, sondern das Verfahren den Anliegen, Ansprüchen und Bedürfnissen der Patienten angepasst werden muss.
Wir stehen darüber hinaus auch in einer gesundheitspolitischen Verantwortung. Immer noch und immer wieder sind die Angebote für psychotisch erlebende Menschen unzureichend. Ich erwähne als ein Beispiel die chronisch akuten Patienten, also die Patienten, die mit einer schweren akuten Psychose stationär eingewiesen werden und nicht gesunden, sondern immer weiter in ihrem psychotischen Erleben befangen bleiben. Sie sind schwer krank und sie brauchen deshalb unter Umständen monatelang eine intensiv psychiatrische, persönliche, beziehungsorientierte Begleitung. Wer sich in diesem Feld auskennt, weiß, wie enorm schwierig es ist, eine personalintensive Langzeitbehandlung aufrechtzuerhalten.
An dieser Stelle schiebe ich eine persönliche Bemerkung ein. Die Umstellung der Abrechnungsbedingungen in der Psychiatrie hat massive Auswirkungen auf die Versorgung gehabt. Zwar ist allgemein bekannt, dass es DRGs (Diagnose Related Groups oder Abrechnungssysteme nach Diagnosegruppen) in der Psychiatrie nicht geben kann. Dennoch hat man, zumindest in der Schweiz, an die DRGs angelehnte Versorgungsmodelle etabliert. Nach einer Anzahl von Wochen wird gemäß diesen Fallpauschalen die Behandlung unprofitabel. Ich erinnere mich an folgendes Gespräch mit einem Vertrauensarzt einer Krankenkasse, die eine etwa neun Monate gehende Behandlung eines schizophrenen Patienten massiv beanstandete. Er hatte das Recht, die gesamte Dokumentation einzusehen. Er wies dann darauf hin, dass im siebten und achten Monat der Patient nachmittags die Klinik verlassen konnte, um Menschen zu treffen, um Einkäufe zu machen etc., und dies ohne Begleitung. Daraufhin meinte der Vertrauensarzt, dass eine stationäre Behandlung von Menschen, die Ausgang hätten, nicht mehr nötig sei. Das also, was wir als eine große und erfreuliche Bereicherung im Rahmen einer unendlich schweren Therapie angesehen hatten, wurde nun plötzlich gegen den Patienten gewendet. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, sich intensiv einzusetzen für Behandlungsmöglichkeiten, die aufgrund der immer schwieriger werdenden ökonomischen Bedingungen gefährdet sind.
Aus der Traumatherapie ist uns geläufig, dass es zu den therapeutischen Aufgaben gehört, dass der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin Zeugnis ablegt; d. h. ja nichts anderes, als das Trauma, das überwältigende Erlebnis, zu beglaubigen. Wenn wir Zeugnis für jemand ablegen, verlassen wir aber unsere Position, die wir normalerweise einnehmen: Wir sind nicht mehr neutral oder ein Gegenüber, sondern wir stehen neben den Patienten oder stellvertretend für sie, um sie zu schützen und auf ihr Leid aufmerksam zu machen.
Das setzt Betroffenheit voraus. Diese steht am Anfang aller Verantwortung. Der Religionsphilosoph Emanuel Lévinas1hat sie zum Ausgangspunkt seiner Philosophie des Antlitzes gemacht. Mit dem Begriff des Antlitzes fasst Lévinas die primordiale Ergriffenheit, die sich angesichts der Ungeschütztheit oder Nacktheit des anderen einstellt. Die Wahrnehmung des leidenden Gesichts überrascht den Wahrnehmenden, ja tut ihm Gewalt an. Sie ist nicht nur präreflexiv, sondern auch vorintentional, d. h. aber auch, dass sie jeder Vorstellung vorausgeht. Sie konstituiert eine ethische Aufgabe, nicht allgemein menschlich gleichsam auf die »Nacktheit des Menschen überhaupt« oder auf die »anthropologische Grundtatsache der Ungeschütztheit« zu reflektieren, sondern sich von der Verwundbarkeit des je einzelnen, unverwechselbaren, individuellen Gesichtes beeindrucken zu lassen, eines Gesichtes, das gezeichnet ist von den Erfahrungen, von dem, was ihm angetan worden ist, auch von den Traumatisierungen, die es erlebt hat. Diese Verantwortung motiviert zu einem therapeutischen Engagement. Natürlich, darüber wird zu reden sein, macht diese Parteinahme eine therapeutische Haltung, die zugleich auf Abstinenz und Neutralität aufbaut, schwer. Aber es ist nicht unmöglich, beide Positionen miteinander zu verbinden.
Stigmatisierung
Können wir denn anders handeln als die Menschen, die psychotisch erleben, zu stigmatisieren? Die Geschichte der Psychiatrie ist eine Geschichte der Ausgrenzung, der Diffamierung, der Gewalt, der Verhöhnung. Der große Hofmaler Francesco de Goya war sich nicht zu schade, in die Irrenhäuser seiner Zeit zu gehen und das Elend der dort untergebrachten abzubilden und dem höfischen und gebildeten Publikum vorzuführen.2
Als ich meine Assistenzarztzeit in der psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg absolvierte und begeistert von der differenzierten Psychopathologie war, die dort eine lange Tradition hatte, so war ich gleichermaßen entsetzt zu erfahren, dass die sogenannte T4 Aktion, die Vernichtung chronisch psychisch kranker Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus in dieser Klinik mit konzipiert wurde. Aber erst in den 1970er Jahren fing man an, die unselige Geschichte aufzuarbeiten. Der emeritierte Professor Rauch hatte noch ein eigenes Zimmer in der Klinik und nahm an den forensischen Seminaren regelmäßig teil. Er hatte sich in der Nazizeit durch die Obduktion von Kindern, die der Euthanasie zum Opfer gefallen waren, einen Namen gemacht. Wir wussten es, aber wehrten uns nur zögernd. Stigmatisierung liegt auch dann vor, wenn die, die stigmatisieren, ausgrenzen, töten, gedeckt werden.3
In den zwölf Jahren meiner Tätigkeit als ärztlicher Direktor der Psychiatrie Baselland ist es mir nicht gelungen, Fixierungen, die ich immer bekämpft habe, gänzlich abzuschaffen, und ich war mir immer quälend bewusst, dass ich damit die Gewalt fortsetze, die eng mit der Stigmatisierung verknüpft ist. Die Gewalt in der Psychiatrie ist ihrerseits bedingt durch die Versorgungsverhältnisse und somit durch die Ökonomie. Eine ausreichende persönliche und menschliche, mitmenschliche Präsenz kann so viel an Gewaltmaßnahmen einsparen helfen. Psychiatrische Kliniken werden heute auch dadurch stigmatisiert, dass sie im Vergleich zu anderen Kliniken hoffnungslos unterfinanziert sind.
Zu fragen ist freilich, ob wir durch die Art und Weise, wie wir auf psychische Krankheit schauen, ob wir durch den ärztlichen Blick auch an der Stigmatisierung teilnehmen, ohne uns ihr entziehen zu können. Aber wir können hellhörig werden, wenn wir die Menschen mehr zu Wort kommen lassen, die eine psychotische Erlebniswelt durchschritten haben. Im Schweizer Archiv für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie (SANP), dessen Chefredakteur ich bis Ende 2021 gewesen bin, wurden in den letzten Jahren First-person Accounts veröffentlicht. Wie anders klingt das, was ein Mann von 43 Jahren rückblickend über seine Krankheit schreibt, im Vergleich zu dem, was wohl in seiner Krankenakte steht. Ich zitiere ausführlich, um auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie sich das psychotische Erleben anfühlen mag und wie viel Wertung in der Diagnostik steckt, die wir gewöhnlich und unausweichlich benutzen. Stellen Sie sich vor, der Herr wäre Ihr Patient, stellen Sie sich vor, was Sie über ihn gesagt oder geschrieben hätten, und vergleichen Sie dies mit der subjektiven Perspektive des Menschen, der im Rückblick auf seine vor 23 Jahren begonnene schwere psychische Krankheit tatsächlich in der ersten Person, also von sich als Individuum und Subjekt schreibt.
First-person Account
»Ich fühlte mich nicht krank ‒ andersartig fühlte ich mich. Vor allem wegen der Stimmen, die ich hörte. Und das war gut so. Ich vernahm Botschaften wie: ›Du wirst ein Guru werden, ein Wissender, der anderen jederzeit die richtige Hilfe bieten kann‹ oder ›Du wirst die Welt retten‹. Auch spielten Musiker an Konzerten nur für mich, der Nachrichtensprecher sendete mir aus dem Fernseher per Telepathie immer wieder anerkennende Botschaften zu.
Anderen Personen gegenüber fühlte ich mich emotional überlegen. Ich erzählte niemandem, dass ich Stimmen hören konnte. Zu persönlich waren die Botschaften.
Auch in der Klinik schwieg ich weiter, schaute niemandem in die Augen, schüttelte keine Hände. Vor allem nahm ich keine Aufträge an oder führte sie nicht aus. Dieses Verhalten wurde vor allem für mein nächstes Umfeld schwierig. Meine Familie und die besten Freunde besuchten mich über längere Zeit. Ich verhielt mich stumm und in mich gekehrt. Ich benötigte Kraft und enormen Willen, um die Reglosigkeit aufrecht zu erhalten. Später besuchte mich nur noch meine Familie.
Ein Jahr war ich in der Klinik mit ein wenig Sonderbehandlung ›deponiert‹. Vom Arzt ließ ich mich nicht in ein Gespräch verwickeln. Ich wollte mein Leben lang nicht mehr sprechen. Es war für mich zu dieser Zeit nicht schwierig, ohne Sprache zu leben, denn die Angst, ›meine Stimmen‹ zu verlieren, war übermächtig. Diese blieben weiter meine Oasen, weil mir das Leben in der Gesellschaft bereits einige Jahre zuvor zu viel wurde. Stimmen bauten mich auf, wenn ich zuunterst auf der Selbstmitleids-Spirale angekommen war. In der Not suchte ich in diesem Zustand ab und zu Plätze auf, um mich zu suizidieren. Dank der Stimmen fand ich umgehend in eine euphorische Welt. Zustände der Seele können eben manchmal nicht rational nachvollzogen werden. Das ist gut so. Wo bleibt sonst das Magische, das uns neu inspirieren kann und uns plötzlich wieder staunen lässt?
Heute, 23 Jahre später, lebe ich ein gänzlich anderes Leben. Innerlich bin ich immer noch derselbe, steige in die gleichen Fettnäpfchen, höre manchmal träumerisch den Stimmen zu. Stimmen, die sich verändert haben. Stimmen, denen ich aber entgegentreten kann und für mich glaubhaft zu entkräften vermag.
Warum ich nach vier Jahren wieder zu sprechen begann, würde ich vielleicht in den Worten von Anaïs Nin beantworten: ›Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde als das Risiko zu blühen‹.«4
Gehen wir nun im Detail durch, was dieser ehemalige Patient über sich berichtet. Er hat Stimmen gehört, die akustischen Halluzinationen wurden von dem Heidelberger Psychopathologen Kurt Schneider5 als Symptom ersten Ranges bezeichnet, das lange als wegleitend für die Schizophrenie angesehen worden ist und tatsächlich immer wieder im psychotischen Erleben auftaucht, allerdings heute nicht mehr als pathognomonisch angesehen wird. Ungewöhnlich freilich ist, dass die Stimmen ihn ermutigen, dass sie anerkennende Botschaften aussenden. Sehr oft werden sie in anderen Fällen als bedrängend, befehlend, gängelnd erlebt, manchmal beschimpfen sie auch. Das ist für unseren Patienten anders, er schätzt sie.
Bereits diese Aussage gibt zu denken. Wissen wir, wie unsere Patienten das, was wir als Symptom verstehen, selbst bewerten? Wir gehen davon aus, und sehr häufig stimmt das ja auch, dass akustische Halluzinationen, dass Halluzinationen überhaupt, störend empfunden werden. Hier wird etwas anderes ausgesagt, die Stimmen sind wie Oasen, der Patient hat Angst, die Stimmen zu verlieren. Wenn also eine Behandlung, zum Beispiel mit Antipsychotika, dazu führt, dass die Wahrnehmungsstörungen verschwinden, ist es noch nicht gesagt, ob wir dem Patienten damit etwas Gutes tun oder ob wir ihm auch etwas wegnehmen.
Welche Qualität schreibt er den Halluzinationen zu? Offensichtlich sind sie sehr intim, er sagt: zu persönlich. Eine Oase in der Wüste ist ein rettender Ort, ein Rückzugsort, an dem man inmitten der Trockenheit und Hitze der Wüste überleben kann. Der Patient berichtet, dass er sich völlig von anderen abgeschottet hat, er hat niemanden die Hand gegeben, ja er hat niemanden angeschaut, schon gar nicht mit anderen gesprochen. Er hat nichts mehr getan, er beschreibt wohl so etwas wie einen katatonen Zustand, eine Reglosigkeit, in der er subjektiv mit aller Anstrengung verharrt, die er also fast um jeden Preis aufrecht erhalten will. Er merkt, dass die anderen, auch seine Familienmitglieder, ihn nicht mehr verstehen, dass er schwierig für sie wird. Er spricht nicht, wird also in der Fachterminologie der Psychiatrie mutistisch, er verstummt – und das immerhin für vier Jahre, wie nebenher erwähnt wird. Aber was uns seine Worte sehr deutlich vermitteln, das ist, dass er sich auf Biegen und Brechen von anderen zurückzieht. Dieser Rückzug geht sehr weit, so weit, dass er durchaus auch an Suizid denkt.
Er beschreibt es nicht, aber wir wollen es uns fragen, warum er diesen Rückzug wählt. Anders als wenn wir ihn in der Therapie hätten, können wir seine Geschichte, die auslösenden Situationen, die frühen Erfahrungen nicht rekonstruieren. Aber was wir doch mit guten Gründen annehmen können, ist, dass der Rückzug von anderen Menschen entscheidend ist, dass im eigenen Erleben alles darum geht, sich gleichsam ganz auf sich selbst zurückzuziehen und eine eigene Welt aufzubauen, die von der mitmenschlichen Welt der anderen erlöst. Der Schweizer Psychiater, der frühzeitig die Psychoanalyse in sein Denken einbezogen hatte und dem wir den Begriff der Schizophrenie verdanken, Eugen Bleuler, hat den Autismus, also den Rückzug auf das eigene Selbst als den Dreh- und Angelpunkt der Schizophreniediagnose angesehen, als Grundstörung in der Schizophrenie6. Die Schwierigkeit, Nähe auszuhalten, den Abstand zu anderen Menschen gut auszutarieren bzw. extreme Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese aktivische Formulierung erlaubt ist, um einen Abstand zu finden, in dem der psychotisch lebende Mensch sich sicher fühlen kann, spielt also offenbar eine entscheidende Rolle im psychotischen Erleben. Wir werden darauf ausführlich zurückkommen.