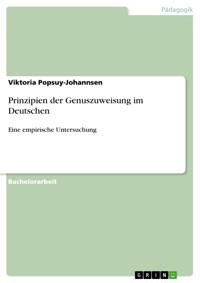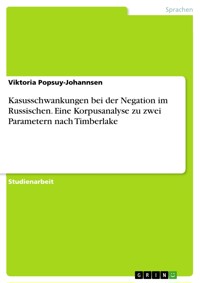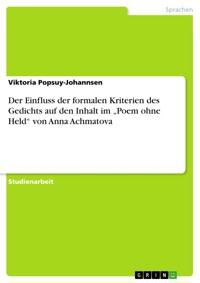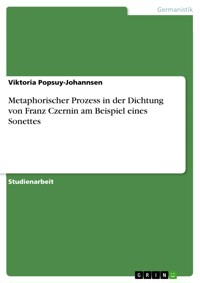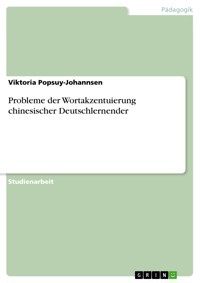Puškins "Eugen Onegin". Die Entwicklung des Protagonisten weg vom Byronschen Helden E-Book
Viktoria Popsuy-Johannsen
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Russistik / Slavistik, Note: 2,3, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Institut für Slavistik), Veranstaltung: Hauptseminar "Puškins „Eugen Onegin", Sprache: Deutsch, Abstract: Um 1800 beginnt eine neue geistes- und stilgeschichtliche Epoche – die Romantik. Diese Zeit zeichnet sich durch bestimmte Denkweisen aus. Empfindungen und Gefühle rücken in den Mittelpunkt, die Fantasie wird betont, man interessiert sich für alles Außergewöhnliche und bricht mit klassischen Normen. Im England des frühen 19. Jahrhunderts prägt Lord Byron die romantische Literatur wie kein zweiter. In seinem Werk „Childe Harolds Pilgerfahrt“ vermischt er gezielt die Grenzen zwischen Leben und Werk, Realität und Fiktion, Held und Autor und erreicht damit die Darstellung des modernen Helden, des sogenannten „Byronsche Helden“. Seit 1814 wurde Byron auch in Russland bekannt und ab den 1820er Jahren nahm seine Beliebtheit bei der liberalen Jugend, den Schriftstellern, Kritikern und Lesern stetig zu. Dem byronschen Einfluss konnte sich auch der russische Dichter Alexander Puškin nicht entziehen. In Puškins Hauptwerk „Eugen Onegin“ besteht eine große Ähnlichkeit des Protagonisten mit dem Byronschen Helden. In dieser Arbeit wird gezeigt, wie Puškin den Byronismus überwindet. Dabei soll verdeutlicht werden, dass Puškin die Entwicklung als Mittel benutzt, um einen Übergang von der Romantik zum Realismus bzw. vom romanischen zum „realistischen“ Helden zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Byronscher Held am Beispiel von Childe Harold
3. Byrons Einfluss auf Puškin
4. Eugen Onegin als Byronscher Held
5. Puškins Protagonist – „weg vom Byronismus“
5.1 Autor vs. Protagonist
5.2 „Eugen Onegins“ Entwicklung
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts fängt „eine geistes- und stilgeschichtliche Epoche“[1] an – die Romantik. Diese Epoche wird durch bestimmte Denkweisen ausgezeichnet: „die Subjektivierung von Menschenbild und Empfindungen, die Betonung von Fantasie und Gefühl, die Poetisierung der Wirklichkeit, das Interesse an allem Außergewöhnlichen und „Genialischem“, der Bruch mit klassischen Normen, die Sehnsucht nach dem Unendlichen […]“[2]. Die Romantiker führen „die innere Welt und die Erinnerungen an eine verklärte Vergangenheit zum Raum menschlicher Selbstverwirklichung“[3] aus, um den Übergang vom Klassizismus zur Romantik zu schaffen. In England zu Beginn des 19. Jahrhunderts „lebt [Byron] den europäischen Intellektuellen ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit vor“[4]. In seinem Werk „Childe Harolds Pilgerfahrt“ vermischt Byron gezielt die Grenzen zwischen Leben und Werk, Realität und Fiktion, Held und Autor,[5] und damit erreicht er die Darstellung des modernen Helden, der so genannte „Byronsche Held“. Dessen Charakteristiken werden im nächsten Kapitel dieser Arbeit am Beispiel „Childe Harolds Pilgerfahrt“ dargestellt.
Byrons Leben und Werke wurden Weltweit als Vorbild gesehen. Seit 1814 war Byron in Russland bekannt und ab den 1820er Jahren bei der liberalen Jugend, den Schriftstellern, Kritikern und Lesern beliebt.[6] Der byronsche Einfluss kann auch bei Alexander Puškin erkannt werden. Die byronschen Züge sind am meisten in Puškins „Südlichen Poeme“ („Южные поэмы“) zu finden, da er „die Gleichgültigkeit zum Leben und seinen Genüssen darstelle“[7]. In Puškins Hauptwerk „Eugen Onegin“ kann die Ähnlichkeit des Protagonisten zum Byronschen Held gesehen werden. Diese soll im vierten Kapitel der Arbeit mit Textauszügen deutlich gemacht werden.
Im letzten Kapitel der Arbeit wird die Überwindung des Byronismus von Puškin an zwei Aspekten gezeigt. Dabei soll verdeutlicht werden, dass Puškin die Entwicklung als Mittel benutzt, um einen Übergang von der Romantik zum Realismus bzw. um einen Übergang vom romanischen zum „realistischen“ Helden zu präsentieren.
2. Byronscher Held am Beispiel von Childe Harold
Die europäische Romantik kann „als Epoche des Gefühlsüberschwanges, der Melancholie und des Weltschmerzes“[8] erfasst werden. Das Werk „Childe Harolds Pilgerfahrt“ bringt „die Kluft zwischen den romanischen Idealen und der ernüchternden Wirklichkeit der nach-napoleonischen Ära zum Ausdruck“[9]. Es wird deutlich, dass das Geschlecht des Adels für die jüngere Generation keine große Rolle mehr spielt:
Childe Harold hieß er; aber sein Geschlecht
Und Ahnenreihe darf ich euch nicht sagen;
Euch mag genügen, daß vielleicht mit Recht
Sein Haus berühmt war in vergangnen Tagen.
Doch welchen Glanz ein Nam auch einst getragen,
Ein schlechter Sproß verdunkelt all sein Licht;
Kein Wappenschmuck noch Staub in Sarkophagen,
Kein Redeschwulst und honigsüß Gedicht
Adelt die böse Tat und wendet das Gericht. (I, 3) [10].
Der Pessimismus der Zeit, der Zweifel an der Gesellschaft, an der Moral und an der Regierung wird vom Autor bis zum Ende des Textes verfolgt[11] und „Zweifel am Sinn des Lebens“[12] dargestellt:
Vielleicht auch mit Dämonen, die den Sinn
Zum Guten töten und nach Beute jagen
In finstren Herzen, welche vom Beginn
Der Schwermut Keim in ihren Fasern tragen
Und Gram und Nacht aufsuchen mit Behagen
Und Wähnen, daß für sie im Schicksalsbuch
Qual steht, die nicht vergeht wie andre Plagen.