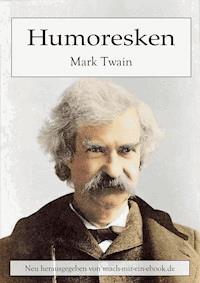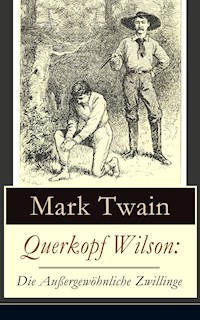
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieses eBook: "Querkopf Wilson: Die Außergewöhnliche Zwillinge" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Querkopf Wilson ist ein Roman von Mark Twain. Schauplatz der Geschichte ist die heimelige, etwas verschlafene Kleinstadt Dawson's Landing am Mississippi, die wie Deer Lick und auch wie St. Petersburg an Mark Twains Heimatstadt Hannibal in Missouri erinnert. Dawson's Landing ist eine Sklavenhalterstadt, in der man von Getreideanbau und Schweinezucht lebt und in der Schwarze sozial schlecht gestellt sind. Das muss auch die zwanzigjährige, selbstbewusste Roxy feststellen, eine Sklavin im Haus von Percy Driscoll. Als dort ein Dieb gesucht wird, droht Driscoll allen Schwarzen mit dem Verkauf "in den Süden" - dorthin, wo man noch brutalere Methoden der Unterdrückung pflegt. Roxy sorgt sich um die Zukunft ihres Sohns Valet de Chambre, genannt Chambers, und entschließt sich kurzerhand zum Kindertausch: Sie stülpt ihrem wenige Monate alten Sohn die Kleider von Thomas Bechet Driscoll, genannt Tom, über, dem gleichaltrigen Sohn ihres Herrn, den sie an Mutterstatt betreut. Niemand bemerkt den Tausch, denn wie Roxy ist Chambers ein Schwarzer mit weißer Haut. Samuel Clemens (1835-1910), besser bekannt unter seinem Pseudonym Mark Twain - war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Mark Twain ist vor allem als Autor der Bücher über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn bekannt. Er war ein Vertreter des amerikanischen Realismus und ist besonders wegen seiner humoristischen, von Lokalkolorit und genauen Beobachtungen sozialen Verhaltens geprägten Erzählungen sowie aufgrund seiner scharfzüngigen Kritik an der amerikanischen Gesellschaft berühmt. In seinen Werken beschreibt er den alltäglichen Rassismus; seine Protagonisten durchschauen die Heuchelei und Verlogenheit der herrschenden Verhältnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Querkopf Wilson: Die Außergewöhnliche Zwillinge
Wilson, der Spinner (Historischer Kriminalroman)
Übersetzer: Margarete Jacobi
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Im Staate Missouri, auf dem rechten Ufer des Mississippi, liegt die Stadt, welche der Schauplatz dieser Geschichte ist. Sie heißt Dawson, und man muß von St. Louis bis dahin noch sechs Stunden mit dem Dampfboot stromabwärts fahren.
Der Ort bestand im Jahre 1830 aus einer Anzahl freundlicher ein-oder zweistöckiger, weißgetünchter Häuser, die über und über mit einem Gewirre von Schlingrosen, Jelängerjelieber und vielfarbigen Winden bedeckt waren. Zu jeder dieser hübschen Heimstätten gehörte auch ein Vorgärtchen mit weiß angestrichenem Staketenzaun. Dort blühten Goldlack, Stockrosen, Federnelken, Balsaminen und anders altmodische Blumen in üppiger Fülle, während auf den Fensterbrettern Holzkästen mit Moosrosen prangten und Geranien in Blumentöpfen ihr feuriges Rot mit der zarteren Farbe der Schlingrosen mischten, die an der Mauer in die Höhe kletterten. Wenn draußen auf dem Blumenbrett neben Kästen und Töpfen noch Raum war, so lag – falls die Sonne schien – sicher eine Katze da. Lang ausgestreckt, schlief sie in wohligem Behagen mit einer Pfote an der Nase und wärmte sich den weichen Pelz. Dies war der offenkundigste Beweis und ein unfehlbares Zeichen, daß in dem Hause Glück und Zufriedenheit wohnten; natürlich mußte die Katze aber gut gefüttert, wohl versorgt und in Ehren gehalten sein. Eine Familie, die sich keine Katze hält, kann in vollkommener Gemütlichkeit leben, aber welches Mittel hat sie, es vor der Welt kund zu thun?
Auf beiden Seiten war der gepflasterte Bürgersteig in der ganzen Länge der Straßen am äußeren Rand mit Akazien eingefaßt, deren Stämme eine hölzerne Schutzvorrichtung hatten. Die Bäume spendeten im Sommer Schatten und im Frühling süßen Duft, wenn sie ihre reichen Blütensträuße aufthaten. Das Geschäftsleben der Stadt beschränkte sich ganz auf die Hauptstraße, die etwas vom Fluß entfernt, mit diesem in gleicher Richtung lief. In jedem ihrer Häuserviertel ragten zwei oder drei mehrstöckige, steinerne Warenhäuser hoch über die aus Holz gebauten, dazwischen liegenden Kaufläden empor. Erhob sich ein Windstoß, so wurden die schwingenden Aushängeschilder längs der ganzen Straße knarrend hin-und herbewegt. Die blau und weiß gestreifte schräge Stange mit dem Becken, war das Abzeichen der Barbierläden in Dawson, und an einer Ecke stand hoch aufgerichtet ein unangestrichener Pfahl, der von oben bis unten mit allerlei Blechwaren, Töpfen, Tiegeln und Pfannen bekränzt war, die im Winde laut klapperten, um anzuzeigen, daß hier der erste Klempner der Stadt sein Geschäft betrieb.
Das klare Wasser des Stromes bespülte die vordersten Häuser des Ortes, welcher sich dann einen Abhang hinaufzog und sich immer weiter zerstreute. Die letzten Gebäude reichten bis an den Fuß der steil emporragenden Berge, die bis zum Gipfel dicht bewaldet waren und die Stadt im Halbkreis umgaben.
Viele Dampfboote kamen etwa jede Stunde stromaufwärts und -abwärts vorbeigefahren. Die Schiffe der kleinen Cairo-und der kleinen Memphislinie legten immer an, aber die großen Dampfer von New-Orleans hielten nur gelegentlich, um Grüße zu tauschen oder Passagiere und Frachtgüter aufzunehmen. Ebenso machten es die zahlreichen Fahrzeuge, die von rechts und links aus den Nebenflüssen kamen – aus dem Illinois, dem Missouri, dem oberen Mississippi, dem Ohio, dem Monongahela, dem Tennessee, dem Roten Fluß, dem Weißen Fluß und wie sie alle heißen. Diese Dampfer waren nach den verschiedensten Orten unterwegs und versorgten mit ihrer Ladung sämtliche Gemeinwesen am Ufer des Mississippi. Durch ein neunfach wechselndes Klima, von den nördlichen Fällen bei St. Anthony, bis in das glühend heiße New-Orleans hinunter, brachten sie allen Anwohnern, was zu ihrer Notdurft und jeder nur erdenklichen Bequemlichkeit erforderlich war.
Die Bewohner von Dawson hielten sich Sklaven, welche die einträgliche Schweinezucht besorgen und das fruchtbare Getreideland ringsum bebauen mußten. Es war eine ruhige, wohlhäbige und zufriedene Stadt, vor fünfzig Jahren erbaut und in zwar langsamem, aber stetigem Wachstum begriffen. Ihr angesehenster Bürger, Jork Leicester Driscoll, zählte etwa vierzig Jahre und war Richter am Bezirksgericht. Stolz auf seine vornehme, altvirginische Abkunft, strebte er stets, es seinen Vorfahren gleich zu thun, nicht nur in betreff der Gastlichkeit, sondern auch durch sein etwas förmliches, würdevolles Wesen. Er war freigebig und gerecht, auch genoß er die größte Hochachtung und Liebe seiner Mitbürger. Sein ganzes Trachten ging dahin, ein Edelmann zu sein ohne Furcht und Tadel. Das war seine einzige Religion, der er unverbrüchlich treu blieb. Von Haus aus wohlhabend, vermehrte er seinen Besitz noch mit der Zeit, und es fehlte ihm und seiner Frau nureines, um ganz glücklich zu sein: sie hatten keine Kinder. Je mehr Jahre dahinflossen, um so sehnlicher wünschten sie einen solchen Schatz ihr eigen zu nennen, aber der Segen blieb aus und ihr Verlangen ward nicht erfüllt.
Im Hause dieses Ehepaares lebte noch Frau Rahel Pratt, Herrn Driscolls verwitwete Schwester, gleichfalls kinderlos und tief bekümmert darüber. Die Frauen waren gute einfache Menschen, die ihre Pflicht thaten und ihren Lohn in einem ruhigen Gewissen und der Anerkennung ihrer Gemeindegenossen fanden. Sie gehörten zur presbyterianischen Kirche, während der Richter ein Freidenker war.
Ein anderer Abkömmling aus einer der ersten Familien von Alt-Virginien war Pembroke Howard, der Rechtsanwalt, etwa vierzigjährig und unverheiratet, ein wackerer, stattlicher Herr, der streng auf Ehre und Ansehen hielt und in aller Höflichkeit bereit war, jeden, der an irgend etwas, das er gesagt oder gethan hatte, den geringsten Anstoß nahm, vor seine Klinge zu fordern oder ihm mit jeder beliebigen Schieß- oder Hiebwaffe Genugthuung zu geben. Er stand bei aller Welt in Gunst und war der beste Freund des Richters.
Ferner erwähnen wir den Oberst Cecil Burleigh Essex, auch einen furchtbar vornehmen Herrn aus den Südstaaten, aber mit ihm haben wir weiter nichts zu schaffen.
Percy Northumberland Driscoll, ein um fünf Jahre jüngerer Bruder des Richters, war verheiratet. Seiner Ehe entsproßten auch mehrere Kinder, die aber leider von Masern, Kroup und Scharlachfieber befallen wurden und dadurch dem Doktor Gelegenheit gaben, seine wirksamen, vorsintflutlichen Arzneimittel anzuwenden. Da wurden die Wiegen wieder leer. Uebrigens war der Bruder des Richters ein wohlhabender Mann, auch ein kluger Kopf in spekulativen Geschäften, und sein Besitzstand wuchs.
Am ersten Februar 1830 wurden in seinem Hause zwei Knäblein geboren, eins gehörte ihm und das andere einer seiner Sklavinnen, der zwanzigjährigen Roxana, meist Roxy genannt. Diese stand schon am selben Tage wieder auf und hatte alle Hände voll zu thun, denn sie mußte beide Neugeborenen versorgen. Frau Percy Driscoll starb, ehe noch eine Woche um war, und die Pflege und Wartung der Kleinen wurde ausschließlich Roxy anvertraut. Sie konnte dabei ganz nach eigenem Gutdünken verfahren, denn Herr Driscoll vertiefte sich bald wieder in seine Geschäftsangelegenheiten und ließ sie thun, was sie wollte.
Im Laufe desselben Monats Februar hatte sich auch ein neuer Einwohner in Dawson niedergelassen. Dies war David Wilson, ein junger Mann von schottischer Abstammung, der aus seiner Geburtsstadt im Staate New-York nach jener abgelegenen Gegend gewandert kam, um sein Glück zu suchen. Er hatte eine höhere Bildungsanstalt durchgemacht und dann noch mehrere Jahre auf einer der Rechtsschulen Neuenglands studiert. Fünfundzwanzig Jahre alt, nicht hübsch, mit sandfarbenem Haar und einem Gesicht voll Sommersprossen, machte er doch einen angenehmen Eindruck. Seine klugen blauen Augen schauten offen und freimütig drein und sie konnten zuweilen recht schalkhaft zwinkern.
Seine Laufbahn in Dawson wäre gewiß gleich beim Anbeginn vom Glück begünstigt gewesen, hätte er nicht schon am ersten Tage eine unselige Bemerkung gemacht, welche die Leute gegen ihn einnahm. Er befand sich eben im Gespräch mit mehreren Bürgern, deren Bekanntschaft er gemacht hatte, als ein unsichtbarer Hund ein so widerwärtiges Gekläff, Geknurre und Geheul begann, daß man sein eigenes Wort kaum verstehen konnte. Da sagte der junge Wilson vor sich hin, wie jemand, der laut zu denken pflegt:
»Wenn mir doch die Hälfte von dem Hund gehörte!«
»Weshalb denn?« fragte einer.
»Damit ich den Teil, der mein wäre, umbringen könnte.«
Die Leute sahen ihm neugierig forschend und ängstlich ins Gesicht, aber sein Ausdruck verriet ihnen nichts – sie fanden keine Erklärung darin. Einer nach dem andern schlich beiseite, als ob es ihm unheimlich würde in Wilsons Nähe. Unter sich kamen sie dann wieder zusammen und besprachen den Vorfall mit einander.
»Der scheint mir ein Narr zu sein,« sagte einer.
»Eristein Narr, verlaßt euch drauf,« meinte ein anderer.
»Wie einfältig, zu sagen, er wollte, daß ihm der Hund zur Hälfte gehörte,« fiel der dritte ein. »Was glaubt er denn, der Tropf, daß aus dem Rest des Tieres wird, wenn er seinen Anteil umbringt? Meint er etwa, es wird am Leben bleiben?«
»Natürlich muß er das gedacht haben, sonst wäre er der größte Schafskopf. Hätte er vorausgesehen, daß wenn er seine Hälfte umbrächte, der andere Teil auch stürbe, so müßte er auch wissen, daß man ihn dafür ganz ebenso verantwortlich machen würde, als ob er die fremde Hälfte statt seiner eigenen tot geschlagen hätte. – Nun – habe ich recht oder unrecht?«
»Versteht sich, ganz recht,« erscholl es einstimmig und dann bestätigte jeder einzelne, was er von ihm hielt.
»Meiner Ansicht nach ist der Mensch nicht bei Sinnen,« sprach der erste.
»Jedenfalls hat er einen Knacks,« ließ sich der zweite hören.
Nummer drei sagte: »Ein rechter Einfaltspinsel!«
»Freilich,« bestätigte Nummer vier, »das Muster von einem Hansnarren.«
»Ich halte ihn für einen echten Dämelack,« äußerte Numero fünf. »Wer anderer Meinung ist, dem bleibt es unbenommen, aber, das ist meine Auffassung.«
»Ganz einverstanden, werte Herren,« versicherte Numero sechs. »Ein Esel, wie er im Buche steht. Ja, ich glaube, es ist nicht zu viel behauptet, wenn ich sage, daß er der größte Querkopf ist, den ich im Leben gesehen habe. Ja, ja, – ein Querkopf, wie es keinen zweiten giebt – und dabei bleibt’s.«
So war denn Wilsons Urteil gesprochen. Die Geschichte flog wie ein Lauffeuer durch die Stadt, sie war in aller Munde. Ehe noch eine Woche verging, hatte er seinen Taufnamen verloren und hieß statt dessen nur noch der ›Querkopf‹. Mit der Zeit wurde er allgemein geschätzt und beliebt, aber der Spitzname hatte sich schon so fest eingenistet, daß er ihn nicht wieder los wurde. Er war nun einmal von Anfang an für einen Narren erklärt worden und der Spruch ließ sich weder drehen noch wenden. Zwar hatte die Bezeichnung bald keine feindselige oder unfreundliche Bedeutung mehr, aber sie haftete ihm dauernd an, volle zwanzig Jahre lang.
Zweites Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Mit der kleinen Summe Geldes, die Wilson bei seiner Ankunft besaß, kaufte er eins der letzten Häuschen am äußersten Westende der Stadt. Von dem Driscollschen Wohnhaus trennte ihn nur ein großer, mit Gras bewachsener Hof, den ein Lattenzaun in zwei Hälften teilte. Sein Geschäftsbureau mietete er unten in der Stadt und hing ein Blechschild heraus, auf dem zu lesen stand:
David Wilson, Rechtsanwalt und Notar.Ausfertigung von gerichtlichen Urkunden, Kostenanschlägen u. s. w.
Aber jene erste unglückselige Bemerkung hinderte sein Fortkommen als Advokat gänzlich. Es stellten sich keine Klienten ein. So nahm er denn das Schild nach einer Weile wieder herunter und hing es mit veränderter Inschrift an seinem eigenen Hause auf. Er bot jetzt dem Publikum seine bescheidenen Dienste als Landmesser, Buchhalter und Rechnungsführer an. Gelegentlich bekam er auch Arbeit: ein Feld zu vermessen oder die Bücher eines Kaufmanns in Ordnung zu bringen. Mit echt schottischer Geduld und Ausdauer nahm er sich vor, seinem ungünstigen Ruf zum Trotze es doch noch einmal zu einer Anwaltspraxis zu bringen. Der arme Mensch konnte freilich nicht voraussehen, welche jahrelange Mühsal ihn das kosten würde.
Er hatte natürlich großen Ueberfluß an müßiger Zeit, aber das lastete nicht schwer auf ihm; denn für jede neue Erfindung auf geistigem Gebiet interessierte er sich eifrig und stellte sofort die darauf bezüglichen Versuche bei sich daheim an. Zu seinen besonderen Liebhabereien gehörte es, die Linien der menschlichen Hand zu entziffern. Er hatte auch noch ein anderes Steckenpferd, das er anscheinend nur zur Unterhaltung betrieb, denn den eigentlichen Zweck desselben wollte er niemand erklären, auch gab er ihm keinen Namen. Seine Liebhabereien – das hatte er bald herausgefunden – trugen nur noch mehr dazu bei, ihn in den Ruf eines Querkopfs zu bringen, und so hütete er sich wohl, zu viel davon laut werden zu lassen. Das Steckenpferd ohne Namen war eine Sammlung von Abdrücken der Fingerspitzen verschiedener Leute. In seiner Rocktasche führte Wilson immer einen flachen Kasten bei sich, welcher innen Falze hatte, in denen fünf Zoll breite Glasplättchen steckten. Auf jedem der Gläser war unten ein Stück weißes Papier aufgeklebt. Nun bat er irgend jemand, sich mit der Hand durchs Haar zu fahren, (wodurch sich etwas von dessen natürlicher Fettigkeit den Fingern mitteilte) und zuerst den Daumen, dann jede einzelne Fingerspitze der Reihe nach auf einem Glasplättchen abzudrücken. Auf dem Zettel unter den fünf schwachen Fettflecken, die so entstanden, verzeichnete er genau Namen, Jahr und Datum, z. B.: John Smith, rechte Hand – nahm dann den Abdruck von Smiths linker Hand auf einer andern Glasplatte und notierte auch dies pünktlich auf dem weißen Zettel. Beide Gläser kamen nun wieder in den Kasten und wurden Wilsons Sammlung einverleibt. Er nannte sie seine ›Protokolle‹ und war oft stundenlang, ja bis tief in die Nacht hinein beschäftigt, sie mit der größten Genauigkeit zu prüfen und zu untersuchen. Ob er aber irgend etwas darin entdeckte, und was das möglicherweise sein konnte, verriet er niemand. Manchmal zeichnete er auch eins der so gewonnenen, zarten, verschlungenen Muster des obersten Fingergliedes auf Papier und machte dann eine riesige Vergrößerung davon mit Hilfe des Storchschnabels, so daß er das Gewebe der geschweiften Linien ganz ohne Mühe nach Belieben betrachten konnte. An einem drückend heißen Nachmittag – es war der erste Juli 1830 – saß er in seinem Studierzimmer, das, nach Westen gelegen, auf eine Anzahl leerer Baustellen hinausging. Neben ihm lag ein Stoß Rechnungsbücher, die er in Ordnung bringen sollte. Ein Gespräch, das draußen geführt wurde, störte ihn bei der Arbeit. Die beiden Personen mußten nicht dicht beisammen sein, denn sie schrieen einander laut zu.
»Sag’ mal, Roxy, was macht dein Kleiner, gedeiht er gut?« tönte es von fern her.
»Das will ich meinen, und du, Jasper, bist du auch auf dem Strumpf?« schrie es in nächster Nähe.
»Na, es macht sich, kann nicht klagen. Bald komm ich zu dir, Roxy, ich will dich freien.«
»Untersteh’ dich, du abscheulicher Schmutzfink! Hahaha! Das fehlte mir noch, mich mit so ‘nem schwarzen Nigger abzugeben wie du einer bist. Der alten Tante Cooper ihre Nancy hat dir wohl den Laufpaß gegeben?« Roxys sorgloses Gelächter schallte wieder hell durch die Luft.
»Bist eifersüchtig, Roxy! Wahrhaftig ja – hahaha! Hab’s erraten, du Dirne!«
»Oho, was du dir nicht einbild’st! – Gieb nur acht, daß dein Dünkel nicht nach innen schlägt, sonst bringt er dich noch um. Wenn du mir gehören thätest, verkaufte ich dich lieber heut wie morgen flußabwärts – du treibst’s zu bunt. Wart’ nur, ich sag’ deinem Herrn, er soll’s thun, sobald ich ihn seh’.«
So ging dies leere müßige Geschwätz noch endlos fort, denn die beiden fanden ihr Wortgefecht sehr unterhaltend und witzig und waren stolz auf die schlagfertigen Antworten, die sie gaben.
Wilson trat ans Fenster, um das Paar näher zu betrachten. Bis das Geplapper aufgehört hatte, konnte er doch nicht arbeiten.
Drüben auf dem Bauplatz in der glühenden Sonne saß Jasper, ein junger kohlschwarzer Neger von prächtigem Wuchs, auf einem Schiebkarren. Statt seinem Geschäft nachzugehen, ruhte er erst ein Stündchen aus, um zum Beginn der Arbeit Kräfte zu sammeln. Vor Wilsons Veranda aber stand Roxy neben dem nach Landessitte geflochtenen Kinderwagen, worin ihre beiden Pflegebefohlenen, jeder an einem Ende, einander gegenüber saßen. Nach Roxys Redeweise zu urteilen, hätte man sie für eine Schwarze halten sollen, aber da irrte man sich gewaltig. Was etwa farbig an ihr war – höchstens der sechzehnte Teil – das sah man nicht. Ihre hohe Gestalt, ihre stolze Miene und Haltung machten einen majestätischen Eindruck; in jeder Bewegung, jeder Gebärde prägte sich edle Anmut und Würde aus. Sie war sehr weiß und zart, die Wangen rosig angehaucht von Kraft und Gesundheit, auch hatte sie ein wohlgeformtes, kluges, anziehendes Gesicht, charakterfeste ausdrucksvolle Züge, braune, feuchtschimmernde Augen und schönes braunes Haar, dessen üppige Fülle sie jedoch unter einem buntkarierten Tuch verbarg, das sie turbanartig um den Kopf gebunden trug. Ihr Benehmen unter ihresgleichen war frei und ungezwungen, doch dabei etwas herrisch und von oben herab; aber natürlich war sie in Gegenwart weißer Leute die Demut und Fügsamkeit selbst.
Dem Ansehen nach war Roxy wirklich so weiß, wie man nur irgend sein konnte, aber ihr eines farbiges Sechzehntel schlug alle anderen fünfzehn Sechzehntel aus dem Felde und machte sie zur Negerin, zur verkäuflichen Sklavin. An ihrem Kinde war sogar nur ein Zweiunddreißigstel farbig, aber es galt dennoch nach Gesetz und Sitte für einen Neger und Sklaven. Es harte blaue Augen und blonde Locken, wie sein kleiner weißer Altersgenosse; aber selbst der Vater des weißen Knaben, der sich nur wenig um die Kinder bekümmerte, konnte sie an der Kleidung unterscheiden: der kleine Weiße trug ein feines, reich mit Falbeln besetztes Musselinkleidchen und ein Korallenhalsband, während der andere keinerlei Schmuck besaß und nur ein grobes leinenes Hemd anhatte, das ihm kaum bis zu den Knieen reichte. Der weiße Knabe hieß Thomas à Becket Driscoll, der andere Valet de Chambre, ohne Vatersnamen – den durfte kein Sklave führen. Roxana hatte die Benennung irgendwo aufgeschnappt; der Klang gefiel ihr, und da sie glaubte, es sei ein Rufname, beglückte sie ihren Liebling damit. Natürlich wurde er bald in ›Schamber‹ abgekürzt.
Wilson hatte Roxy schon öfters gesehen, und als sich das Wortgeplänkel zu Ende neigte, trat er vors Haus, um ein paar Abdrücke zu sammeln. Sobald Jasper ihn gewahrte, gab er seinen Müßiggang auf und ging eifrig an die Arbeit, während Wilson die Kinder in Augenschein nahm.
»Wie alt sind sie, Roxy?« fragte er.
»Beide gleich alt, – gerade fünf Monat. Am ersten Februar geboren.«
»Ein paar nette Kerlchen. Einer so hübsch wie der andere.«
Roxy lachte vor Vergnügen übers ganze Gesicht und zeigte ihre weißen Zähne. »Schönen Dank, Massa Wilson, wie gut von Ihnen, das zu sagen, denn einer ist ja bloß ein Neger, wissen Sie. Der niedlichste kleine Neger von der Welt, sag’ ich immer, aber natürlich nur, weil es meiner ist.«
»Wie unterscheidest du sie denn, Roxy, wenn sie keine Kleider anhaben?«
Sie brach in ein ungeheures Gelächter aus.
»O, ich kenne sie schon von einander; aber Massa Percy – da wett’ ich drauf – der könnte sie nicht unterscheiden – um keinen Preis, nein, nein.«
Wilson plauderte noch ein Weilchen fort, dann nahm er einen Abdruck von Roxys Fingerspitzen für seine Sammlung – rechte Hand und linke Hand – auf zwei Glasplättchen, schrieb Namen und Datum auf den Zettel und machte es mit den Händchen der Kleinen ebenso.
Zwei Monate später, am dritten September, ließ er sich die Abdrücke des Dreiblatts noch einmal geben. Bei Kindern pflegte er in kürzeren Pausen die Aufnahmen vorzunehmen, bei älteren Leuten in Pausen von einigen Jahren.
Tags darauf – das heißt am vierten September – fand ein Ereignis statt, das einen tiefen Eindruck auf Roxana machte. Herr Driscoll vermißte abermals eine kleine Summe Geldes – womit angedeutet werden soll, daß das nichts Neues war, sondern sich schon mehrmals wiederholt hatte; es geschah bereits zum vierten Mal.
Driscoll verlor endlich die Geduld. Er war kein hartherziger Mann; Sklaven und andere Tiere behandelte er stets mit Milde, gegen irrende Brüder von seiner eigenen Rasse zeigte er sogar große Nachsicht. Aber Unredlichkeit verabscheute er, und offenbar war ein Dieb im Hause. Es konnte nur einer seiner Neger sein. Da galt es scharfe Maßregeln zu ergreifen. Er rief die Dienerschaft zusammen, welche außer Roxy noch aus drei Personen, einem Mann, einer Frau und einem zwölfjährigen Knaben bestand; verwandtschaftliche Beziehung hatten sie nicht zu einander.
»Ich habe euch alle schon mehrmals gewarnt, aber es ist umsonst gewesen. Diesmal will ich Ernst machen. Der Dieb wird verkauft. Wer von euch ist der Schuldige?«
Es schauderte ihnen bei dieser Drohung; hier waren sie gut aufgehoben, jeder Wechsel brachte höchst wahrscheinlich eine Verschlechterung. Alle leugneten standhaft. Niemand hatte etwas gestohlen – wenigstens kein Geld – vielleicht ein Stückchen Zucker oder Kuchen, einen Löffel Honig oder dergleichen, worauf es Massa Percy nicht weiter ankam – aber kein Geld – auch nicht einen Cent. Sie beteuerten es mit großer Zungengeläufigkeit, allein Herr Driscoll ließ sich nicht rühren. »Nenne den Dieb!« war alles, was er jedem mit strenger Stimme erwiderte.
Thatsächlich waren alle schuldig, außer Roxana, die zwar argwöhnte, daß die andern den Diebstahl begangen hatten, es aber nicht gewiß wußte. Ihr graute, wenn sie bedachte, wie nahe daran sie selbst gewesen war, das Geld zu nehmen; nur der Bußtag in der Methodistenkirche der Farbigen vor vierzehn Tagen hatte sie noch im letzten Augenblick davor behütet. Gerade am Tage nach diesem Gottesdienst, während sie noch ihrer Sündenvergebung eingedenk und stolz auf ihre Seelenreinheit war, hatte ihr Herr ein paar Dollars offen auf seinem Pult herumliegen lassen, und als sie mit dem Staubtuch dorthin kam, geriet sie in schwere Versuchung. Eine Weile sah sie das Geld mit steigendem Groll von der Seite an.
»O, der dumme Bußtag,« rief sie dann, »hätte man ihn doch bis morgen verschoben!«
Um dem Versucher nicht zu erliegen, deckte sie ein Buch darüber und der Mammon fiel einem der anderen Sklaven zu. Sie brachte dies Opfer, weil sie noch zu sehr unter dem Eindruck der religiösen Handlung stand. Als Beispiel für spätere Fälle sollte es durchaus nicht gelten; in ein bis zwei Wochen war sie wieder weltklug und nahm es weniger streng mit der Frömmigkeit, und wenn das nächste Mal ein paar Dollars so verlassen dalagen, würde sie sich gern ihrer erbarmen.
War sie denn schlecht von Natur oder überhaupt schlimmer als ihre Rasse im allgemeinen? Keineswegs. Die Farbigen befanden sich im Kampf ums Dasein in großem Nachteil gegenüber den weißen Brüdern und hielten es daher nicht für Sünde, ihre Bedrücker gelegentlich etwas auszuplündern – versteht sich nur in kleinem Maßstab; sie stahlen gewöhnlich nur unbedeutende Dinge. Eßwaren entwendeten sie aus der Speisekammer, so oft sie nur konnten, einen messingnen Fingerhut, eine Scheibe Wachs, einen Sack voll Schmirgel, ein Papier mit Nähnadeln, einen silbernen Löffel, einen Dollarschein, Bänder, allerlei Putz oder andere ziemlich wertlose Gegenstände, hielten sie für gute Beute. Sie fanden durchaus kein Unrecht darin, sich dergleichen anzueignen und gingen ohne die geringsten Gewissensbisse mit dem geraubten Gut in der Tasche zur Kirche, um dort voll aufrichtiger Frömmigkeit so laut zu singen und zu beten, wie sie nur konnten. Jede Räucherkammer auf dem Lande mußte fest verschlossen und verriegelt sein, denn selbst der farbige Diakonus verschmähte es nicht, einen Schinken mitzunehmen, wenn die Vorsehung ihm im Traume oder auf andere Weise kundthat, wo ein solcher leckerer Gegenstand einsam am Nagel hing und nach einem Freunde schmachtete. Hätten aber auch hundert Schinken dagehangen, der Diakonus würde nur einen genommen haben – das heißt, nicht zwei auf einmal. In kalten Nächten pflegte ein mitleidiger schwarzer Gauner den Hennen, die auf einem Baum Nachtruhe hielten, ein gewärmtes Brett unter die erstarrten Klauen zu schieben. Schläfrig setzte sich dann ein Huhn mit dankbarem Glucksen auf das behagliche Plätzchen, der Gauner aber steckte den Vogel unbekümmert in seinen Sack und verzehrte ihn später mit Vergnügen. Er war fest überzeugt, daß er dem weißen Manne, der ihm täglich ein unschätzbares Gut – seine Freiheit – raubte, ruhig diese Kleinigkeit entwenden dürfe, ohne damit eine Sünde zu begehen, die Gott ihm am Tage des Gerichts zurechnen werde.
»Nenne den Dieb!«
Driscoll hatte es schon zum vierten Mal mit rauher Stimme gerufen. Jetzt fügte er eine schreckliche Drohung hinzu:
»Ich gebe euch nocheineMinute Zeit« – er zog seine Uhr heraus. »Wenn ihr nach Ablauf derselben nicht gesteht, verkaufe ich euch alle vier – aber nicht hier am Ort, sondern nach Süden –flußabwärts.«
Das hieß so viel als zur Hölle verdammt werden, kein Missouri-Neger zweifelte daran. Roxy konnte sich kaum aufrecht halten, sie wurde leichenblaß; die andern fielen auf die Kniee wie vom Blitz getroffen, Thränen stürzten aus ihren Augen, sie hoben flehend die Hände empor, und alle drei riefen wie aus einem Munde:
»Ich hab’s gethan!«
»Ich hab’s gethan!«
»Ich hab’s gethan!« – »Gnade, Massa, Gnade! – Herrgott erbarme dich über uns arme Neger!«
Driscoll steckte seine Uhr ein. »Nun gut,« sagte er, »ich will euch hier verkaufen, obwohl ihr es nicht verdient. Von Rechts wegen sollte ich euch den Fluß hinunter schicken.«
Die Schuldigen warfen sich in überschwenglichem Dankgefühl vor ihm auf den Boden, küßten ihm die Füße und versicherten, sie würden seine Güte nun und nimmermehr vergessen und ihr Leben lang für ihn beten. Sie meinten das ganz aufrichtig, denn, hatte er nicht wie ein Gott seine mächtige Hand ausgereckt und die Pforten der Hölle vor ihnen verschlossen? – Er selbst wußte, daß er eine edle, hochherzige That vollbracht hatte und war innerlich stolz auf seine Großmut. Am Abend schrieb er den Vorfall in sein Tagebuch, damit sein Sohn ihn in späteren Jahren lesen könnte und durch sein Beispiel angetrieben würde, ebenfalls Güte und Menschlichkeit walten zu lassen.
Drittes Kapitel.
Inhaltsverzeichnis