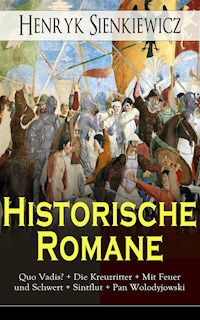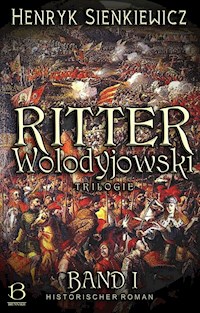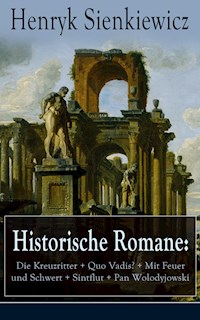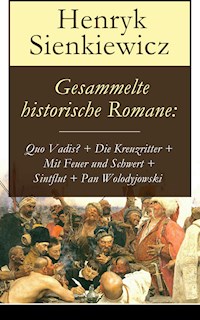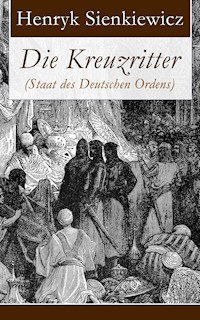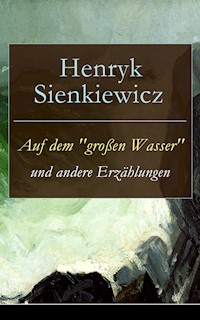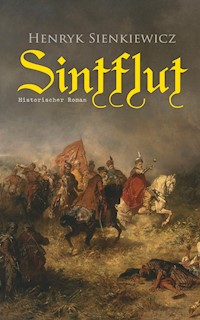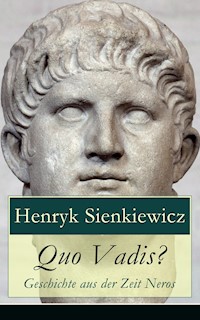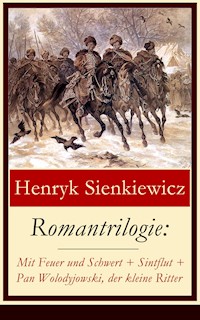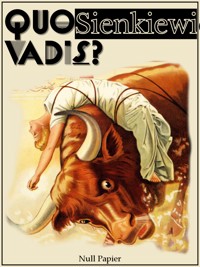
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
"Quo vadis? Wohin gehst Du?" fragt Petrus Jesus bei seiner Flucht aus Rom. Diese in den Petrusakten geschilderte letzte Begegnung inspirierte den polnischen Schriftsteller Henryk Sienkiewiczs zu seinem Roman, in dem er die Anfänge des Christentums in Rom zur Zeit Neros farbenprächtig und spannend schildert. Damit schuf er den ersten historischen Weltbestseller. Der Roman erzählt die Liebesgeschichte zwischen dem jungen Patrizier Marcus Vinicius und Lygia, einer Christin, die als Geisel nach Rom verschleppt wurde. Die Liebenden geraten in den Strudel der Ereignisse um die Christenverfolgungen unter der Regentschaft Neros. "Quo vadis" war bereits kurz nach seinem Erscheinen ein großer Erfolg und wurde mehrmals verfilmt. Am bekanntesten ist die Verfilmung von 1951 mit dem noch jungen Peter Ustinov in der Rolle des Neros. Sienkiewicz (1846-1916) erhielt 1905 den Nobelpreis für Literatur, "Quo vadis?" war ein wesentlicher Grund dafür. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis?
Henryk Sienkiewicz
Quo vadis?
(Quo vadis: Powie z czasów Nerona)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Paul Seliger EV: Reclam, Leipzig, 1920 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-98-2
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Epilog
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Zum Buch
»Quo vadis? Wohin gehst Du?« fragt Petrus Jesus bei seiner Flucht aus Rom.
Diese in den Petrusakten geschilderte letzte Begegnung inspirierte den polnischen Schriftsteller Henryk Sienkiewiczs zu seinem Roman, in dem er die Anfänge des Christentums in Rom zur Zeit Neros farbenprächtig und spannend schildert. Damit schuf er den ersten historischen Weltbestseller.
Der Roman erzählt die Liebesgeschichte zwischen dem jungen Patrizier Marcus Vinicius und Lygia, einer Christin, die als Geisel nach Rom verschleppt wurde. Die Liebenden geraten in den Strudel der Ereignisse um die Christenverfolgungen unter der Regentschaft Neros.
»Quo vadis« war bereits kurz nach seinem Erscheinen ein großer Erfolg und wurde mehrmals verfilmt. Am bekanntesten ist die Verfilmung von 1951 mit dem noch jungen Peter Ustinov in der Rolle des Neros.
Sienkiewicz (1846-1916) erhielt 1905 den Nobelpreis für Literatur, »Quo vadis?« war ein wesentlicher Grund dafür.
1
Petronius erwachte gegen Mittag, fühlte sich aber noch sehr ermattet, denn er hatte gestern ein Gastmahl bei Nero mitgemacht, das bis tief in die Nacht gewährt hatte. Jedoch das Frühbad und das sorgsame Kneten des Körpers durch eigens hiezu geübte Sklaven beschleunigten bald den Lauf seines trägen Blutes und ermunterten ihn, so daß er nach einiger Zeit aus der letzten Prozedur des Bades wie von den Toten auferstanden, mit glänzenden Augen, geistreichem Wesen und Frohsinn, verjüngt, voll Lebensgeist hervorging. Man nannte ihn ja auch mit Recht den Arbiter elegantiarum.1
Nach diesem Gastmahl, bei dem ihn die Narrenpossen des Vatinius und Nero, Lucanus und Seneka gelangweilt und er auch an der gelehrten Abhandlung, ob auch die Frau eine Seele habe, sich beteiligt hatte -- stand er spät auf und nahm, wie gewöhnlich, ein Bad. Zwei riesige Badediener betteten ihn auf ein mit schneeweißem ägyptischen Byssus bedecktes Lager von Zypressenholz und begannen mit ihren in wohlriechendes Olivenöl getauchten Händen den wohlgestalteten Körper einzureiben -- er aber wartete mit geschlossenen Augen, bis die Wärme des Schwitzbades und die Wärme ihrer Hände auf ihn wirkte und die Mattigkeit verscheuchte.
Plötzlich rief der Sklave, der die Namen der ankommenden Gäste melden mußte, durch den Vorhang, daß der junge Marcus Vinicius soeben aus Kleinasien zurückgekehrt und zum Besuch eingetroffen sei. Petronius befahl, den Gast sofort hereinzulassen. Vinicius war der Sohn von Petronius’ älterer Schwester, die vor Jahren mit Marcus Vinicius, der unter Tiberius die Würde eines Konsularis bekleidete, sich vermählt hatte. Der junge Marcus diente gegenwärtig unter Corbulo gegen die Parther und war nach beendetem Feldzug in die Stadt zurückgekehrt. Petronius hatte für ihn jene Schwäche, die an Anhänglichkeit grenzt, denn Marcus war ein schöner, athletischer Jüngling, der zugleich feine Umgangsformen besaß, was Petronius über alles schätzte.
»Gruß dem Petronius«, sagte der junge Mann, elastischen Schrittes eintretend, »mögen dir die Götter gewogen sein!«
»Sei gegrüßt in Rom, und die Ruhe sei dir süß nach dem Kampfe«, versetzte Petronius, die Hand aus den Falten des weichen Gewebes, das ihn umhüllte, herausstreckend. -- »Was hört man in Armenien? Kamst du auch während deines Aufenthalts in Asien nach Bithynien?«
Petronius war einst in Bithynien Statthalter gewesen und hatte sein Amt mit Umsicht und Gerechtigkeit verwaltet. Sein Charakter war aus den widersprechendsten Eigenschaften zusammengesetzt, und da er allgemein für sehr verweichlicht und prunkliebend galt, erinnerte er sich gern jener Zeiten, weil sie den Beweis dafür erbrachten, daß er auch tätig und energisch sein konnte, wenn es ihm beliebte.
»Ich kam unter anderem auch nach Herakleia«, entgegnete Vinicius. »Corbulo sandte mich dorthin, Verstärkungen zusammenzuziehen.«
»Erzähle mir, was man von den parthischen Grenzen hört! Mich langweilen sie zwar alle, diese barbarischen Völker, die in ihrer Heimat, wie der junge Arulamus erzählt, noch auf allen Vieren kriechen und nur uns gegenüber sich für Menschen ausgeben. Jetzt sind sie ein beliebter Gesprächsstoff in Rom, schon deshalb, weil es gefährlich ist, von anderen Dingen zu sprechen.«
»Dieser Krieg steht schlecht, und wenn Corbulo nicht wäre, könnte man sich auf eine völlige Niederlage gefaßt machen.«
»Corbulo! Beim Bacchus! Der reine Kriegsgott! Ein gewaltiger Heerführer, und zugleich feurig und rechtlich und einfältig. Ich habe ihn schon deshalb gern, weil Nero ihn fürchtet.«
In diesem Augenblick traten zwei Sklaven ein, welche sich um Petronius bemühten und ihm die Härchen der Arme und Hände herauszogen, während Marcus das Unterkleid abwarf und auf die Aufforderung des Petronius hin in ein lauwarmes Bad stieg.
Petronius schaute auf den Jüngling mit dem befriedigten Auge eines Künstlers.
Als Marcus fertig war und sich seinerseits den Haarauszupfern überließ, trat ein Vorleser ein, der eine Bronzebüchse umgehängt trug, in der eine Papyrusrolle steckte.
»Willst du zuhören?« fragte Petronius.
»Wenn es dein eigenes Werk ist, gern!« versetzte Vinicius. »Wenn nicht, möchte ich mich lieber mit dir unterhalten. Heutzutage fangen die Dichter ihre Zuhörer an allen Straßenecken ab.« »Und ob! Man kommt an keiner Basilika, weder bei den Thermen noch bei einer Bibliothek oder einem Buchladen vorbei, ohne auf einen Dichter zu stoßen, der sich wie ein Affe gebärdet. Als Agrippa aus dem Osten hieherkam, hielt er diese Leute für Besessene. Aber das liegt jetzt so in der Zeit. Wenn der Kaiser Verse schreibt, müssen natürlich alle seinem Beispiel folgen. Nur bessere Verse darf niemand schreiben als der Kaiser, und deshalb schreibe ich nur Prosa, womit ich aber weder mich selbst noch andere behellige. Nein, das, was der Vorleser vortragen soll, ist ein Buch des Fabricius Veiento, das jetzt überall leidenschaftlich gelesen wird, weil es unendlich viel Klatsch und Skandal enthält. Es sucht jedermann in dem Buche sich selbst mit Besorgnis, Bekannte aber mit stillem Vergnügen. In dem Buchladen des Arvinus wird das Buch von hundert Schreibern nach einer Vorlage geschrieben, und der Erfolg ist sicher.«
»Deine Streiche sind dort nicht zu haben?«
»O doch, aber der Verfasser ist fehlgegangen, denn ich bin viel schlechter und weniger fade, als er mich dort schildert. Siehst du, wir haben hier schon längst das Gefühl für das Würdige und Unwürdige verloren, mir geht es selbst so, obwohl Seneka, Musonius und Traseas es zu erkennen glauben. Mir ist auch alles gleichgültig, über Herkules rede ich, was ich denke. Aber dennoch habe ich den Vorzug vor andern, daß ich weiß, was häßlich und was schön ist; dies versteht zum Beispiel unser kupferbärtiger Dichter,2 dieser Fuhrmann, dieser Gassensänger, dieser Tänzer, nicht.«
»Dennoch tut es mir um Fabricius leid! Er war ein guter Gesellschafter.«
»Seine Eigenliebe hat ihn verdorben. Jeder mißtraute ihm, niemand wußte etwas Rechtes, aber er selbst konnte nichts behalten und erzählte alles nach allen Richtungen hin unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Hörtest du schon die Geschichte des Rufinus?«
»Nein.«
»So gehen wir hinüber ins Frigidarium.3 Während wir uns abkühlen, erzähle ich dir die Geschichte.«
Beide begaben sich in den Baderaum, in dessen Mitte ein Springbrunnen in hellrosa Farben sprudelte und einen Veilchenduft verbreitete. Dort setzten sie sich in Nischen, die mit Seide ausgepolstert waren, und genossen die Kühle. Es herrschte einen Augenblick Stille.
»Du liebst den Krieg«, begann Petronius, »was ich von mir nicht sagen kann, denn unter den Zelten werden die Fingernägel brüchig und verlieren ihre rosige Färbung. Übrigens hat jeder seine Liebhaberei, so wie der Kupferbärtige den Gesang liebt, besonders seinen eigenen. Übrigens, sage mir, schreibst du auch Verse?«
»Nein. Ich habe noch niemals einen Hexameter fertiggebracht.«
»Spielst du die Laute und singst dazu?«
»Nein.«
»So bist du vielleicht Meister im Wagenlenken?«
»Seinerzeit habe ich mich an den Wettfahrten in Antiochia beteiligt, aber ohne Erfolg.«
»Dann bin ich deinetwegen beruhigt. Zu welcher Partei gehörst du auf der Rennbahn?«
»Zu den Grünen.«
»Dann bin ich völlig beruhigt, besonders da du zwar ein hübsches Vermögen besitzest, aber doch nicht so reich bist wie Pallas und Seneka. Du mußt wissen, daß es bei uns von Vorteil ist, wenn einer dichtet, zur Laute singt, deklamiert und sich im Zirkus an den Wettfahrten beteiligt, besser aber ist es und vor allem ungefährlicher, wenn einer nicht dichtet, nicht die Laute schlägt, nicht singt und nicht an den Wettfahrten im Zirkus teilnimmt, am besten aber ist es, wenn man alles anzustaunen versteht, was der Feuerbart tut. Du bist ein hübscher junger Mann und daher der Gefahr ausgesetzt, daß Poppäa dich liebgewinnt. Doch nein -- sie ist darin schon zu erfahren. Sie hat an der Seite ihrer beiden ersten Gatten genug Liebe genossen, und jetzt als Neros Gemahlin denkt sie an ganz andere Dinge.«
»Du wolltest mir ja die Geschichte des armen Rufinus erzählen.«
»Im Salbraum sollst du sie hören.«
Aber im Salbraum wurde die Aufmerksamkeit des Vinicius schnell auf etwas anderes gelenkt, nämlich auf die ungewöhnlich schönen Sklavinnen, die auf die Männer warteten und sich anschickten, ihren Leib mit köstlichen arabischen Salben einzureiben.
»Beim wolkentürmenden Zeus«, rief Marcus Vinicius. »Schönere Sklavinnen kann auch der Feuerbart nicht besitzen.« Mit einer freundschaftlichen Gutmütigkeit sagte Petronius: »Du bist ja mein Blutsverwandter, und ich bin weder so ungefällig wie Bassus noch so ein Kleinigkeitskrämer wie Aulus Plautius.« Als Vinicius diesen letzten Namen hörte, hob er rasch das Haupt und fragte: »Wie kommst du jetzt auf Aulus Plautius? Weißt du, daß ich etliche Tage in seinem Hause zubrachte, als ich mir vor der Stadt den Arm verstauchte? Zufällig kam gerade Plautius des Weges gefahren, als mir der Unfall zustieß, und weil er mich leidend sah, nahm er mich zu sich, wo mich sein Sklave, der Arzt Merion, behandelte und ich bald gesundete. Gerade davon wollte ich mit dir sprechen.«
»Warum? Hast du dich gar in Pomponia verliebt? In diesem Falle müßte ich dich bedauern: nicht mehr jung, dagegen tugendhaft! Eine schlimmere Vereinigung könnte ich mir gar nicht vorstellen.«
»In Pomponia nicht -- nein!« sagte Vinicius.
»In wen denn?«
»Ja, wenn ich’s nur selber wüßte, in wen! Ich weiß auch nicht einmal genau, wie sie heißt: Lygia oder Callina. Im Hause wird sie Lygia genannt, weil sie dem Lygiervolke entstammt, sie hat aber auch noch ihren Babarennamen Callina. Es ist dies ein merkwürdiges Haus, dieses Haus des Plautius. Mehrere Tage hindurch ahnte ich nicht, welch göttliches Wesen es bewahrt, bis ich es eines Morgens vor Sonnenaufgang erblickte, als es sich an dem Gartenbrunnen wusch. Von dieser Zeit an sah ich sie noch zweimal, und seither weiß ich nicht mehr, was Ruhe ist; ich habe keine andere Sehnsucht mehr; nichts, was die Stadt mir bieten könnte, kann mich locken; ich begehre weder Gold noch korinthisches Erz, weder Bernstein noch Perlen, noch Wein und Festgelage, nur Lygia will ich. Ich sage dir offen, Petronius, ich sehne mich nach ihr Tag und Nacht.«
»Wenn sie eine Sklavin ist, so kaufe sie doch!«
»Sie ist keine Sklavin.«
»Was ist sie denn? Eine Freigelassene des Plautius?«
»Ich weiß es nicht; eine Königstochter oder etwas Ähnliches.« »Du machst mich sehr neugierig, Vinicius.«
»Wenn du mich nun anhören willst, werde ich gleich deine Neugierde befriedigen. Die Geschichte ist nicht sehr lang. Du kanntest vielleicht gar persönlich den König der Sueven, Vannius, der, aus seinem Reiche vertrieben, sich lange Zeit in Rom aufhielt. Kaiser Drusus brachte ihn wieder auf seinen Thron. Vannius war ein tüchtiger Mann, regierte anfangs gut und führte glückliche Kriege, später fing er jedoch an, nicht nur die Nachbarn, sondern auch seine eigenen Untertanen zu schinden. Um diese Zeit beschlossen Vangio und Sido, Söhne des Vibilius, Königs der Hermunduren, ihren Onkel Vannius zu zwingen, wieder nach Rom zu flüchten.«
»Ganz recht, ich erinnere mich, es ist ja noch gar nicht so lange her, es war zu Claudius’ Zeiten.«
»Nun brach der Krieg aus. Vannius rief die Jazygen zu Hilfe, seine beiden Schwiegersöhne dagegen die Lygier, welche von den Reichtümern des Vannius gehört hatten und, herbeigelockt in der Hoffnung auf reiche Beute, in so großer Anzahl kamen, daß selbst der Kaiser Claudius für die Ruhe seiner Grenzen fürchtete. Claudius wollte sich in einen Krieg mit den Barbaren nicht einmischen und schrieb an Atelius Hister, den Führer der Donaulegionen, daß er ein wachsames Auge auf den Verlauf des Krieges richte und über den Frieden jener Gegenden wache. Hister verlangte nun von den Lygiern, daß sie sich verpflichten, die Grenzen nicht zu überschreiten; dies wurde nicht nur bereitwillig zugesagt, sondern auch Geiseln gestellt, unter denen sich die Frau und Tochter ihres Heerführers befanden... also ist meine Lygia die Tochter jenes Heerführers.«
»Woher weißt du das alles?«
»Dies erzählte mir alles Aulus Plautius selbst. Die Lygier haben zwar nicht die Grenzen überschritten; aber die Barbaren kommen wie ein Unwetter und verschwinden ebenso; so verschwanden auch sie samt ihren Auerochshörnern, die sie auf den Köpfen trugen. Sie schlugen den Vannius und seine Verbündeten, jedoch fiel ihr König, und sie machten sich mit dem Raube davon und ließen die Geiseln in den Händen des Hister. Kurz darauf starb die Mutter, und das Kind sandte Hister an Pomponius, der damals Statthalter von Germanien war. Pomponius kehrte nach Beendigung des Krieges mit den Chatten nach Rom im Triumph zurück. Die Jungfrau ging hinter dem Triumphwagen des Siegers. Nach beendeter Einzugsfeier wußte Pomponius selbst nicht, was er mit der Geisel, die er nicht gut als Gefangene behandeln konnte, anfangen sollte, und schenkte sie seiner Schwester Pomponia Graecina, der Frau des Plautius. In diesem Hause, wo alles -- vom Herrn angefangen bis zum Federvieh -- tugendhaft ist, wuchs sie heran und ist ebenso tugendhaft wie Graecina selbst und so schön, daß selbst Poppäa neben ihr wie eine herbstliche Feige neben einem Hesperidenapfel sich ausnehmen müßte.«
»Und nach dieser Jungfrau sehnst du dich?«
»Ja, ich will Lygia haben. Ich will sie mit meinen Armen umschlingen und an meine Brust drücken und ihren Atem fühlen. Ich will sie in meinem Hause haben, immerzu, bis mein Haupt weiß ist wie der Gipfel des Soracte im Winter.«
»Sie ist keine Sklavin, gehört aber schließlich doch zur Familie des Plautius und wird wohl, da sie eine verlassene Waise ist, als Pflegling betrachtet werden müssen. Plautius könnte sie dir abtreten, wenn er wollte.«
»Da kennst du aber Pomponia Graecina nicht. Schließlich haben sich beide an sie gewöhnt, als wäre Lygia ihr eigenes Kind.«
»Ob ich Pomponia kenne! Die reinste Zypresse! Wäre sie nicht des Aulus Ehefrau, könnte man sie als Klageweib verdingen. Auch Aulus Plautius kenne ich, und ich glaube, daß er eine gewisse Schwäche für mich hat, obwohl er mit meiner Lebensweise nicht einverstanden ist. Sicher schätzt er mich höher als all die andern, wie zum Beispiel Domitius Afer, Tigellinus und den übrigen Freundestroß Feuerbarts, da ich mich niemals zum Angeber hergegeben habe. Neros Ausführung hat schon oft mein Mißfallen erregt, wenn Seneka und Burrhus noch durch die Finger sahen. Glaubst du, daß ich beim Plautius etwas für dich erreichen könnte, so stehe ich dir zu Diensten.«
»Ich glaube, daß du es kannst. Du hast Einfluß auf ihn und besitzest großen Scharfsinn. Wenn du mit Plautius sprechen wolltest...«
»Du hast zwar eine große Meinung von meinem Einfluß und meiner Klugheit, und wenn es sich um sonst nichts handelt, so will ich mit Plautius reden, sobald er in die Stadt übergesiedelt ist.« »Sie sind schon seit zwei Tagen hier.«
»So wollen wir in das Triklinium gehen, wo das Frühstück unser harrt, und dann lassen wir uns neugestärkt zu Plautius tragen.« »Du warst mir immer lieb«, rief Vinicius lebhaft, »jetzt aber möchte ich am liebsten hier in diesem Raume deine Bildsäule aufstellen -- so schön wie diese hier -- und ihr Opfer darbringen.« So sprechend wandte er sich den Statuen zu, welche eine Seitenwand der duftdurchschwängerten Lichthalle zierten, und wies mit der Hand auf eine Bildsäule des Petronius, die ihn als Hermes mit einem goldenen Stab in der Hand darstellte.
Dann sagte er weiter: »Beim Lichte des Helios, wenn der göttliche Alexander dir ähnlich gewesen ist, dann kann man sich über Helena nicht wundern.«
Dieser Ausruf enthielt ebensoviel Wahrheit als Schmeichelei, denn Petronius, wenn auch älter und minder athletisch gebaut, war noch schöner als Vinicius. Die Frauen in Rom bewunderten an ihm nicht nur die geistige Gewandtheit und den seinen Geschmack, der ihm den Beinamen Arbiter elegantiarum eingebracht hatte, sondern auch die Wohlgestalt seiner Erscheinung. Tiefe Bewunderung drückte sich auf den Gesichtern der Mädchen aus Kos aus, welche jetzt die Falten seiner Toga ordneten, von denen besonders eine, Eunike mit Namen, ihm voll Demut und Entzücken in die Augen schaute; liebte sie ihn doch insgeheim.
Er achtete jedoch nicht darauf sondern lächelte Vinicius zu. Dann schlang er seinen Arm um seinen Nacken und führte ihn in den Speisesaal.
Im Unctuarium blieb nur Eunike zurück, hob den mit Bernstein und Elfenbein kunstvoll eingelegten Stuhl, auf welchem Petronius gesessen, und rückte ihn vorsichtig bis zu dessen Bildsäule. Sie bestieg den Stuhl, und als sie in gleicher Höhe mit der Bildsäule war, schlang sie plötzlich die Arme um den Hals, dann warf sie ihr Goldhaar zurück, schmiegte ihren rosigen Leib an den weißen Marmor und preßte voll Leidenschaft ihren Mund auf die kalten Lippen des Petronius.
Schiedsrichter des feinen Geschmacks <<<
Kaiser Nero; auch Rotbart, Feuerbart wurde er spottweise genannt <<<
Kaltwasserbad <<<
2
Nach dem Frühstück schlug Petronius einen kleinen Schlummer vor. Seiner Ansicht nach war es noch zu früh, um Besuche zu machen. Am geeignetsten erschienen ihm dazu die Nachmittagsstunden, aber nicht eher, als bis die Sonne den Tempel des Kapitolinischen Zeus überstiegen hatte und die Strahlen schräg auf das Forum fielen. Inzwischen könnten sie, meinte er, ruhig ein Schläfchen machen. Es sei so angenehm, im Atrium dem Geplätscher des Brunnens zu lauschen und nach den üblichen tausend Schritten in dem rötlichen Lichte, welches durch den purpurnen, halbzugezogenen Vorhang drang, vor sich hinzuträumen.
Vinicius gab Petronius recht, und sie begannen auf und ab zu schreiten, über die neuesten Vorkommnisse in der Stadt und auf dem Palatinus plaudernd oder auch philosophische Bemerkungen austauschend. Hierauf begab sich Petronius in das Schlafzimmer, schlief jedoch nicht lange. Schon nach einer halben Stunde kam er wieder zum Vorschein, ließ sich Verbenaöl bringen und rieb sich damit Hände und Schläfen ein.
»Du glaubst nicht, wie sehr das belebt und erfrischt«, bemerkte er. »So, jetzt bin ich fertig.«
Die Sänfte stand schon längst bereit; sie stiegen ein und ließen sich nach dem Vicus Patricius, ins Haus des Aulus, tragen. Das Haus des Petronius lag an dem südlichen Abhang des Palatinus, unfern des von den reichsten Leuten bewohnten Stadtteils Carinae. Der kürzeste Weg dahin führte unterhalb des Forums, aber Petronius wollte noch beim Juwelier Idomen vorsprechen und befahl, über den Vicus Apollinis und über das Forum gegen den Vicus Sceleratus zu gehen, an dessen Ecke sich die mannigfachsten Verkaufsläden befanden.
Riesige Mohren hoben die Sänfte und setzten sich in Bewegung, voraus gingen Sklaven, pedisequi genannt. Petronius hielt die nach Verbenaöl duftenden Finger vor die Nasenlöcher und schien nachzusinnen, dann sagte er: »Es fällt mir eben ein, daß deine Waldnymphe, wenn sie keine Sklavin ist, das Haus des Plautius verlassen und in das deine übersiedeln könnte. Du müßtest sie natürlich mit Liebesbeweisen, mit Reichtümern überhäufen, wie ich meine vergötterte Chrysotemis, die ich, unter uns gesagt, mindestens schon ebenso satt habe wie sie mich.«
Marcus schüttelte das Haupt.
»Also nicht?« fragte Petronius. »Du würdest bei dieser Angelegenheit schlimmstenfalls eine Stütze am Kaiser finden, und du kannst versichert sein, daß unser Feuerbart, infolge meines Einflusses, auf deiner Seite wäre.«
»Du kennst Lygia nicht!« versetzte Vinicius.
»So gestatte mir die Frage: Kennst du sie anders als vom Sehen? Hast du mit ihr gesprochen? Hast du ihr deine Liebe gestanden?«
»Ich sah sie zuerst am Springbrunnen, und dann traf ich nur zweimal mit ihr zusammen. Du mußt wissen, daß ich während meines Aufenthaltes auf dem Landsitze des Aulus in einer Seitenvilla wohnte, welche für Gäste bestimmt ist, und da ich den Arm verstaucht hatte, konnte ich an den gemeinschaftlichen Mahlzeiten nicht teilnehmen. Erst am Vorabend meines Weggangs traf ich Lygia bei der Mahlzeit, konnte jedoch kein Wort mit ihr sprechen. Ich mußte anhören, was mir Aulus von seinen in Britannien erfochtenen Siegen erzählte und dann von dem Niedergang der kleinen Leute in Italien, welchem zu steuern sich Licinius Stolo bemühte. Dann sah ich Lygia wieder bei der Zisterne im Garten; sie hielt ein eben ausgerissenes Schilfrohr in der Hand, dessen Kolben sie ins Wasser tauchte, um die im Umkreise wachsenden Irisblumen damit zu besprengen. Beim Schilde des Herakles, ich sage dir, meine Knie zitterten nicht, als die heulenden Parther wie ein finsteres Gewölk auf unsere Schlachtreihen losstürmten, aber sie zitterten bei jener Zisterne. Verwirrt wie ein Knabe flehte ich nur mit den Augen um Erbarmen. Lange vermochte ich kein Wort hervorzubringen.«
Petronius warf dem jungen Mann einen Blick zu, in dem etwas wie Neid lag. »Du Glücklicher!« rief er aus. »Welt und Leben mögen schlecht sein wie sie wollen, eines in ihnen bleibt doch ewig gut: die Jugend!« Nach einer Weile fragte er wieder: »Und du hast sie nicht angesprochen?«
»O doch! Ich rang nach Fassung, und als ich wieder zur Besinnung gekommen war, sprach ich mit ihr. Aus Asien, sagte ich ihr, sei ich zurückgekehrt und habe mir ganz nahe vor der Stadt den Arm verstaucht. Große Schmerzen habe ich erdulden müssen; da aber die Zeit gekommen sei, dieses gastliche Haus verlassen zu sollen, sei ich zu der Einsicht gekommen, daß es besser sei, hier zu leiden, als anderswo zu genießen. Sie hörte mich an, gleichfalls verwirrt, mit gesenktem Köpfchen, während sie mit dem Schilf etwas in den safrangelben Sand zeichnete. Dann blickte sie flüchtig empor, ließ ihre Augen von den gemachten Zeichen zu mir schweifen, als wollte sie etwas fragen -- und entfloh dann plötzlich.«
»Sie muß schöne Augen haben.«
»Wie das Meer -- ich versenkte mich in sie wie in ein Meer. Nach wenigen Augenblicken kam der kleine Plautius auf mich zu und wollte etwas fragen. Ich aber verstand nicht, um was es sich handelte.«
»O du Frühlingsknöspchen am Baume des Lebens! Du erstes, grünes Ästchen an der Weinranke! Ich sollte dich eigentlich statt zum Plautius in das Haus des Gelocius bringen lassen, wo eine Schule für lebensunkundige Knaben ist.«
»Ja, was willst du denn eigentlich?«
»Und was schrieb sie denn in den Sand? War es vielleicht ein von einem Pfeile durchbohrtes Herz oder ähnliches? Wie konntest du solche Zeichen unbeachtet lassen!«
»Länger trage ich die Toga, als du glaubst, und ehe noch der kleine Plautius dazukam, hatte ich die Zeichen längst geprüft. Ich wußte auch, daß die griechischen und römischen Jungfrauen oft ein Geständnis in den Sand graben, das sie nicht aussprechen wollen... Aber errate, was sie zeichnete!«
»Wenn es etwas anderes ist, als ich vermute, so rate ich nicht.«
»Einen Fisch!«1
»Wie sagst du?«
»Einen Fisch, sagte ich. Sollte dies vielleicht bedeuten, daß in ihren Adern bisher noch kaltes Blut fließt? Ich weiß es nicht. Du aber, der du mich eine Frühlingsknospe am Baume des Lebens nanntest, wirst dieses Zeichen gewiß besser verstehen.«
»O Teuerster! Über solche Dinge frage Plitius. Er ist Kenner von Fischen. Würde der alte Apicius noch leben, der könnte dir ebenfalls noch etwas erzählen. Dieser hat in seinem Leben mehr Fische gegessen, als ihrer mit einem Male in der Bucht von Neapel Platz haben.«
Das weitere Gespräch ward unterbrochen, denn sie kamen jetzt in belebte Straßen, wo der Menschenlärm es übertönt hätte. Bei dem Vicus Apollinis wendeten sie sich nach dem Boarium und dann nach dem Forum Romanum, wo an schönen Tagen vor Sonnenuntergang sich eine dichte Volksmenge zu versammeln pflegte. Die Leute strömten durch die Säulenhalle, um Neuigkeiten auszutauschen, sie betrachteten die Sänften vornehmer Persönlichkeiten, die vorüber getragen wurden, oder sie drängten sich vor den Gewölben der Händler zusammen. Die eine Hälfte des Forums, die dicht unter den hervorspringenden Felsen des Kastells lag, war schon in Schatten getaucht, während die Säulen der höher gelegenen Tempel in goldenem und bläulichem Schimmer erglänzten. Die tieferstehenden warfen lange Schatten auf die Marmorplatten. Das Forum war derart mit Säulen bebaut, daß das Auge sich darin wie in einem Walde verlor. Häuser und Säulen schienen zusammengehäuft, sie türmten sich übereinander; sie strebten teils der Höhe zu, teils klebten sie an der Felswand des Kapitols.
Von den breiten Stufen des »dem höchsten Gotte« geweihten Tempels kam ein neuer Menschenstrom. Auf den Rednerbühnen ließen sich verschiedene Redner hören. Hie und da ertönten Rufe der Verkäufer, die Früchte, Wein oder mit Feigensaft gemischtes Wasser feilboten, von Quacksalbern, die wunderbare Heilmittel anpriesen, von Wahrsagern, die verborgene Schätze zu entdecken versprachen, und von Traumdeutern. Da und dort hörte man Töne einer ägyptischen Sistra, einer Sambuke oder einer griechischen Flöte; durch den ohrenbetäubenden Tumult sah man Kranke, Fromme, Betrübte, die Opfergaben nach den Tempeln trugen; Taubenschwärme flogen über die Köpfe der Menge und ließen sich auf einem freien Plätzchen des Marktes nieder, gierig die Körner aufpickend, die man ihnen hinwarf, um gleich wieder aufzufliegen, wenn jemand kam. Zwischen den zahlreichen Gruppen drängten sich zeitweise Abteilungen von Soldaten und Wachen durch, welche für Straßenordnung zu sorgen hatten. Die griechische Sprache hörte man überall ebenso oft wie die lateinische, und jede andere Sprache wurde geduldet.
Vinicius, der lange nicht in der Stadt gewesen war, betrachtete mit einer gewissen Neugierde den Menschenschwarm und das Forum Romanum, das die Welt beherrschte, aber zugleich ganz überflutet schien von Menschen fremder Abstammung und Sprache. In der Tat verschwand das heimische Element fast in dieser Masse, die aus den verschiedenartigsten Rassen und Nationen zusammengesetzt war. Man sah hier Äthiopier und blonde Riesen aus dem fernen Norden, Britannier, Gallier und Germanen; man sah Mongolen mit ihren geschlitzten, schiefstehenden Augen, Leute vom Euphrat, Männer vom Indus mit ziegelrot gefärbten Bärten, Syrer von den Ufern des Orontes mit schwarzen, sanftblickenden Augen; knochendürre Wüstenbewohner Arabiens, Juden mit eingefallenem Brustkorb, Ägypter mit dem ewig gleichgültigen Lächeln auf den Gesichtern, Numidier und Afrikaner; Griechen aus Hellas, welche gleich den Römern über die Stadt herrschten, die aber wegen ihres Wissens, ihrer Kunst, ihres Verstandes und ihrer Verschlagenheit zu solcher Macht gekommen waren, Griechen von den kleinasiatischen Inseln, aus Ägypten, aus Italien und dem narbonnensischen Gallien. Bei der großen Schar von Sklaven mit durchlöcherten Ohren mangelte es auch nicht an freigelassenen, müßigen Leuten, welche der Kaiser unterhielt, nährte, sogar kleidete. Es fehlte auch nicht an Schacherern und Priestern der Isis, auf deren Altar mehr Opfer dargebracht wurden als in dem Heiligtum des Zeus auf dem Kapitol -- es mangelte nicht an Priestern der Kybel, die goldene Maisähren in der Hand trugen, an Priestern der Wandergötter, an morgenländischen Tänzerinnen, die grellfarbige Mitra auf dem Haupt, an Amulettenhändlern, an Schlangenbändigern und chaldäischen Magiern, endlich an Leuten ohne irgendwelche Beschäftigung, die sich jede Woche in den diesseits des Tiber gelegenen Getreidespeichern meldeten, sich um Lotterielose in den Zirkussen schlugen, die Nächte in den jeden Augenblick mit Einsturz drohenden Häusern des jenseits des Tiber gelegenen Stadtteils verbrachten, die sonnigen und wärmeren Tage aber in den Kryptoportiken, in den schmutzigen Garküchen der Vorstädte oder vor den Häusern der Reichen, von wo ihnen zuweilen die Reste vom Tische der Sklaven zugeworfen wurden.
Petronius war bei der Menge wohlbekannt. An Vinicius’ Ohr drang fortwährend der Ruf: Das ist er! Das ist er! Man liebte ihn wegen seiner Freigebigkeit, und seine Popularität hatte sich noch gesteigert, als man erfuhr, daß er sich vor dem Kaiser gegen das Todesurteil ausgesprochen hatte, welches über die ganze Familia2 des Präfekten Pedanius Secundus, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts, verhängt worden war, weil einer von ihnen in einem Anfall von Verzweiflung den Tyrannen getötet hatte. Petronius erklärte zwar öffentlich, daß ihm die Sache höchst gleichgültig sei und er sich nur in seiner Eigenschaft als Arbiter elegantiarum dagegen ausgesprochen habe, weil sich sein ästhetisches Gefühl durch das barbarische Urteil beleidigt fühle, das vielleicht roher Skythen, niemals aber römischer Männer würdig sei. Das über dieses Blutbad aufgeregte Volk liebte Petronius seit dieser Zeit trotzdem.
Aber er achtete nicht darauf, denn er erinnerte sich, daß dieses Volk auch den Britannicus geliebt, welchen Nero vergiften, und Agrippina, welche er ermorden ließ, und Octavia, die man erwürgte, nachdem man ihr vorher im heißen Dampfbade die Adern geöffnet, Rubelius Plautius, der ausgewiesen wurde, und Traseas, dem schon der morgige Tag das Todesurteil bringen konnte. Die Liebe des Volkes konnte eigentlich als schlechte Vorbedeutung gelten, und der skeptische Petronius war abergläubisch. Zudem verachtete er die Menge als Aristokrat und als Ästhetiker. Diese Leute, die in dem bauschigen Teil ihres Gewands geröstete Bohnen bei sich trugen, nach denen sie rochen, diese Leute, die fortwährend heiser und schweißtriefend waren durch das Moraspiel3 an den Straßenecken und in den Säulengängen, verdienten in seinen Augen nicht Menschen genannt zu werden.
Ohne daher die Beifallsrufe und Kußhände, die ihm da und dort zugeworfen wurden, zu beachten, erzählte er dem Marcus die Geschichte des Petanius und spottete über die Wandelbarkeit des Straßenpöbels, der am Tage nach einem drohenden Aufruhr dem Nero auf seiner Fahrt zum Tempel des Jupiter Stator zugejubelt hatte.
Vor dem Buchladen des Arvinus ließ Petronius halten und kaufte ein zierliches Manuskript, welches er Vinicius überreichte. »Ein Geschenk für dich«, erklärte er.
»Danke dir!« versetzte Vinicius, und mit einem Blick auf den Titel bemerkte er fragend:
»Satirikon? Das ist etwas Neues. Von wem denn?«
»Von mir, doch will ich nicht in die Fußstapfen des Rufinus treten, dessen Geschichte ich dir erzählen wollte, noch in die des Fabricius Veiento, ich bitte dich also, mich nicht zu verraten, denn kein Mensch weiß davon.«
»Aber du sagtest doch, du schriebest keine Verse?« fragte Vinicius, einen Blick in das Manuskript werfend. »Hier aber finde ich die Prosa stark mit Versen durchflochten.«
»Wenn du es lesen wirst, richte deine Aufmerksamkeit vor allem auf das Gastmahl des Trimalchion. Was die Verse anlangt, so sind sie mir von dem Augenblick an verleidet, seit Nero ein Epos schrieb. Aber ich wollte dir ja die Geschichte des Rufinus erzählen, um dir zu zeigen, was Autoreneitelkeit ist.«
Doch ehe er noch begonnen hatte, bogen sie in den Vicus Patricius ein und befanden sich gleich darauf vor der Behausung des Aulus. Ein junger, kräftiger Türhüter öffnete ihnen die Tür, über der eine in einem Käfig eingeschlossene Elster in einem Bauer hing, die die Angekommenen mit einem lauten »Salve!« begrüßte.
Auf dem Wege aus der zweiten Vorhalle in das Atrium sagte Vinicius: »Hast du bemerkt, daß der Türhüter hier keine Ketten trägt?«
»Ein merkwürdiges Haus«, versetzte halblaut Petronius. »Es ist dir gewiß bekannt, daß Pomponia Graecina im Verdachte steht, Bekennerin eines Aberglaubens zu sein, der aus dem Osten kommt und auf der Verehrung eines gewissen ›Christos‹ beruht. Crispinilla ist die Urheberin dieses Verdachts gegen Pomponia. Jene kann es ihr nicht verzeihen, daß sie sich mit einem Manne für ihr ganzes Leben begnügte. Eine Schüssel eßbarer Pilze aus Noricum dürfte heutzutage leichter zu haben sein, als eine zweite derartige Frau zu finden. Man hat sogar Hausgericht über sie abgehalten...«
»Du hast recht, es ist ein merkwürdiges Haus. Später erzähle ich dir noch, was ich gesehen und gehört habe.«
So sprechend waren sie im Atrium angelangt. Der die Aufsicht darüber führende Sklave, der Atriensis, sandte den Nomenklator weg, um die Gäste anzumelden, während die andern Diener Sessel und Fußschemel für sie zurechtstellten. Petronius, der sich vorstellte, in diesem Hause herrsche ewig Trübsinn -- da er nie in diesem Hause verkehrte --, blickte mit einem gewissen Staunen, ja, mit einem Gefühl der Enttäuschung umher, denn das Atrium machte einen durchaus heiteren Eindruck.
Aus der Höhe drang durch die zweite Öffnung eine helle Lichtgarbe, die an dem Springbrunnen in tausend Funken zerstäubte. Der viereckige Teich, in dessen Mitte der Springquell emporsprudelte, war von Anemonen und Lilien umgeben. Besonders für Lilien schien eine Vorliebe im Hause zu herrschen; es gab deren ganze Büsche; weiße und feuerfarbige Lilien und violette Irisblumen, deren zarte Blütenblätter unter dem zerstäubenden Wasser wie versilbert erschienen. Durch das feuchte Moos, mit welchem die Lilienblätter bedeckt waren, und durch die Blätterbüschel sah man Bronzestatuetten hervorschimmern, welche Kinder und Wasservögel darstellten. An einer Ecke stand, gleichfalls aus Bronze, eine Hirschkuh, die ihren durch die Feuchtigkeit von Rost grünlich gewordenen Kopf gegen das Wasser neigte, als ob sie trinken wollte. Der Fußboden des Atriums war aus Mosaik, die Wände, teils mit rotem Marmor ausgelegt, teils mit Bäumen, Fischen, Vögeln und Greifen bemalt, erfreuten das Auge durch ihre Farbenpracht. Die Füllungen an den zu den anstoßenden Räumen führenden Türen waren teils mit Schildkrot, teils mit Elfenbein verziert; an den Wänden, zwischen den Türen, standen die Statuen der Vorfahren des Aulus. In allem verriet sich eine gewisse gediegene Wohlhabenheit, frei von jedem Luxus, aber überall ein vornehmes Selbstbewußtsein.
Petronius, der zwar viel prächtiger eingerichtet war, fand hier doch nichts, was seinen Geschmack beleidigt hätte, und er wollte sich gerade mit einer Bemerkung darüber an Vinicius wenden, als der Türsteher den Vorhang zur Seite schob, welcher das Atrium von dem Tablinum4 trennte, und aus der Tiefe des Hauses sich Aulus Plautius eiligen Schritts näherte.
Aulus war ein in vorgerückten Jahren stehender Mann mit schon ergrauten Haaren; aber er war noch sehr rüstig und frisch, und sein etwas zu kurzes Gesicht mit dem an einen Adler erinnernden Profil deutete auf einen energischen Charakter. Jetzt aber malte sich etwas wie Erstaunen, ja wie Unruhe auf seinen Zügen über den unerwarteten Besuch des Freundes, Gefährten und Vertrauten Neros.
Petronius war zu sehr Weltmann und zu scharfsinnig, als daß er dies nicht bemerkt hätte. Nach den ersten Begrüßungen versicherte er daher auch mit aller Unbefangenheit und Liebenswürdigkeit, die ihm zu Gebote stand, daß er gekommen sei, für die freundliche Pflege, die seinem Schwestersohn in diesem Hause zuteil geworden, zu danken. Sein Besuch, zu dem er sich übrigens durch seine lange Bekanntschaft mit Aulus berechtigt gefühlt habe, sei einzig und allein auf diesen Grund zurückzuführen.
Aulus versicherte seinerseits, daß er ihm ein lieber Gast sei, und was die Dankbarkeit beträfe, so hege er selbst etwas dergleichen für Petronius, wenn auch dieser vielleicht den Grund nicht erraten würde.
»Du hast nämlich dem Vespasian, den ich schätze und liebe, das Leben gerettet, als er das Unglück hatte, bei einer Vorlesung der Gedichte des Kaisers einzuschlafen.«
»Ein Glück für ihn«, versetzte Petronius, »denn auf die Art hat er sie wenigstens nicht gehört. Ich will auch zugeben, daß die Sache für ihn hätte unglücklich ausfallen können. Der Feuerbart wollte durchaus einen Centurio zu ihm schicken, mit dem freundschaftlichen Auftrag, er möchte sich die Adern öffnen.«
»Du aber, Petronius, lachtest ihn aus.«
»So ist es, oder vielmehr ich sagte ihm, wenn Orpheus durch seinen Gesang die wilden Tiere eingeschläfert habe, sei sein Triumph kein geringerer, wenn es ihm gelang, Vespasian einzuschläfern. Man darf ja den Feuerbart tadeln, vorausgesetzt, daß der Tadel sich auch als Schmeichelei auffassen läßt. Unsre huldreiche Augusta Poppäa versteht dies ausgezeichnet.«
»Ja, leider, das sind jetzt schlimme Zeiten«, erwiderte Aulus. »Mir fehlen zwei Vorderzähne, die mir ein von Britannenhand geschleuderter Stein einschlug, und seither zische ich; aber die glücklichste Zeit meines Lebens habe ich doch in Britannien zugebracht.«
»Weil es eine siegreiche Zeit war«, warf Vinicius ein.
Petronius befürchtete, der alte Feldherr möchte von seinen Schlachten berichten, und änderte schnell den Gesprächsgegenstand. Er erzählte, daß Landleute bei Präneste einen toten jungen Wolf mit zwei Köpfen gefunden hätten, daß der Blitz einen Eckpfeiler des Lunatempels beschädigt habe, und daß einige Priester das für ein böses Zeichen hielten und den Untergang Roms prophezeiten.
Aulus hörte aufmerksam zu und sagte, daß man solche Zeichen nicht so leicht aufnehmen dürfe. Die Götter können über die Greueltaten erzürnt sein, dies wäre auch nicht zu verwundern -- und in so einem Falle wären die Opfer angebracht.
Petronius begann nunmehr die Besitzung des Plautius sowie auch den guten Geschmack, der sich in der ganzen Ausstattung verriet, zu loben.
»Ein alter Familiensitz ist das«, versetzte Plautius, »in welchem ich seit meiner Inbesitznahme nichts geändert habe.«
Der Vorhang zwischen dem Atrium und dem Tablinum wurde nunmehr zurückgeschoben, und man konnte durch mehrere Räume hindurch in den Garten blicken, der in der Ferne wie ein helles Bild in dunklem Rahmen aussah. Fröhliches Kinderlachen drang von dort bis ins Atrium.
»O Feldherr«, rief Petronius, »gestatte uns, dieses fröhliche Lachen in der Nähe anzuhören, es ist eine Seltenheit heutzutage.«
»Recht gern«, sagte Plautius, sich erhebend. »Mein kleiner Aulus und Lygia ergötzen sich beim Ballspiel. Was aber das Lachen anbelangt, Petronius, so glaubte ich, dein ganzes Leben ginge unter Lachen dahin.«
»Das Leben ist des Lachens wert, deshalb lache ich«, entgegnete Petronius, »jedoch klingt dies Lachen anders.«
»Petronius«, fügte Vinicius hinzu, »lacht weniger bei Tage, aber um so mehr bei der Nacht.«
So plaudernd durchschritten sie das Haus und gelangten in den Garten, wo Lygia und der kleine Aulus mit Bällen spielten, welche von ausschließlich zu dieser Unterhaltung bestimmten Sklaven, Spheristae genannt, vom Boden aufgelesen und immer wieder den Spielenden überreicht wurden. Petronius warf einen raschen Blick auf Lygia, während der kleine Aulus, als er Vinicius erblickte, auf diesen zulief. Der junge Mann aber neigte im Vorüberschreiten das Haupt vor dem lieblichen Mädchen, das, den Ball in der Hand, mit etwas gelösten Haaren noch ganz atemlos und errötend dastand.
In der von Efeu, wildem Wein und Geißblatt überschatteten Gartenhalle saß Pomponia Graecina, und die Männer gingen, sie zu begrüßen. Obwohl Petronius nie das Haus des Plautius besuchte, war sie ihm bekannt, denn er war schon häufig bei Antystia, der Tochter des Rubelius Plautius, und im Hause des Seneka und bei Polliona mit ihr zusammengetroffen. Er konnte nun ihrem ernsten und trotzdem schönen Gesicht, der Vornehmheit ihrer Gestalt, ihren Bewegungen und ihrer Redeweise seine Bewunderung nicht versagen. Pomponia verwirrte seine Anschauung vom Weibe derart, daß der in Grund und Boden verderbte und wie kein zweiter in Rom selbstbewußte Mann ihr gegenüber nicht nur eine gewisse Achtung empfand, sondern auch ein wenig seine gewohnte Sicherheit verlor. Während er ihr jetzt für die dem Vinicius gewidmete Fürsorge dankte, begann er sogleich sein Bedauern darüber auszusprechen, daß sie sich nirgends blicken lasse, daß man sie weder im Zirkus noch im Amphitheater sehe, worauf sie, ihre Hand in die ihres Gatten legend, ruhig erwiderte: »Wir beide werden alt und lieben immer mehr die häusliche Einsamkeit.«
Petronius wollte einen Einwand machen, allein Aulus Plautius fügte in dem ihm eigentümlichen zischenden Tone hinzu: »Wir fühlen uns immer fremd unter den Menschen, welche sogar unsern römischen Göttern griechische Namen beilegen.«
»Seit einer gewissen Zeit werden ja die Namen der Götter nur als Redefiguren gebraucht«, entgegnete Petronius gleichgültig, »und da die Griechen uns in der Redekunst unterwiesen haben, wird es mir zum Beispiel auch leichter, Hera statt Juno zu sagen.« Darauf blickte er auf Pomponia, als wollte er sagen, daß er in ihrer Gegenwart an keine andre Gottheit denken könne, und versuchte jetzt zu widerlegen, was sie über ihr Alter gesagt hatte: »Die Menschen altern schnell, und besonders diejenigen, welche ein ganz anderes Leben führen, und zudem gibt es Gesichter, die Saturn zu vergessen scheint.«
Petronius sagte dies mit einer gewissen Aufrichtigkeit, denn obwohl Pomponia Graecina den Mittag ihres Lebens überschritten hatte, war ihre Gesichtsfarbe ungewöhnlich frisch geblieben, und da ihr Kopf klein und die Züge zart waren, machte sie zuweilen trotz der schwarzen Gewänder und des tiefen Ernstes ihrer Züge den Eindruck einer noch jungen Frau.
Inzwischen näherte sich der kleine Aulus dem Vinicius, mit welchem er schon auf dem Landsitze Freundschaft geschlossen hatte, und forderte ihn zum Ballspiel auf. Nach dem Knaben betrat auch Lygia das Triklinium. Unter den Efeugehängen und den über ihr Gesicht gleitenden Lichtstrahlen erschien sie jetzt Petronius noch schöner als beim ersten Blick. Da er sie bisher noch nicht gesprochen hatte, erhob er sich von seinem Sitze, neigte das Haupt vor ihr und sagte statt der üblichen Begrüßung die Worte, mit denen Odysseus die Königstochter Nausikaa begrüßte:
»Dich grüß’ ich, Hohe der Göttinnen oder der Jungfrauen! Bist du der Sterblichen eine, die rings umwohnen das Erdreich? Dreimal selig dein Vater und deine treffliche Mutter, Dreimal selig die Brüder zugleich...«
Selbst Pomponia fand Gefallen an der Gewandtheit des Weltmanns. Was Lygia betrifft, so lauschte sie verwirrt, errötend und wagte nicht die Augen aufzuschlagen. Allmählich aber zuckte es um ihre Mundwinkel, ein mutwilliges Lächeln zeigte sich auf ihren Lippen, und in ihrem Gesicht kämpfte mädchenhafte Scheu sichtlich mit dem Wunsche, eine Antwort zu geben. Offenbar trug dieser Wunsch den Sieg davon, denn sie erhob plötzlich den Blick zu Petronius und antwortete mit den Worten Nausikaas fast in einem Atemzug und als sage sie eine eingelernte Lektion her:
»Keinem geringeren Manne, noch törichten gleichst du, o Fremdling!«
Dann wandte sie sich um und entfloh, einem verscheuchten Vögelchen gleich. Nun war die Reihe an Petronius, sich zu wundern, hatte er doch nicht erwartet, Homerische Verse aus dem Munde eines Mädchens zu hören, von dessen nordischer Abstammung er durch Vinicius unterrichtet worden war.
Er blickte fragend zu Pomponia hinüber, doch konnte ihm diese keine Auskunft geben, weil sie sich eben lächelnd an dem Stolze weidete, der das Antlitz des alten Aulus verklärte.
Er aber verstand es nicht, diesen Stolz zu verbergen. Er liebte Lygia wie sein eigenes Kind, und dann fühlte er sich in seinen altrömischen Vorurteilen zwar oft veranlaßt, gegen die griechischen Sitten und deren Verbreitung zu donnern, trotzdem hielt er sie aber für den Gipfelpunkt aller feinen Bildung. Er selbst hatte sich eine solche Bildung niemals aneignen können, was ihn insgeheim schmerzte. Daher freute er sich, daß der gewandte Weltmann und Dichter, der sicherlich nur allzu geneigt war, sein Haus für ein barbarisches anzusehen, eine Antwort in der poetischen Sprache Homers erhalten hatte.
»Wir haben in unserm Hause einen Griechen«, sagte Aulus zu Petronius gewendet, »der unsern Knaben unterrichtet, und das Mädchen wohnt den Lehrstunden bei. Sie ist noch eine rechte Bachstelze, eine liebe Bachstelze, an die wir uns beide recht gewöhnt haben.«
Petronius warf jetzt durch die Efeu- und Geißblattgewinde einen Blick in den Garten und beobachtete die Spielenden. Vinicius hatte die Toga abgeworfen, und nur mit der Tunika angetan, warf er den Ball der ihm gegenüberstehenden Lygia zu, die ihn mit hocherhobenen Armen aufzufangen suchte. Anfangs hatte das Mädchen keinen großen Eindruck auf Petronius gemacht. Es schien ihm gar zu schmächtig. Doch schon in dem Augenblick, da er sie im Triklinium genauer ansah, verglich er sie im Geiste mit der Morgenröte, und als Kenner bemerkte er dann sehr wohl, daß in ihrem ganzen Wesen etwas Ungewöhnliches liege. Jede Einzelheit wurde von ihm wahrgenommen und gehörig gewürdigt; das zarte, rosige Gesicht, die frischen Lippen, die himmlischen, wie das Meer blauen Augen, die alabasterweiße Stirn, die Fülle des dunklen Haares, das in den Windungen wie Bernstein oder korinthisches Erz schimmerte, der schlanke Hals, die herrlich herabfallenden Schultern und die ganze geschmeidige, zarte, maienjunge und frisch erblühte Gestalt.
Petronius wandte sich an Pomponia Graecina, und nach dem Garten zeigend, sagte er: »Jetzt begreife ich, Domina, daß ihr mit diesen beiden euer Haus dem Zirkus und den Gelagen auf dem Palatinus vorziehet.«
»So ist es«, antwortete Pomponia, ihren Blick auf den kleinen Aulus und Lygia richtend.
Die jungen Leute hatten nunmehr ihr Spiel beendet und wandelten auf den mit Sand bestreuten Wegen des Gartens, wobei sie sich wie weiße Bildsäulen von dem dunklen Hintergrunde der Myrten und Zypressen abhoben. Lygia hielt den kleinen Aulus bei der Hand. Als sie sich eine Weile ergangen hatten, ließen sie sich auf einer Bank in der Nähe des Fischweihers, die die Mitte des Gartens einnahm, nieder. Den kleinen Aulus litt es aber da nicht lange; er machte sich auf, um die Fische aufzuscheuchen, die in dem kristallhellen Wasser des Teiches umherschwammen, und Vinicius fuhr in der Rede fort, welche er schon während des Spaziergangs begonnen hatte.
»Ja«, sagte er mit tiefer, etwas bebender Stimme, »kaum hatte ich die Knabentoga abgeworfen, als ich bei der asiatischen Legion eingereiht wurde. Ich kannte weder die Stadt und deren Freuden, noch das Leben, noch die Liebe. Von Anakreon und Horaz kann ich wohl einige Gedichte auswendig, aber niemals vermöchte ich es, Verse zu sprechen, wenn der Geist vor Bewunderung sprachlos wird und keine eigenen Worte findet. Als ich noch ein Knabe war, besuchte ich die Schule des Musonius, der uns lehrte, daß unser Glück stets darauf beruhe, zu wollen, was die Götter wollen, und daß es daher nur an uns selbst liege, glücklich zu sein. Ich glaube aber, daß es noch ein anderes großes und unendliches Glück gibt, das nicht von unserm Willen abhängt, weil nur die Liebe es uns gewähren kann. Selbst die Götter fühlen dieses Glück, und auch ich, o Lygia, der ich die Liebe erst jetzt kennengelernt habe, sehne mich nach dem Glück, das sie allein zu geben vermag...«
Er schwieg und eine Zeitlang vernahm man nur das leise Gurgeln des Wassers, welches der kleine Aulus mit Steinen bewarf, um die Fische aufzuscheuchen.
Nach einer Weile begann Vinicius von neuem mit noch weicherer, leiserer Stimme: »Du kennst doch Titus, den Sohn des Vespasian? Von dem sagt man, er habe sich, kaum dem Knabenalter entwachsen, so leidenschaftlich in Berenice verliebt, daß die Sehnsucht ihn fast verzehrte... Lygia! Auch ich wäre einer solchen Liebe fähig. Reichtum, Ruhm, Macht -- sie sind ein leerer Rauch! Ein Nichts! Der Reiche trifft immer wieder einen Reicheren, der Ruhmreichere wird durch den größeren Ruhm eines Fremden in Schatten gestellt, der Mächtige durch den Mächtigeren bezwungen... Aber kann selbst der Cäsar, kann sogar irgendein Gott eine größere Wonne empfinden oder glücklicher sein als ein gewöhnlicher Sterblicher, wenn die Heißersehnte an seiner Brust ruht? Die Liebe macht uns den Göttern gleich, o Lygia!«
Das junge Mädchen lauschte mit einer gewissen Unruhe und Verwunderung, etwa so, wie sie dem Klange einer griechischen Flöte oder einer Zither gelauscht hätte. Ihr war, als singe Vinicius eine seltsame Weise, die ihrem Ohr schmeichelte, die ihr Herz mit ohnmächtiger Furcht und zugleich mit unbegreiflicher Freude erfüllte. Ihr war auch, als ob er etwas ausspräche, was sie schon zuvor empfunden, wovon sie sich aber keine Rechenschaft hatte geben können. Sie fühlte, daß er etwas in ihr erweckte, was bisher geschlummert hatte und nun wie ein unklares Traumgebilde eine immer deutlichere und anziehendere Form annahm.
Die Sonne hatte sich inzwischen längst über die Tiber gewälzt und stand niedrig über dem Janiculushügel. Auf die regungslosen Zypressen fiel ein rötlicher Lichtschein, die ganze Luft war davon durchtränkt. Lygia hob die blauen, wie eben aus dem Schlummer erwachenden Augen zu Vinicius empor, und jetzt da er sich mit einer zitternden Bitte im Blick über sie neigte, erschien er ihr schöner als alle Menschen, ja selbst schöner als die griechischen und römischen Götter vor den Tempeln. Er aber umfing leicht ihr Handgelenk und fragte: »Errätst du nicht, Lygia, weshalb ich dir dies sage?« »Nein!« flüsterte sie so leise, daß er es kaum verstand.
Doch er glaubte ihr nicht, und ihre Hand immer fester umschließend, hätte er vielleicht, von seiner Leidenschaft übermannt, das liebliche Mädchen an sein klopfendes Herz gezogen und noch feurigere Worte an sie gerichtet, wenn nicht auf dem von Myrten umsäumten Fußpfade der alte Aulus erschienen wäre. Indem er nähertrat, rief er ihnen zu: »Die Sonne geht unter, hütet euch vor der gefährlichen Abendkühle. Wir sind hier nicht in Sizilien, wo man sich des Abends im Freien ergeht und Chorgesänge singt.«
Er begann jetzt, von Sizilien zu erzählen, wo seine landwirtschaftlichen Besitzungen lagen, die ihm sehr ans Herz gewachsen waren. Der Gedanke sei ihm schon häufig gekommen, erklärte er, ganz nach Sizilien überzusiedeln und dort in beschaulicher Ruhe sein Leben zu enden. Genug habe er des winterlichen Reifes, denn auch sein Haupt sei ja schon weiß. Noch trügen zwar die Bäume ihre Blätter, noch lache über die Stadt ein blauer Himmel, aber wenn die Weinranke gelb werde, wenn der Schnee auf dem Albanergebirge falle, wenn die Götter die Campania mit heftigen Stürmen heimsuchten, dann vielleicht ziehe er mit dem ganzen Hause auf seinen stillen ländlichen Wohnsitz.
»Wie? Du hättest Lust, Rom zu verlassen, Plautius?« sagte Vinicius plötzlich beunruhigt.
»Schon lange habe ich diesen Wunsch«, antwortete Aulus, »denn dort ist es ruhiger und gefahrloser.«
Und er begann aufs neue seine Obstgärten und seine Herden zu rühmen -- das im Grün versteckte Haus und die Berge, wo der Thymian und das Pfefferkraut wuchs, von Bienen umsummt. Vinicius hatte keinen Sinn für diese begeisterte Schilderung, er dachte nur daran, daß Lygia ihm entrissen werden könnte, und blickte zu Petronius hinüber, als wenn er von diesem Hilfe erwartete.
Petronius, der an Pomponias Seite saß, labte sich an dem Anblick der untergehenden Sonne, an dem Garten und an der am Fischweiher stehenden Menschengruppe. Er empfand den hier herrschenden Seelenfrieden sofort, und prüfend betrachtete er die Hausbewohner. Ein ihm fremder Ausdruck lag auf den Zügen Pomponias, des alten Aulus, des Knaben und Lygias, ein Ausdruck, den er auf den Gesichtern andrer niemals wahrgenommen hatte, die ihn tagtäglich oder vielmehr jede Nacht umgaben. Welch friedliches, heiteres Leben schienen diese Menschen hier zu führen! Und mit einer gewissen Verwunderung gestand er sich, daß es wohl eine Lebensführung geben müsse, deren Schönheit, deren Anmut er nie kennengelernt hatte, er, der doch stets im Leben nach Schönheit und Anmut strebte. Diesem Gedanken Worte verleihend, wandte er sich an Pomponia und sagte: »Ich erwäge im Geiste, wie verschieden doch eure Welt ist von der, über die Nero regiert.« Pomponia aber richtete ihren Blick zum Abendhimmel empor und erwiderte schlicht: »Nicht Nero regiert die Welt, sondern Gott.« --
Ein kurzes Schweigen trat ein. Auf dem zum Triklinium führenden Wege wurden die Schritte des alten Heerführers, des Vinicius, Lygias und des kleinen Aulus hörbar, aber ehe diese nahetraten, fragte Petronius: »Du glaubst demnach an die Götter, Pomponia?«
»Ich glaube an Gott, der einzig, gerecht und allmächtig ist«, antwortete das Weib des Aulus Plautius.
IΗΣΟΎΣ -- Iēsous (neugr. Iisús) Jesus
ΧΡΙΣΤΌΣ -- Christós »Christus« (der Gesalbte)
ΘΕΟΎ -- Theoú Gottes
ΥΙΌΣ -- Hyiós (neugr. Iós) Sohn
ΣΩΤΉΡ -- Sōtér (neugr. Sotíras) Erlöser
Der Fisch war eines der symbolischen Erkennungszeichen der ersten Christen. Die einzelnen Buchstaben des griechischen Wortes (ἰχθύς) bilden die Anfangsbuchstaben der griechischen Worte für Jesus Christus Gottes Sohn, Erlöser: <<<
die vierhundert Köpfe zählende Familia wurde gekreuzigt <<<
Ein Spiel, in dem man mit einem Blick erraten muß, wieviel Finger einer in die Höhe gehoben hat. Ein noch jetzt in Italien beliebtes Spiel <<<
der Geschäftsraum des Hausherrn <<<
3
Petronius hatte Vinicius versprochen: »In wenigen Tagen schon wird die göttliche Lygia unter deinem Dache von deinem Brote essen.«
Er hielt sein Versprechen. Tags darauf schlief er ununterbrochen bis zum Abend, ließ sich dann nach dem Palatinus tragen und hatte mit Nero eine vertrauliche Unterredung. Die Folge davon war, daß schon am dritten Tage ein Centurio an der Spitze einer Abteilung der prätorianischen Leibwache vor dem Hause des Plautius erschien.
Die Zeiten waren unsicher und schrecklich. Boten dieser Art waren häufig Verkünder des Todes. Als daher der Centurio mit dem Hammer an das Tor des Aulus pochte und der Oberaufseher des Atriums die Kunde brachte, daß Söldlinge in der Vorhalle sich befänden, herrschte Bestürzung im ganzen Hause. Die Angehörigen versammelten sich alsbald um den alten Krieger, denn niemand zweifelte, daß vornehmlich ihm Gefahr drohe. Pomponia umklammerte seinen Hals mit ihren Armen, schmiegte sich innig an ihn, und ihre blassen Lippen bewegten sich rasch, unverständliche Worte murmelnd. Lygia, weiß wie ein Tuch, bedeckte seine Hand mit Küssen, und der kleine Aulus klammerte sich an die Toga des Vaters.
Nur der alte Kriegsmann selbst, der dem Tod unzähligemal ins Antlitz geschaut hatte, blieb ruhig, und sein kurzes Adlerprofil schien wie aus Stein gemeißelt. Sanft schob er seine Gattin von sich und trat ins Atrium, wo der Centurio seiner harrte. Es war der alte Cajus Hasta, sein ehemaliger Untergebener und Gefährte aus den britannischen Kriegen.
»Sei gegrüßt, mein Feldherr«, sagte er. »Ich bringe dir einen Befehl und die Grüße des Kaisers. Hier sind die Täfelchen zum Zeichen, daß ich in seinem Namen komme.«
»Ich bin dem Kaiser dankbar für seine Grüße, und dem Befehl werde ich Folge leisten«, erwiderte Plautius. »Sei mir gegrüßt, Hasta, und sprich: welchen Auftrag hast du zu überbringen?«
»Aulus Plautius«, begann Hasta, »der Kaiser hat in Erfahrung gebracht, daß in deinem Hause die Tochter des Lygierkönigs weilt, die dieser König noch zu Lebzeiten des göttlichen Claudius den Römern als Geisel dafür übergab, daß die Grenzen des Reiches niemals durch die Lygier verletzt werden sollten. Der göttliche Nero ist dir dankbar, mein Feldherr, weil du ihr so viele Jahre hindurch Gastfreundschaft gewährtest, doch will er nicht, daß sie dir länger zur Last falle, auch ist er der Meinung, daß das Mädchen, als eine Geisel, unter den Schutz des Kaisers und des Senats gehöre, und deshalb befiehlt er dir, sie in meine Hände auszuliefern.«
Aulus war zu sehr Soldat und zu sehr Römer, als daß er sich diesem Befehl gegenüber einen Ausruf des Bedauerns, ein unnützes Wort oder eine Klage erlaubt hätte. Aber eine Falte des Zorns und des Schmerzes grub sich plötzlich in seine Stirn. Vor diesem Zucken der Wimpern hatten einst die britannischen Legionen gezittert, und jetzt in diesem Augenblick malte sich auf Hastas Gesicht ein jähes Erschrecken. Doch Aulus Plautius fühlte sich diesem Befehl gegenüber machtlos. Einige Zeit blickte er auf die Täfelchen und die Schriftzüge, dann hob er den Blick zum alten Centurio und sprach mit ruhiger Stimme: »Warte hier im Atrium, Hasta, bis die Geisel dir ausgeliefert werden kann.«
Nach diesen Worten begab er sich an das andere Ende des Hauses in den Ökus genannten Saal, wo Pomponia Graecina, Lygia und der kleine Aulus ihn voll Angst und Unruhe erwarteten.
»Keinem von uns droht der Tod noch Verbannung auf ferne Inseln«, sagte er, »und dennoch ist der Bote des Kaisers ein Unglücksbote. Um dich handelt es sich, Lygia.«
»Um Lygia?« rief Pomponia erstaunt.
»So ist es«, antwortete Aulus. Und zu dem Mädchen gewendet sagte er: »Lygia, du bist in unserem Hause aufgewachsen wie unser leibliches Kind, und wir beide, Pomponia und ich, lieben dich wie eine Tochter. Aber du weißt, daß du nicht unsre Tochter bist. Als Geisel bist du Rom von deinem Volke übergeben worden, und dem Kaiser gebührt die Obhut über dich. Daher nimmt dich der Kaiser aus unserem Hause.«
Der alte Kriegsmann sprach ruhig, aber mit seltsamer, fremd klingender Stimme. Lygia hörte ihn mit weit offenen Augen an, als ob sie nicht recht verstehe, um was es sich handelte, und die Wangen Pomponias bedeckten sich mit Todesblässe.
»Aulus!« schrie Pomponia entsetzt und umschlang das Mädchen mit ihren Armen, als ob sie es schützen wollte. »Besser wäre ihr der Tod.«
Lygia hatte sich an ihre Brust geworfen und wiederholte immer nur das Wort: »Mutter! Mutter!«, denn sie brachte nichts anderes hervor.
Auf des Aulus Zügen zeigten sich Zorn und Schmerz. »Wäre ich allein auf der Welt«, sagte er finster, »gäbe ich sie nicht lebend hin. Aber ich habe kein Recht, dich und unsern Knaben ins Verderben zu stürzen; er kann vielleicht noch bessere Zeiten erleben. Heute noch will ich zum Kaiser gehen und ihn anflehen, daß er den Befehl widerrufe. Ob er mich vorlassen wird, weiß ich freilich nicht. Jetzt aber lebe wohl, Lygia! Pomponia und ich haben immer den Tag gesegnet, an dem du einen Platz an unserm Herd einnahmst.«
Hierauf wandte er sich rasch um und kehrte ins Atrium zurück, um der in ihm aufsteigenden, eines Römers und Feldherrn unwürdigen Rührung Einhalt zu tun. Pomponia aber führte Lygia ins Schlafzimmer und suchte sie zu beruhigen, zu trösten und ihr Mut zuzusprechen.
»Jetzt ist die Zeit der Prüfung gekommen«, sagte sie. »Das Haus des Kaisers ist eine Lasterhöhle, ein Haus der Schande und des Verbrechens. Aber Lygia, die neue Lehre, der wir anhängen, erlaubt uns nicht, Hand an uns zu legen, sie erlaubt uns nur, gegen Schmach und Schande uns zu verteidigen, selbst wenn wir dafür Marter und Tod erleiden müßten. Die Erde ist ein Jammertal, aber zum Glück währt das Leben nur einen Augenblick, und es gibt ein Auferstehen aus dem Grabe, ein Jenseits, wo nicht mehr Nero, sondern die ewige Barmherzigkeit waltet, wo statt des Schmerzes ewige Freude und statt der Tränen ewiger Jubel herrscht.«
Und sie drückte das Köpfchen des jungen Mädchens noch inniger an ihre Brust. Lygia aber ließ sich zu ihren Füßen nieder, und die Augen in den Falten von Pomponias Gewand verbergend, verharrte sie eine Zeitlang schweigend. Als sie sich endlich erhob, zeigte das junge Gesicht schon etwas mehr Fassung.
»Ich scheide schwer von euch, von dir, Mutter, vom Vater und vom Bruder, aber ich weiß, daß jeder Widerstand vergeblich wäre und euch allen Verderben brächte. Ich gelobe dir jedoch, im Kaiserpalast deiner Worte nie zu vergessen.«
Einmal noch schlang sie die Arme um den Hals Pomponias, und als sie beide in den Ökus zurückgekehrt waren, nahm sie Abschied vom kleinen Plautius, von dem greisen Griechen, beider Lehrer, von der Gewandhüterin, von der sie als Kind gewartet worden war, und von allen Sklaven.
Einer von ihnen, ein hochgewachsener, breitschultriger Lygier, den man im Haus Ursus, den Bären, hieß und der seinerzeit mit Lygia, deren Mutter und anderen Dienern ins römische Lager gekommen war, fiel zu den Füßen des jungen Mädchens nieder, beugte auch die Knie vor Pomponia und rief: »O Domina! Laßt mich meine Herrin begleiten, damit ich ihr im Kaiserpalast dienen und sie beschützen kann.«
»Du bist nicht unser Diener, sondern Lygias«, erwiderte Pomponia Graecina. »Aber wird man dir auch den Eintritt gestatten? Und wie willst du über sie wachen?«
»Das weiß ich nicht, Domina, ich weiß aber, daß Eisen in meinen Händen wie Holz bricht.« --
Als Aulus Plautius, der jetzt zurückkehrte, von der Bitte des Lygiers erfuhr, erklärte er, man habe gar kein Recht, ihn zurückzuhalten, da er zum Gefolge Lygias gehöre. Auf seinen Rat wurden noch einige Sklavinnen zur Bedienung mitgegeben. Pomponia wählte dazu nur Bekennerinnen des neuen Glaubens, und da auch Ursus diesem Glauben seit mehreren Jahren angehörte, konnte sie auf die Treue dieser Diener zählen, sich aber auch mit dem Gedanken trösten, daß nun ein Saatkorn der neuen Lehre im Hause des Kaisers ausgestreut werde.
Durch einige Zeilen, die sie niederschrieb, stellte sie dann noch Lygia unter den Schutz Aktes, der Freigelassenen Neros. Bei den Versammlungen der Glaubensbekenner war Akte zwar nie anwesend, aber Pomponia hatte von andern gehört, daß Akte den Christen nie ihre Hilfe versage und eifrig in den Briefen des Paulus von Tarsos lese. Sie hatte auch vernommen, daß die junge Freigelassene, die in stiller Trauer dahinlebte, ganz anders war als die andern Frauen in Neros Hause und sie für den guten Geist des Palastes galt.
Hasta versprach, Akte den Brief einzuhändigen, und machte nicht die mindesten Schwierigkeiten, die Sklaven mitzunehmen, denn er hielt es für selbstverständlich, daß eine Königstochter ihr eigenes Dienergefolge haben müsse; ja, er wunderte sich sogar über die geringe Anzahl. Nur bat er um Eile, weil er sonst fürchten müsse, in den Verdacht zu kommen, die Erfüllung des kaiserlichen Befehls mit Saumseligkeit betrieben zu haben.
Die Stunde der Trennung war gekommen. Pomponias und Lygias Augen füllten sich abermals mit Tränen, Aulus legte noch einmal die Hand auf das Haupt des Mädchens -- und von den Klagerufen des kleinen Aulus begleitet, der, um die Schwester zu schützen, den Centurio mit den kleinen Fäusten bedrohte, führten die Söldlinge Lygia in den Kaiserpalast.
Der alte Krieger befahl, seine Sänfte bereit zu halten, dann schloß er sich mit Pomponia in ein Zimmer ein und sagte zu ihr: »Höre mich an, Pomponia. Ich gehe zum Kaiser, obwohl ich fürchte, daß es vergeblich sein wird, und auch zu Seneka, dessen Wort aber leider nicht mehr viel vermag. Heut haben Sofonius Tigellinus oder Vatinius mehr Geltung... Was den Kaiser selbst anbelangt, so hat er wahrscheinlich niemals in seinem Leben irgend etwas vom Stamme der Lygier gehört; wenn er also die Auslieferung Lygias als Geisel fordert, so tut er es nur, weil jemand ihn dazu überredet hat, und es ist leicht zu erraten, wer dies ist.«