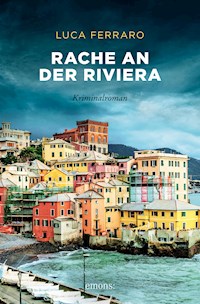
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Eine furiose Mischung aus Dolce Vita und dunkler Vergangenheit. Spätsommer an der Riviera. Gerichtsmediziner Johann Sorbello steht vor der Leiche einer jungen Frau, die aus dem Piranha-Becken des Genueser Aquariums geborgen wurde. In ihrer Lunge findet er Olivenöl, was den ermittelnden Kommissar aber wenig zu interessieren scheint. Kurzerhand beschließt Sorbello, selbst Nachforschungen anzustellen. Seine Suche nach der Wahrheit führt ihn in ein entlegenes Dorf in den Bergen – und in einen Kampf auf Leben und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Der Autor, Jahrgang 1965, schreibt unter dem Pseudonym Luca Ferraro. Er lebt mit seiner Frau in Berlin und Ligurien. Nach dem Studium der Politologie und Amerikanistik arbeitete er zunächst als Reporter für Zeitungen und Magazine, seit Ende der neunziger Jahre dreht er als Autor und Regisseur Reportagen für das Fernsehen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Montage aus mauritius images/Realy Easy Star/ Toni Spagone/Alamy, shutterstock.com/kuzmaphoto
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-591-6
Komplett überarbeitete Neuausgabe
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Tod an der Riviera« bei der epubli GmbH.
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Prolog
Der Mann öffnete die Tür zur heiligen Kammer. Vier armdicke weiße Kerzen tauchten den winzigen Raum in flackerndes Licht. Vor dem Altar kniete die Frau, mit dem Rücken zu ihm. Wie immer hatte sie nichts zwischen ihre Knie und den kalten Schieferboden gelegt. »Kälte härtet dich ab. Schmerz macht dich stark.« Wie oft hatte er diese Worte gehört.
Er betrat das Zimmer, schloss die schwere Holztür hinter sich und schob den Riegel vor. Die Frau reagierte nicht. Er wusste, dass sie ihren Rosenkranz in den Händen hielt, hörte das Klappern der Perlen und ihr heiseres Flüstern: »Heilige Maria, Muttergottes, bitte für uns Sünder.« Neunundfünfzig Perlen und ein Kreuz. Sechzig Gebete. Dreiundfünfzig davon das Ave-Maria.
Er hatte noch nie einen Rosenkranz gebetet. Das war etwas für Frauen. Und doch kannte er jedes Wort auswendig, sein ganzes Leben hatte er hier zugehört. Manchmal war er in diesem monotonen Wortrauschen eingeschlafen. Das hatte sie wütend gemacht. Aber ihr Gebet hatte sie nie unterbrochen. Erst danach griff sie zur Lederpeitsche. Schmerz macht dich stark. Er hatte sich das Einschlafen abgewöhnt.
Er setzte sich auf die alte Holzbank, auf der er schon als Kind gesessen hatte, und wartete. Er blickte auf den kerzengeraden Rücken der Frau. Sie wippte im Takt ihrer Worte fast unmerklich vor und zurück. Schlank, straff, kontrolliert, so war sie immer gewesen. Ihre weißgrauen Haare hatte sie zu einem Knoten zusammengebunden. Von hinten wäre niemand auf die Idee gekommen, dass sie fünfundachtzig Jahre alt war.
»Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.« Sie war fertig.
Stille.
Er wartete.
Nach ein paar Minuten hörte er ihre raue Stimme: »Hast du deine Aufgabe gelöst?«
»Ja, es gab keine Probleme.«
»Hast du mir etwas mitgebracht?«
Er stand auf und griff in die Tasche seiner grün gescheckten Jägerhose. Ein zusammengeknülltes Stofftaschentuch, darin eingewickelt ein winziger Gegenstand. Wortlos reichte er das Bündel nach vorn.
Die Frau nahm es entgegen, ohne sich umzudrehen, stand auf und öffnete den Deckel zu einem gläsernen Schrein auf dem Altar. Sie blickte auf ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto in einem Holzrahmen und auf eine rostige Blechdose. Sie öffnete die Dose und legte das, was er mitgebracht hatte, hinein. Danach kniete sie sich wieder hin, nahm ihren abgegriffenen Rosenkranz aus der Rocktasche und begann ein neues Gebet.
Er wartete. Er wusste, er hatte alles richtig gemacht. Heute würde sie zufrieden mit ihm sein.
Es wurde still. Die Messe war zu Ende.
Seine Großmutter drehte sich um und sah ihn an. Sie streckte ihre Hand nach ihm aus.
Er zuckte kurz zurück. Ein Reflex, den ihn das Leben gelehrt hatte.
Langsam, fast zärtlich streichelte sie mit der Rückseite ihrer rissigen Finger über seine Wange.
Teil I
Die Entscheidung
1
Donnerstag
Das Wasser war trüb. Die Piranhas waren nicht mehr zu sehen. Alberto versuchte, irgendetwas hinter der fünf Zentimeter dicken Glasscheibe wahrzunehmen. Doch er sah nichts als eine milchig rötliche Brühe.
Er schaute sich um. Gegenüber, im großen Becken auf der anderen Seite des dunklen Gangs, drehte ein Seehund eine Pirouette und schwamm rasant wieder davon. Alberto sah ihm gedankenverloren hinterher.
Seit neun Jahren war er Tierpfleger im zweitgrößten Aquarium Europas, das auf einem umgebauten Schiff im alten Hafen von Genua lag. Ungelernt hatte er als Einundzwanzigjähriger angefangen. Und sich Schritt für Schritt immer tiefer in die südamerikanische Fischwelt hineingearbeitet. Mittlerweile gab es in ganz Italien kaum jemand, der mehr über Piranhas wusste als er. Sogar aus dem Ausland bekam er regelmäßig Anfragen, wie mit den legendären Raubfischen umzugehen sei. Doch in diesem Moment stand er vor einem Rätsel.
Alberto sah auf die Uhr. Kurz vor sieben, er hatte wie so oft als Erster seinen Dienst begonnen und war noch allein. In zweieinhalb Stunden würde der Touristenstrom beginnen. Aber seine Piranhas, eine der Hauptattraktionen, waren leider verschwunden.
Er ging näher an die sechs Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Scheibe heran, um in der trüben Suppe vielleicht doch etwas zu erkennen. Jetzt konnte er Schatten sehen, die sich langsam bewegten. Offenbar waren die Fische noch am Leben. Aber warum war das Wasser so trüb?
Er erinnerte sich an die Zeit, als er den Piranhas manchmal Pferdefleisch als Futter ins Becken geworfen hatte. Damals hatte sich das Wasser stundenlang ähnlich verfärbt. Seitdem er nur noch aufgetauten Frostfisch verfütterte, war dieses Problem nicht mehr aufgetreten.
Alberto glaubte, ein Schnalzen hinter sich zu hören. Doch da war nur der Seehund mit seinem grau-weiß gescheckten Fell, der wieder an ihm vorbeischwamm. An dessen fünfzehn Meter langem Riesenbecken drückten sich normalerweise die Kinder ihre Nasen platt, angezogen von den Kapriolen der stets fröhlich wirkenden Robben. Die Erwachsenen dagegen waren von etwas anderem fasziniert, der Gefahr, die gegenüber lauerte: Piranhas. Hundertsechsundvierzig unschuldig aussehende Raubfische, die es sonst nur in südamerikanischen Flüssen gab. Auf dem Schild über dem Becken stand der lateinische Name: Pygocentrus nattereri, Roter Piranha, bis zu fünfunddreißig Zentimeter lang, mit Glupschaugen und einem seltsam vorstehenden Unterkiefer. Es gab definitiv schönere Fische hier im Aquarium. Aber keine anderen regten so sehr zu blutigen Phantasien an.
Viele erzählten sich die klassischen Gruselstorys über ihr gefährliches Gebiss. Geschichten von Rindern, die zum Trinken ins flache Wasser gingen und auf einmal von einem Piranha-Schwarm angefallen wurden. Mit ihren messerscharfen Zähnen rissen die Fische ganze Fleischbrocken aus dem lebendigen brüllenden Tier. Bis nur noch ein Gerippe übrig war, aufs Skelett abgenagt.
Alberto kannte auch die Legende, wonach die Amazonas-Indianer ihre Toten als Skelette begruben. Angeblich versenkten sie die Verstorbenen vorher an einem Seil im Fluss, als Aasfutter für die Fische. Und wenn sie die Leichen ein oder zwei Tage später wieder herausholten, waren nur noch sauber genagte Knochen übrig.
Die meisten dieser Geschichten waren übertrieben. Wenn Piranhas keinen Hunger hatten, waren sie ängstlich und lammfromm. Aber Alberto wusste auch, dass sie tatsächlich mit einer unglaublichen Kraft zubeißen konnten. Ein einziges Mal hatte er nicht aufgepasst, in seinem ersten Jahr als Piranha-Pfleger. Beim Füttern war ihm ein Stück Plastiktüte ins Wasser gefallen. Und ohne lange nachzudenken, hatte er mit seiner rechten Hand danach gegriffen. Sekundenbruchteile später ein stechender Schmerz. Ungläubig hatte er auf den zwanzig Zentimeter großen Fisch gestarrt, der sich in seiner Fingerkuppe verbissen und seinen Kopf wild hin- und hergeschüttelt hatte. Dann war es vorbei. Der junge Piranha fiel zurück ins Wasser, mit seiner Beute. Ein knapper Zentimeter Zeigefinger war einfach weg. Auch die Spitze des Knochens hatte der Fisch glatt abgebissen.
Unter bestimmten Bedingungen konnte so ein Schwarm in einen regelrechten Fressrausch verfallen. Hohe Temperaturen, dadurch weniger Sauerstoff im Wasser und vor allem: wenig oder kein Futter.
Alberto machte sich klar, dass diese Voraussetzungen gerade erfüllt waren. Die Sommerhitze hatte das Wasser um ein paar Grad erwärmt. Und die Piranhas hatten seit einer Woche nichts gefressen. Erst für morgen war die nächste Fütterung angesetzt.
Nachdenklich betrachtete Alberto die Narbe auf seinem Fingerstumpf. Hatte jemand den Fischen etwas ins Becken geworfen?
Er schaute hoch. Etwas schien tatsächlich an der Wasseroberfläche zu treiben. Ein großer, länglicher dunkler Gegenstand. Er würde sich das Piranha-Becken von oben ansehen müssen, um herauszufinden, was es war.
Er ging durch eine schwarze Tür hinein in den Versorgungsbereich. Ein unangenehmer Geruch schlug ihm entgegen. Während er einen Fuß nach dem anderen auf die Stahlstufen setzte, die zum Beckenrand führten, zwang er sich, die Treppe zu fixieren.
Er spürte ein Ziehen in seinem Magen. Angst vor dem, was hier passiert war. Was auch immer da im Wasser trieb, es gehörte dort nicht hin. Und es hatte dazu geführt, dass seine Piranhas nicht mehr zu sehen waren.
Schließlich hob er langsam seinen Blick – und sah in die leeren Augen eines Totenkopfes. Auf dem Wasser trieb ein zerfetzter Körper. Er bewegte sich. Der Kopf nickte auf und ab. Der rechte Arm ruderte in Schlangenlinien durch das Wasser.
Alberto spürte Panik in sich aufsteigen. Er zwang sich, ruhig zu bleiben, und schaute genauer hin. Die Bewegungen wurden von den Piranhas ausgelöst, die er von oben wieder schemenhaft sehen konnte. Sie zerrten an dunklen Gewebefetzen herum. Menschenfleisch.
2
Freitag
Johann Sorbello hatte großartige Laune. Nur noch das Gespräch mit Commissario Moreno über die Piranha-Leiche, und das lang ersehnte Wochenende konnte beginnen.
Von seinem Fenster im dritten Stock des gerichtsmedizinischen Instituts sah er die grünen Ausläufer der Seealpen. Ein Stückchen links davon, verdeckt durch das chaotisch bunte Häusergewirr der Altstadt, ahnte er den tiefblauen Golf von Genua.
Der Himmel war wolkenlos, die Sonne schickte ihre letzten Strahlen des Tages, und für morgen sagte das Internet fünf bis sechs Windstärken voraus. Es würde ein perfekter Surftag werden.
Wenn die Leute ihn, den deutschen Halbitaliener, immer wieder fragten, warum er sich ausgerechnet Genua ausgesucht hatte, konnte er viele Gründe nennen: Da gab es die faszinierende Altstadt mit ihren schmalen schattigen Gassen, in denen keine Autos fuhren und abends die Gerüche von Pasta und Pesto übers Pflaster zogen. Mit dicht gedrängten fünf- bis sechsstöckigen Häusern, zwischen denen man den Himmel nur erhaschen konnte, wenn man den Kopf in den Nacken legte. Wo jede Piazza wie eine Lichtung wirkte, auf der die Sonnenstrahlen endlich Einlass fanden, um prunkvolle Fassaden aus dem 15. und 16. Jahrhundert zu erleuchten.
Dann war da die einzigartige Lage an der Riviera mit Dutzenden von traumhaften Stränden in direkter Nähe und einem milden Klima, bei dem man selbst im November noch zum Baden ins Mittelmeer springen konnte.
Und schließlich war es für ihn natürlich eine große Herausforderung, an der Spitze eines der wichtigen gerichtsmedizinischen Institute Italiens zu stehen.
Doch in den sechs Monaten, die er schon hier war, hatte er schnell gemerkt, dass es noch einen wesentlichen Grund gab, sich in der quirligen Hafenstadt wohlzufühlen: Für leidenschaftliche Windsurfer wie ihn war diese Bucht mit ihren regelmäßigen thermischen Winden, die von den Seealpen aufs Mittelmeer herunterfielen, ein echter Hotspot.
Das Klopfen an der Tür riss Johann aus seiner Vorfreude. Zu seiner Überraschung trat nicht der Leiter der Mordkommission ein, sondern Guido Ferrari, mit vierundzwanzig Jahren jüngster Assistenzarzt am gerichtsmedizinischen Institut.
Guido war klein, schmächtig und demonstrativ homosexuell. Er hatte seine mittellangen Haare weißblond gefärbt, schminkte sich immer sorgfältig und trug mit Vorliebe farbenfrohe Kleidung. Auch heute war sein Make-up perfekt, dazu hatte er ein eng anliegendes schlammfarbenes T-Shirt und eine nachtblaue Stoffhose gewählt.
Johann versuchte wie so oft, ein spontanes Grinsen zu unterdrücken.
Guido dagegen strahlte ihn an. »Dottore, darf ich Sie kurz stören?«
Johann ahnte, dass Guido nicht über wissenschaftliche Ergebnisse mit ihm reden wollte, sondern wieder einmal über seine Alpträume. Am Vorabend hatten sie die Leiche aus dem Piranha-Becken zusammen obduziert.
Er seufzte verstohlen. »Machen Sie es kurz. Ich erwarte jeden Moment Besuch von der Polizei.«
»Dottore, wie schaffen Sie das nur, so etwas nicht an sich heranzulassen? Ich habe die ganze Nacht von diesem zerfressenen Körper geträumt. Selbst wenn ich jetzt die Augen zukneife, sehe ich den gruseligen Totenschädel vor mir.« Guido schloss demonstrativ die Augen und verzog sein Gesicht zu einer seltsamen Grimasse.
Johann atmete tief durch. Zum wiederholten Male fragte er sich, ob Guido ein guter Gerichtsmediziner werden würde. Auf wissenschaftlichem Gebiet war er den anderen Assistenten weit voraus. Er war scharfsinnig und hatte einen guten Blick für das Wesentliche. Auf der anderen Seite nahm er sich praktisch alles zu Herzen, besonders die Leichen auf dem Seziertisch. Während der Untersuchungen funktionierte er perfekt und war augenscheinlich in der Lage, seine Emotionen auszuschalten. Nach getaner Arbeit jedoch überfielen ihn die Eindrücke und Gefühle umso stärker. Nicht gerade hilfreich für einen Gerichtsmediziner.
Und doch war Johann froh, den jungen Mann eingestellt zu haben. Er war ein wohltuender Farbklecks im staubigen grauen Institut. Und: Guido war in dieser oft so feindseligen Umgebung praktisch sein einziger Verbündeter.
»Mein lieber Guido, Sie wissen doch: Wir sind Wissenschaftler. Und auf unserem Tisch liegen keine Schicksale, sondern spannende Untersuchungsaufgaben. Sie müssen das völlig emotionslos sehen. Wer dieser Mensch war und wie viel er möglicherweise gelitten hat, sollte Ihnen absolut egal sein. Wir haben da ein sehr konkretes Rätsel vor uns, und dieses Rätsel gilt es zu lösen.«
Johann war sich schmerzlich bewusst, dass er seinem jungen Assistenten gegenüber gerade nicht ehrlich war. Denn ausgerechnet diese Leiche hatte auch ihn zutiefst berührt. Doch er wollte es sich als Chef nicht leisten, Gefühle zu zeigen.
»Ich weiß ja, Dottore«, antwortete Guido. »Aber es ist wirklich nicht leicht. Wie haben Sie das damals geschafft, als Sie in der Ausbildung waren?«
Johann dachte innerlich staunend darüber nach, dass diese Zeit kaum mehr als zehn Jahre zurücklag. Mit seinen sechsunddreißig Jahren war er gerade mal zwölf Jahre älter als Guido. Der jüngste leitende Gerichtsmediziner im ganzen Land, zudem der einzige Deutsche.
Das erneute Klopfen an der Tür unterbrach seinen Gedankenfluss und erlöste ihn aus der Not, eine gute Antwort auf Guidos Frage zu finden.
Sein Assistent verabschiedete sich sofort und ging, Commissario Bruno Moreno trat ein. Johann registrierte den abfälligen Blick, den er Guido hinterherwarf.
Er schüttelte Moreno die Hand und stellte wieder einmal fest, dass dieser dabei an ihm vorbeisah.
Johann kannte den Leiter der Mordkommission aus mehreren vorangegangenen Ermittlungen. Ein kleiner, schlanker Mann, immer perfekt gekleidet, heute in einem frisch gebügelten Leinenhemd, darüber ein dunkelgraues Sakko. Die mittellangen dunkelbraunen Haare trug er stets mit jeder Menge Gel nach hinten gekämmt. Offensichtlich waren sie gefärbt, Johann konnte nicht die Spur eines grauen Ansatzes entdecken. Mit Mitte fünfzig war das nicht besonders glaubwürdig.
»Tut mir leid, Dottore. Ich konnte nicht früher kommen«, sagte Moreno mit seiner leisen Stimme. »Wir mussten noch einer Spur in der Sache mit der Piranha-Frau nachgehen.«
»Kein Problem«, antwortete Johann. »Wissen Sie mittlerweile, wer sie ist?«
Er hatte schon viele Leichen auf seinem Seziertisch gehabt, denen er buchstäblich nicht mehr ins Gesicht schauen konnte. Besonders unschön waren Körper, die längere Zeit im Wasser gelegen hatten. Sobald sich im Prozess der Leichenfäulnis Teile der Gesichtshaut ablösten, hatte Johann immer wieder mal erlebt, dass selbst hartgesottene Ermittler eine Auszeit von der Sektion brauchten.
Natürlich hatte er auch schon Leichen ganz ohne Kopf seziert. Und einmal hatte ein psychisch gestörter Schlachtermeister seinem Opfer fein säuberlich die Gesichtshaut abgezogen. Ein Anblick, den Johann lange nicht losgeworden war.
Dagegen hatte ihn die Leiche aus dem Piranha-Becken zunächst einmal seltsam kaltgelassen. Alles Menschliche war verschwunden. Die Fische hatten einen Großteil der Haut und auch gewaltige Stücke der Muskulatur weggefressen. Selbst die inneren Organe waren perforiert.
Erst gestern Vormittag war Johann mit Blaulicht ins Aquarium gefahren. Das riesige Gebäude im alten Hafen von Genua war von Dutzenden Polizisten umringt gewesen. An den Kassen davor hatten bereits lange Schlangen von Touristen gestanden, die einerseits darauf hofften, endlich eingelassen zu werden, andererseits aber auch gespannt darauf warteten, dass vor ihren Augen irgendetwas passieren könnte.
Am Tatort selbst hatte es für ihn nicht viel zu tun gegeben. Auf die erste Untersuchung der Leiche im Becken hatte er verzichtet; es war einfach zu gefährlich. Er ordnete also zunächst an, dass die Kriminaltechniker vorsichtig Wasserproben entnahmen. Danach stand die Frage im Raum, wie die Männer von der Spurensicherung die Leiche aus dem Aquarium herausheben sollten. Auch mit Handschuhen schien das Risiko, verletzt zu werden, zu groß. Schließlich brachte der Tierpfleger mehrere lange Metallgreifer, die normalerweise dazu benutzt wurden, das Becken innen zu säubern. Damit gelang es den Polizisten schließlich, den Körper zu fassen und auf eine Plane zu legen.
Ein Blick genügte Johann, um zu erkennen, dass er die Untersuchung nicht dort, sondern im gerichtsmedizinischen Institut fortsetzen würde. Das Einzige, was er mit einem speziellen Tatortthermometer überprüfte, war die Temperatur im Inneren des Restkörpers. Siebenundzwanzig Grad – genau die Temperatur des Aquariumwassers. Für die Ermittlung des Todeszeitpunktes half ihm das nicht weiter. So, wie die Leiche aussah, musste sie schon ein paar Stunden im Becken gelegen haben.
Kurz darauf war das, was von dem unbekannten Menschen übrig geblieben war, vorsichtig auf seinem Sektionstisch ausgepackt worden. Und er hatte untersucht, was möglich gewesen war.
Johann konnte sich nicht daran erinnern, dass ihm ein Opfer jemals so wenige Anhaltspunkte zur Analyse geboten hatte. Für die Identifizierung gab es weder ein Gesicht noch Fingerabdrücke. Nur die DNA und der Zahnstatus lagen vor. Die Piranhas hatten zwar das Zahnfleisch angenagt, das Gebiss war aber weitgehend unversehrt geblieben. Schon daraus konnte Johann ersehen, dass er einen relativ jungen Menschen vor sich liegen hatte. Das Skelett gehörte zu einer Frau, sie musste zwanzig bis dreißig Jahre alt gewesen sein, etwa einen Meter sechzig groß, keine erkennbaren Knochenbrüche.
Wie immer, wenn er eine Leiche aufs Genaueste untersucht hatte, war er in diesem Moment gespannt, welcher Mensch, welches Leben diese sterbliche Hülle ausgefüllt hatte. Er wartete auf die Antwort des Commissario.
Moreno blickte aus dem Fenster, als er schließlich sprach. »Sie heißt Francesca Ermia, war vierundzwanzig Jahre alt und Sekretärin in einer Firma. Sie wurde gestern von ihrer besten Freundin als vermisst gemeldet. Wir haben ihren Zahnarzt gefunden und ihm den Zahnstatus geschickt. Er hat vorhin angerufen und bestätigt, dass es sich um seine Patientin handelt.«
»Haben Sie schon einen Verdacht, wer ihr das angetan haben könnte?«
Moreno sah irgendwo in die ligurische Berglandschaft und antwortete nicht. Offenbar hatte er nicht vor, Johann weitere Details über die tote Frau im Piranha-Becken zu erzählen. Stattdessen stellte jetzt er die Fragen.
»Was können Sie mir über die Todesursache sagen? Wir haben das ganze verdammte Fischbecken leeren lassen. Vorher wurde stundenlang jeder einzelne beschissene Piranha mit einem Kescher herausgefischt. Gefunden haben wir nichts. Keine Waffe, keine Kleidungsreste, keinen Schmuck, gar nichts.«
Johann öffnete den Ordner, den er auf seinem Tisch bereitgelegt hatte. »Vielleicht das Wichtigste zuerst: Die Frau war schon tot, als sie in das Becken geworfen wurde. Ihre Lunge war als einziges Organ fast unverletzt. Wir haben kein Wasser darin gefunden. Also ist sie nicht ertrunken.«
»Könnte es nicht sein, dass die Fische sie getötet haben?«
Johann hatte die Frage erwartet. Er hatte selbst eine Weile darüber nachgedacht.
»Zwei Gründe sprechen dagegen: Erstens, wenn die Fische sie bei lebendigem Leibe gefressen hätten, wäre sie im Becken verblutet. In dem Fall hätten wir im Wasser mehr Blut finden müssen. Aber in unseren Proben gab es erstaunlich wenig Blut. Das bedeutet, der Blutkreislauf war schon lange unterbrochen, als die Piranhas ihr die erste Wunde zufügten. Zweitens, und damit kommen wir zur wahrscheinlichen Todesursache: In der Lunge gab es zwar kein Wasser, aber etwas anderes. Und das habe ich offen gestanden in meiner Karriere noch nicht erlebt. In ihrer Lunge identifizierten wir Öl, sehr wahrscheinlich Olivenöl.«
Moreno wirkte erstaunlich gelangweilt. »Was bedeutet das?«
»Das bedeutet, dass sie ziemlich sicher an Olivenöl erstickt ist. Wenn es so etwas gäbe wie ein Schwimmbecken mit Olivenöl, würde ich sagen, sie ist darin ertrunken. Wie gesagt, ich kenne keine Präzedenzfälle. Ansonsten gibt es keine Verletzungen, die nicht von den Fischen herrühren.«
»Kann jemand ihr das Öl eingeflößt haben? So lange, bis sie keine Luft mehr bekommen hat?«
»Denkbar wäre das. Normalerweise hätten wir in diesem Fall Blutergüsse oder andere Anzeichen von Gewalt an ihrem Gesicht und ihrem Hals entdecken müssen. Aber leider haben uns die Fische ja die Möglichkeit genommen, solche Indizien aufzuspüren. Wenn ich ein Handbuch für den perfekten Mord schreiben müsste, bekäme die Entsorgung der Leiche in einem Piranha-Becken definitiv ein eigenes Kapitel. Ich kann mir kaum eine bessere Methode vorstellen, alle Spuren zu verwischen.«
Moreno zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche und sah Johann mit einem Mal scharf ins Gesicht. »Darf ich?« Die Frage war reine Floskel.
Johann schob ihm den Aschenbecher über den Tisch. Er selbst hatte sich das Rauchen im Medizinstudium abgewöhnt, schwer beeindruckt von der schwarz angelaufenen Teerlunge eines Kettenrauchers, die er mit den Kommilitonen im Präparationskurs seziert hatte.
Hier in Italien schienen fast alle Menschen zu rauchen. Im Institutsgebäude war das Rauchen zwar schon seit Jahren streng verboten. Und trotzdem wurde der Aschenbecher im Büro des obersten Gerichtsmediziners von Genua regelmäßig benutzt. Gewohnheitsrecht, es schien schon immer so gewesen zu sein, auch bei Johanns Vorgänger, Dottor Alessandro Bertoli, dem früheren Leiter der Gerichtsmedizin. Fast zwanzig Jahre lang hatte Bertoli dieses Zimmer okkupiert. Vor einem Jahr war der damals Neunundfünfzigjährige suspendiert worden. Sechs Monate danach hatte Johann das Büro übernommen. Von Anfang an war ihm, dem »Tedesco«, dem Deutschen, von fast allen Institutsmitarbeitern kaum verhohlene Feindseligkeit entgegengeschlagen. Da schien es ihm übertrieben deutsch, gleich zu Beginn seines neuen Jobs den fanatischen Nichtraucher zu spielen. Er hatte den Aschenbecher auf seinem Konferenztisch stehen lassen.
Commissario Moreno zündete sich eine Zigarette an und führte sie mit einer seltsam affektierten Geste zum Mund. Er inhalierte tief und fragte: »Okay, was gibt es noch? Anzeichen von Drogen oder Alkohol?«
»Soweit wir das feststellen können: weder Alkohol noch andere Drogen. Der Todeszeitpunkt ist schwer einzugrenzen, irgendwann zwischen sechs Uhr abends und Mitternacht. Wahrscheinlich hat sie nichts zu Abend gegessen. Jedenfalls konnten wir im Magen sowie in den Wasserproben keine Rückstände menschlicher Nahrung finden. In ihrer Vagina fanden sich aber Spuren von Sperma. Wir können leider nicht mehr herausfinden, ob sie vergewaltigt wurde oder einfach nur kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr hatte. Die DNA des Spermas haben wir jedenfalls analysiert.«
Moreno blies Rauch in die Luft und grinste derb. »Wenigstens hat sie vor ihrem Tod noch ein bisschen Spaß gehabt. Okay, was noch?«
Johann blätterte eine Seite in seinem Ordner um. Er war gespannt, ob sich Moreno endlich zu einer emotionalen Reaktion hinreißen lassen würde. Denn was als Nächstes kam, war der Teil der Untersuchung, der ihn selbst aus dem Gleichgewicht gebracht hatte.
Er erinnerte sich genau an den Augenblick. Vorsichtig hatte er das, was von der Gebärmutter übrig gewesen war, freigeschnitten und aus dem Körper herausgehoben. Normalerweise wurden die Organproben erst im Nachhinein analysiert. Aber bei dieser Leiche war eben nichts normal. Da die Piranhas auch hier gewütet hatten, konnte er in die Gebärmutter hineinschauen. Und sah den Embryo beziehungsweise das, was von ihm übrig war. Der Anblick des angefressenen Fötus hatte Johann die Tränen in die Augen getrieben. In diesem Moment war es vorbei gewesen mit der professionellen Distanz, die er vorher erst wieder dem jungen Guido empfohlen hatte.
»Der Tote als wissenschaftliches Objekt, in dem es richtig zu lesen gilt.« – Johann erinnerte sich nur zu gut an den Leitspruch seines Berliner Professors. Er hatte immer gut damit gelebt und sich nur selten dafür interessiert, welche Schicksale hinter den Körpern auf seinem Tisch gesteckt hatten. Aber die Vorstellung, dass die Fische ihre Zähne in diese Leibesfrucht geschlagen hatten, hatte ihn erschauern lassen.
Jetzt sagte er ruhig: »Sie war im fünften Monat schwanger. Es wäre ein Mädchen geworden. Wir konnten die DNA feststellen, obwohl die Fische einen Teil des Embryos gefressen haben. Der Vater ist ziemlich sicher derselbe Mann, von dem das Sperma stammt.«
Moreno sah ihn mit müden Augen an. Ob ihn die Nachricht berührte, war nicht zu erkennen. »Gut, das ergibt vielleicht einen Sinn.«
»Was meinen Sie, gibt es schon einen Verdächtigen?«
Moreno bequemte sich nun doch zu einer Antwort: »Der Freund des Opfers ist verschwunden. Er arbeitete als Tierpfleger im Aquarium. Er hatte jedenfalls die Möglichkeit, sich dort Zutritt zu verschaffen. Wir haben keine Einbruchsspuren gefunden.«
»Aber warum sollte er die Leiche ausgerechnet im Piranha-Becken ablegen?«
»Das werden wir ihn fragen, wenn wir ihn gefunden haben. Vielleicht haben sie Streit gehabt. Vielleicht ist er durchgedreht. Die beste Freundin sagt zwar, dass die beiden ein Herz und eine Seele waren. Aber sie war nicht besonders kooperativ. Keine Ahnung, ob die blöde Kuh die Wahrheit sagt.«
»Und das Öl?«
Moreno wirkte genervt. »Keine Ahnung. Vielleicht stand die Olivenölflasche gerade auf dem Tisch in Reichweite. Vielleicht haben sie sich über das richtige Salatdressing gestritten. Dann hat er sie eben gepackt und ihr das Öl in den Hals gegossen. Was weiß ich?« Er stand auf. Ein deutliches Signal, dass das Gespräch für ihn beendet war.
Johann merkte, dass Morenos herablassende Art ihm die gute Laune nahm. »Warten Sie einen Moment, Commissario. Ich glaube nicht, dass ihr das Öl eingeflößt wurde. Wenn ein Mann in Wut gerät, wenn er eifersüchtig ist oder was auch immer, dann würde er zuschlagen, vielleicht zum Messer greifen. Normalerweise erwürgen gehörnte Ehemänner ihre Frauen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Inhalt einer Ölflasche reicht, um einen Menschen damit zu ersticken. Das Opfer würde sich wehren, würde husten, würde einen Teil wieder ausspucken.«
»Wer weiß das schon? Sie sagen ja selbst, es gibt keine Präzedenzfälle. Vielleicht hat der Wichser sie bewusstlos geschlagen, ihr das Öl in den Mund gekippt und ihr die Nase zugehalten. Er wird es uns hoffentlich bald erzählen.« Moreno wandte sich zur Tür.
Doch Johann ließ nicht locker: »Zwei Dinge noch: Wir haben eine Analyse des Öls in Auftrag gegeben. Es gibt da spezielle Verfahren, mit denen man feststellen kann, um welche Sorte es sich handelt. Das wird aber ein paar Tage dauern. Und noch etwas Seltsames. Dem Opfer fehlte ein Schneidezahn, der zweite oben rechts. Keine Ahnung, warum. Jedenfalls glaube ich nicht, dass die Fische ihn gefressen haben. Soweit ich weiß, hat man ihn auch nicht im Becken gefunden.«
Johann hielt kurz inne, um sich zu konzentrieren. Die Sache mit dem Schneidezahn weckte eine Erinnerung in ihm. Schon als er die Tatsache des fehlenden Zahns bei der Sektion in sein Diktiergerät gesprochen hatte, war ihm der Anflug eines Gedankens gekommen. Eine Assoziation, eine Idee, vielleicht ein anderer Fall?
Wieder versuchte er, sich konkret zu erinnern, was sich dahinter verbarg, wieder vergeblich. Also fuhr er fort.
»Das mit dem Zahn ist umso auffälliger, als sie ansonsten ein perfektes Gebiss hatte. Sie sollten den Zahnarzt fragen, ob sie deswegen in Behandlung war.«
Moreno war stehen geblieben. Er zog ein etwa zehn mal fünfzehn Zentimeter großes Farbfoto aus der Tasche seines Sakkos und schaute es sich an.
»Also hier auf dem Bild hat sie keine Zahnlücke. Die Freundin hat es aufgenommen. Sie sagt, die Aufnahme sei erst ein paar Tage alt.«
»Darf ich mal sehen?«
Johann war tatsächlich neugierig. Die seltsamste Leiche seines Lebens bekam ein Gesicht.
Eine schöne dunkelhaarige Frau sah ihn an. Ein schmales Gesicht, hohe Wangenknochen, intensive dunkelbraune Augen. Sie schenkte der Kamera ein strahlendes Lächeln. Ihre Zähne waren makellos. Aber das war es nicht, was Johann aus der Fassung brachte.
Er starrte das Bild von Francesca Ermia an, hörte seinen Puls in beiden Ohren hämmern, spürte die aufsteigende Hitze in seinem Gesicht. Er wendete sich ab, um zu verbergen, dass er rot geworden war, ging zum Fenster und holte erst einmal tief Luft. Doch Moreno hatte seine Aufregung bemerkt.
»Was ist los? Kennen Sie die Frau etwa?«
»Nein. Aber sie sieht genauso aus wie eine Frau, die ich einmal kannte.« Johann zögerte ein paar Sekunden lang. »Sie wurde auch ermordet. Sie ist sozusagen ein Geist aus meiner Vergangenheit.«
Er hatte nicht vor, dem Commissario zu erzählen, welche Geschichte dahintersteckte.
3
Samstagmorgen
»Caffè al banco 1 Euro«, stand auf einer kleinen Tafel unter dem großen Wandspiegel. Wie in fast allen Genueser Cafés kostete der Espresso im Stehen an der Theke fünfzig Cent weniger als im Sitzen an einem der Tische. Dass in dieser Gegend viele Millionäre wohnten, schien sich auf die Preise der Bar nicht auszuwirken.
Johann legte eine Münze auf den Tresen und bestellte seinen caffè. Der Barista, ein älterer Herr mit Anzugweste und Fliege, griff nach einer vorgewärmten Tasse. Während die Espressomaschine brummte, drehte sich Johann um und musterte die Menschen im Raum. Besonders reich sah hier niemand aus. Der junge Mann mit dem dicken Bauch, der einen Tisch weiter saß, wirkte eher bedürftig. Er nippte an seinem crodino und schaufelte gewaltige Mengen stuzzichini in sich hinein, kleine belegte Brothappen, Oliven und Kartoffelchips, die zu jeder Art von Drink umsonst serviert wurden. Auch der Handwerker im staubigen Overall, der neben Johann an der Theke stand, hatte nicht den Anschein von Wohlstand. Weißgraue Dreadlocks, ein zerfurchtes Al-Pacino-Antlitz, Hände, denen man die tägliche harte Arbeit ansah. Er tunkte seine Brioche in den Cappuccino, verschlang das Gebäck, leerte die Tasse und ging. Das typische italienische Frühstück.
Johann nahm einen Schluck von seinem Espresso und grübelte darüber nach, warum er an einem Samstagmorgen ausgerechnet in dieses Viertel von Genua aufgebrochen war. Zu einer Adresse, die ihm Commissario Moreno zunächst gar nicht geben wollte, als er ihn am Abend zuvor angerufen hatte.
»Was wollen Sie von ihr? Hören Sie, Dottore. Das sind unsere Ermittlungen. Außerdem ist die Dame, vorsichtig formuliert, nicht besonders kooperationswillig. Ich habe kaum einen ganzen Satz aus ihr herausbekommen. Wollen Sie Detektiv spielen?«
Johann war durchaus bewusst gewesen, dass Moreno recht hatte. Und doch hatte er ihn weiter bedrängt. Irgendwann hatte Moreno nachgegeben und ihm gesagt, wo die beste Freundin der Piranha-Leiche wohnte. Allerdings nicht ohne einen mahnenden Hinweis mit den üblichen Fäkalbegriffen:
»Dottore, ich weiß ja nicht, was für eine Scheißgeschichte dahintersteckt. Ich möchte nur sehr deutlich formulieren: Mischen Sie sich nicht ein!«
»Nein, natürlich nicht«, hatte Johann ruhig geantwortet und es in dem Moment ernst gemeint.
Jetzt war er sich nicht mehr so sicher. Dass Commissario Moreno seinen Hinweis auf das Olivenöl einfach ignorierte, wurmte ihn. Und die Erinnerung an das schöne Gesicht auf dem Foto ließ ihn nicht los.
Er goss den süßlich cremigen Espresso in einem Zug hinunter und verließ die Bar.
***
Enza Marconi schaute auf das Meer. Von ihrem zwei mal drei Meter großen Panoramafenster im sechsten Stock des Palazzo Lupi konnte sie die ganze Bucht vor Genua überblicken. Der Wind peitschte Gischt über die Wellenkämme. Bunte Segel flitzten auf und ab. Die Windsurfer waren wieder unterwegs.
Wenn sie hier stand, fragte sie sich oft, wie es sich wohl anfühlen mochte, nur auf einem Brett mit Segel über das Mittelmeer zu rasen.
Das Geräusch der Türklingel riss sie aus ihren Gedanken. Sie hatte keine Ahnung, wer um diese Zeit etwas von ihr wollen könnte. Zehn Uhr morgens an einem Samstag. War es wieder der ekelhafte Commissario?
Sie ging zur Tür und sah auf den Monitor der Sprechanlage. Ein dunkelhaariger Mann, vielleicht Mitte dreißig, gut aussehend, aber wildfremd. Sie drückte auf die Sprechtaste. »Ja, bitte?«
»Guten Morgen. Mein Name ist Johann Sorbello. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich?«
Der Mann lächelte in die Kamera. Er sah wirklich gut aus.
Enza zögerte, drückte wieder auf die Taste. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
»Ich möchte mit Ihnen über Francesca Ermia sprechen.«
Enza war sprachlos. Erst am Vortag war die Polizei bei ihr gewesen. Und man hatte ihr mit keinem Wort verraten, was wirklich passiert war. Nur dass Franca nicht mehr lebte. Natürlich hatte sie von der Leiche im Piranha-Becken gelesen. Zeitungen und Fernsehen überboten sich mit Gruselstorys. Aber bisher wusste niemand, wer das Opfer war.
Ihre Gedanken überschlugen sich. Toni arbeitete doch im Aquarium. Und auch er war verschwunden. Was um Himmels willen war geschehen?
»Hallo! Sind Sie noch da?«
Die Stimme des Mannes vor ihrem Haus holte sie zurück in die Gegenwart. »Ja, Entschuldigung. Ich verstehe nicht, wie ich Ihnen helfen kann.«
»Verzeihen Sie, dass ich Sie so überfalle. Ich bin Gerichtsmediziner. Die Polizei hat mir gesagt, dass Sie Francescas beste Freundin waren. Ich muss einfach mit Ihnen sprechen. Bitte.«
Enza sah an sich herab. Sie trug eine labbrige Jogginghose, darüber ein verwaschenes Schlafshirt. Ihre Haare standen kreuz und quer vom Kopf ab. Sie hatte sich noch nicht einmal die Zähne geputzt. Ein Alptraum. Sie überlegte kurz und fällte eine Entscheidung.
»Kommen Sie hoch und wundern Sie sich nicht. Ich war gerade im Bad und brauche noch fünf Minuten.«
***
Johann betrat den Palazzo und sah sich erstaunt um. Das prachtvolle Gebäude aus dem 16. Jahrhundert war offensichtlich vor Kurzem luxussaniert worden. Francescas beste Freundin musste sehr wohlhabend sein. Die Adresse hatte ihn jedenfalls überrascht. Am Belvedere Luigi Montaldo tummelten sich auf der Straße die Touristen, von hier aus hatte man einen grandiosen Blick über Stadt und Hafen. Im Gebäude darüber lagen angeblich die teuersten Apartments von Genua.
Im sechsten Stock wartete die nächste Überraschung auf ihn. Nur zwei Eingänge gab es im Etagenflur, der in einer geschmackvollen Kombination von Schiefer und Marmor glänzte. Die beiden Apartments mussten riesig sein, so wie die Wohnungstüren. Sie waren bestimmt drei Meter hoch und bestanden aus massivem, matt geöltem Kastanienholz. Vor etwa fünfhundert Jahren, als Genua noch reichste Stadt der Welt gewesen war, hatte ein ganz normaler Handwerker Olivenzweige und Löwenköpfe in das Türblatt geschnitzt.
Johann fuhr mit den Fingern die Ornamente entlang. Er freute sich jedes Mal, wenn er den Spuren von Genuas großartiger Vergangenheit begegnete.
Rechts war die Tür nur angelehnt. Johann blickte aufs Klingelschild. Zwei Buchstaben: E. M. Er klopfte und wartete.
Keine Reaktion.
Vorsichtig trat er ein. Mit einem sanften Schnappen fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Von hinten hörte er eine gedämpfte Stimme.
»Machen Sie es sich bequem. Ich bin gleich da.«
Johann trat zum riesigen Fenster. In der Bucht sah er die Segel der Windsurfer. Ein Gefühl der Wehmut befiel ihn. Doch sein Surfbrett musste warten, er hatte sich nun mal für diesen Besuch entschieden.
Er sah sich um. Das Zimmer war bestimmt vierzig Quadratmeter groß. Links stand ein gewaltiges schlichtes graues Sofa. Rechts befand sich eine dunkelrote Küchenzeile. An der Wand neben dem Fenster ein Schreibtisch mit Laptop und einem Stapel Papier. In der Mitte auf dem geölten Parkettfußboden lagen ein paar große bunte Kissen, ansonsten war der Raum praktisch leer. Trotzdem strahlte das Zimmer eine angenehme Gemütlichkeit aus. Die Frau, die hier wohnte, hatte Geschmack.
Johann hörte das Geräusch eines Föhns. Er setzte sich auf das Sofa und ließ seine Gedanken schweifen. Wenn er ehrlich war, begriff er nur zum Teil, warum er sich auf den Weg in diese Wohnung gemacht hatte, anstatt auf seinem Surfbrett über die Wellen zu gleiten.
Die Piranha-Leiche hatte ein Gesicht bekommen. Ein Antlitz, das nun schon zum zweiten Mal in seiner Seele brannte. Die Ähnlichkeit war frappierend. Er erinnerte sich an jedes Detail. Montagmorgen, 23. Juni 2009. Ihr Name war Hülya Demirek, und sie sah unglaublicherweise genauso aus wie Francesca Ermia.
Johann hatte manchmal davon gelesen, dass es solche Zufälle gab. Dass einander wildfremde Menschen sich ähnelten wie eineiige Zwillinge. Aber er hatte es noch nie selbst erlebt. Wieder sah er Hülya vor sich. Sie lächelte nicht, sie schaute ihn flehend an. Er sah das Blut aus den Schusswunden strömen. Und er fühlte wieder diesen plötzlichen Anflug der totalen Panik.
»Darf ich Ihnen einen caffè anbieten?«
Johann blickte auf. Er hatte nicht gemerkt, dass Enza Marconi den Raum betreten hatte. Vor ihm stand eine Frau, die vollkommen anders aussah als das Gespenst aus seiner Vergangenheit. Er spürte, dass ihn das erleichterte. Enza Marconi war schlank und für eine Italienerin ungewöhnlich groß, bestimmt einen Meter fünfundsiebzig. Erstaunlicherweise trug sie zu Hause hochhackige Sandaletten, was sie noch einmal um fünf Zentimeter größer machte.
Johann stand auf, um ihr die Hand zu schütteln, und fand sich annähernd auf einer Höhe mit ihr: braune Augen, kurze flachsblonde Haare, schöne volle Lippen. Sie sah frech aus, als sie ihn anlächelte. Ihre sinnliche Ausstrahlung brachte ihn kurz aus der Fassung. Dann erinnerte er sich, dass sie ihm einen Espresso angeboten hatte.
»Ja gern, aber nur wenig Zucker bitte.«
Sie lächelte weiter. »Vielleicht wollen Sie mir in der Zwischenzeit erzählen, wer Sie sind und was Sie eigentlich von mir wollen.« Ihre Stimme war dunkel, fast heiser. Sie klang älter, als sie war. Johann schätzte sie auf Anfang dreißig, vielleicht ein paar Jahre mehr.
Sie ging leichtfüßig durch den Raum zur Küchentheke, wo eine gewaltige Espressomaschine stand. Sie war es sichtlich gewöhnt, auf hohen Absätzen zu gehen.
Johann schaute ihr fasziniert hinterher. Seine Gastgeberin trug schwarze, eng anliegende Designerjeans, die ihre langen Beine betonten. Darüber eine leicht schimmernde dunkelbraune Seidenbluse. Als sie eine Tasse aus dem Regal nahm, konnte Johann im Profil ihren kleinen Busen erahnen. Sie erinnerte ihn an ein Model auf dem Laufsteg.
***
Enza drückte auf den Knopf. Die Maschine mahlte scheppernd eine Portion Kaffeebohnen. Während der Espresso in die Tasse lief, musterte sie verstohlen ihren Gast. Er sah in Wirklichkeit noch besser aus als auf dem Videomonitor. Schlank, sportlich, mit Jeans und T-Shirt leger gekleidet. Ungewöhnlich leger für einen Italiener. Sein Gesicht und seine Hände waren von der Sonne gebräunt. Braune, struppige Haare um ein freundliches Gesicht, die Haarspitzen ein bisschen heller, wie vom Salzwasser ausgebleicht. Einen Gerichtsmediziner hatte sie sich anders vorgestellt.
»Ich heiße Johann Sorbello und bin Leiter der Gerichtsmedizin hier in Genua.«
Er sprach perfektes Italienisch. Und doch war da ein Akzent, den sie nicht einordnen konnte. Irgendwie charmant, dachte sie. Der Mann aus der Gerichtsmedizin gefiel ihr. Doch seine nächsten Worte brachten sie wieder zurück in die Realität.
»Ich habe von der Polizei erfahren, dass Sie die beste Freundin von Francesca Ermia waren. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu ihr stellen?«
»Warum? Was haben Sie mit der Sache zu tun?«
Der Mann zögerte. »Ich habe ihre Leiche untersucht.«
Enza merkte, wie ihre Traurigkeit zurückkam. Sie reichte ihm den Espresso, setzte sich auf ein Kissen und bemühte sich, ruhig zu sprechen.
»War sie es? Ist Franca die Leiche aus dem Piranha-Becken?«
»Ich darf darüber offiziell nicht reden. Aber ja, sie war es.«
Sie schluckte, doch das Schluchzen in ihrer Kehle ließ sich nicht unterdrücken. Sie fühlte die Tränen auf ihren Wangen und wandte sich ab. »Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment.« Sie rannte zurück ins Bad, putzte sich die Nase, wusch sich das Gesicht.
Drei Minuten später war sie mit ihrem Make-up wieder zufrieden. Als sie zurück in die Wohnküche kam, sah der fremde Gast sie erwartungsvoll an. Sie versuchte, sich zusammenzureißen.
»Tut mir leid. Franca war wirklich meine beste Freundin. Ich kann einfach noch nicht glauben, dass …« Der Kloß im Hals erstickte ihre Stimme.
Der Mann auf dem Sofa ergriff wieder das Wort. »Ich bedaure es auch sehr, dass ich Ihnen das erzählen musste. Es ist nur so, dass die Umstände ihres Todes so seltsam und ungewöhnlich sind, dass ich einfach mehr über sie erfahren möchte.«
»Was für ein Mistkerl könnte so etwas tun? Wie gestört muss man sein, um jemand den Piranhas vorzuwerfen?« Enza bremste sich und setzte neu an. »Was ist denn überhaupt passiert?«
Wieder dieses Zögern auf der anderen Seite.
»Ich dürfte gar nicht mit Ihnen sprechen. Alles, was ich Ihnen erzähle, fällt unter die Schweigepflicht. Sie müssen mir zusichern, dass Sie mit niemandem darüber reden.«
»Kein Problem. Ich wüsste auch keinen Menschen, mit dem ich darüber sprechen möchte.«
»Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, was genau passiert ist. Sie wurde am Mittwochmorgen im Aquarium gefunden. Jemand hat sie getötet und ihre Leiche danach dort abgelegt. Alles andere ist sehr schwierig zu bestimmen, weil die Untersuchung der Leiche kompliziert ist. Ich muss zugeben, es fällt mir nicht leicht, die Umstände konkreter zu beschreiben.«
Enza merkte, wie der Mann vor ihr nach Worten suchte. Sie fürchtete sich vor dem, was er sagen wollte. Aber sie wollte die Wahrheit wissen.
»Haben die Piranhas sie gefressen?«
»Ja, jedenfalls zum Teil. Aber sie war definitiv schon tot, als das passierte.«
Enza holte tief Luft, versuchte, die Bilder aus einem Horrorfilm, die vor ihrem inneren Auge erschienen, irgendwie auszuknipsen. Die ruhige Autorität, die Johann Sorbello ausstrahlte, half ihr dabei, sich auf Inhalte zu konzentrieren.
»Woran ist sie denn gestorben?«
»Auch das ist äußerst seltsam. Wir glauben, dass sie an Olivenöl erstickt ist. Jedenfalls haben wir Öl in ihrer Lunge gefunden.«
Enza wurde eiskalt. Ausgerechnet Olivenöl! Konnte das ein Zufall sein? In ihrem Kopf schien sich alles zu drehen. Sie blieb eine Weile still, bemüht, einen klaren Gedanken zu greifen. Dann fasste sie einen Entschluss.
»Okay, was wollen Sie von mir wissen?«
***
Johann merkte es sofort. Die Atmosphäre hatte sich verändert. Plötzlich wirkte Enza Marconi weniger weich, weniger traurig. Ein harter Zug hatte sich in ihr schönes Gesicht eingeschlichen. Eine senkrechte Linie auf ihrer Stirn, die sie älter aussehen ließ. Sie zündete sich eine Zigarette an. Er stellte seine erste Frage.
»Wann haben Sie Francesca zuletzt gesehen?«
»Am letzten Wochenende. Sonntagabend war ich mit ihr und ihrem Freund Toni essen. Wir haben uns im Fischrestaurant ›Da Rina‹ getroffen.«
»Ist Ihnen etwas aufgefallen?«
»Nein, wir hatten Spaß. Das Essen war gut. Wir haben viel Wein getrunken. Alles war wie immer.«
»Und danach?«
»Franca und ich, wir hatten uns für Mittwochabend verabredet. Wir wollten uns um achtzehn Uhr im ›Caffè degli Specchi‹ auf einen Aperitif treffen. Doch sie war nicht da. Um Viertel nach sechs rief sie mich an und sagte, sie müsse nur noch kurz etwas erledigen, spätestens um sieben würde sie nachkommen.«
»Aber sie kam nicht?«
»Nein. Als sie um Viertel nach sieben noch nicht da war, habe ich versucht, sie anzurufen. Aber ihr Handy war nicht erreichbar, wahrscheinlich ausgeschaltet. Ich habe es immer wieder probiert, weil ich mir Sorgen machte. Franca kommt nie zu spät. Und sie ist immer total zuverlässig. Ich habe in der Nacht nicht gut geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich an ihrer Tür geklingelt. Niemand hat aufgemacht. Danach habe ich die Polizei angerufen.«
»Und ihr Freund? Wie heißt er noch mal?«
»Antonio. Aber alle nennen ihn Toni. Der ist auch verschwunden. Die beiden wohnten ja zusammen. Ist er etwa auch tot?«
»Das weiß ich nicht. Die Polizei sucht nach ihm. Haben die beiden sich manchmal gestritten?«
»Warum fragen Sie? Glauben Sie etwa, dass Toni etwas damit zu tun hat?«
Johann rang mit sich. Spätestens an diesem Punkt musste er sich disziplinieren. Was der Commissario ihm erzählt hatte, war definitiv Ermittlerwissen und damit streng geheim. Er versuchte auszuweichen.
»Ich glaube gar nichts. Was ich denke, spielt auch keine Rolle.«
Er spürte sofort, dass Enza Marconi ihn durchschaute. Ihr Blick war weiter wie versteinert, aber ein Hauch von einem Lächeln umspielte ihre Lippen. Er wurde einfach nicht schlau aus ihr.
»Hören Sie«, sagte sie schließlich. »Wenn ich Ihnen vertraue, müssen Sie mir auch vertrauen. Ich begreife sowieso nicht, warum Sie hier bei mir sitzen. Selbst wenn Sie der zuständige Gerichtsmediziner sind, was haben Sie mit der Suche nach dem Mörder zu tun?«
Johann überlegte. Wie viel durfte, wie viel wollte er ihr sagen? Er war sich ja selbst über seine Motive noch nicht im Klaren. Aber wenn er weiterkommen wollte, musste er da jetzt durch.
»Sie haben recht. Ich habe Sie gerade erst kennengelernt. Und Ihnen kommt das Ganze natürlich merkwürdig vor. Ich bin hier, weil mich der Tod Ihrer Freundin zutiefst aufgewühlt hat. Francesca Ermia erinnert mich an eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Da gibt es etwas, das mich hierhergetrieben hat, das ich herausfinden muss.«
Enza schien zu begreifen, dass er nicht konkreter werden wollte. »Bitte nennen Sie sie Franca. Sie hasst es, mit ihrem vollen Namen angesprochen zu werden«, sagte sie und zögerte, ehe sie mit fester Stimme weitersprach. »Ich muss wohl sagen, sie hat es gehasst. Also noch mal: Wird Toni etwa verdächtigt?«
»Ja, die Polizei glaubt, dass er es war. Er hatte einen Schlüssel zum Aquarium. Und er ist verschwunden. Das alles spricht gegen ihn.«
»Das ist doch totaler Quatsch. Ich habe noch nie ein Paar erlebt, das sich so sehr geliebt hat. Toni war vielleicht ein bisschen seltsam. Aber er hätte alles für Franca getan. Das ist absolut unvorstellbar.«
Johann horchte auf. »Was meinen Sie mit ›ein bisschen seltsam‹?«
»Na ja, er konnte sehr verschlossen sein. Die beiden kommen aus irgendeinem Dorf oben in den Bergen. Dort haben sie sich auch kennengelernt. Aber wenn man danach fragte, lenkte er immer ab oder war sehr still. Er hat ein totales Geheimnis daraus gemacht. Und wenn ich ehrlich bin, war das bei Franca genauso. Sie war meine beste Freundin, und trotzdem weiß ich nichts über ihre Familie und über ihre Herkunft. Die Polizei hat mich gefragt, wer ihre nächsten Verwandten sind. Ich habe keine Ahnung. Die beiden sind auch nie nach Hause gefahren. Dennoch, Franca und Toni waren ein Herz und eine Seele.«
Johann spürte, dass sie die Wahrheit sagte. Ihre Augen leuchteten, die Stirnfalte war wieder verschwunden.
»Wussten Sie, dass Franca schwanger war?«
Die Frage traf Enza wie ein Faustschlag. »Ja, sie hat es mir erzählt. Ich glaube, ich war die Einzige außer Toni, die Bescheid wusste. Sie war so glücklich.«
»Kann es sein, dass die beiden darüber in Streit geraten waren?«
»Auf keinen Fall. Er hat sich gefreut wie ein Wahnsinniger.«
Enza Marconi stand auf und ging zu ihrem Schreibtisch. Aus einer Schublade holte sie ein Foto und gab es ihm.
Er blickte in drei lachende Gesichter. Enza mit ihrem blonden Bubikopf in der Mitte, links von ihr das schöne Gesicht, das er schon kannte. Es versetzte ihm wieder einen Stich, auch wenn die Ähnlichkeit bei diesem Bild nicht ganz so extrem war. Rechts ein sympathisch aussehender Mann mit kahl rasiertem Kopf.
Johann wusste aus Erfahrung, dass es viele Mörder mit netten Gesichtern gab. Aber Enzas Beschreibung von Toni wirkte auf ihn überzeugend. »Darf ich das Foto behalten?«
»Ja, ich habe die Datei auf meinem Computer.«
Johann dachte einen Moment nach. »Wenn es nicht Toni war, wer könnte sonst einen Grund gehabt haben, Franca umzubringen? Und warum ist Toni verschwunden?«
Enza sah ihn an, zuckte hilflos mit den Schultern. »Vielleicht wurde er ja auch umgebracht.«
»Klar, das ist möglich.« Johann erinnerte sich an den Zahnstatus der Leiche. »Wissen Sie, ob Franca kürzlich einen Unfall hatte? War sie vielleicht beim Zahnarzt? Ihr fehlte nämlich ein Schneidezahn.«
Enza schüttelte den Kopf. »Sie hatte die schönsten Zähne der Welt. Als wir uns am Sonntag gesehen haben, war alles in Ordnung. Und sie hat mir auch am Telefon nichts erzählt.«
Johann hatte plötzlich wieder das Gefühl, etwas Wichtiges zu übersehen. Was war es bloß, woran ihn diese Zahnlücke erinnerte? Bei Opfern von brutaler Gewalt war er schon oft mit ausgeschlagenen Zähnen konfrontiert worden. Aber dieser Fall war nun mal wie kein anderer. Er versuchte, das schwarze Loch in seinem Gedächtnis mit Inhalt zu füllen, merkte aber, dass er die Erinnerung nicht erzwingen konnte.
»Vielleicht bringt uns ihr Umfeld weiter. Wissen Sie, wo Franca arbeitete?«, fragte er.
Enzas Gesicht verdüsterte sich wieder. Dieses Gespräch schien wie eine emotionale Berg-und-Tal-Fahrt für sie zu sein. Ihr Schweigen dehnte sich endlose Sekunden. Verheimlichte sie ihm etwas?
»Ja. Sie war Sekretärin bei ›Extravergine‹«, sagte sie schließlich zögernd.
Johann schaute sie überrascht an. Enza wich seinem Blick aus, sah auf den Boden.
»Sie meinen die Firma ›Extravergine‹? Den Olivenöl-Riesen?«
Enza nickte stumm.
Bei Johann überschlugen sich die Gedanken. Olivenöl. Die Substanz, die er in Francas Lunge gefunden hatte. Er dachte an die Laboruntersuchung der Ölprobe. Die Ergebnisse sollten nächste Woche kommen. Ob man wohl feststellen konnte, von welchem Hersteller das Olivenöl stammte?
»Extravergine« war einer der größten Olivenölproduzenten des Landes. Er hatte kürzlich einen Artikel darüber gelesen. Der Chef der Firma hatte auf seinem Anwesen für die Fotografen posiert, neben seiner deutlich jüngeren blonden Freundin und einem knallroten Ferrari. Mit Olivenöl war der Mann schwer reich geworden. Eine groß aufgemachte »Tellerwäscher wird Millionär«-Geschichte. Nur dass der Tellerwäscher in diesem Fall als armer Olivenbauer angefangen hatte.
Johann erinnerte sich sogar noch an den Namen des neureichen Ölbarons: Gianni Marconi.
Marconi. Auf einmal wurde ihm bewusst, dass die junge Frau, die ihm gegenübersaß, den gleichen Familiennamen trug.
Er dachte an die exquisite Lage des Hauses, die Größe ihrer Wohnung, das Panoramafenster und sah Enza direkt in die Augen.
»Sagen Sie mal. Der Chef von ›Extravergine‹ heißt doch Marconi. Sind Sie vielleicht …?«
Enza Marconi ließ ihn nicht ausreden. »Ja, er ist mein Vater.«
4
Samstagmittag
Er hatte sich entschieden. Er würde sterben. Keine Angst mehr vor den Schmerzen. Keine Gefühle. Er sah Francas totes Gesicht vor sich und spürte nur noch Leere. Es gab andere leblose Gesichter, die ihn schon so lange quälten. Er hatte Franca nie davon erzählt. Jetzt war es zu spät. Vor ihm lag nichts mehr außer dem Sprung. Und vorher der letzte Besuch bei der Nonna.
Seit sieben Jahren war er nicht mehr hier gewesen. Nichts hatte sich verändert. Die Kerbe in der Haustür, die er als Achtjähriger eingeritzt hatte. Für die er zehn Hiebe mit der Peitsche bekommen hatte. Die blinden Fensterscheiben, die nie geputzt worden waren. Das blecherne Schild neben der Haustür, das vor einem Hund warnte, den er nie hatte haben dürfen. Haustiere waren für sie immer tabu gewesen.
Er klopfte nicht, bevor er eintrat. Er wusste, dass sie um diese Zeit, kurz nach Sonnenaufgang, in der heiligen Kammer war. Er ging die Treppe hoch und erkannte das Knarren jeder einzelnen Stufe wieder.
Sie drehte sich nicht um, als er die Tür öffnete. Sie kniete und betete.
Auch hier hatte sich nichts verändert. Aber er war ein anderer geworden. Er hatte zwar keine Zukunft, aber er stand nicht mehr in ihrer Macht.
Mit drei Schritten ging er durch den Raum, packte sie an der Schulter und riss sie zu sich herum.
Sie sah ihm ins Gesicht, überrascht, dass er es war. Aber sie blieb still.
»War es das, was du wolltest?«, schrie er. »Sollen alle sterben? Alle für ihn?« Er zeigte auf den Schrein.
Sie antwortete nicht. Ihr Blick irrlichterte an ihm vorbei.
Er schlug ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Das erste Mal in seinem Leben. Er hatte so viele Schläge von ihr bekommen. In ihrem Mundwinkel war Blut. Sie schaute ihn wieder an, sagte aber weiterhin kein Wort.
Er schlug noch einmal zu. Sie stürzte zu Boden.
»Wir hatten ein neues Leben!«, brüllte er, außer sich vor Wut! »Sie hat dir nichts getan! Ihr hättet uns in Ruhe lassen können! Ihr habt alles vernichtet!«
Sie blieb liegen, sah ihm weiter stumm ins Gesicht.
Er schrie: »Ich hasse dich!«
Endlich sprach sie, heiser und unerbittlich: »Du bist nicht wichtig. Deine Hure ist nicht wichtig. Ich habe dir immer gesagt, was wichtig ist. Aber du warst nicht hart genug, um deine Aufgaben zu erfüllen.«
Ihm wurde kalt. Seine Wut erlosch. Auf einmal wurde ihm bewusst, dass sie wahnsinnig war. Dass sie ihn zu ihrem Werkzeug gemacht hatte, fast sein ganzes Leben. Dass es keinen Sinn mehr machte zu reden. Es war vorbei. Er drehte sich um und ging.
5
Samstagnachmittag
Johann war nicht bei der Sache. Er lag im Bett mit Veronica, dachte aber an Enza. Nicht in sexueller Hinsicht, obwohl er sie durchaus attraktiv fand. Nein, ihn quälte die Frage, was die Tochter von Gianni Marconi vor ihm verbarg. Warum hatte sie nicht sofort erzählt, wo Franca gearbeitet hatte, als er das Olivenöl in ihrer Lunge erwähnte? Warum hatte sie ihn mehr oder weniger rausgeworfen, nachdem das Gespräch auf ihren Vater gekommen war? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er das Gefühl gehabt, dass Enza die Wahrheit sagte. Aber jetzt? Wollte sie ihren Vater schützen?
»Was ist los? Woran denkst du?« Veronica küsste ihn neckisch auf die Nase. »Wollen wir Sex haben, oder willst du lieber ein Kuschelprogramm?«
Er fühlte sich ertappt. Aber er sah, dass sie lächelte, und er wusste, dass er bei Veronica nur wenig falsch machen konnte.
»Ja, ich geb’s zu. Mir lässt ein Fall keine Ruhe.«
Veronica richtete sich auf, stützte sich auf einen Ellbogen. »Erzähl mir davon.«





























