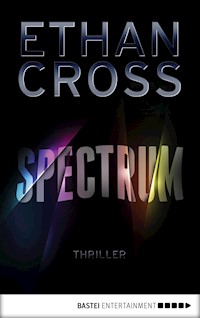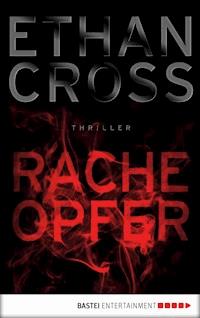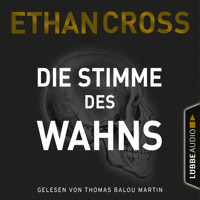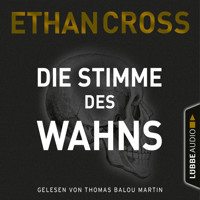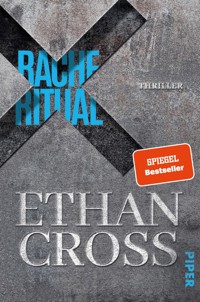
14,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese kultischen Ritualmorde kann nur einer aufklären: Baxter Kincaid! Der legendäre Ravenkiller hat ein blutiges Markenzeichen: Er ritzt seinen grausam zugerichteten Opfern Runen aus der nordischen Mythologie in die Stirn. Ganz klar ein Fall für Baxter Kincaid, der auf Ritualmorde, Serienkiller und die dunkelsten aller Verbrechen spezialisiert ist. Baxter quittierte den Polizeidienst, denn nur so kann der unangepasste Ermittler sich auf die perfiden Spiele der Täter einlassen – und sie schlagen. Deshalb engagiert ihn das San Francisco Police Department auch regelmäßig als »Berater« Das Problem bei diesem Fall: Baxter hat den Ravenkiller vor zehn Jahren hinter Gitter gebracht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Racheritual« an empfehlungen@piper.de, und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem amerikanischen Englisch von Leena Flegler
© Aaron Brown 2024
Published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, USA.
Titel der englischen Originalausgabe: »The Raven« bei Head of Zeus, London 2025
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Covermotiv: Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Teil 1
Andere Zeiten, andere Sitten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Teil 2
Neue Zeiten, neue Verbrechen
18
Neun Jahre Später
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Teil 3
Totgesagte leben länger
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Teil 1
Andere Zeiten, andere Sitten
1
Jamar Evans – eben noch Obdachloser, im nächsten Moment mutmaßliches Opfer von Menschenhändlern – presste die Wange auf den Boden des alten Lieferwagens. Er versuchte, flach und gleichmäßig zu atmen und keinen Mucks zu machen. Wie leicht sich ein Menschenleben binnen eines Wimpernschlags verändern konnte.
Eine Stunde zuvor hatte Jamar an einer Straßenecke im Tenderloin-Viertel mitten in San Francisco gestanden und einen Foodtruck betrachtet. So einen wollten er und seine Freundin Maya auch eines Tages haben. Tagsüber würden sie Burritos verkaufen und sich abends hinten drin wegballern. Noch schien der Traum in weiter Ferne zu liegen. Sein Vorhaben für den Abend war weit pragmatischer gewesen – es war das gleiche Vorhaben, das er schon zigmal erfolgreich in die Tat umgesetzt hatte: ein paar Gramm Heroin auftreiben, irgendwo im Loin ein ruhiges Eckchen finden, in das er sich zurückziehen konnte, und dann in Gedanken irgendwo hindriften, weit weg von den anderen Junkies, den Zeltlagern und dem Gestank, den sie verbreiteten.
Jamar hatte zunächst geglaubt, der Mann könnte ihm helfen, seinen Plan für den Abend zu verwirklichen. Jetzt im Nachhinein wünschte er sich, er hätte sich an die Regeln der Straße gehalten und niemandem über den Weg getraut.
Er hatte den Tag über unten an der Pier 39 Touristen angehauen, wie er und ein paar andere aus der Community es nannten, wenn sie schnorren gingen, und tatsächlich in Rekordzeit genug für einen Eight-Ball zusammengehabt. Deshalb war er auch früh nach Tenderloin weitergezogen, hatte gehofft, dort auf einen Dealer zu treffen und sich dann eine der besseren Stellen zu sichern, vielleicht in einer Gasse, in der ein Müllcontainer zumindest aus einer Richtung Deckung versprach. Er kannte viele aus der Community, und ein paar davon konnte er sogar leiden, aber nichts vermieste einem den Trip schneller als irgendein Spinner auf Speed oder Meth, der neben einem saß und gar nicht mehr aufhörte mit dieser oder jener Verschwörungstheorie. Nur eins war noch schlimmer: von den Cops verscheucht zu werden. Aber solange er in Tenderloin blieb, war das kein großes Problem. In San Francisco war es mehr oder weniger egal, was man anstellte, solange man dabei im richtigen Viertel blieb. Scheißegal, welchen Fetisch oder welche Sucht man hatte – Hauptsache, man kam niemandem in die Quere, der nach Geld süchtig war. Sofern man sich an die Regeln hielt, konnte man sogar direkt vor den Augen eines Cops drücken. Neun von zehn Malen ließ der es einem durchgehen. Trotzdem ging Jamar lieber kein Risiko ein. Am besten, man forderte sein Schicksal nicht auch noch heraus.
Er war durch die Straßen gestrichen, hatte sich nach einer geeigneten Stelle umgesehen und sich hier und da nach seiner Abendvergnügung erkundigt. Fälschlicherweise hatte er angenommen, dass heute sein Glückstag wäre, als er auf einen Typen etwa im selben Alter und in einem abgerissenen schwarzen Sweatshirt gestoßen war, der ihn gefragt hatte, ob er etwas kaufen wolle.
»Hast du auch Äitsch?«, hatte Jamar gefragt.
Woraufhin der vermeintliche Dealer gesagt hatte: »Was immer du verträgst, Bruder.«
Jamar hatte gelacht. »Hast du eine Ahnung, was ich alles vertrage!«
»Da lang.« Mit einem Lächeln war der Typ vorausgegangen. »Finden wir es heraus.«
Sein neuer bester Freund führte ihn in eine Gasse, in der ein schwarzer Lieferwagen parkte. Und kaum dass Jamar der Verdacht kam, dass hier möglicherweise irgendwas faul sein könnte, packten ihn zwei Gestalten von hinten, rissen ihn von den Füßen, warfen ihn auf die Ladefläche und zogen die Türen von innen zu, während der Fake-Dealer den Wagen umrundete und sich ans Steuer setzte.
Jamar schrie um Hilfe, obwohl er wusste, dass es zwecklos war. In Tenderloin um Hilfe zu rufen bedeutete im Großen und Ganzen: »Vielleicht wechselst du besser die Straßenseite und guckst mal schön in die andere Richtung.«
Seine Entführer zogen ihm einen dunklen Sack über den Kopf und fesselten seine Hände im Rücken, vermutlich mit breiten Kabelbindern. Dann drückten sie sein Gesicht auf die Ladefläche und rieten ihm, die Füße still und die Klappe zu halten, wenn er das hier überleben wollte.
Und Jamar wollte es überleben, ganz gleich, was ein Außenstehender dazu gesagt hätte. Er war in eine Grube gefallen, aber fest entschlossen, in nächster Zeit dort wieder hinauszuklettern. Seine Zukunftsträume trieben ihn an, die Hoffnung auf ein besseres Leben, das aus irgendeiner Chance erwuchs, die ihm das Schicksal noch zuspielen würde. Er war immerhin erst Anfang zwanzig und hatte nicht vor, für den Rest seines Lebens ein kaputter Junkie zu bleiben. Er war felsenfest davon überzeugt, dass das Leben ihm eine Gelegenheit bieten würde, wenn er nur lange genug durchhielt. An genau diesem Gedanken hielt er sich jetzt fest: Wenn er durchhielt, änderten sich die Vorzeichen vielleicht noch.
Nachdem er minutenlang unbequem dagelegen hatte, während der Lieferwagen erst durch die Stadt gefahren war und dann beschleunigt hatte – und vermutlich auf die Autobahn aufgefahren war –, versuchte er, sich ein Stück aufzurichten. Sofort trat einer der Typen nach ihm. Der Kopf bleibe unten. Und dort blieb er die nächste Stunde auch.
Dann hörte Jamar den Motor aufjaulen, als runtergeschaltet wurde und sie von der Autobahn auf gewundene Landstraßen fuhren. Wieder verging einige Zeit, die sich anfühlte wie eine Ewigkeit. Weil er abgesehen von seiner inneren Uhr keine Möglichkeit hatte, die Zeit zu messen, hoffte er einfach, dass diese nicht stimmte und sie nicht ewig aus der Stadt rausgefahren wären.
Obwohl … Möglicherweise spielte der Ort auch gar keine Rolle. Es war schließlich nicht so, als hätte ihm irgendwer aus der Stadt helfen können. Trotzdem wuchs die Panik, je weiter sie sich von Tenderloin entfernten. Er hatte fast das Gefühl, als hätte die Entführung an sich der Höhepunkt sein müssen, und je mehr Zeit verstrich, in der sie ihm nichts taten, desto mehr hätte die Hoffnung die Angst verdrängen müssen. Doch das Gegenteil war der Fall. Je weiter sich der Lieferwagen von der Stadt entfernt hatte, je mehr Zeit vergangen war, umso mächtiger und gefräßiger war seine Angst geworden.
Er versuchte, sich einzureden, dass seine Lage, die sich in jener Gasse so rasend schnell verändert hatte, hier draußen ebenso schnell wieder umschlagen konnte. Aber egal, welchen gut gemeinten Blödsinn er sich einredete – wirklich daran glauben konnte er nicht.
So abrupt seine Reise begonnen hatte, so jäh kam der Transporter zu einem Halt. Jemand zerrte Jamar Evans auf die Füße, schleifte ihn aus dem Lieferwagen und befahl ihm, sich in Bewegung zu setzen. Er hatte immer noch den Sack über dem Kopf, doch durch die Fasern konnte er ein Stück voraus ein Feuer erahnen. Außerdem nahm er den muffigen Geruch vermoderten Laubs und Holzes wahr. Ansonsten schien es hier still zu sein: Es waren weder Verkehr noch das übrige Hintergrundrauschen der Stadt zu hören. Nichts. Nur ab und zu der vereinzelte Ruf eines Nachtvogels.
Jamar wurde ein paar Hundert Meter weit über unebenes Gelände geführt, bevor jemand ihn auf einen Baumstamm drückte und ihm den Sack vom Kopf zog.
Er war sich nicht sicher, was er erwartet hatte, doch sobald sich seine Augen an das Licht gewöhnt hatten, war klar, dass er sich so etwas nicht in seinen wirrsten Fieberträumen hätte ausdenken können. Es kam ihm vor, als wäre er durch ein Portal in die Vergangenheit eingetreten: Direkt vor ihm flackerte ein Lagerfeuer, und ringsum schien auf mehreren Baumstämmen eine Horde urzeitlicher Krieger zu sitzen. Während die Kälte durch Jamars Segeltuchjacke und zwei Sweatshirt-Schichten drang, waren diese Männer hüftaufwärts nackt.
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen, sodass Jamar die Szene auf sich wirken lassen konnte. Er hörte, wie der Lieferwagen davonfuhr. Zwei der Männer, die ihn hierher eskortiert hatten, waren geblieben und legten ihre Kleidung ab, sodass sie im gleichen Aufzug vor ihm standen wie ihre Kameraden. Sie nahmen Bärenfelle entgegen, an denen immer noch der Schädel samt Reißzähnen und Augen hing. Sie setzten ihn sich auf und fingen an, sich das Gesicht weiß zu bemalen und mit roten Zeichen zu versehen. Auch die anderen hatten sich Tierfelle übergezogen, die ihnen vom Scheitel bis über den Rücken fielen. Auf der Stirn trugen sie ein rotes Symbol, das Jamar noch nie gesehen hatte: drei ineinander verschränkte Dreiecke.
Sämtliche Krieger starrten ihn mit wildem, gierigem Blick an. Im Lieferwagen hatte Jamar sich alle möglichen Szenarien ausgemalt. Er war zu dem Schluss gekommen, dass das Schlimmste, was ihm passieren konnte, irgendeine Art sexuelle Versklavung war. Doch als er jetzt den Blick schweifen ließ, fragte er sich, ob der Grund für seine Verschleppung vielleicht eher kannibalischer als sexueller Natur war. Ihm fiel auf, dass vier Männer Bärenfelle trugen, vier andere den Kopf und Pelz eines Wolfes, und einer – der allein ein Stück abseits des Feuers saß – trug Schädel und Fell eines Wildschweins.
Der Mann im Wildschweinfell wirkte auf ihn nicht annähernd so gierig wie alle anderen. Er hatte den Blick auch nicht auf Jamar gerichtet, sondern ins Feuer und wirkte fast ebenso nervös wie Jamar. Der Mann rang die Hände und tippte in einem abgehackten Rhythmus mit dem Fuß auf die Erde. Außerdem schien er ein gutes Stück älter als alle anderen zu sein. Die Bärenfelle und Wolfspelze wirkten alle wie Anfang zwanzig oder sogar jünger, während der Wildschweinmann leicht untersetzt und sein Brusthaar ergraut war. Schon vor Jahren war er in den Bereich abgerutscht, den Jamar der Einfachheit halber als alt bezeichnete – was im Prinzip auf jeden zutraf, der ihm selbst zehn oder mehr Jahre voraus war.
Sobald die zwei Männer, die ihn hergebracht hatten, ihr Gesicht fertig bemalt und am Feuer Platz genommen hatten, lehnte einer im Bärenfell sich vor. Er war auffällig muskulös, doch als er anfing zu sprechen, klang seine Stimme kein bisschen männlich. Stattdessen hatte sie das helle, jugendliche Timbre eines Teenagers.
»Wie heißt du?«
»Jamar.« Er versuchte, seine Stimme am Zittern zu hindern.
Der junge Krieger zeigte ein dermaßen boshaftes Schmunzeln, dass Jamar sich schon fragte, ob der Mann vom Teufel persönlich besessen war.
»Willkommen, Jamar. Du darfst mich Magni nennen. Heute ist möglicherweise der bislang glücklichste Tag deines erbärmlichen, sinnlosen Lebens.«
2
In der fünften Etage des siebenstöckigen Betonklotzes an der Bryant Street, wo das Morddezernat des San Francisco Police Department untergebracht war, starrte Baxter Kincaid aus dem Fenster. Die Gebäude unter ihm waren in Nebel gehüllt. Es gab Leute, die diese Schwaden, die von der Bay heraufzogen, abgrundtief hassten. Baxter selbst kam es bei Nebel immer so vor, als würde die echte Welt mit der Welt der Träume verschmelzen.
Die Sonne war schon vor Stunden untergegangen, trotzdem waren sein Partner und er immer noch konzentriert bei der Arbeit. In seinem Revier, in seiner Obhut, waren obdachlose Jugendliche ermordet worden. Baxter wusste nur zu gut, dass Obdachlosigkeit nicht immer allein mit psychischer Krankheit oder Drogensucht erklärbar war. Viele hatten einfach nur Pech gehabt – wie sein eigener Vater: Eine Verkettung von Fehlschlägen und falschen Entscheidungen hatte dazu geführt, dass ihr Familienoberhaupt Grund und Boden verloren hatte. Er hatte sich genötigt gesehen, in einem Minivan, der ihnen – zwei Erwachsenen und fünf Kindern – von da an als Dach über dem Kopf gedient hatte, aus dem südlichen Texas nach Kalifornien zu ziehen. Eine wohlhabende Tante hatte sie an der Schwelle abgewiesen, und so waren Baxter und seine Familie in San Francisco auf der Straße gelandet, wo sie die Müllcontainer durchwühlt hatten, um zu überleben.
Angesichts dieser Lebensumstände hatte Baxter sich als junger Bursche geschworen, dass trotz des bescheidenen Starts mal etwas aus ihm werden würde. Nicht um seiner selbst willen, sondern um den obdachlosen Bewohnern dieser Stadt zu helfen, von denen ihm viele ans Herz gewachsen waren. Das hatte seine Berufswahl entsprechend eingeschränkt. Er hätte Anwalt oder Politiker werden können, aber allein bei der Vorstellung verzog er angewidert das Gesicht. Es gab nur einen Beruf, der dem jungen Baxter Kincaid immer Respekt abgenötigt hatte: der des Polizisten.
Mittlerweile hatte er als solcher schon einige Berufsjahre auf dem Buckel. Er drehte sich vom Fenster weg und zu Terry Callahan um, der seit dem vergangenen Jahr sein Partner war und der jetzt dasselbe Whiteboard anstarrte, das auch Baxter die halbe Nacht angestarrt hatte. Ihr Dienstzimmer war eine kleine, karge Schuhschachtel. Keiner von ihnen beiden war sonderlich begabt in Sachen Inneneinrichtung. Baxter war Single, und Terry war zwar verheiratet, doch auch seine Frau war nicht gerade interessiert daran, es den beiden mithilfe von Zimmerpflanzen oder hübschen Dekogegenständen bei der Arbeit übermäßig gemütlich zu machen. Im Grunde bestand der Raum aus ihren zwei Schreibtischen sowie den Tafeln an den Wänden, auf denen sie ihre Fälle dokumentierten.
Terry lehnte an seiner Schreibtischkante. Auf der Tafel, die er anstarrte, hatten sie Informationen zu ihrem Hauptverdächtigen, Steinar Hagen, zusammengetragen.
Zum gefühlt fünfzigsten Mal wischte sich Baxter über die Nase, um sicherzustellen, dass von den zwei Lines, die er sich auf der Toilette genehmigt hatte, nichts zu sehen war. Er war immer hochgradig paranoid und verunsichert, sobald er auf Koks war, und obwohl er verzweifelt versuchte, dem Impuls zu widerstehen, konnte er nicht anders und fuhr sich in einem fort durchs Gesicht. Wann immer möglich, spielte er es als Erkältung herunter. Er konsumierte ja auch nicht ständig. Aber außergewöhnliche Umstände erforderten nun mal außergewöhnliche Maßnahmen.
Baxter ließ sich auf Terrys Schreibtischstuhl fallen und bemerkte in seinem typisch südtexanischen, lang gezogenen, ausgedehnten Singsang: »Du siehst aus wie einer dieser Wünschelrutengänger von früher, die so ein Stöckchen vor sich halten und auf gut Glück mitten im Nirgendwo irgendetwas aufspüren wollen.«
»Tja, es sieht ja auch ganz danach aus«, murmelte Terry Callahan, »als wäre dieser Fall nur noch mit ›gut Glück‹ zu lösen.«
3
Jamar hätte ihn am liebsten angeschrien, dass sein Leben weder erbärmlich noch sinnlos sei, allerdings war ihm klar, dass er in seiner derzeitigen Lage besser keinen Streit suchte. Dieses Lodern in Magnis Augen kannte er nur zu gut: Er hatte es zigmal in den Augen streunender Hunde und hungriger Homo sapiens auf der Straße gesehen. Mit trockener Kehle stieß Jamar krächzend hervor: »Richtig glücklich fühle ich mich aber nicht …«
»Solltest du aber«, entgegnete Magni. »Heute wird deiner Seele ein Upgrade zuteil. Die meisten unwürdigen Primitiven wie du landen nach ihrem Tod in Hel – in der nordischen Hel, nicht der christlichen Hölle. Das sind zwei grundunterschiedliche Orte. Aber du landest woanders, Jamar. Für dich haben die Nornen etwas anderes vorgesehen. Du bist eingeladen, dich zwischen all jene einzureihen, die in Odins erhabenes Walhall einziehen.«
Was immer Magni da sagte, klang in Jamars Ohren nach unverständlichem Kauderwelsch, und er hatte keinen Schimmer, was er darauf erwidern sollte. Deshalb sagte er lieber nichts. Er versuchte, sich nicht zu bewegen, als hätte soeben ein riesiges Raubtier seinen Weg gekreuzt, das ihn hoffentlich gleich wieder vergessen und weiterziehen würde.
Magni stand auf und fing an, langsam um das Feuer herumzugehen. Er hob die Arme in Richtung Vollmond, der wie eine Taschenlampe vom Himmel herabschien. Dann kicherte er kurz und schüttelte den Kopf. »Sieh sich einer die Schönheit, die Erhabenheit des Mondes an. Und doch ist er dazu bestimmt, zusammen mit seinem großen Bruder, der Sonne, von einem riesenhaften Wolf verschlungen zu werden. Anschließend verschlingt Fenrir obendrein Odin und die ganze Welt – es sei denn, die besten Krieger der Geschichte versammeln sich rechtzeitig in Walhall, wo sie sich für die Schlacht gegen das riesige Untier wappnen.« Unvermittelt drehte sich Magni zu Jamar um. »Hast du davon schon mal gehört? Von der Wahrheit, wie sie die Nordmänner erzählen?«
»Ich hab schon mal von dieser Kuh gehört, die über den Mond gesprungen ist«, platzte es aus Jamar heraus, »aber noch nie von einem Wolf, der den Mond gefressen hätte.«
Magni lachte. »Tja, aber hier haben wir es nicht mit einem Kinderreim zu tun, sondern mit der Wahrheit. Sie mag metaphorisch sein – schließlich wissen wir nicht, in welcher Gestalt der Untergang eintreffen wird –, aber der Größte der Götter hat seinem auserwählten Volk einen höheren Weg gewiesen: einen Weg, der von Kriegern beschritten wird, die sich zwischen die Zerstörung und den Neuanfang stellen werden. Krieg bringt Leiden mit sich, wie wir alle wissen. Zum Glück empfangen wir die Gnade unseres Göttervaters Odin in Form seines Zorns, den er in die Herzen derer ergießt, die seinem ehrwürdigen Weg folgen.«
Erneut hatte Jamar keine Ahnung, wie er auf das Geschwafel reagieren sollte, und hielt stattdessen den Mund. Je länger Magni vor sich hin schwadronierte, umso mehr wollte Jamar am liebsten laut schreiend das Weite suchen. Allerdings wusste er, dass er nicht weit kommen würde. Was eine derart wilde Horde ihm antun könnte, wenn er sich davonmachte, wollte er sich gar nicht ausmalen. Trotzdem juckte es ihm in den Beinen, und alles in ihm drängte zur Flucht.
»Wir sind eine Eliteeinheit aus Kriegern, die auserwählt und damit beauftragt wurden, Odins Geist in die Welt zu tragen«, fuhr Magni fort. »Die Geschichtsschreibung nennt uns ›Berserker‹, was eine Gattungsbezeichnung für vier unterschiedliche Kriegertypen ist. In den alten Quellen sind Männer beschrieben, die von einem Tierfell abgesehen ohne Rüstung in die Schlacht zogen. Sie waren wild und erbarmungslos, konnten Verletzungen erleiden und doch weiterkämpfen und Wunden davontragen, ohne zu bluten. Sie waren dem gewöhnlichen Menschen weit überlegen und mit göttlicher Macht gerüstet. Die furchterregendsten Krieger aller Zeiten. Ein verhältnismäßig kleiner Trupp aus Berserkern war imstande, in jedweder großen Schlacht das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. Hast du schon mal von uns gehört, Jamar?«
Jamar schüttelte den Kopf.
»Das ist schade. Aber das wird sich jetzt ändern. Die Welt wird sich wieder an meine Urväter erinnern. Alte Sitten werden zu neuen werden. Heute Abend siehst du drei Kriegertypen vor dir: meine Wenigkeit und meine drei Brüder, die die Berserkir oder ›Bärenfelle‹ repräsentieren – so der Ursprung der Gattungsbezeichnung für jene Krieger, die sich Odins Zorn zu eigen machen. Dann gibt es vier weitere Brüder: die Úlfhéðnar oder ›Wolfshäuter‹. Unsere Geistführer, die die Ursprungsgestalt eines Tieres annehmen, bestimmen in der Schlacht unseren Kampfstil. Dann hätten wir hier noch einen Jǫfurr, die Bezeichnung für den ›Kopf eines Wildschweins‹ oder das ›Wildschweinfell‹. Wir Bärenfelle sind die Wildesten von allen, jene, die am weitesten gehen. Unsere wölfischen Brüder sind schon etwas disziplinierter, und der Jǫfurr ist gemeinhin eine Position, die für die erfahrensten Krieger des Clans reserviert ist.«
Ohne nachzudenken und lediglich, um überhaupt etwas dazu zu sagen, platzte es aus Jamar heraus: »Und was ist der vierte Typ?«
Magni lächelte. »Schön zu hören, dass du Interesse zeigst. Der letzte Typus des Berserkers wird in den Quellen am seltensten erwähnt, zumindest in denjenigen Quellen, die noch auffindbar waren, nachdem die Christen unser Reich überrannt und unser Volk mit den schmutzigsten Mitteln seit Menschengedenken gewaltsam konvertiert hatten. Diese sagenumwobenen Brüder stammen aus unseren Reihen und werden eigens für die Schlacht ausgewählt, weil sie über besondere Tarnfertigkeiten verfügen. Sie sind Assassine. Während der Rest von uns in die Schlacht stürmt, halten sie sich zunächst im Schatten und schlagen ohne Vorwarnung zu. Sie sind die Blodjegere, die ›Blutjäger‹ oder auch ›Raben‹, die Mächtigsten unter den Geisttieren, weil sie Odin, unserem höchsten Gott, am nächsten stehen. Die Raben werden nur zu speziellen Zeiten und unter bestimmten Umständen beschworen: wenn unser Herr nach Heimlichkeit statt nach Stärke verlangt.«
Magni wandte sich zu dem älteren Mann im Wildschweinfell um, der hier und da flüchtig zu Jamar gespäht, ihm aber kein einziges Mal ins Gesicht gesehen hatte. Der Mann machte nach wie vor einen extrem rastlosen Eindruck. Als Magni auf ihn zutrat, richteten auch die anderen ihre Aufmerksamkeit auf ihn. Jamar nutzte die Gunst des Augenblicks.
Gerade erst wenige Monate zuvor hatte er ein Paar Stahlkappenschuhe eingetauscht. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch nicht gewusst, dass sie die Füße kühlten, und sie einfach als kleine Sondermaßnahme zum Eigenschutz angesehen, mit der er um sich treten konnte, ohne sich dabei den Fuß zu brechen. Doch jetzt setzte er die Stahlkappen ein, indem er ein brennendes Holzscheit in Magnis Richtung kickte und in ein und derselben Bewegung losrannte.
Er hatte zuvor bereits entschieden, in welche Richtung er durch den Wald fliehen und wie er zurück an die Straße gelangen wollte. Wenn er bloß einen kleinen Vorsprung herausholen könnte, würde er sie alle abhängen, da war er sich sicher. Nun hatte er ja auch keine andere Wahl: Diese Männer würden ihn umbringen. Besser, er starb bei dem Versuch, seine Haut zu retten, als bei jedwedem wahnwitzigen Ritual, das diese Typen sich ausgedacht hatten.
Doch kaum dass Jamar über den Baumstamm sprang, hatte ihn einer der Wolfspelze am Bein gepackt. Jamar kam ins Trudeln. Er landete im Gestrüpp, stolperte zur Seite gegen einen Baum und schlug sich den Kopf an.
Er hatte kaum Zeit, sich über die Schmerzen Gedanken zu machen, als ihn jemand auch schon brachial zu Fall brachte und sich im nächsten Moment etwas hart in seinen Hals presste. Hineinschnitt. Etwas Scharfes – Zähne oder Klauen. Dann spürte er heiße Atemluft an seinem Ohr, als jemand flüsterte: »Eine falsche Bewegung, und ich reiß dir die Kehle auf. Du stehst jetzt auf, und wir reden weiter. Noch ein Fluchtversuch, und ich zeig dir, wozu die Waffe an deinem Hals imstande ist.«
Magni richtete sich auf und zerrte Jamar auf die Beine. Dann machte er einen Schritt zurück und öffnete die Faust. Zwischen seinen Fingern kamen vier abgerundete Klingen zum Vorschein.
»Das hier ist eine Baghnakh.« Er streckte die Hand aus, damit Jamar besser sehen konnte. Magnis Zeige- und der kleine Finger steckten in Metallringen, die an einem Steg mit vier geschwungenen Krallen befestigt waren. Der Steg selbst lag quer über seiner Handfläche auf. »So etwas wird auch ›Tigerkralle‹ genannt. Eigentlich stammt sie aus Indien und nicht von meinen nordischen Ahnen, aber ich wollte etwas haben, was meinem Geisttier besser entspricht als menschliche Waffen. Und was käme echten Krallen näher?«
Jamar zuckte panisch zurück, als Magni in einer rasend schnellen Bewegung nach dem nächstbesten Baum schlug, die Borke streifte und vier tiefe Scharten im Stamm hinterließ. Zufrieden betrachtete er sein Werk.
»Stell dir vor, Jamar, das wärst du gewesen.«
Jamar hob die zitternden Hände. »Schon gut, schon gut, du bist der Boss. Aber ich musste es doch wenigstens versuchen.«
»Das nenne ich Kampfgeist, Jamar. Aber keine Bange: Für dich ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Wir brauchen dich als Teil unseres Rituals, aber das heißt nicht, dass du heute Nacht sterben musst. Du könntest sogar wiedergeboren werden.«
Entweder hatte Jamar ein ernsthaftes Schädeltrauma erlitten, oder aber ihm war langsam alles egal. »Wiedergeburt wäre schon cool. Ich will sowieso einiges ändern. Eine zweite Chance, und mein Leben könnte diesmal ganz anders verlaufen.«
In der Zwischenzeit hatten die anderen Krieger sich ebenfalls um sie geschart. Magni legte seine Hand auf die Schulter des Mannes im Wildschweinfell.
»Wenn wir sterben, ziehen wir in Walhall ein, wo wir uns auf die Entscheidungsschlacht vorbereiten. Aber Krieger ziehen nun mal nirgends alleine hin, sie brauchen Gefolgsleute, die für sie die Zelte aufschlagen, die kochen und die Speisen auftischen und die Klingen schärfen.«
»Dann braucht ihr Sklaven für euer Jenseits?«
Magni zuckte mit den Schultern. »So in etwa. Aber frag dich mal selbst, Jamar: Glaubst du an all das hier wirklich? Wenn wir den Ritus vollziehen, in dem du dich als Diener unseres Clans verpflichtest – glaubst du dann wirklich, dass all das auch eintritt, wenn du stirbst?«
»Nie im Leben! Ihr seid ja nicht ganz dicht …«
»Tja, da hätten wir es doch. Warum tust du dann nicht einfach so, als würdest du es glauben? Und wenn wir mit unserem Ritual fertig sind, darfst du wieder gehen, das verspreche ich dir.«
»Das versprichst du mir?«
»Genau.«
Jamar war drauf und dran, Magni zu erzählen, was er von dessen Versprechen hielt, doch weil er hier anscheinend ohnehin keine Wahl hatte, sagte er bloß: »Dann mal los.«
4
Die anderen Detectives hatten Terry den Spitznamen »Dirty Terry« verpasst, weil sein Name nun mal fast klang wie Harry Callahan aus dem bekannten Polizeifilm, der ebenfalls in San Francisco spielte – nur dass Terry kein bisschen so aussah wie der Hauptdarsteller, Clint Eastwood. Terry war eins fünfundsiebzig groß, bereits ergraut mit Tendenz zur Glatze und gebaut wie ein Ex-Footballspieler, der Footballtrainer geworden war.
Er bedachte Baxter mit einem finsteren Blick und grollte: »Hast du wieder gezuckerte Donuts gegessen und mir keinen übrig gelassen?«
Baxter legte eine Extraportion Südstaaten-Singsang in seine Antwort. »No, Sir. Das würde unserer Partnerschaft doch nur einen schweren Schlag versetzen. Wie kommst du darauf?«
»Du hast weißes Pulver an der Wange. Du kannst so viel sniffen und dir reinpfeifen, wie du willst, aber wenn du zu weit runtergehst und dich in dem Zeug wälzt, dann bleiben zwangsläufig Spuren zurück.«
Baxter unterdrückte den Impuls, sich sofort übers Gesicht zu wischen. »Verarsch mich nicht, Terry, da ist nichts auf meiner Wange.«
Terry zuckte mit den Schultern. »Ich will ja nichts sagen, aber wenn hier eines Morgens der Bürgermeister oder der Polizeichef oder irgendeine andere sagenumwobene Gestalt hereinschneit – was durchaus möglich wäre, so viel Wirbel, wie dieser Fall gerade macht –, willst du dann wirklich dieses Zeug im Gesicht haben? Oder erzählst du dann, du hättest Plätzchen gebacken?«
Baxter musste noch immer an sich halten, um sich nicht über die Wange zu wischen. Er kniff die Augen zusammen. »Gibt’s irgendein Problem, Terry?«
»Was? Fühlst du dich bevormundet oder was?«
»Hab ich jetzt Zeug im Gesicht oder nicht?«, fragte Baxter in wieder halbwegs versöhnlichem Tonfall.
Terry verdrehte die Augen. »Nein. Aber solange du hier weiterhin die ganze Zeit herumschniefst und schnaubst und die blutunterlaufenen Augen dir fast aus dem Kopf platzen, ist die Sache ziemlich offensichtlich.«
Baxter schloss die Augen und strich sich durch die hellblonden Haare, die gerade noch so als businesskurz durchgingen. Sie waren auf diese spezielle Art gewellt, dass er aussah, als wäre er auf einem Surfboard zur Welt gekommen. Dabei hatte er in Wahrheit sogar Angst vor dem Wasser.
»Wie du selbst gesagt hast«, seufzte er, »sind wir in dem Fall auf Sand gelaufen. Ich brauchte ein bisschen geistige Erweiterung … Verdammt noch mal, Terry! Keine Ahnung, wie du es ohne Hilfe durch eine Nachtschicht nach der anderen schaffst!«
»Ich brauche von Haus aus kaum Schlaf … und es gibt Kaffee. Eine verdammt wirksame Droge.«
Baxter neigte den Kopf leicht zur Seite. »War das gerade eine Anspielung auf einen Dave-Chapelle-Joke?«
»Bleib bei der Sache.«
»Bei welcher Sache denn? Was genau willst du mir eigentlich sagen, alter Mann?«
»Ich bin gar nicht so viel älter als du. Nicht, wenn man das große Ganze betrachtet. Und ich wollte dich einfach nur daran erinnern, dass du hier beim San Francisco Police Department bist. Du bist Detective im Morddezernat.«
Diesmal war Baxter an der Reihe, die Augen zu verdrehen. »Und darüber hinaus bin ich Bürger der Vereinigten Staaten, ich bin Bewohner Kaliforniens – und eine Schande für all meine Mitmenschen. Willst du das damit sagen?«
»Ich will nur sagen, dass es illegal ist. Und dass du ein Cop bist!«
Baxter schloss die Augen, biss die Zähne zusammen und ließ ein paar Sekunden verstreichen. »Terry, ich gehe hier gerade unter. Wir haben es mit jeder Menge toter Straßenkids zu tun, die allem Anschein nach irgendeinem nordischen Spuk zum Opfer gefallen sind. Das mag jetzt nicht gerade die Topmeldung sein, weil sie allesamt nicht zur Kategorie ›reich und schön‹ gehört haben, aber das sind meine Leute. Ihretwegen bin ich Cop geworden. Ich will sie beschützen. Allerdings fühle ich mich gerade so nutzlos wie ein Fallschirm aus Beton. Dieser Fall erstickt mich.«
Terry schüttelte den Kopf. »Das ist doch genau der Punkt, Großer! Ständig erzählst du, dass du mal Polizeichef werden willst. Gerade verfügen wir über eine ganze verdammte Taskforce, die auf unser Kommando hört – und wir haben nichts. Nichts, worauf wir sie ansetzen könnten. Ich brauche dich bei klarem Verstand und nicht vollgedröhnt wie ein Junkie!«
Auch Baxter schüttelte den Kopf. »Du bist hier der alte Hase. Du solltest diese Show leiten. Zeig mir, o weiser Mann, wie es funktioniert. Dann muss ich mir auf dem Scheißhaus auch keine Lines mehr reinpfeifen. Weil ich dann nämlich das Gefühl hätte, ich hätte alles für die Opfer getan!«
Bedächtig zog Terry eine seiner Schreibtischschubladen auf und nahm ein Tütchen mit Erdnüssen heraus, wie man sie an Tankstellen und in Bars kaufen konnte. Er riss die Verpackung auf. »Wenn der Bürgermeister morgen hier reinkommt und dich fragt: ›Wer ist unser Täter?‹, was antwortest du dann?«
Baxter griff in dieselbe Schublade und nahm einen Stift heraus. Dann trat er ans Whiteboard, das über und über mit Fotos und Notizzetteln übersät war, zwischen denen kreuz und quer verschiedenfarbige Verbindungslinien verliefen. Er nahm die Kappe vom Stift, kreiste das Foto von Steinar Hagen ein und unterstrich dreimal dessen Namen. »Der hier. Ist vielleicht nicht derjenige, der dort draußen persönlich zuschlägt und Leute abschlachtet, aber er ist der Charles Manson hinter den Morden. Ich würde dem Bürgermeister antworten, dass wir nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen müssen, und die Verhaftung ist wasserdicht.«
Terry lachte. »Und was, wenn er dich darauf festnagelt? Was, wenn er Beweise sehen will? Was, wenn der Bürgermeister – oder noch wahrscheinlicher: der Lieutenant oder der Captain – hier reinmarschiert und fragt: ›Was habt ihr zwei Volltrottel überhaupt zustande gebracht?‹, und du antwortest das Gleiche? Was, wenn er dann sagt: ›Okay, ich informiere den Staatsanwalt. Was genau kann ich ihm vorlegen?‹«
Baxter schüttelte erneut den Kopf. »Keine Ahnung … Aber ich weiß, dass ich recht habe. Der Typ ist unser Mann. Ich hab’s im Urin.«
Terry verzog das Gesicht. »Wo?!«
»Komm schon, Terrybär. Als wir mit Steinar Hagen gesprochen haben, hat der Typ ausgesehen, als würde ihm auf die blutigen Details einer abgehen. Wenn wir den in den Zeugenstand holen, werden die Leute ihren Kindern die Augen zuhalten und das Weite suchen, so wie damals, als Manson sich das Hakenkreuz in die Stirn geritzt hat. Hagen ist eiskalt und eine toxische Persönlichkeit.«
»Wir ziehen aber nicht los und verhaften Leute, nur weil sie eine toxische Persönlichkeit haben. Und wir ziehen auch nicht herum und verhaften Leute, nur weil sie – wie hast du es gerade formuliert? – aussehen, als würde ihnen darauf einer abgehen. Ist das der Fachausdruck? Darin bist du nicht zufällig Experte, Sergeant Kincaid?«
»Warum zickst du mich heute eigentlich so an, Terry?«
»Weil du mich scheiße nervst, wenn du auf Koks bist! Oh, und vielleicht auch noch, weil der Stift, mit dem du das Bild umkreist hast, ein Edding war. Den kriegt man da nicht mehr runter, du Trottel!«
Baxter starrte erst den Stift in seiner Hand und dann das Whiteboard an. »Warum hast du denn nichts gesagt?«
»Wann denn? Als du ihn dir geschnappt hast? Oder als du sofort angefangen hast, damit rumzuschmieren?«
»Was hatte der dann hier draußen zu suchen, wenn das kein Whiteboard-Marker ist?«
»›Hier draußen‹ im Sinne von: in meiner Schublade?«
»Ist doch egal«, knurrte Baxter. »Bestimmt haben die Putzleute irgendwas dabei, womit sie den wieder wegkriegen. Ich bin mir sicher, so was passiert alle naselang.«
»Und genau das meine ich: Ständig sorgst du für Chaos und erwartest dann, dass andere hinter dir herputzen. Und wenn du auf Koks bist, gleich noch zehnmal mehr. Du stehst hier vor mir und hast keine Beweise. Du hast nichts in der Hand, womit wir arbeiten könnten.«
5
Jamar hasste die Natur. Für ihn fühlte sie sich unnatürlich an. Ihm war wesentlich wohler, wenn er Asphalt unter den Füßen hatte. Als sie ihn zum Feuer zurück eskortierten und auf denselben Baumstamm drückten, auf dem er zuvor schon gesessen hatte, kam es ihm vor, als hätte Asphalt eine Art magische Rettungskraft: Wenn er nur zurück auf eine asphaltierte Straße käme! Während die Krieger ebenfalls wieder Platz nahmen, stellte er sich vor, wie er auf herrlich glattem Untergrund wieder aufwachen würde. Vielleicht in den letzten Zügen des Rausches, allenfalls noch mit jemandem, der ihm Narcan in die Nase pumpte und eine Herz-Lungen-Massage machte. Wie schön das wäre, wie wunderbar sich der sonnengewärmte Asphalt an seinem Rücken anfühlen würde …
Im Licht des flackernden Lagerfeuers wirkten die bemalten Gesichter, die Augen und Zähne der Tierschädel auf den Köpfen der Krieger, als säßen ihm merkwürdige Mischwesen gegenüber.
Magni nahm einen Gegenstand hoch, der aussah wie ein Schürhaken mit einem zweiköpfigen Hammer am Ende, und legte ihn ins Feuer. Dann setzte er sich und wandte sich wieder Jamar zu. Dieser Verrückte lächelte ihn allen Ernstes an, als wären sie Kumpels auf einem Campingtrip. Mit demselben breiten Lächeln im Gesicht griff er nach hinten und zog einen Rucksack näher, wie man ihn in jedem beliebigen Outdoor-Geschäft bekam. Dass jemand, der so gekleidet war wie Magni, durch etwas so Modernes aus Kunstfasern und mit Klettverschlüssen wühlte, war ein merkwürdiger Anblick. Dann schien er gefunden zu haben, was er suchte: ein mit mehreren merkwürdigen Symbolen verziertes Horn. Er legte es neben sich ab und griff erneut in den Rucksack.
»Also, Jamar … Wie bist du auf der Straße gelandet? Erzähl uns ein bisschen was über dich.«
Jamar antwortete wie in Trance: »Es hat doch jeder irgendeine rührselige Geschichte auf Lager, da interessiert meine doch nicht.«
Magni schob die Unterlippe vor und neigte den Kopf zur Seite. »Das stimmt nicht, Jamar. Du bist drauf und dran, Teil unseres Clans zu werden. Klar wollen wir deine Geschichte hören.«
Daran hatte Jamar so seine Zweifel, trotzdem antwortete er: »Ich hab meinen Vater nie kennengelernt. Meine Mutter war auf Crack, deshalb bin ich bei meiner Großmutter in Oakland aufgewachsen. Sie ist beim Einkaufen in einen Schusswechsel zwischen zwei verfeindeten Gangs geraten. Danach hatte ich die Wahl: Kinderheim oder auf mich allein gestellt klarzukommen. Ich hab alle Hoffnungen auf ein besseres Leben in San Fran gesetzt, und seither ist es mir blendend ergangen. Reicht das fürs Erste?«
»Tut mir leid, was dir widerfahren ist. Aber ab jetzt brauchst du dir wegen deiner Vergangenheit und Zukunft keine Sorgen mehr zu machen. Du hast jetzt eine neue Familie.«
Inzwischen hatte Magni all seine Zutaten aus dem Rucksack gefischt und befüllte das Horn, bei dem es sich allem Anschein nach um ein antikes Drogenutensil handelte. Dann hob er es vors Gesicht und roch an der Mischung. Sein Lächeln wurde breiter.
»Dies hier ist Odins Elixier, Jamar. Wir werden es gleich zu uns nehmen, und anschließend vollziehen wir ein Ritual, bei dem unser Hugr unseren Körper verlässt und den Hugr unseres Geisttieres dazu einlädt, wiederzukehren und sich in unserem Fleisch mit uns zu vereinen. Wenn du möchtest, darfst du gern daran teilhaben.«
Jamar biss die Zähne zusammen.
»Ich hätte nie geglaubt, dass ich das mal sagen würde«, presste er nach ein paar Sekunden hervor, »aber ich will eure Drogen lieber nicht ausprobieren.«
Magni gluckste. »Gut, Jamar. Vielleicht wird dieser Abend ein Wendepunkt für dich. ›Clean aus Angst‹ – heißt es nicht so?«
Noch während Magni geantwortet hatte, waren zwei weitere Krieger hinter Jamar getreten, was ihm nicht gerade behagte. Aber was hätte er dagegen tun sollen? Er bedachte sie mit einem flüchtigen Blick, dann drehte er sich wieder zu Magni um. Sein neuer bester Kumpel reichte soeben das Trinkhorn mitsamt dem Drogengebräu an seinen Nebenmann weiter. Dann stand er auf.
»Während des Rituals könnte es zu Vorfällen kommen, die dir eventuell nicht zusagen, Jamar. Dies hier wäre einer davon.«
Er zog den eigenartigen Schürhaken aus den Flammen. Das Ende mit dem doppelköpfigen Hammer war glühend rot. Magni drehte den heißen Hammerkopf gen Himmel und rammte den eisernen Griff vor sich in die Erde. Dann wandte er sich an die beiden Krieger, die hinter Jamar Position bezogen hatten.
»Bringt ihn her.«
Kräftige Hände schoben sich unter seine Achseln. Jamar versuchte noch, sich loszumachen – vergebens. Sie hatten ihn gepackt und bugsierten ihn nach vorn. Er stemmte die Fersen in den Boden, woraufhin sie ihn einfach nur anhoben und zu Magni trugen. Soweit Jamar es mitbekommen hatte, hatte der Anführer dieses Möchtegern-Kriegertrupps selbst nicht von seiner Droge gekostet. Trotzdem hatte der junge Mann den wilden, besessenen Blick eines Speed-Junkies. Die beiden Wolfspelze schoben Jamar noch ein Stück vor, bis er unmittelbar vor dem glühenden, qualmenden, hammerartigen Gegenstand stand.
Im nächsten Moment packte Magni Jamar bei den Armen und presste die Innenseiten seiner Unterarme gegen die Schlagseiten des Doppelhammers.
Das glühend heiße Metall brannte sich in sein Fleisch. Jamar wand sich, brüllte und versuchte, seinen Oberkörper zurückzureißen, doch er konnte nichts tun. Die Männer waren stärker als er und hielten ihn in einem Todesgriff fest. Der Gestank seines eigenen verbrannten Fleisches stieg ihm in die Nase.
Er flehte sie an, ihn loszulassen, und tatsächlich ließ Magni unvermittelt von ihm ab. Die beiden Krieger trugen ihn zurück zu seinem Baumstamm. Heulend tastete er über die Wunden an seinen Unterarmen und schleuderte Magni eine Reihe von Flüchen entgegen. Der Anführer der Krieger schlenderte bloß in aller Seelenruhe zurück zu seinem Rucksack. Er nahm eine Wasserflasche und einen kleineren Gegenstand heraus, drehte sich zu Jamar um und warf ihm die Flasche und eine Tube Brandsalbe in den Schoß. Dann kehrte er zu seinem Platz zurück, und die beiden Krieger, die Jamar zu dem Brandeisen geschleift hatten, taten es ihm gleich. Jamar hätte von seinen Folterern lieber keine Hilfe angenommen, doch seine Unterarme taten höllisch weh. Als er sich Wasser über die Wunden goss, rollten weitere Schmerzenswellen über ihn hinweg.
Mit zitternden Fingern drehte er den Verschluss der Brandsalbe auf. Während er sie vorsichtig auf der ersten Wunde verstrich, dämmerte ihm, dass sie ihm anscheinend ein Zeichen eingebrannt hatten. Es erinnerte an das Biohazard-Symbol, sah aber irgendwie anders aus … Er starrte noch einen Augenblick lang darauf, ehe er die Salbe auf dem anderen Arm verstrich, den das gleiche Symbol zierte. Es erinnerte vage an drei ineinander verschlungene Trinkhörner von der Sorte, wie Magni es inzwischen wieder in der Hand hielt.
»Was zum Teufel sollte das, Mann? Ich bin doch kein Rindvieh, das man einfach so brandmarkt!«
»Das war nur ein Teil des Rituals. Entspann dich. Ich hab dir doch sogar die Salbe gegeben, damit die Schmerzen nachlassen. Ich will dich in Topform, Jamar. Und warum sollte ich dir die Salbe geben, wenn wir nicht vorhätten, dich wieder gehen zu lassen? Hab nur noch ein kleines bisschen Geduld mit uns irren Wilden, dann bist du wieder frei.«
Jamar heulte und krümmte sich vor Schmerzen. »Aber warum müsst ihr mich dafür verbrennen?«, wimmerte er.
Magni nahm einen großen Schluck aus seinem Horn und reichte es abermals an seine Kumpane weiter. »Wir mussten dich nur dieses eine Mal brandmarken … Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob du den weiteren Verlauf angenehmer finden wirst … Meinen Vorfahren und den Berserker-Clans – also all jenen, die sich an Odins Zorn laben – wird nachgesagt, dass wir Ursprung der Werwolf-Legenden seien, die in deiner Kultur so tief verankert sind. Die Berserker haben sich in der Schlacht einen solchen Ruf erkämpft, dass man von ihnen sprach, als wären sie übernatürlich, als würden geschlagene Wunden nicht bluten, als kämpften sie mit der Stärke einer ganzen Legion. Tatsächlich glaube ich, dass die Werwolf-Legenden der Wahrheit sogar recht nahe kommen, denn wir verwandeln uns wirklich: Wir werden zu wilden Tieren. Wir treten in Verbindung mit Geistern, mit Odins Zorn und mit unseren Seelenwesen. Dies alles tun wir mithilfe von Odins Elixier, das es uns ermöglicht, unseren Geist über dieses sterbliche Elend zu erheben. Stell es dir wie Messwein vor. Ich erzähle dir das nur, damit du all das, was du gleich zu sehen bekommst, halbwegs ruhig hinnehmen kannst. Wer immer das Ritual früher mitansah, hat wilde Geschichten über Fabelwesen ersonnen. Deshalb bitte ich dich, erst mal ruhig genau dort sitzen zu bleiben, wo du jetzt bist. Es ist wahrscheinlich am besten und dient deiner eigenen Sicherheit, wenn du versuchst, während der kompletten Zeremonie stillzuhalten.«
Inzwischen hatte das Horn wieder die Runde gemacht und war erneut bei Magni angelangt. Er nahm noch einen großen Schluck und reichte es abermals herum. Dann zwinkerte er Jamar zu, drehte sich zum Feuer und zu seinen Brüdern um und setzte laut zu Erklärungen in einer fremdartigen Sprache an. Die anderen erhoben sich und reagierten, indem sie merkwürdige Gesten ausführten. Dabei starrten sie ins Feuer oder empor in den Himmel, ehe sie sich nach und nach in Bewegung setzten, mit steif angewinkelten Armen ums Feuer tanzten und in einen Singsang verfielen, knurrten, jaulten und die Hände in Richtung Mond reckten. Der Tanz beschleunigte sich, bis irgendwann auch der letzte Krieger auf den Beinen war, den Mond anheulte und die Zähne fletschte. Immer schneller bewegten sie sich um das Feuer herum, stießen die Fäuste gen Himmel und riefen Wörter in einer Sprache, die er nicht verstehen konnte.
Unterdessen saß Jamar auf seinem Baumstamm und versuchte, sich trotz Schmerzen vorzustellen, dass er wieder zu Hause wäre, wieder in asphaltierter Sicherheit, und dass all dies nur ein wirrer Traum wäre. Er versuchte, sich einzureden, dass er wie dieses Kind aus dem Buch wäre, das er in jungen Jahren gelesen hatte: Wo die wilden Kerle wohnen. Das Kind hatte sich den wilden Kerlen angeschlossen – allerdings hatte Jamar nicht die Absicht, sich dieser Gruppe und ihrem Treiben anzuschließen. Er saß so reglos da wie nur möglich, während die Krieger um ihn herum tanzten, knurrten und ihn ansahen, als würden sie nichts lieber wollen, als ihm das Fleisch von den Knochen zu reißen, es zu kochen und zu verschlingen. Er fragte sich, ob ihr Ritual wohl genau darauf hinauslaufen würde. Allein die Hoffnung, dass sich das Blatt für ihn noch einmal wenden würde, bewahrte ihn davor, eine Dummheit zu begehen.
Nur Minuten zuvor hatte Jamar behauptet, dass er die Finger von Magnis Drogen lassen wolle; in Wahrheit jedoch hätte er sie nur zu gern eingenommen. Jedwede Droge, ganz egal welche. Alles, nur um das Grauen und die Angst zu betäuben. Doch allmählich hatte er auch so etwas wie einen Plan: Er hoffte, dass diese Typen von dem Zeug aus dem Trinkhorn dermaßen wegtreten würden, dass er als der einzig Nüchterne in der ganzen Gruppe abermals einen Fluchtversuch unternehmen könnte. Aber was immer das Horn enthalten hatte, schien seine Entführer nicht auf die Matte zu schicken. Es schien sie vielmehr anzufeuern, als würden sie auf einer merkwürdigen Wolke aus Ekstase und Irrsinn schweben. Jamar befürchtete bereits, dass sie sich jeden Moment wie das Rudel wilder Tiere, in das sie sich allmählich zu verwandeln schienen, auf ihn stürzen könnten. Aus Angst, einen solchen Angriff zu provozieren, wagte er nicht, sich vom Fleck zu rühren.
Während die Tanzerei weiterging, fingen sie nach und nach an, Waffen zu schwingen, die sie hinter den Baumstämmen hervorgeholt hatten. Bei vielen handelte es sich um Schilde und Äxte. Einige hielten ein Paar langer Stichwaffen in der Hand, ein weiterer durchfurchte die Luft mit Klauen, wie Magni sie ihm zuvor gezeigt hatte. Sie schlugen ihre Schilde aufeinander und kreuzten die Klingen, während sie weiter jaulten, knurrten und Gesänge für ihre Götter vorbrachten.
All das kam zu einem abrupten Ende, als Magni einen hölzernen Schild zur Hand nahm und brüllte: »Genug! Es ist an der Zeit für die Odensjakt!«
Dann kam er auf Jamar zumarschiert und drückte ihm den verzierten Schild in die Hand. Jamar entdeckte einen eingeschnitzten Wolf und ein Pferd mit acht Beinen, und rings um den Rand war eine Schlange abgebildet, die sich in den Schwanz biss.
»Der ist für dich. Nimm ihn.«
Jamar hätte sich lieber geweigert, etwas von Magni anzunehmen, doch eine Waffe oder einen Schutzschild würde er nicht ablehnen. Er starrte auf den Schild hinab. »Bitte, du hast doch gesagt, ihr würdet mich laufen lassen …«
Magni lächelte, und diesmal war klar, dass Jamar keinen Mann, sondern eine Kreatur vor sich hatte, die nur mehr halb Mensch, halb Monster war – mit wildem Blick und Speichel, der ihm von den Lippen troff. Magni zeigte in die Richtung, die von der Schnellstraße wegwies, über die Jamar hergeschleift worden war, und sagte mit leicht verwaschener Stimme: »Zwei Meilen da runter liegt ein Fluss. Wenn du es bis rüber ans andere Ufer schaffst, lassen wir dich leben.«
Tränen liefen Jamar über die Wangen, als er flüsternd erwiderte: »Du hast versprochen, mich gehen zu lassen …«
Von einem irren Kichern begleitet erwiderte Magni: »Ich lasse dich doch gehen. Ich hab dir nur nie versprochen, dass wir dich nicht verfolgen würden.«
6
Baxter fühlte sich wie ein Ballon, aus dem die Luft entwich, und das trotz seiner chemisch-geistigen Erweiterung. Neben ihm trat Terry ans Whiteboard.
»Brechen wir es noch mal runter, du Ass. Steinar Hagen ist Vorsitzender der Odin Society – seiner Aussage zufolge ein Verein aus ortsansässigen Kulturenthusiasten, die zusammenkommen, um über alte nordische Mythen zu reden. Und das war es angeblich auch schon. Dieser Typ, von dem du so sicher bist, dass du ihn mit einem Edding einkreisen musstest, ist ein angesehener Professor, stammt aus einer schwerreichen norwegischen Unternehmerfamilie und hat ein Alibi für jeden einzelnen Vorfall, den wir uns angesehen haben. Er hat ein Alibi für jeden einzelnen Todeszeitpunkt. Für jede einzelne Entführung. Wenn wir ihn fragen würden, wo er in der Nacht war, als Tupac erschossen wurde, hätte er vermutlich ebenfalls eins. Aber dieses helle Köpfchen hier, Sergeant Baxter Kincaid, hat die Chuzpe, gegenüber unserem Captain oder dem Bürgermeister oder wem auch immer in der Befehlskette zu behaupten, dass Steinar Hagen unser Täter sei. Edding-Unterstreichungen inklusive.«
»Okay, vielleicht hab ich keine Beweise dafür«, brummelte Baxter, »aber was kommt denn von dir, Terry? Mal abgesehen von negativer Klugscheißerei?«
»Wenn Hagen unser Mann ist, dann müssen wir die Schwachstellen in seinen Alibis finden, was uns bislang nicht gelungen ist. Wenn er die Morde in Auftrag gegeben hat, dann müssen wir zuallererst diejenigen finden, die die Taten für ihn ausgeführt haben. Jedes einzelne Mitglied der Odin Society, von dem wir wissen, hat ebenfalls ein Alibi. Aber wenn er all das nur vortäuscht, müssten wir ihn doch wohl trotzdem irgendwie mit einem der Tatorte in Verbindung bringen können. Kannst du das, Sergeant Kincaid?«
»Warum hat dieses Sergeant Kincaid bei dir immer einen abfälligen Unterton?«
»Weil ich dich daran erinnern will, wer du bist und was hier deine Aufgabe ist.«
»Und du glaubst, das hätte ich vergessen? Ich hab dir doch gerade gesagt, wie mich der Fall und der Druck, der darauf lastet, runterziehen. Ich hab um eine Rettungsboje gebeten, aber du drückst mir lieber weiter den Kopf unter Wasser und reichst mir auch noch Bleigewichte.«
»Ich versuche doch nur, dich dazu zu bringen, die Zielgerade im Blick zu behalten, Baxter.«
»Was wäre denn zum Beispiel mit den FasTrak-Fotos?«, gab Baxter kopfschüttelnd zurück.
»Was soll damit sein?«
»Als wir ihm das zweite Mal auf die Pelle gerückt sind, hat Hagen den Braten ja wohl gerochen und geahnt, dass wir ihn nicht nur befragen, weil er uns als Skandinavistik-Professor beraten sollte. Er hat seine Anwälte eingeschaltet, und augenblicklich lagen die Alibis vor. Ausgerechnet seine Anwälte haben uns doch sofort die FasTrak-Aufnahmen hingeworfen, als Beweis dafür, dass ihr Mandant fernab der Tatorte war. Aber weshalb war er ausgerechnet zu diesen speziellen Zeitpunkten sonst wo unterwegs? Und wie kommt’s, dass er ausgerechnet zu unseren Tatzeiten durch überwachte Mautstellen fuhr?«
»Das ist bloß vage verdächtig, hat aber keine Beweiskraft.«
»Und was, wenn die FasTrak-Aufnahmen von den Mautstellen manipuliert waren?«
»Wieso sollte er sich solche Mühe machen? Wenn er unser Charlie Manson ist, wie du behauptest, dann hat er Leute, die für ihn die Drecksarbeit machen. Er muss überhaupt nicht am Tatort gewesen sein. Er benutzt diese Mautkameras bloß, um seine eigene Unschuld zu beweisen.«
»Klar. Aber du hast doch selbst erlebt, wie creepy der Typ ist. Die Art, wie er über Wikinger spricht – da hatte ich eine Gänsehaut! Der würde doch trotzdem mit dabei sein wollen. Wenigstens ein Mal. Wir müssen herausfinden, wann das war. Da sind die FasTrak-Fotos doch gar kein schlechter Ausgangspunkt. Er hat bei zwei unterschiedlichen Gelegenheiten seinen genauen Aufenthaltsort durch FasTrak nachgewiesen, was mir hochgradig verdächtig vorkommt. Mir ist schon klar, dass so etwas im Bereich des Möglichen liegt und nichts ist, was ein Gericht überzeugen würde. Aber wenn er an so ein Foto käme und es irgendwie faken könnte, dann könnte er mit seinen Kumpels und seinen Lakaien doch Spaß haben und immer noch für jedes einzelne Verbrechen ein Alibi vorweisen.«
Terry verzog kopfschüttelnd das Gesicht. »Ich weiß nicht … FasTrak ist ein behördliches System. Ich bin mir relativ sicher, dass die Hürden für Hacker ganz ordentlich sind. Du hast die Fotos doch selbst gesehen. Außerdem sind es ja nicht nur Fotos, es gibt auch Videoaufzeichnungen dazu. Sieht für mich alles ziemlich echt aus.«
»Du weißt aber auch, was man heutzutage mit Videos für einen Irrsinn anrichten kann. Vielleicht hat jemand die Aufnahmen manipuliert?«
»Ansehen kann man es sich ja mal.« Terry warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Willst du noch schlafen, oder holen wir uns ein Frühstück aus einem 24-Stunden-Diner und fahren direkt weiter zur FasTrak-Zentrale? Vielleicht lohnt es sich, dort ein bisschen herumzuschnüffeln und unsere Möglichkeiten auszuloten. Ich mache später am Nachmittag ein Nickerchen, aber ich könnte verstehen, wenn du dich lieber jetzt hinlegen willst.«
Baxter kniff die Augen zusammen. »Dir ist doch verdammt noch mal klar, dass ich in nächster Zeit sowieso nicht schlafen kann. Immerhin ist das der Sinn und Zweck von Koks.«
Terry rutschte von der Schreibtischkante. »Dann zieh deine Jacke an, du Genie. Wir müssen Menschenleben retten und ein paar Verbrecher hinter Schloss und Riegel bringen. Aber zuallererst gibst du ein Frühstück aus.«
»Ich hab gar nicht richtig Hunger …«
»Dann spendier mir ein Frühstück. Und ich hoffe sehr, dass der Geruch von Fritteusenfett dir auf den Magen schlägt. Vielleicht lernst du es ja so.«
Baxter warf sich die Jacke über die Schulter. »Mit solchen Freunden braucht man echt keine Feinde mehr.«
Terry gab ihm einen festen Klaps auf die Schulter und lächelte ihn an. »Wer hat denn behauptet, dass wir Freunde wären?«
7
Wiederholt dachte Jamar an seine kleine Schwester, die in staatlicher Obhut gelandet war, und an einen Tag, den sie mal gemeinsam am Strand verbracht hatten. Sie hatte ihm Sand ins Gesicht geworfen und dann behauptet, dass er vorsichtig sein müsse, wenn er die Sandkörner einatme, weil selbst ein paar Körnchen seine Lunge durchlöchern könnten. Jamar hatte sofort das Gefühl gehabt, als hätte er Sandpapier in der Brust, und war hilfeschreiend zu seiner Großmutter gerannt.
Auch jetzt, da er um sein Leben rannte, fühlte es sich an, als hätte er Sand in der Lunge. Er keuchte und hustete ununterbrochen, ohne dass es ihm Linderung verschaffte. Er war körperlich in miserabler Verfassung, und er schwor sich, sofern er dies hier überlebte, in Zukunft besser auf sich aufzupassen.
Er lief durch den stockfinsteren Wald, so schnell er nur konnte, krachte gegen Äste und durch Gestrüpp und stolperte über Steine und Wurzeln. Wenn er es durch den Fluss hindurch schaffte, der angeblich zwei Meilen entfernt war, wäre er wieder frei. Doch durch diese lichtlose Wildnis zu laufen war nicht sein einziges Handicap: Magni hatte ihm eröffnet, dass er lediglich eine Minute Vorsprung bekäme.
Jamar hatte keine Zeit verloren und war auf der Stelle so schnell wie nur möglich losgerannt. Außerdem hatte er im Kopf bis sechzig gezählt. Die komplette erste Minute lang hatte er hinter sich anhaltendes Jaulen und das Aufeinanderkrachen der Schilde und Klingen gehört. Die Krieger hatten noch weit mehr Getöse gemacht als zuvor.
Doch sowie die Minute vorbei gewesen war, war schlagartig alles still geworden.
Der Wald ringsum, die riesigen, mondbeschienenen Bäume und Moosflächen wirkten auf Jamar wie eine Märchenlandschaft. Hier war es vollkommen still, abgesehen von seinem eigenen abgehackten Keuchen und seinem hämmernden Herzen. Aus der Dunkelheit heraus war kein Mucks zu hören.
Er lief weiter, trieb sich voran, strauchelte und kroch vorwärts, so schnell er konnte. Doch dann entdeckte er den ersten Verfolger: eine riesenhafte Kontur, die links von ihm auf einer Anhöhe stand. In der rechten Hand hielt die Gestalt eine seltsam altertümliche Axt.
Jamar wich zur Seite aus und versuchte, Abstand zwischen sich und den Feind zu legen, doch der Krieger rührte sich nicht mal von der Stelle. Er stand einfach reglos da und sah zu, wie Jamar sich entfernte, ehe er binnen eines Wimpernschlags mit der Dunkelheit verschmolz.
Von rechts vernahm er eine Bewegung, und ihm dämmerte, dass sie weit mehr taten, als ihn lediglich zu verfolgen. Sie spielten mit ihm, spielten irgendein Spielchen, vielleicht trieben sie ihn auch in eine bestimmte Richtung. Jamar war eines klar: Er musste weiterrennen, weil er nun auch von direkt hinter sich ein Geräusch hörte, ein Geräusch aus solcher Nähe, dass er auf seinem Weg durch die düstere Landschaft nicht mal mehr über die Schulter spähen wollte.
Er ließ einen Trampelpfad hinter sich und sprang in das ausgetrocknete Bett eines Baches, rannte noch ein Stück weiter, ehe er auf der anderen Seite eine Ausstiegsstelle entdeckte, die er würde hinaufkriechen können. Sie war mit Moos überzogen und gab unter seinen Händen und Füßen nach. Kurz hatte er die seltsame Vorahnung, dass gleich der Boden unter ihm nachgeben und er in ein Loch stürzen würde, als könnte die Erde ihr Maul aufreißen, um ihn zu verschlingen. Jamar hasste beengte Räume, und lebendig verschlungen zu werden gehörte eindeutig in die Top Five seiner schlimmsten Ängste – neben der Vorstellung, von einem sadistischen Clown in einen Gully gezerrt zu werden. Von Wikinger-Berserkern abgeschlachtet zu werden hatte bisher nicht dazugehört, aber das hatte sich an diesem Abend geändert.
Zu seiner Erleichterung gab das Bachbett unter ihm nicht nach. Er kletterte hinaus und verspürte im nächsten Moment stechende Schmerzen, die von der Rückseite seiner Beine ausgingen. Als er herumwirbelte, sah er gerade noch, wie eine Gestalt am anderen Ufer davonhuschte. Jamar untersuchte seine Verletzungen. Die Wunden waren nicht tief, trotzdem waren die Schmerzen heftig. Sie trieben ihn an, er setzte sie regelrecht ein, ließ sich von ihnen einpeitschen, als er die Anhöhe vor sich hinaufkletterte. Dann rannte er weiter und stieß auf einen weiteren Trampelpfad. Von allen Seiten waren Geräusche zu hören. Die Berserker hielten mit ihm Schritt und gaben sich nicht mal mehr die Mühe, sich vor ihm versteckt zu halten. Und sie knurrten, fauchten und jaulten.
Er versuchte, sie auszublenden und weiterzukommen, obwohl seine Beine wie Feuer brannten und seine Atemzüge zusehends abgehackter und mühsamer wurden. Er war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen, trotzdem rannte er weiter, griff um Baumstämme und setzte die Arme ein, um sich Stück für Stück vorwärtszuschleudern.
Hier und da kreuzte einer der Berserker seinen Weg, rammte ihn oder stieß mit der Waffe nach ihm. Zweimal gelang es ihm, den Hieb mit seinem Holzschild zu parieren. Ein anderes Mal erwischten sie ihn an der Hüfte mit einem Messer. Allerdings war offensichtlich, dass sie ihn nur piesacken und ihm keine ernsthaften Verletzungen beibringen wollten.
Ihr Spielball zu sein war unerträglich. Inzwischen bestand nicht der geringste Zweifel mehr, dass sie ihn vor sich hertrieben. Trotzdem blieb ihm nichts anderes übrig, als zu rennen. Er konnte schließlich nicht einfach kehrtmachen und die feindliche Linie durchstoßen. Er versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken. Versuchte, sich einzureden, dass seine einzige Hoffnung darin bestand weiterzulaufen, dass seine einzige Aufgabe nur mehr war, seine Arme und Beine in Bewegung zu halten. Wenigstens fühlte die Luft sich hier sauberer und klarer an. Gierig atmete er ein.
Im Schatten der Bäume vor ihm zeichnete sich eine Lichtung ab, und er fragte sich schon, ob dort der Fluss verlief. Er glaubte zwar nicht, dass er schon zwei Meilen gerannt war, gleichzeitig fühlte es sich bereits wie vierzig an. Mit einem Ziel vor Augen und einem Extraschuss Adrenalin in den Adern mobilisierte er seine Kräfte und zwang seine Beine, schneller zu laufen.
Vielleicht anderthalb Meter ehe die Lichtung sich vor ihm verbreiterte, rammte ihn eine dunkle Gestalt in die Seite. Er versuchte noch, sich wegzudrehen und den Schild hochzureißen, doch es war vergebens. Er verlor den Boden unter den Füßen, segelte regelrecht seitwärts, schlug hart gegen den Stamm eines Mammutbaums und dann auf dem feuchten Erdboden auf.
Wie ein tollwütiger Grizzly stürzte Magni sich auf ihn, hob die Klauen hoch über den Kopf und holte nach ihm aus. Jamar hatte nicht mal mehr Zeit, seinen Schild zu heben, als die Klingen auch schon in den Baumstamm einschlugen. Brüllend schlug Magni drei weitere Male zu. Dann packte der wild gewordene Irre Jamars Schild und riss ihn ihm aus der Hand.
Jamar war sich sicher, dass dies das Ende war. Mit ein, zwei Hieben hätte Magni ihm den Bauch und die Brust aufgeschlitzt. Doch statt mit seinen Klauenfäusten auf ihn loszugehen, packte er Jamar am Kragen, zerrte ihn hoch und schubste ihn auf die Lichtung.
Jenseits der Bäume fiel er auf die Knie, und sein Blick blieb an einem eigenartig nach Wikinger-Art errichteten Gebäude hängen. Es sah aus wie in einem Freilichtmuseum, wie die nachgebaute Wohnstätte eines lange untergegangenen Volkes. Es handelte sich um ein Holzhaus, war vielleicht sechs mal sechs Meter groß und schien aus einem einzigen großen Raum zu bestehen. Der Rest der Lichtung war unbebautes, offenes Gelände.
Jamar stemmte sich hoch und sah sich nach Hinweisen auf die übrigen Berserker um. Er schien allein zu sein, auch wenn er genau wusste, dass das nicht der Fall sein konnte. Und kaum dass er die Mitte der Lichtung erreicht hatte, flammten ringsum entlang der Baumgrenze Fackeln auf. Die komplette Lichtung war von Lichtern gesäumt. Wie in einen Bann geschlagen starrte er in die Flammen, die immer näher rückten, bis er von Berserkern umzingelt war, die sich zwar vorbeugten und ihn angrollten, aber wirkten, als würden sie von einer unsichtbaren Leine zurückgehalten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: