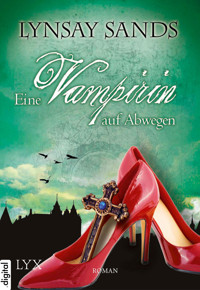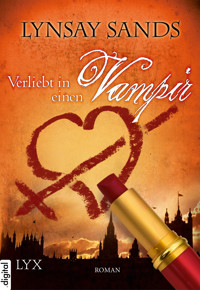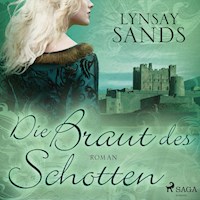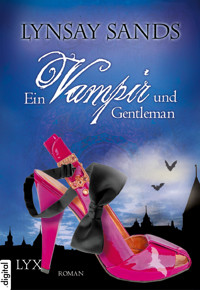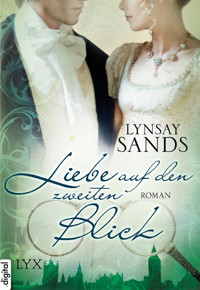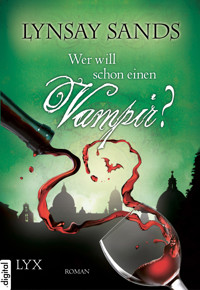9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Argeneau
- Sprache: Deutsch
Seit Domitian Argenis die Polizistin Sarita als seine Seelengefährtin erkannt hat, malt er sich den Moment, in dem er sie gänzlich zu der Seinen macht, in den schillerndsten Farben aus - nicht Teil seiner Fantasie war allerdings, sich gefesselt auf dem Tisch eines geheimen Labors wiederzufinden. Oder dass er und Sarita die Geiseln eines verrückten Wissenschaftlers sind. Die beiden müssen nun ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Ewigkeit gemeinsam auf Wolke 7 verbringen zu können!
"Lynsay Sands Bücher machen einfach Spaß: sexy, unendlich lustig und bis oben hin gefüllt mit Abenteuern!" Library Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchProlog1234567891011121314151617Die AutorinLynsay Sands bei LYXImpressumLYNSAY SANDS
Ran an den Vampir
Roman
Ins Deutsche übertragen von Ralph Sander
Zu diesem Buch
Seine Seelengefährtin zu finden, darauf wartet Domitian Argenis seit einer halben Ewigkeit. Nachdem er herausgefunden hat, wer sie ist, verbringt er die andere Hälfte damit, sich darauf vorzubereiten, die Auserwählte zu der Seinen zu machen. Als er dann aber Wind davon bekommt, dass das Objekt seiner Sehnsucht, die Polizistin Sarita, unter rätselhaften Umständen nach Venezuela gelockt wurde, hält ihn nichts mehr! Denn erst kürzlich sind in dieser Gegend mehrere Unsterbliche verschwunden – und die Fäden aller Vermisstenfälle laufen bei einer Person zusammen: Dr. Dressler, einem mysteriösen Wissenschaftler. Doch kurz bevor Domitian die Möglichkeit bekommt, Dressler zu befragen, wird er betäubt, entführt … und wacht auf einer exotischen Insel wieder auf. Zu seiner großen Überraschung befindet sich Sarita bei ihm. Nur er und seine Angebetete, ganz allein auf diesem traumhaften Eiland? Was eigentlich nach paradiesischen Zuständen klingt, entpuppt sich allerdings schnell als lebensgefährlich. Denn die beiden sind die Gefangenen Dr. Dresslers, dessen scheußlichen Plänen sie auf die Schliche kommen. Domitian und Sarita müssen fliehen – und je tiefer sie in Schwierigkeiten stecken, desto enger rücken die beiden zusammen. Und schon bald ist es nicht nur die Gefahr, die Saritas Herz wild schlagen lässt …
Prolog
»Allmählich glaube ich, dass sie sich verspäten werden«, murmelte Domitian und wuchtete den Matchbeutel etwas höher auf seine Schulter, damit das im Ärmel versteckte Mikrofon seine Worte besser aufnehmen konnte.
»Vielleicht ist es ja ein Zeichen.« Lucian Argeneaus Stimme klang überraschend klar und deutlich. Der Ohrstecker, den Domitian von ihnen bekommen hatte, war so klein, dass man ihn nicht mehr sehen konnte, wenn er sich erst einmal im Ohr befand. Dennoch war der Ton bemerkenswert laut und klar. »Wir sollten das jetzt vergessen und …«
»Versuchst du immer noch, es mir auszureden, Onkel?«, fragte Domitian amüsiert, fügte dann aber in einem ungeduldigen Tonfall hinzu: »Ich weiß nicht, warum du dich so dagegen sträubst, dass ich das mache. Vor allem wenn inzwischen Onkel Victor, Lucern, Decker, Nicholas, Tante Eshe, Mirabeau La Roche und Santo Notte zu denen gehören, die spurlos verschwunden sind. Ich dachte eigentlich, wenn sie alle entführt wurden, dann …«
»Genau das ist der Grund«, knurrte Lucian. »Es ist gefährlich. Wir haben bereits mehrere Jäger verloren, Leute, die bewaffnet und darauf trainiert sind. Du, Domitian, gehst da unbewaffnet rein, und du bist nicht als Jäger ausgebildet.«
»Stimmt, aber ich war mal ein Krieger. Ich kann mich schon zur Wehr setzen«, hielt Domitian dagegen. »Abgesehen davon war keiner von deinen Jägern dorthin eingeladen worden. Ich dagegen schon.«
»Richtig, aber die Frage ist doch, ob du als Koch eingeladen worden bist, der für Dressler arbeiten soll. Oder bist du als Unsterblicher eingeladen, den er seiner Sammlung einverleiben will?«
»Ich hab’s dir doch gesagt. Er weiß nicht, dass ich ein Unsterblicher bin«, sagte Domitian bewusst langsam und eindringlich, wobei er jede Silbe betonte. Es war nicht das erste Mal, dass sie beide diese Unterhaltung geführt hatten, und es sah ganz danach aus, dass sie das Ganze wieder aufs Neue durchkauen würden. »Wenn Dressler es wüsste, hätte er schon ein Dutzend Gelegenheiten gehabt, um mich zu entführen. Er ist seit fünf Jahren Stammgast in meinem Restaurant, er weiß es ganz eindeutig nicht.«
»Oder er will keinen Unsterblichen entführen, der so nah an seiner Wirkungsstätte lebt«, wandte Lucian ein. »Das hätte uns vielleicht sofort hierher nach Venezuela geführt.«
Domitian trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. »Ein verschwundener Unsterblicher in Caracas hätte euch nicht hergeführt, wenn in den Staaten so viele von uns unauffindbar sind.«
»Mag sein. Aber vielleicht hätten wir auch …«
»Ist dieser Helikopter auf dem Weg hierher?«, unterbrach Domitian seinen Onkel und legte eine Hand an die Stirn, um die Augen vor der Sonne abzuschirmen. Das Gefährt flog ziemlich niedrig und schien sich auf einem Kurs zu der Stelle am Fuß des Docks zu befinden, wohin er beordert worden war, um dort darauf zu warten, dass er abgeholt wurde. Er hatte ein Boot erwartet, aber …
»Sind das Schwimmer?«, tönte Lucian aufgebracht aus dem Ohrstecker.
Domitian wusste, dass Lucian und die anderen keine so gute Sicht hatten, da sie sich in einem kleinen Boot weiter unten an den Docks befanden. Hinzu kam, dass sie sich in der engen Kabine am Bug versteckt halten mussten, die nur über winzige Fenster verfügte. Im Vergleich zu ihm konnten sie genau genommen kaum etwas erkennen.
»Ja, der Helikopter hat Schwimmer«, bestätigte er und konnte jetzt auch die Kufen erkennen, an denen die Schwimmer befestigt waren. Damit war der Helikopter praktisch ein Amphibienfahrzeug, das an Land ebenso wie auf dem Wasser landen konnte. Domitian vermutete, dass der Helikopter auf dem Weg zu ihm war. Offenbar ging nicht nur ihm dieser Gedanke durch den Kopf, und er zuckte zusammen, als ein lauter Fluch in seinem Ohr dröhnte.
»In diesen Helikopter wirst du nicht einsteigen!«, wies Lucian ihn energisch an. »Denk dir eine Ausrede aus. Sag ihnen, du hast es dir anders überlegt. So was haben wir nicht eingeplant. Die Boote in der Bucht könnten den Helikopter aus den Augen verlieren. Hast du verstanden?«
Domitians Gedanken überschlugen sich, während er sah, wie der Hubschrauber langsamer wurde und zur Landung am Ende des Docks ansetzte. Die Frage war, ob er an Bord gehen sollte oder nicht. Wenn er vorgab, Flugangst zu haben, würde Dressler ihm vielleicht ein Boot schicken. Dann konnten Lucians Männer ihnen aus sicherer Entfernung folgen, um die fragliche Insel zu finden. Aber vielleicht würde Dressler das auch nicht machen, sondern Verdacht schöpfen, dass mit Domitian etwas nicht stimmte, und sein Angebot komplett zurückziehen.
Dieses Risiko konnte Domitian nicht eingehen. Er musste unter allen Umständen auf diese Insel gelangen. Seine Lebensgefährtin war dort und schwebte womöglich in großer Gefahr.
»Domitian? Hörst du mich?«, brüllte Lucian, dann wurde seine Stimme etwas leiser, da er jemanden in seiner Nähe fragte: »Funktioniert das Ding nicht? Warum antwortet er nicht?«
»Vielleicht wird deine Stimme vom Lärm des Helikopters übertönt«, hörte man jemand anderes sagen. Domitian war sich ziemlich sicher, dass es sich um den jungen Jäger Justin Bricker handelte, dem er für diesen Vorschlag sehr dankbar war. Er würde einfach so tun, als könnte er seinen Onkel nicht hören. Oh ja, er würde auf jeden Fall in diesen Helikopter einsteigen. Vielleicht brachte er sich damit selbst in Lebensgefahr, aber wenn er es nicht tat, dann verspielte er womöglich seine einzige Chance auf eine glückliche Zukunft.
»Verdammt, Domitian! Steig nicht in den Helikopter ein! Domitian!«
Er ignorierte die Stimme in seinem Ohr, sah zu, wie der Helikopter nicht wasserte, sondern am Ende des Docks landete, und machte sich dorthin auf den Weg.
»Domitian Argeneau!«, brüllte Lucian voll unbändiger Wut.
»Es heißt Argenis, Onkel. Nicht Argeneau«, korrigierte Domitian ihn mit sanfter Stimme, dann zog er unauffällig den Stecker aus dem Ohr und schob ihn in die Hosentasche seiner eng anliegenden Jeans. Egal, was man ihm sagte – er würde in diesen Hubschrauber einsteigen, sagte sich Domitian, während er sah, wie die Tür am Helikopter geöffnet wurde.
Instinktiv duckte er sich, als er unter den kreisenden Rotorblättern hindurchlief. Ein Mann im Anzug streckte ihm die Hand entgegen, um ihm den Matchbeutel abzunehmen. Domitian überließ ihm die Tasche und nickte dankbar, dann hielt er sich am Türrahmen fest und stieg ein. Da nur der Fensterplatz war frei, setzte er sich dort hin und zog die Tür hinter sich zu, ohne von irgendwem dazu aufgefordert worden zu sein.
Als er sich schließlich zu den anderen Männern umdrehte, verkrampfte er sich vor Erstaunen, als er am Hals plötzlich einen heftigen Schmerz verspürte. Fast im gleichen Moment wurde er ohnmächtig.
1
Sarita schlug das Buch zu, das sie hatte lesen wollen, und warf es ungeduldig zur Seite. Es war ein grässliches Buch. Aber vielleicht war sie auch einfach nicht in der Stimmung, um zu lesen, räumte sie gereizt ein, während sie ihrer Rastlosigkeit nachgab und aufstand. Als Polizistin in Kanada war in ihrem Leben daheim immer viel los, von allen möglichen Aktivitäten bis hin zu dringenden Einsätzen. Aber das hier? Nur herumzusitzen und zu warten, dass sie ihre Großmutter besuchen durfte, zehrte allmählich an ihren Nerven. Sarita konnte es nicht erwarten, sich persönlich ein Bild davon zu machen, wie es ihrer Großmutter nach dem Unfall ging. Nur deshalb war sie hergekommen. Stattdessen verbrachte sie ihre Zeit auf dieser Insel, auf die man sie nach ihrer Ankunft in Venezuela gebracht hatte, ging mal ungeduldig auf und ab oder las in irgendwelchen Büchern, von denen keines sie wirklich fesseln konnte. Es machte sie verrückt, einfach nur herumzusitzen und darauf zu warten, dass Dr. Dressler auf die Insel zurückkehrte und seine Männer anwies, sie zurück zum Festland zu bringen. Bedauerlicherweise war er nicht da gewesen, als sie hier eingetroffen war, und ohne seinen ausdrücklichen Befehl würden seine Männer gar nichts unternehmen.
Ungehalten schnalzte sie mit der Zunge und verließ die Bibliothek. Sie presste missmutig die Lippen zusammen, als ihr Blick zu den beiden Männern wanderte, die an der zweiflügeligen Haustür Wache hielten. Der eine stand links, der andere rechts der Tür, sie starrten stur geradeaus, verzogen keine Miene und hielten die Hände locker an der Seite, um sofort nach den Schusswaffen zu greifen, von denen sie wusste, dass beide sie trugen.
Das war aber auch das Einzige, was sie richtig machten, soweit sie das beurteilen konnte. Ihr war gesagt worden, dieses Übermaß an Sicherheitsvorkehrungen auf der Insel sei ergriffen worden, weil in Venezuela fast im Minutentakt Menschen entführt wurden und weil »el doctor« für seine Sicherheit genauso sorgen wollte wie für die seiner Familie, seiner Angestellten und seiner Besucher. Wenn das allerdings der Fall war, sollten seine Aufpasser eigentlich draußen vor der Tür Wache schieben und die Gegend im Auge behalten, damit sich keine Entführer dem Anwesen nähern konnten. Dass sie im Haus postiert waren und das Geschehen dort beobachteten, ergab keinen Sinn.
Allerdings gab es draußen auch Wachposten, wie sie einräumen musste. Zwei Männer standen gleich vor der Tür, und rund ein Dutzend mehr waren auf dem Gelände verstreut. »El Doctor« war wohl ein wenig paranoid, was Entführungen anging. Aber da man ihre eigene Mutter auch entführt und ermordet hatte, als Sarita noch sehr jung gewesen war, sollte sie ihm wohl seine Maßnahmen, für Sicherheit für alle zu sorgen, hoch anrechnen, anstatt ihn für paranoid zu halten. Und dennoch empfand sie heute diese an allen Ecken und Enden aufgestellten Wachposten einfach nur als ärgerlich.
Da sie wusste, dass ihre schlechte Laune eine Folge dieser Kombination aus Langeweile und Frust war, machte sie auf dem Absatz kehrt und ging durch den Flur in Richtung Küche. Sie würde sich etwas zu trinken holen und dazu vielleicht einen von Aletas köstlichen Keksen. Bei der Gelegenheit könnte sie herausfinden, ob sie der Köchin vielleicht bei irgendetwas behilflich sein konnte, um die Zeit totzuschlagen. Im Augenblick würde sie sich sogar freuen, das Geschirr spülen zu dürfen, was einiges über das Ausmaß ihrer Langeweile aussagte.
Sie verzog den Mund, frustriert darüber, dass sie nach nur gerade einmal drei Tagen Nichtstun bereits so tief gesunken war. Als sie die Küchentür aufdrückte und eintrat, schlug ihr sofort der Duft von etwas Köstlichem entgegen. Sie zog die Nase kraus, als sie das herrliche Aroma tief in sich aufsog. Aleta stand an der Kücheninsel und rührte in einem Kochtopf, und Sarita ging zu ihr, um einen Blick in den Topf zu werfen. Sie entdeckte Gemüse- und Fleischwürfel in einer dicklichen Soße, ein Potpourri an herrlichen Aromen.
»Hola«, begrüßte Aleta sie mit einem freundlichen Lächeln, das Sarita erwiderte. »Hola. Das riecht ja gut. Ich könnte schwören, Aleta, Sie sind ein Engel. Alles, was Sie zubereiten, ist köstlich.«
»Gracias«, sagte Aleta, die vor Freude errötete.
»Was ist das?«, fragte sie und beugte sich noch einmal über den Kochtopf, um das verlockende Aroma abermals tief in sich aufzunehmen.
»Un estofado de ternera«, antwortete die Köchin.
»Hmm«, machte Sarita und schnupperte abermals am Eintopf.
»Es ist noch nicht Zeit für das Abendessen, aber das Essen ist schon fertig«, ließ Aleta sie wissen, da ihr wohl nicht entgangen war, dass Sarita das Wasser im Mund zusammenlief. »Wenn Sie Hunger haben, können Sie jetzt schon essen.«
»Oh ja, bitte«, sagte sie prompt.
Aleta reagierte mit einem amüsierten Kichern. »Dann setzen Sie sich ins Esszimmer, und ich bringe Ihnen einen Teller.«
Sarita schüttelte den Kopf. »Ich kann hier essen. Ich fände es schöner, ein bisschen Gesellschaft zu haben«, fügte sie zur Erklärung hinzu, als Aleta die Stirn in Falten legte.
Die Miene der anderen Frau nahm einen sanfteren Ausdruck an. »Dann essen Sie eben hier«, befand sie und nickte. »Setzen Sie sich.« Dabei deutete sie auf die Hocker, die auf der gegenüberliegenden Seite der Kücheninsel standen.
Sarita wollte sich selbst mit Essen und Trinken versorgen, doch sie vermutete, wenn sie darauf bestand, würde Aleta es sich vielleicht doch noch anders überlegen und sie nicht in der Küche essen lassen. Also nahm sie gehorsam auf einem der Hocker Platz und sah zu, wie Aleta ein paar Kellen Eintopf in einen Suppenteller schöpfte.
»Que quieres tomar?«, fragte sie, als sie den Teller vor Sarita hinstellte.
»Ein Wasser wäre gut«, antwortete sie.
»Agua«, sagte Aleta, die immer wieder ins Spanische verfiel, obwohl an ihrem Englisch nichts auszusetzen war. Aber vermutlich fühlte sie sich in der fremden Sprache doch nicht so sicher, und Sarita würde sie nicht noch zusätzlich in Verlegenheit bringen, indem sie sie darauf ansprach.
Sarita nahm den Löffel, tauchte ihn in den Eintopf und pustete kurz drauf, um ihn etwas abzukühlen, dann endlich nahm sie den Löffel in den Mund. Der Eintopf schmeckte so gut wie er duftete, nein, er war sogar noch besser – so viel besser, dass Sarita lustvoll aufstöhnte, als der Geschmack auf ihrer Zunge förmlich explodierte.
Amüsiert stellte Aleta ihr ein Glas Wasser und einen Teller mit einem großen tequeño darauf zu ihrem Teller, dann widmete sie sich wieder dem Kochtopf auf der Herdplatte.
Sarita biss von der frittierten und mit Käse gefüllten Brotstange ab. Sie liebte Aletas tequeños. Genau genommen konnte sie sich für absolut alles begeistern, was die Frau seit Saritas Ankunft auf der Insel vor drei Tagen gekocht hatte. Sie überlegte ernsthaft, ob sie der Köchin ein Angebot machen sollte, damit sie ihr nach Kanada folgte und dort weiter für sie kochte. Sie musste nur darüber nachdenken, ob sie sich das leisten konnte. In ihrem Apartment war nicht genug Platz für sie beide, also müsste sie sich ein Haus anschaffen. Ganz abgesehen von den unzähligen Problemen, die die Einwanderungsbehörde ihr machen würde.
Sarita hatte den Eintopf und ihr tequeño fast aufgegessen, da legte Aleta die Schöpfkelle zur Seite und holte einen Mixer aus dem Schrank, den sie auf den Tresen stellte und anschloss. Dann ging sie zum Kühlschrank und kam mit einer großen Ladung gewaschenem und kleingeschnittenem Gemüse zurück.
»Was machen Sie jetzt?«, fragte Sarita interessiert, während Aleta den größten Teil des Gemüses in den Mixer gab. Dann ging sie zum Vorratsschrank.
Augenblicke später kehrte sie mit einem großen Glas zum Tresen zurück, in dem sich irgendein Pulver befand. »La bebida nutritiva para el doctor.«
Ein Gesundheitstrunk für den Doctor, übersetzte Sarita im Stillen und stutzte, während sie mit ansah, wie Aleta das Pulver in einen Messbecher schüttete. »El Doctor ist zurück?«, fragte sie erstaunt.
»Zurück?« Aleta betrachtete kritisch den Messbecher und gab noch etwas mehr Pulver dazu, während sie das Gefäß leicht schüttelte. »Zurück von wo? Er ist seit Wochen nirgendwo mehr hingereist. Seit er sein año sabático genommen hat, ist er immer nur unten im Labor.«
Sabbatjahr, dachte Sarita. Dr. Dressler hatte von diesem Sabbatjahr gesprochen, als er sie angerufen hatte, um sie über den Sturz und die Verletzungen ihrer Großmutter zu informieren. Anscheinend hielt er sich seitdem nur in seinem Labor auf, und nicht auf dem Festland, wie man sie hatte glauben lassen. Nach Dr. Dresslers Anruf fürchtete sie um das Leben ihrer Großmutter, schließlich befand sie sich in einem Alter, in dem man einen solchen Sturz oftmals nicht überlebte. Sarita hatte sich mit dem ersten verfügbaren Flugzeug auf den Weg nach Venezuela gemacht, wo sie vom Chef von Dr. Dresslers Sicherheitsteam per Hubschrauber auf die Insel gebracht wurden. Erst dort hatte sie dann erfahren, dass sich ihre Großmutter noch immer in einem Krankenhaus in Caracas befand. Natürlich hatte sie darauf bestanden, sofort aufs Festland zurückgebracht zu werden, woraufhin ihr erklärt worden war, dass ohne Dr. Dresslers ausdrückliche Genehmigung weder der Helikopter noch eines der Boote die Insel verlassen durfte. Außerdem war ihr gesagt worden, dass Dressler nicht »da« sei.
Sarita hatte diese Aussage so gedeutet, dass er sich nicht auf der Insel befand, weshalb sie voller Ungeduld auf seine Rückkehr gewartet hatte. Und nun sah es so aus, dass er sich offenbar auf der Insel befand, nur eben nicht hier im Haus. Diese Neuigkeit machte sie wütend, wobei ihre Wut vor allem Dresslers Sicherheitschef galt, der sich nicht klar genug ausgedrückt hatte. Hätte sie das gewusst, wäre sie notfalls persönlich zu Dressler gegangen, um sich von ihm die Erlaubnis zu holen. Dann hätte sie schon vor Tagen am Bett ihrer Großmutter sitzen können.
Mürrisch stand sie auf und trug das benutzte Geschirr zur Spüle.
»Lassen Sie ruhig, das erledige ich schon«, sagte Aleta, als Sarita den Wasserhahn aufdrehte.
»Gracias«, murmelte Sarita und hörte auf die Frau, anstatt mit ihr zu streiten. Abgesehen davon war in dem kurzen Moment ohnehin alles abgespült worden. Auf dem Weg zur Tür fügte sie noch hinzu: »Und vielen Dank für das Essen, es war köstlich.«
»De nada«, entgegnete die Köchin gedankenverloren, da sie sich ganz aufs Abmessen konzentrierte.
Sie hatte die halbe Strecke durch den Flur zurückgelegt, da fielen Sarita die Männer ein, die an der Tür Wache hielten. Ihnen wollte sie nicht erklären müssen, dass sie runter zum Labor wollte, zumal zu befürchten war, dass sie sie davon abhalten würden. Also machte sie kehrt und lief die Treppe hinauf in den ersten Stock. Sie folgte dem Gang bis zu dem Zimmer, in dem man sie gleich nach ihrer Ankunft untergebracht hatte, und ging hinein.
Ein vorsichtiger Blick zur Terrassentür ließ sie erkennen, dass die Sonne bald untergehen würde. Im schwächer werdenden Tageslicht konnte sie Männer ausmachen, die aus allen Richtungen zum Haus zurückkehrten. Als sie die Küche betreten hatte, war es noch nicht Zeit fürs Abendessen gewesen, doch inzwischen war es so weit, und ganz offensichtlich war sie nicht die Einzige, die ein Faible für Aletas Kochkünste hatte.
Sie wartete ab, bis alle Männer ums Haus herumgegangen waren und sie sie nicht länger sehen konnte. Sie wusste, sie waren auf dem Weg zur Küche, um ihr Essen zu holen. Das hieß, draußen war jetzt nur die Notbesetzung anwesend, also die beiden Männer an der Tür, die Männer auf den Wachtürmen und die am Tor zum eingezäunten Labor. Diese Männer würden bald abgelöst werden, damit auch sie etwas essen konnten. Oder aber ihnen wurde eine Portion gebracht. Das jedoch wusste Sarita nicht, weil es ihr bislang nicht wichtig erschienen war, sich darüber Gedanken zu machen.
Ihr war es jetzt auch egal, überlegte sie, während sie nach draußen auf den Balkon ging. Der Garten war verwaist, also stieg sie über das Geländer, ließ sich an den weiß gestrichenen Metallgitterstäben nach unten gleiten, bis sie an der Unterkante angelangt war. Sie ließ los und landete mit einem mühelosen Sprung auf der Terrasse darunter. Ein leichtes Aufstöhnen kam ihr über die Lippen, als sie mit bloßen Füßen auf den Steinplatten aufkam. Nachdem sie sich in aller Eile umgesehen hatte, lief sie am Haus entlang bis zur vorderen Ecke.
Ein Blick um dieselbe ergab, dass sogar die Männer Essen holten, die vor der Eingangstür Wache geschoben hatten. Sie war jeden Abend davon ausgegangen, dass die Männer vor der Tür genauso wie die, die drinnen standen, so lange warteten, bis sie in der zweiten Schicht ebenfalls essen gehen konnten. Offenbar war das aber nicht der Fall. Während sie noch darüber nachdachte, lief sie quer über den Rasen, hin zu dem Weg, der zwischen den Bäumen hindurch zum Labor führte. Sie rechnete damit, jeden Moment entdeckt zu werden, doch sie schaffte es tatsächlich bis zur Baumreihe, die entlang des Zauns verlief, ohne jemandem vom Sicherheitsdienst über den Weg zu laufen. Zwischen den Bäumen blieb sie stehen und betrachtete die eingezäunten Gebäude, die alle zu Dr. Dresslers Labor gehörten. Aus der Luft hatte das halbe Dutzend lang gestreckter Bauten nach Kasernen irgendeiner Armee ausgesehen. Als sie aber jetzt die Wachtürme an jeder Ecke des Areals und den meterhohen Zaun betrachtete, kam es ihr eher so vor, als hätte sie es mit einem Gefängnis zu tun.
Wieder betrachtete sie aufmerksam die Männer, die die Türme bewachten. Wegen der einsetzenden Dämmerung konnte sich Sarita nicht ganz sicher sein, aber es schien so, als sei deren Aufmerksamkeit mehr auf das ausgerichtet, was sich innerhalb des Zauns befand. So als wäre ihre Aufgabe die, jemanden davon abzuhalten, aus diesem umzäunten Areal zu entkommen, anstatt irgendwelche Eindringlinge von draußen zu stoppen. Da sie fand, dass das für sie nur von Vorteil sein konnte, straffte sie die Schultern und näherte sich dem Wachhaus am einzigen erkennbaren Zugangstor zu dem Gelände.
Innerlich machte sich Sarita auf eine hitzige Diskussion gefasst, während sie zum Tor ging. Es war davon auszugehen, dass der diensthabende Wachmann sie nicht durchlassen würde. Aber das war auch nicht nötig, es genügte, wenn Dr. Dressler zu ihr kam. Sie würde darauf bestehen, dass der Wachmann den Doctor anrief und ihn zum Tor kommen ließ. Und dann würde sie von Dr. Dressler verlangen, dass er sie von seinen Leuten per Boot oder Helikopter ans Festland bringen ließ, damit sie endlich ihre Großmutter besuchen konnte. Schließlich war sie nur deswegen nach Venezuela gekommen. Sarita war verdammt sauer, dass sie drei Tage auf dieser Insel hatte zubringen müssen, während ihre Großmutter ganz woanders im Krankenhaus lag und auf sie wartete.
Wider Erwarten musste sie aber gar nicht mit dem Wachmann diskutieren, denn an dem Häuschen angekommen ging sie bis zum Fenster und wollte eben anfangen zu reden, als sie sah, dass der blonde Mann mit dem Rücken zum Fenster und zum Tor saß und von ihr gar nichts sehen konnte. Er trug Ohrstöpsel und sah sich einen Film an, der auf dem Computermonitor vor ihm auf dem Tresen lief.
Ein Porno, wie sie mit einem Blick auf den Bildschirm unschwer erkennen konnte.
So viel also zum Thema Sicherheit, dachte Sarita ironisch und schaute sich das Tor an. Es gab ein großes Tor für Fahrzeuge aller Art, daneben ein kleineres für Passanten. Dorthin ging Sarita und konnte nur fassungslos den Kopf schütteln, als sich herausstellte, dass der Zugang nicht einmal verschlossen war. Sie machte die Tür auf, ging hindurch und zog sie leise hinter sich zu. Dann ging sie zügig auf das erste Gebäude zu. Sie hatte mehr als die halbe Strecke zurückgelegt, als ein Ruf ertönte, dem ein weiterer folgte, und dann immer mehr, da andere den Ruf hörten und ihn zum nächsten weitergaben, sobald sie sie entdeckt hatten.
Sarita beschloss, diese Reaktion auf ihre Anwesenheit zu ignorieren, und ging einfach weiter, wenngleich auch etwas zügiger als zuvor. Sie erreichte die Tür und sah sich noch einmal kurz um, ehe sie das Gebäude betrat. Zwei Männer von den Türmen kletterten auf Leitern nach unten, doch der Mann im Wachhaus war noch immer in seinen Porno vertieft. Er konnte nach wie vor nichts davon mitbekommen haben, was um ihn herum los war. Auf ihn wartete vermutlich jede Menge Ärger.
Sie zog die Tür hinter sich zu und begutachtete den Raum, den sie soeben betreten hatte. Das war eindeutig ein Labor, alles war in Weiß gehalten, an zwei Wänden fanden sich Ober- und Unterschränke aus Edelstahl. An der dritten Wand standen ein Kühlschrank und eine Kühltruhe, beide von einer Größe, wie man sie in Großküchen benötigte. An der vierten Wand schließlich stand ein Schreibtisch.
Mitten im Raum hatte man dicht nebeneinander zwei große Rolltische abgestellt, die beide Saritas Interesse auf sich lenkten.
Da sie nicht glauben wollte, was sie sah, ging Sarita Schritt für Schritt weiter, bis sie den ersten Tisch erreicht hatte. Darauf lag die obere Hälfte eines Leichnams, der an den Tisch festgeschnallt war. Der Mann war vermutlich um die fünfundzwanzig Jahre alt geworden, hatte blonde, kurz geschnittene Haare und ein hübsches Gesicht, aber so bleich, als wäre nicht mehr ein einziger Tropfen Blut in seinen Adern zu finden. Sein Oberkörper befand sich in einem makellosen Zustand … sofern man davon absah, dass dieser Körper dicht unterhalb des Bauchnabels so endete, als hätte man ihn in zwei Hälften zerteilt.
Fassungslos betrachtete Sarita den Leichnam, der mit Dutzenden von Metallbändern am Tisch festgeschnallt war, von denen eines über seine Stirn lief, ein weiteres seinen Hals umschloss, gefolgt von zahllosen anderen, die alle in einem Abstand von nur wenigen Zentimetern angebracht waren. Selbst die beiden Arme wurden mit einem halben Dutzend Metallbänder am Tisch festgehalten.
Sarita sah zu dem zweiten Tisch, auf dem die untere Körperhälfte ruhte. Der Lendenbereich war mit einem kleinen Handtuch bedeckt, aber der Bereich, der zuvor mit dem Oberkörper verbunden gewesen war, glich einer riesigen klaffenden Wunde. Man hätte meinen können, dass man ihn wie einen Baumstamm einfach in der Mitte durchgesägt hatte.
Während sich Sarita die Schnittfläche an Ober- und Unterkörper genauer ansah, stellte sie sich die Frage, wieso sie nicht längst vor Panik ausgerastet war.
Vermutlich hing es damit zusammen, dass kein Tropfen Blut zu sehen war, überlegte sie. Oder weil es nicht echt aussah. Oder es lag daran, dass sie sich an die Ausstellung Körperwelten erinnert fühlte, bei der konservierte Leichen so präpariert worden waren, dass die Anatomie des Körperinneren gezeigt werden konnte. 2005 hatte ihr Vater sie ins Ontario Science Center mitgenommen, um sich diese Ausstellung anzusehen. Ja, das hier erinnerte an die blutleeren Darstellungen der Vorgänge, die sich im Körperinneren abspielten. Ganz danach sah es aus. Das hier musste eine Leiche aus der Universität sein, davon war sie fest überzeugt.
Das passte zusammen, fand Sarita. Immerhin war Dr. Dressler als Professor an einer der Universitäten in Venezuela tätig, auch wenn es ihrer Meinung nach wohl nicht an der Tagesordnung war, dass ein Professor einfach eine Leiche mit nach Hause nahm.
Warum beide Körperhälften so massiv an den Tischen festgezurrt waren, war für Sarita ein unerklärliches Rätsel.
Lauter werdende Stimmen lenkten ihre Aufmerksamkeit auf sich, und als Sarita sich zur Tür umdrehte, hörte sie jemanden sagen: »Ich kümmere mich darum. Ihr kehrt auf eure Posten zurück … und tut diesmal gefälligst das, wofür ihr da seid.«
Da ging die Tür auf, und ein älterer Mann in dunkler Hose und weißem Arztkittel kam herein. Er war groß, das schneeweiße Haar trug er gescheitelt und nach hinten gekämmt. Die Wellen, in denen es herabfiel, ließ die Vermutung zu, dass der nächste Friseurbesuch bereits eine Weile überfällig war. Schnäuzer und Kinnbart waren ebenso weiß, nur seine Augenbrauen waren ein Mix aus weißen und dunklen Härchen, die erkennen ließen, dass er in jüngeren Jahren dunkelbraune, wenn nicht gar schwarze Haare gehabt hatte. Die Haut am Hals war auffallend faltig, und das Gesicht von tiefen Falten durchzogen, die aber längst nicht so ausgeprägt waren, wie sie es von jemandem erwartet hätte, der bereits über achtzig war.
»Dr. Dressler?«, fragte sie zögernd, dann erst fiel ihr die Frau auf, die ihm nach drinnen gefolgt war.
Sie trug ebenfalls eine dunkle Hose und einen Arztkittel, aber sie war höchstens Anfang dreißig. Das blonde Haar trug sie zu einem straffen Knoten zusammengebunden, ihr Gesicht war eindeutig nicht geschminkt und dennoch wunderschön. Zumindest wäre es wunderschön gewesen, wenn sie nicht so missmutig dreingeschaut hätte, fand Sarita.
»Sarita, meine Liebe. Was für eine Freude, Sie endlich kennenzulernen«, begrüßte Dr. Dressler sie und lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich. Er griff nach Saritas Hand und hielt sie fest umschlossen, um sie zur Seite zu dirigieren, während er hinzufügte: »Leider kommen Sie in einem sehr unpassenden Moment her. Dieses Experiment duldet keinen Aufschub, deshalb muss ich Sie bitten, uns nicht im Weg zu stehen, während wir unsere Arbeit erledigen. Sobald wir damit fertig sind, werden wir uns unterhalten.«
Sie blieb an der Wand stehen, an die er sie praktisch gedrängt hatte, und verfolgte schweigend mit, wie er zu der blonden Frau ging und ihr dabei half, die beiden Tische so zusammenzuschieben, dass sich obere und untere Körperhälfte berührten.
»Hol das Blut, Asherah«, wies Dr. Dressler sie an, während er Schnallen zuschnappen ließ, durch die die beiden Hälften zu einem langen Tisch verbunden wurden.
Die blonde Frau ging zum Kühlschrank in einer Ecke und öffnete ihn, sodass der Blick auf zahllose Reihen von Blutbeuteln freigegeben wurde.
Sarita versteifte sich unwillkürlich. Diese Blutbeutel sahen genauso aus wie die, die im Krankenhaus oder bei einer Blutbank zu finden waren, aber die Menge an Beuteln machte sie sprachlos. Auf die Entfernung hin konnte sie nur schätzen, hielt aber mindestens einhundert Blutbeutel für eine realistische Zahl. Eine schlicht unmögliche Zahl!
Asherah brachte die Beutel zu einem Rolltisch, auf dessen Tablett chirurgische Instrumente angeordnet lagen. Sie warf die Beutel auf das Tablett und schob den Tisch zu Dr. Dressler, dann holte sie ohne zusätzliche Aufforderung zwei Ständer für Blutbeutel und solche mit Nährlösungen und Ähnlichem. Kaum hatte sie beide Ständer neben dem Tisch abgestellt, nahm der Arzt einen der Beutel und machte sich daran, einen Tropf zu legen. Die Nadel schob er in den linken Arm des Leichnams. Gleich darauf nahm er den nächsten Beutel vom Tablett und wiederholte die Prozedur am rechten Arm. Dann sah er erwartungsvoll auf.
Sarita sah, dass Asherah zu den Schränken gegangen war und mit etwas zurückkehrte, das auf den ersten Blick wie ein Knebel aussah, allerdings mit mehr Bändern zum Festmachen. Und anstelle eines Knebels in Form einer Plastikkugel befand sich in der Mitte ein Trichter.
»Zwei Minuten«, sagte Dr. Dressler mahnend und behielt seine Uhr im Auge, während Asherah das Teil so am Kopf befestigte, dass der Trichter im Mund des Toten verschwand.
Dann lief die Frau zum Kühlschrank zurück und holte noch einmal ein halbes Dutzend Blutbeutel, von denen sie bis auf einen alle auf den Instrumentenwagen warf. Sie nahm ein Skalpell von dem Tablett und stellte sich dort neben den Toten, wo die beiden Hälften sich berührten. Sie schaute auf den Schnitt und schien auf irgendetwas zu warten.
Völlig ratlos schüttelte Sarita den Kopf und setzte an: »Was …«
»Schhht«, machte Dr. Dressler sofort. »In dreißig Sekunden werden Sie begreifen.«
Zwar machte Sarita den Mund zu, schüttelte aber weiter den Kopf, da sie ihren Augen nicht trauen wollte, dass sich dieser Irrsinn tatsächlich abspielte. Leichenschändung war in Kanada strafbar, und genau danach sah das aus, was hier gerade betrieben wurde. Dummerweise war das hier nicht Kanada, und sie hatte keine Ahnung, wie die Gesetzeslage in Venezuela war. Allerdings würde sie sich darüber informieren, sobald sie die Gelegenheit dazu bekam.
»Jetzt!«, rief Dr. Dressler und öffnete den einen Tropf, dann lief er um den Tisch herum und machte das Gleiche auf der anderen Seite. Sofort lief das Blut durch die Schläuche, doch davon bekam Sarita kaum etwas mit, da sie zu beschäftigt war, voller Entsetzen mitanzusehen, wie Asherah ein Loch in den Blutbeutel stach, den sie in der Hand hielt. Das Blut lief heraus und verteilte sich dort, wo die beiden Körperhälften zusammengeschoben worden waren.
»Mein Gott«, hauchte Sarita angewidert. Ihr Ekel steigerte sich nur noch mehr, als Dr. Dressler selbst ein Skalpell und einen Blutbeutel an sich nahm, den er über das Gesicht des Toten hielt. Mit der Klinge stach er hinein, und sofort strömte das Blut in den Trichter, der im Mund des Leichnams steckte.
Mit geballten Fäusten stand Sarita da und kämpfte gegen Übelkeit an, während sie das Treiben der beiden weiter verfolgte. Von Herzen wünschte sie sich in diesem Moment, für die Ordnungshüter von Venezuela anstelle von Kanada zu arbeiten, damit sie diesen verrückten Arzt und seine genauso durchgeknallte Assistentin verhaften konnte.
Sie hatte keine Ahnung, was die beiden mit diesem Irrsinn erreichen wollten, aber es war … Weiter kam Sarita mit ihren Überlegungen nicht, da der Tote auf einmal die Augen aufriss und zu kreischen begann. Jedenfalls schien er kreischen zu wollen, aber es war in erster Linie ein raues Gluckern, da er versuchte, einen Ton herauszubekommen, während ihm das Blut in den Rachen lief. Durch seine Anstrengungen spuckte er etwas von diesem Blut wieder aus, das genau auf Dr. Dressler landete.
»Sie haben den Schlauch vergessen, Asherah«, herrschte der Doktor sie aufgebracht an, fügte aber rasch hinzu: »Unterbrechen Sie ja nicht ihre Arbeit!«
Bei dem Vorwurf von Dr. Dressler hatte sie sich mit dem Blutbeutel von ihm wegdrehen wollen, hielt jedoch sofort wieder inne, als sein Befehl folgte.
»Sarita, auf dem Tresen an der Wand hinter mir sollte ein Stück Schlauch liegen«, wandte sich der Mann an sie, während er weiter Blut in den Rachen des Mannes laufen ließ, den sie für tot gehalten hatte. Der schrie nun aus Leibeskräften und spuckte dadurch mehr und mehr von dem Blut aus, das er eigentlich schlucken sollte.
Zu verblüfft von dem, was hier vor ihren Augen ablief, befolgte Sarita Dr. Dresslers Anweisung und brachte ihm den gewünschten Schlauch. Als sie sich zu ihm stellte, deutete er mit einer Kopfbewegung auf das Tablett. »Nehmen Sie einen Beutel.«
Sie griff nach einem der Beutel und hielt ihn dem Doktor hin. Der nahm ihn an sich, wartete, dass der erste Beutel endgültig leer war, dann warf er ihn weg und hielt den vollen Beutel über den Mund seines Opfers.
»Halten Sie das!«, wies er Sarita an, nachdem er ein Loch in den Plastikbeutel gestochen hatte.
Sarita zögerte, begab sich dann aber auf die andere Seite des Tischs und übernahm den Blutbeutel. Ihr fiel auf, dass ihre Hände zitterten, dennoch bemühte sie sich, den Beutel so ruhig wie möglich zu halten. Gleichzeitig biss sie tapfer die Zähne zusammen, da der Leichnam weiterhin schrie wie am Spieß und das meiste Blut wieder aus dem Mund herauspresste, das auf sie und den Doktor spritzte. Dem aber gelang es schließlich, den Schlauch durch den Trichter und weiter in die Speiseröhre des Mannes zu schieben. Der Schlauch sorgte nicht nur dafür, dass das Blut wie beabsichtigt in den Magen gelangte, sondern er schien den Mann auch am Schreien zu hindern.
Da sie davon überzeugt war, dass dem Mann nur noch mehr Schmerzen zugefügt wurden, wandte sie den Blick ab und schaute zu Asherah. Die Assistentin warf den ersten Beutel weg, da er leer war, und nahm den nächsten, schnitt ihn auf und hielt ihn wieder über die Stelle, an der der Körper in zwei Hälften zerteilt worden war. Sarita konnte nur den Kopf schütteln, da ihr Verstand einfach nicht glauben wollte, was sich da vor ihren Augen abspielte.
Dr. Dressler war mit dem Einführen des Schlauchs fertig, nahm aber den Beutel, den Sarita noch immer festhielt, nicht wieder an sich. Stattdessen hängte er neue Blutbeutel an die beiden Ständer, wobei Sarita auffiel, dass die beiden ursprünglichen Beutel bereits zur Hälfte geleert waren.
Kein normaler Tropf führte dem Körper so schnell Flüssigkeit zu. Es konnte nur sein, dass Dr. Dressler mit einer besonders großen Nadel arbeitete. Was das für die Adern des Leichnams zur Folge haben würde, konnte sie nicht beurteilen, aber allein der Gedanke veranlasste sie zu einem empörten Kopfschütteln. Dieser Mann war offenbar gar kein Leichnam, da sich ein Leichnam nicht bewegte und auch nicht schrie. Aber er hätte ein Leichnam sein müssen. Himmel, man hatte ihn in der Mitte durchgeschnitten. Dieser Gedanke ging ihr wieder und wieder durch den Kopf, als sie einen Beutel voller Blut nach dem anderen in den Mund des Mannes laufen ließ, während Asherah das Gleiche am Übergang zwischen Ober- und Unterkörper praktizierte. Währenddessen behielt Dr. Dressler jeden Tropf im Auge und holte zwischendurch neue Beutel aus dem Kühlschrank.
Sarita war bei ihrem sechsten Beutel angelangt und begann allmählich zu glauben, dass das noch ewig so weitergehen würde, da knurrte Asherah auf einmal: »Jetzt.«
Sofort schaute Dr. Dressler auf seine Armbanduhr, nickte und sah Sarita mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen an. »Sehr gut. Asherah wird erst noch das Gröbste aufwischen und dann Ihren letzten Beutel übernehmen. Ich muss die Zeit notieren, und danach können wir reden.«
Er lief zu dem Schreibtisch, der ihr schon beim Hereinkommen aufgefallen war. Sarita sah wieder zu Asherah, die unter den Tisch griff und etwas hervorholte, was an der Spitze wie eine Düse aussah. Erst als die Frau einen Hebel betätigte und Wasser über den Körper des Mannes lief, begriff Sarita.
Ohne die Hand zu bewegen, mit der sie den Beutel über den Mund hielt, bückte sie sich weit genug vor, damit sie einen Blick unter den Tisch werfen konnte. Dabei erkannte sie, dass die obere Tischhälfte fest mit dem Boden verbunden war, während die untere Hälfte hin und her geschoben werden konnte. Zwei Rohre verliefen an einem Tischbein nach oben, wovon eines in den Schlauch überging, den die Frau soeben benutzt hatte. Durch das andere Rohr liefen alle Flüssigkeiten ab, die sich auf dem Tisch gesammelt hatten. Sie richtete sich wieder auf und überprüfte, ob das Blut weiterhin in den Mund des Mannes lief. Als sie wieder zu Asherah sah, stellte sie fest, dass das meiste Blut weggespült worden war.
Ihr Blick fiel auf die Stelle, an der der Leib durchtrennt worden war. Sie musste feststellen, dass beide Hälften mit einem Mal wieder miteinander verbunden schienen. Geblieben war nur eine hässliche rote Narbe, die um den Körper herumverlief.
»Madre de Dios«, hauchte sie, da sie ihren Augen einfach nicht trauen wollte.
»Aus dem Weg.«
Überrascht drehte sie sich zur Seite und sah, dass Asherah den Schlauch weggeräumt hatte und auf sie zukam, ihr den Beutel aus den Fingern nahm und sie aus dem Weg drängte. »El Doctor will mit Ihnen reden.«
Sarita machte einen Schritt zur Seite und betrachtete wieder die umlaufende Narbe.
»Gehen Sie«, fuhr Asherah sie frostig an. »Sie werden hier nicht mehr gebraucht.«
Ohne dass ihr der missbilligende Ausdruck im Gesicht der Frau entgangen wäre, drehte sich Sarita um und ging zu dem Schreibtisch, wo Dr. Dressler wie wild Notizen machte.
Als er offenbar damit fertig war, hob er den Kopf und sah Sarita an. Er stand von seinem Stuhl auf und lächelte sie breit an. »Vielen Dank, Sarita. Ihre Hilfe war unbezahlbar.«
»Wobei genau habe ich eigentlich geholfen?«, wollte sie wissen und setzte eine skeptische Miene auf, während der Doktor um den Tisch herum auf sie zukam. »Dieser Mann war doch tot.«
»Nein, das war er nicht«, versicherte er ihr, ging zu einem der Schränke, wo er ein paar Spritzen herausnahm und dann auf den Kühlschrank zusteuerte. »Und er ist auch kein Mann.«
Sie zog die Augenbrauen hoch und sah wieder zum Tisch. »Für mich sieht er wie ein Mann aus.«
»Ja«, stimmte er ihr zu, bückte sich und holte zwei Ampullen aus dem Kühlschrank. »Aber das ist er nicht. Er ist ein Unsterblicher.«
»Ein Unsterblicher?«, wiederholte Sarita und folgte ihm zurück an den Tisch. Als er keine Antwort gab, sondern sich ganz darauf konzentrierte, die Spritze für den Mann vorzubereiten, schaute sie kurz zu Asherah, die eben den nächsten leeren Blutbeutel wegwarf. Sie ging zum Rolltisch und nahm zwei volle Blutkonserven an sich, um die Beutel an dem Ständer auszutauschen.
»Unsterbliche sind wissenschaftlich weiterentwickelte Sterbliche«, erklärte ihr Dr. Dressler und lenkte ihre Aufmerksamkeit abermals auf sich. »Dieser Mann ist vollgestopft mit biomechanischen Nanos, die darauf programmiert sind, seinen Körper gesund zu halten.«
Nachdem die Spritze aufgezogen war, legte er die Ampulle auf das Tablett und hielt die Spritze weiter in der Hand, während er den von ihm als Unsterblicher vorgestellten Mann betrachtete und erklärte: »Diese Nanos bekämpfen Krankheiten, sie reparieren Schäden, die durch Einwirkung von Sonne und Alterungsprozesse entstanden sind, und sie reparieren Verletzungen, wie Sie sehen konnten.«
Unwillkürlich sah Sarita zu der Stelle, an der der Körper zuvor in zwei Hälften geschnitten worden war.
»Wenn er genug Blut bekommt, wird bald nicht mal mehr eine Narbe zu sehen sein«, ließ Dr. Dressler sie wissen. »Das Blut ist der Treibstoff für die Nanos. Alles spricht dafür, dass die Nanos damit nicht nur Reparaturen im Körper vornehmen können, sondern sich damit auch reproduzieren.«
»Blut«, murmelte Sarita und sah zu Boden, der mit leeren Blutbeuteln übersät war.
»Ja, wenn sie verletzt sind, benötigen sie besonders viel davon«, bestätigte er. »Aber selbst wenn es keine Krankheiten zu bekämpfen oder Verletzungen zu beheben gibt, benötigen die Nanos mehr Blut, als der Wirtskörper produzieren kann, um ihn jung und gesund zu halten. Diese Nanos haben ihre Wirtskörper dazu gezwungen, sich weiterzuentwickeln und zu verändern, um diesem Bedürfnis gerecht werden zu können. Im Ergebnis sind aus ihnen wissenschaftlich erschaffene Vampire geworden.«
Als Sarita ihn ungläubig ansah, drehte er sich zu Asherah um und sagte: »Zeig es ihr.«
Asherah löste die Bänder, mit denen der Trichter in Position gehalten wurde und zog ihn mitsamt dem Schlauch aus dem Schlund des Mannes.
Zwar rechnete Sarita damit, dass der sofort wieder zu schreien beginnen würde, aber von einem schwachen Stöhnen abgesehen blieb er ruhig. Asherah nahm einen der weggeworfenen Beutel und schnitt ihn an einer Seite auf, dann wischte sie mit der Fingerspitze die wenigen noch darin verbliebenen Tropfen Blut auf. Die Fingerspitze hielt sie dem Mann unter die Nase, und obwohl er bewusstlos zu sein schien, glitten auf einmal zwei Zähne aus seinem Oberkiefer heraus und wurden zu spitzen Reißzähnen.
Erschrocken wich Sarita einen Schritt zurück.
»Alles in Ordnung, wir sind vor ihm sicher«, beteuerte Dr. Dressler. »Wären seine Fesseln allerdings nur aus Leder und nicht aus Titan, sähe die Sache anders aus. Von den Fangzähnen abgesehen verleihen die Nanos ihrem Wirt enorme Kräfte und extreme Schnelligkeit. Dazu kommt eine erstaunliche Nachtsicht, außerdem die Fähigkeit, den Verstand eines anderen zu lesen und zu kontrollieren«, fügte er mit finsterer Miene hinzu, beugte sich über den Mann und gab ihm jetzt endlich die bereits vor längerer Zeit vorbereitete Spritze. »Und deswegen müssen wir jeden von ihnen ständig betäubt halten.«
»Jeden von ihnen?«, wiederholte Sarita irritiert.
»Es sind insgesamt achtzehn von ihnen hier in meinen verschiedenen Laboren«, sagte Dr. Dressler und richtete sich wieder auf.
»Wieso?«, fragte Sarita erschrocken, während er die benutzte Spritze weglegte und eine zweite vorbereitete. »Die sind doch ganz bestimmt alle gefährlich, nicht wahr?«
»Normalerweise nicht« entgegnete er. »Sie trinken grundsätzlich nur aus Blutkonserven. Und seit es Blutbanken gibt, ist es ihnen nach ihren eigenen Gesetzen verboten, uns Sterbliche zu beißen.«
Sarita entspannte sich ein wenig. Wenn sie nur Blutkonserven tranken, war das ja gar nicht so schlimm.
»Und bevor es Blutbanken gab, war es ihnen offenbar untersagt, denjenigen zu töten, der von ihnen gebissen wurde. Auf diese Weise ist es ihnen gelungen, über Jahrtausende hinweg unentdeckt mitten unter uns zu leben.«
»Jahrtausende?« Sarita kniff argwöhnisch die Augen zusammen, doch der Doktor zuckte nur mit den Schultern.
»Offenbar gehören sie zu einem Volk, das völlig isoliert vom Rest der Welt existiert hat und das sich seinerzeit technologisch rasend schnell weiterentwickelt hat. Die Nanos waren die Folge einer dieser technischen Entwicklungen.« Er schürzte die Lippen und betrachtete den Mann. »Sie behaupten, Atlantis sei ihre Heimat gewesen, und als Atlantis im Ozean versank, überlebten nur die, die Nanos in sich trugen. Sie mussten sich dem Rest der Welt anschließen. Sie behaupten auch, damals mindestens auf dem Stand gewesen zu sein, auf dem wir heute sind. Sie sagen, dass sie Krankenhäuser und Fachärzte hatten und dass sie Bluttransfusionen bekamen, um den zusätzlichen Bedarf an Blut zu stillen, der durch die Nanos verursacht wurde. Aber mit dem Ende von Atlantis war auch das Ende der Transfusionen gekommen. Die Entwicklungen der restlichen Welt hinkte der von Atlantis um Jahrtausende hinterher. Die Nanos sorgten für die Fangzähne, sie machten ihre Wirtskörper schneller und verliehen ihnen all die anderen speziellen Fähigkeiten, mit denen sie in die Lage versetzt wurden, an das zusätzliche Blut zu gelangen, das sie zum Überleben benötigten.«
Sarita musterte den Mann auf dem Tisch und schüttelte den Kopf. »Wenn ich ihm auf der Straße begegnen würde, käme ich nie auf die Idee, dass er kein Mensch sein könnte.«
»Das ist ja das Schöne. Er ist ein Mensch«, versicherte ihr Dr. Dressler. »Er und die anderen seiner Art haben Kinder und Familien, und sie leben ganz genauso wie wir. Nur dass sie länger leben und dabei nie krank werden. Er ist nicht anders als Sie oder ich, nur trägt er diese Nanos in sich. Ohne sie wäre er ein Sterblicher, und mit ihnen wären wir Unsterbliche.«
Etwas an seinem Tonfall, mit dem er die letzten Worte ausgesprochen hatte, ließ sie innerlich verkrampfen. »Sie haben ihn in der Mitte zerteilt«, sagte sie bedächtig, während sie versuchte, die Zusammenhänge zu verstehen. »Sie wollen an die Nanos herankommen, und darum haben Sie ihn durchgeschnitten.«
»Nein«, beteuerte Dr. Dressler. »Das wäre Vergeudung. Die Nanos sind so programmiert, dass sie im Wirtskörper bleiben. Ausbluten lassen führt zu nichts, da sie sich anscheinend in die Organe und in die Haut zurückziehen, um zu verhindern, dass sie mit dem Blut aus dem Körper geschwemmt werden. Man kann mit etwas Glück ein paar Nanos finden, aber sobald sie den Körper verlassen haben, zerfallen sie in Windeseile.«
Sarita wollte wissen, woher Dressler das alles wusste und wie der Mann dann in zwei Hälften zerteilt worden sein konnte, wenn der Doktor, wie er behauptete, nichts damit zu tun hatte. Aber dann redete er unvermittelt weiter: »Ich weiß, die Nanos müssen irgendwie übertragen werden. Es muss so sein, weil sie sonst ihre Lebensgefährtinnen nicht wandeln könnten.«
»Lebensgefährtinnen?«, wiederholte sie ein wenig gedankenverloren.
»Hmm.« Er nickte beiläufig. »Zwar können Unsterbliche bei Sterblichen den Verstand lesen und kontrollieren, aber hin und wieder sind sie dazu nicht in der Lage. Einer der möglichen Gründe wäre, dass der Sterbliche den Verstand verloren hat. Das macht es offenbar extrem schwierig. Ein anderer Grund dafür wäre, wenn eine Sterbliche für einen von ihnen eine Lebensgefährtin ist. So erkennen sie diese überhaupt erst.«
Sarita wollte fragen, was es mit diesen Lebensgefährten auf sich hatte, kam aber auch dazu nicht, da Dr. Dressler bereits weiterredete: »Jedenfalls habe ich ihn nicht durchgeschnitten, um an die Nanos gelangen zu können. Das ist vielmehr Teil eines Experiments, mit dem ich herausfinden will, wie lange die beiden Körperhälften getrennt sein können, bis die Nanos nicht mehr in der Lage sind, sie wieder eins werden zu lassen. Wir haben mit dreißig Sekunden angefangen, jetzt sind wir bei zwei Stunden angekommen. Natürlich muss man erst sämtliches Blut herausholen, weil sonst die Nanos versuchen werden, den Körper gleich wieder zu reparieren. Beide Hälften werden dann erst mal versiegelt, wobei die untere Hälfte an Blutmangel sterben wird, lange bevor die Nanos ihre Arbeit abgeschlossen haben. Solange aber gar kein Blut da ist, zwingen die Nanos den Körper, in eine Art Stasis zu fallen. Setzt man beide Hälften wieder zusammen und gibt ihnen genug Blut, treten die Nanos in Aktion und heilen den Körper. Vom abgeschnittenen Finger bis hin zum abgetrennten Arm können die Nanos alles wiederherstellen. Je mehr Blut der Körper bekommt, umso schneller erfolgt die Heilung.«
»Mein Gott«, keuchte Sarita und sah den Mann auf dem Tisch entsetzt an. Sie konnte nicht fassen, dass Dr. Dressler ihn vorsätzlich solchen Schmerzen ausgesetzt hatte. So etwas tat man einem lebenden Menschen nicht an, ob er nun Vampir war oder nicht.
»Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, so viel wie möglich über diese Art herauszufinden, aber ich muss zugeben, dass mich dieses Experiment allmählich langweilt. Ich glaube, als Nächstes werden wir einen Arm abschneiden und herausfinden, ob die Nanos einen neuen erschaffen können.«
»Sie …«
Sarita versagte vor Schreck die Sprache, als der Doktor ihr auch schon im nächsten Moment die Nadel der zweiten Spritze in den Hals drückte und ihr das Mittel injizierte. Das Ganze geschah so schnell, dass sie keine Gelegenheit mehr bekam, ihn wegzustoßen. Als sie die Hand endlich abwehrend hochnahm, zog er die Nadel schon wieder heraus und legte sie weg.
»Ab…«
Entsetzt sah sie ihn an, als ihr bewusst wurde, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihre Frage zu stellen. Als sie zu schwanken begann, hielt er sie am Arm fest, um ihr Halt zu geben. Dann sah er zur Decke, da sich von oben ein Motorengeräusch näherte, das schnell lauter wurde.
»Das dürfte der Helikopter sein, der Ihren Lebensgefährten herbringt«, sagte Dr. Dressler erfreut und lächelte sie an, während er sie zu Boden sinken ließ. »Sie beide werden mir eine große Hilfe sein, Sarita. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß.«
2
Sarita regte sich schläfrig, allmählich wurde ihr klar, dass sie in einem Bett lag – auf dem Rücken. Sie schlief nie auf dem Rücken, sondern auf der Seite, und das schon immer. So auf dem Rücken zu liegen, die Hände unterhalb ihrer Brüste auf ihren Körper gelegt … also … das erinnerte sie an ihren Vater, wie der im Sarg gelegen hatte.
Bei dem Gedanken daran verzog sie den Mund, was wiederum bewirkte, dass sie vollends erwachte. Sie drehte sich zur Seite, ohne dabei die Augen zuzumachen, bis sie auf einmal einen Herzschlag lang wie erstarrt dalag und sich dann abrupt aufsetzte.
»Wo bin ich?«, murmelte sie und sah sich in dem fremden Zimmer um.
Das hier war nicht ihr Schlafzimmer in ihrem sonnigen, kleinen Apartment in Toronto, Ontario. In diesem Zimmer hier war alles in Weiß gehalten, und es war mindestens dreimal so groß wie das Schlafzimmer bei ihr zu Hause. Drei große Deckenventilatoren hoch über ihr sorgten für einen angenehmen, kühlenden Windhauch. Zusammen mit den drei doppelflügeligen Türen an der Wand links von ihr schienen sie das Zimmer in drei Räume aufzuteilen, ohne dass dafür auch nur eine Mauer gezogen werden musste. Vor der entlegenen Tür standen eine Couch, ein Zweisitzer und zwei Stühle, alle aus Korb und mit weißen Kissen belegt. Vor der mittleren Tür stand ein kleiner Korbtisch für zwei Personen mit einer Tischplatte aus Glas. Die dritte Doppeltür befand sich genau neben dem Bett, in dem sie saß. Das Bett selbst war wie ein Meer aus weißen Laken. Sarita hatte noch nie ein so riesiges Bett gesehen, das zudem auch noch unglaublich romantisch war, da sich rundherum hauchdünne Vorhänge befanden, die im Augenblick alle aufgezogen waren.
Es sah so aus, als hätte man sie mitten in eine Werbung für ein tropisches Paradies platziert, das speziell auf Flitterwöchner ausgerichtet war. Sie warf einen Blick durch die großen Glasscheiben in der Tür neben dem Bett und betrachtete die Palmen und die exotischen Pflanzen draußen. Unmittelbar vor ihrem Zimmer befand sich zwar eine großzügige, mit Steinplatten ausgelegte Terrasse, doch der Dschungel dahinter war so dicht wie eine Wand und gab einem frisch verheirateten Paar genau die Privatsphäre, die für ein solches Himmelbett unverzichtbar war.
Es war ein wunderschönes Zimmer in einer wunderschönen Umgebung, nur hatte sie keine Ahnung, wie sie hierher gekommen war und was sie hier sollte.
Sie schlug die hauchzarte weiße Decke zur Seite und stieg so aus dem Bett, dass sie vor der Terrassentür stand, als ihre Füße den Hartholzboden berührten. Da erst fiel ihr das weiße Nachthemd auf, das sie trug. Irritiert strich sie mit den Fingern über den dünnen Stoff. Das gehörte eindeutig nicht ihr. Sie ging in Slip und einem übergroßen T-Shirt schlafen.
Auch dieses Nachthemd wirkte wie aus einer Werbung für Flitterwochen im Paradies. Die Spaghettiträger reichten dabei so weit nach unten, dass der Stoff kaum bis über ihre Nippel reichte und so dünn war, dass er sie kaum verdecken konnte. Allein die Tatsache, dass der Stoff leicht gerafft war, sorgte dafür, dass ihre Brüste zumindest ein wenig bedeckt wurden. Weiter unten war allerdings nichts gerafft, sodass sie nicht nur ihre gebräunten Beine, sondern auch das Muttermal am rechten Oberschenkel nur allzu deutlich sehen konnte.
Sie schaute sich um und entdeckte erleichtert einen Morgenmantel, der auf der Korbtruhe am Fußende des Betts lag und ihr beim ersten erkundenden Blick gar nicht aufgefallen war. Sie ging zur Truhe, nahm das Kleidungsstück an sich und streifte es über.
Kaum war das geschehen, verzog sie auch schon missmutig den Mund, denn nachdem sie den Gürtel zugezogen hatte, wurde ihr bewusst, dass der Morgenmantel aus dem gleichen Stoff wie das Nachthemd und auch genauso tief ausgeschnitten war. Beide gehörten offenbar zusammen und waren nicht wirklich dafür bestimmt, irgendetwas von ihrem Körper zu bedecken.
Mürrisch sah sie sich abermals um und hielt Ausschau nach irgendwelcher richtigen Kleidung, vorzugsweise ihre eigene. Aber nirgendwo stand Gepäck herum, und es gab auch keine Sideboards mit Schubladen, in denen etwas von ihren Sachen untergebracht sein könnte.
Von den Türen abgesehen, die hinaus auf die Terrasse führten, fanden sich auch noch drei massive Holztüren im Zimmer, die zum Dekor passend alle weiß gestrichen waren. Eine dieser Türen befand sich in der Wand genau gegenüber vom Bett. Aus einem unerfindlichen Grund war Sarita der Meinung, dass man durch diese Tür nach draußen in einen Flur des Hauses oder Hotels gelangen konnte – oder welcher Art das Gebäude auch immer sein mochte. Sie zog diese Tür jedoch nicht weiter in Betracht, da sie in ihrem jetzigen Aufzug das Zimmer lieber nicht verlassen wollte.
Sie sah zu den beiden anderen Türen, die sich links und rechts vom Bett befanden. Die Tür auf der Seite, auf der sie momentan neben dem Bett stand, war so weit geöffnet, dass Sarita dahinter ein großes, ganz in Weiß gehaltenes Badezimmer erblicken konnte.
Zögerlich ging sie zur Tür und spähte in den Raum, der das Flitterwochenthema fortsetzte mit einer Badewanne für zwei Personen und einer in Glasbausteine gefassten Duschkabine, die so groß war wie bei anderen Leuten das gesamte Badezimmer, und die damit Platz genug für den wildesten Sex unter der Dusche bot. Es gab auch einen langen Tresen aus weißem Marmor mit zwei Waschbecken, außerdem einen kleineren Tresen mit einem Stuhl davor und einem großen beleuchteten Schminkspiegel. Eine weitere Tür führte in einen kleineren separaten Raum mit Toilette und Bidet. Bei deren Anblick wurde Sarita auf einmal bewusst, dass sie dringend musste. Sie betrat den Raum, um die Toilette zu benutzen, während sich ihre Gedanken überschlugen. Ein ganzer Schwall Fragen jagte durch ihren Kopf, ohne dass sie auch nur eine einzige Antwort liefern konnte. So drehten sich ihre Fragen immer nur im Kreis. Wo war sie? Was war passiert? Wie war sie hergekommen? Wessen Kleidung war das, und wie war es dazu gekommen, dass sie sie jetzt trug?
Darüber dachte sie auch noch nach, als ihr plötzlich auffiel, dass das nicht mal ihre Unterwäsche war, die sie unter dem Nachthemd trug. Ein weißer Seidenstring, und das, wo sie nie Strings trug. Einmal hatte sie einen angezogen, weil diese Teile so verdammt sexy aussahen. Aber das war auch das erste und das letzte Mal gewesen, da sie das Gefühl nicht aushielt, andauernd einen völlig verrutschten und eingeklemmten Slip zu tragen.
Was war hier los? Das war die Frage, die durch ihren Kopf geisterte. Ihre letzte Erinnerung war … Nein, genau genommen war alles ziemlich verworren. Da war dieses Bild von einem Labor und einer Leiche, und da war irgendwelcher Unsinn über Vampire, aber das war alles so ohne jeglichen Zusammenhang und unwirklich, dass sie sich sicher war, von den Bruchstücken irgendeines Albtraums verfolgt zu werden. Und da schwirrte auch noch Sorge um ihre Großmutter in ihrem Kopf umher, aber auch das war alles so versprengt und so undeutlich, dass sie nicht wusste, ob es sich dabei um einen Traum oder die Realität handelte. Wenn es danach ging, konnte sich sogar das hier in einem Traum abspielen. Schließlich wusste sie, dass sie sich eine solche Ferienunterkunft niemals würde leisten können.
Panik wollte in ihr aufsteigen, doch Sarita drängte sie zurück. Sie war Polizistin, sie war darin geschult, ihre Reaktionen im Griff zu haben und eine Situation einzuschätzen, bevor sie entschied, wie sie am besten vorgehen sollte. Also würde sie sich erst einmal einen Überblick verschaffen, beschloss sie mit Nachdruck, während sie die Toilettenspülung betätigte.
Zurück im Badezimmer sah sie sich eher zufällig im Spiegel über den Waschbecken. Der Anblick ließ sie stutzen. Ihr schwarzes Haar, das ihr wild und unbändig auf die Schultern fiel, und ihr gebräuntes Gesicht bildeten einen augenfälligen Kontrast zu dem harten Weiß des Nachthemds und des Morgenmantels. Sie sah aus, als wäre sie einem Gruselroman entsprungen … oder einem Pornofilm, wie sie erschrocken feststellen musste, als sie sah, wie deutlich ihre gebräunte Haut und der weiße String durch den viel zu dünnen Stoff zu sehen war. Zum Glück waren ihre Brüste durch den gerafften Stoff zumindest zum Teil verdeckt.
Gereizt schnalzte sie mit der Zunge, seifte die Hände ein und spülte sie ab, um sie dann an einem der flauschigen weißen Handtücher, die gestapelt neben dem Waschbecken lagen, abzutrocknen. Der Anblick der Handtücher brachte sie auf die Idee, in den Schubladen und Schränken im Badezimmer nachzusehen, was dort zu finden war. Sie stieß auf bergeweise Seife, Shampoo, Conditioner, noch mehr Handtücher und Waschlappen.
Als sie danach den Schminktisch aufklappte, fiel ihr Blick auf mehr Make-up, als eine Frau in ihrem ganzen Leben verbrauchen konnte. Lippenstift, Rouge und Lidschatten waren in jeder erdenklichen Farbe vorhanden, und alles war noch originalverpackt. Es gab auch Eyeliner, Mascara, Pinzetten, Nagelfeilen und Nagelschneider, die sich ebenfalls alle noch in ihrer Verpackung befanden, als wären sie eben erst gekauft worden. Dazu kamen ein Haartrockner, mehrere Lockenstäbe und Glätteisen sowie Haarspray, Bürsten und Kämme – also im Grunde alles, was eine Frau irgendwann in ihrem Leben gebrauchen konnte, um sich hübsch zu machen.
Einen Moment lang stand Sarita fassungslos da und betrachtete diese reichhaltige Auswahl, während sie zu begreifen versuchte, was das alles zu bedeuten hatte. Das hauchdünne sexy Nachthemd, das Make-up, das große Bett …
»Nein«, murmelte sie, ließ den Schminktisch zufallen und stürmte aus dem Bad. Im Schlafzimmer war immer noch niemand außer ihr, was das Einzige war, was Sarita auffiel, als sie um das Bett herum zur Tür auf der anderen Seite hetzte. Sie atmete erleichtert aus, als sie sah, dass es sich um einen begehbaren Kleiderschrank handelte, der mit Kleidung und Schuhen nur so vollgestopft war.
Gott sei Dank! Jetzt konnte sie endlich etwas Vernünftiges anziehen und dann herausfinden, wo zum Teufel sie eigentlich war und was hier gespielt wurde. Saritas Erleichterung war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Augenblicke später stand sie mitten in diesem Kleiderschrank und zwang sich, tief und gleichmäßig durchzuatmen. Die Verwirrung, die sie noch kurz nach dem Aufwachen verspürt hatte, war jetzt maßloser Wut gewichen, nachdem sie sich im Kleiderschrank umgesehen hatte. Nicht ein einziges Teil stammte aus ihrer Garderobe, zumindest aber konnte sie nichts entdecken, was ihr gehörte. Es gab Negligés und Nachthemden in allen erdenklichen Farben und Längen – von äußerst kurz bis bodenlang und allesamt so gut wie durchsichtig. Jedes einzelne Teil war für Flitterwochen wie geschaffen, aber nichts davon taugte etwas für den Alltag.
In den Schubladen stapelten sich Strings, Strümpfe und Bikinis, aber es war nicht mal ein einziger BH zu finden. Und die Schuhe, die sie beim Hereinkommen bemerkt hatte, waren ausschließlich High Heels in allen Farben des Regenbogens, damit die genau auf das jeweilige Nachthemd abgestimmt werden konnten. Diese Schuhe waren zwar verdammt sexy, aber gebrauchen konnte sie die im Augenblick nicht.
Betont langsam atmete sie aus, machte kehrt und ging zurück ins Schlafzimmer, wo sie sich fragte, wie ihr nächster Schritt aussehen sollte. Sie schaute zu der Tür, von der sie vermutete, dass sie dort entlang in andere Bereiche des Gebäudes vordringen und möglicherweise Antworten finden würde. Dennoch ging sie auf Abstand zu der Tür, da sie keine Ahnung hatte, was genau sich dahinter befand. Nachdem sie einen begehbaren Kleiderschrank randvoll mit Reizwäsche vorgefunden hatte, war sie sich gar nicht mehr so sicher, dass sie wissen wollte, welche Antworten hinter dieser Tür verborgen lagen. Aber einfach hierzubleiben und gar nichts zu tun, war auch keine Lösung, überlegte sie, während sie gegen etwas stieß, sich umdrehte und das Bett anstarrte.