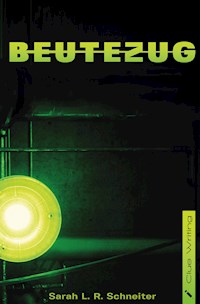Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einunddreißig chronologisch sortierten und lose verbunedenen Kurzgeschichten begleitet ihr Abenteurer, Gauner, Schmuggler, Emporkömmlinge, Forscher und Soldaten an den Rand der Galaxis, auf unwirtliche Welten und in die Leere des Weltraums. Orte, an denen Glück und Verderben derart nahe beieinander liegen, dass sich niemand seines Glücks sicher sein kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah L. R. Schneiter
Randwelten
Geschichten vom Ende der Galaxis
Sarah L. R. Schneiter
RandweltenGeschichten vom Ende der Galaxis
Seite zum Buch/Autorinnenseite: sarahschneiter.com
Copyright © 2020/2023 by Sarah L. R. Schneiter
Zweitauflage, 2023 (Erstauflage 2020)
Covergestaltung: Rahel Meister, @bugsandbrushes
Vertrieb: epubli
Für meine Familie, ganz besonders:
Annemarie
Prolog
Wir reisen in die Milchstraße unserer Zukunft. Raumfahrt und das Reisen über der Lichtgeschwindigkeit sind zum Alltag geworden, unzählige Welten besiedelt und die Technologie hat sich weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz sind viele dieser neuen Welten alles andere als perfekt oder ungefährlich …
In einunddreißig chronologisch sortierten Kurzgeschichten begleitet ihr Abenteurer, Gauner, Schmuggler, Emporkömmlinge, Forscher und Soldaten an den Rand der Galaxis, auf unwirtliche Welten und in die Leere des Weltraums. Orte, an denen Glück und Verderben derart nahe beieinander liegen, dass sich niemand seines Glücks sicher sein kann.
Fans der Promise-Reihe erfahren zudem in diesem Band mehr über die Vorgeschichte mancher Protagonisten, Welten und viele Details zum Universum.
Viele der in diesem Band zusammengefassten und leicht überarbeiteten Kurzgeschichten sind zwischen 2012 und 2019 auf Clue Writing (cluewriting.de) erschienen sowie im Clue Cast vertont worden. Die Weihnachts-Specials wurden ursprünglich auf der Webseite des Bücherstadt Kurier (buecherstadtkurier.com) publiziert.
Mein besonderer Dank gilt den megalotastischen Sprechern des Clue Cast, welche diese Geschichten mit ihren Stimmen zum Leben erweckt haben: Birgit Arnold, Alex Bolte, Vincent Fallow, Annika Gamerad, Klaus Neubauer, Werner Wilkening sowie Rahel für die tolle Audioarbeit.
Ein Ausflug in die Scherenschnittwelt
Es war eng und stickig in der Zwischenwand, überall war sich langsam zersetzendes Isolationsmaterial zu sehen, alte elektrische Leitungen, die noch nicht in Kanälen verlegt worden waren und eine dicke Röhre für Fernwärme, die von Kondenswasser bedeckt war. Anaata machte weder die Hitze noch die beengten Platzverhältnisse etwas aus, als sie sich zwischen den Leitungen und dem Bauschaum hindurchquetschte. Sie fühlte sich wie in einer annähernd zweidimensionalen Scherenschnittwelt, in der es, genau wie auf dem gefalteten Blatt Papier, sich immer wiederholende Löcher und Durchgänge gab; kam man durchs erste, würde man sich auch durch die anderen, identischen quetschen können. Hier drinnen, in der Zwischenwand ihres veralteten Wohnblocks in Inew City, bestand die Welt aus Mustern und Regeln, sie war logisch. Hier war ihr Reich, in dem sich das vierzehnjährige Mädchen mit dem Geschick eines Wasserläufers durch das, eigentlich nicht für Menschen bestimme, Innenleben des Gebäudes bewegen konnte. Sie gab ein leises genervtes Knurren von sich, als sie aus dem Apartment der Whelan-Familie das laute Schmatzen der kleinen Kinder bei Tisch hören konnte, gefolgt von dem Schreien des Babys. Hastig schob sie sich weiter durch die Zwischenwand und langte nach kurzer Zeit und einer Begegnung mit einer aufgescheuchten Maus hinter dem Wohnzimmer der Soungs an, wo angenehme Ruhe herrschte. Offenbar saß der Großvater mal wieder auf der Couch und las in einen Roman, wie fast jeden Nachmittag. Anaata fragte sich, was die Leute wohl von ihr denken würden, wenn sie wüssten, dass das Mädchen hinter ihren Wänden herumkroch und viel von ihrem Leben mitbekam, wohl mehr, als ihnen lieb war. Der Gedanke amüsierte sie für einige Augenblicke, doch dann wandte sie sich wieder ihrer Aufgabe zu. Sie wollte hinter das Apartment der Parks gelangen, diese Familie interessierte sie am meisten, denn schließlich waren es ihre Adoptiveltern.
Auf ihrem Weg durch den Staub, der sie in der Nase kitzelte, erkannte sie das vertraute Emailschild, das vor offen verlegten elektrischen Leitungen warnen sollte, dennoch fühlte sie sich hier geborgen. Hier war sie wirklich sicher, in ihrer Scherenschnittwelt, wie sie ihr Refugium hinter den Wänden nannte, das weitab von der Realität lag und ihr zugleich erlaubte, dichter an die Menschen heranzukommen, als sie es sich sonst jemals gewagt hätte. Sie hatte mehr Angst vor den Menschen da draußen, als von der Möglichkeit, hier hinter der Wand an einem elektrischen Schlag zu sterben, denn in ihrem Reich waren die Dinge nicht real, hier hatte sie die Kontrolle. Seit sie nach einer Odyssee durch mehrere Pflegefamilien endlich bei den Parks gelandet war, hatte sich ihre Lage nicht wirklich verbessert. Ihr Adoptivvater war ein Dockarbeiter am Raumhafen der Stadt und ein starker Trinker, ganz ohne Träume und Ambitionen. Die Adoptivmutter dagegen war aggressiv und sammelte Anzeigen wegen häuslicher Gewalt wie andere Leute Hologramm-Bildchen, seit Anaata bei den Parks war, hatte sie sie noch nie einem Beruf nachgehen sehen. Doch sie störte sich nicht besonders an ihrer aktuellen Familie, sie hatte ihr Interesse für menschliche Probleme nie wirklich entwickelt in der Zeit, nachdem sie als kleines Kind von Menschenhändlern verkauft worden war und schließlich nach mehreren Zwischenstationen auf diesem vergleichsweise wohlhabenden Planeten angelangt war. Reisen in Kryogenikboxen hatten auch ihre Vorteile, man bekam nicht viel von den oft rüpelhaften Menschenhändlern mit, wenn man die meiste Zeit eingefroren war.
Und jetzt verbrachte Anaata ihre freien Nachmittage damit, durch den Keller in die Zwischenwand des Wohnblocks einzusteigen, hoch und runter, kreuz und quer zu kraxeln und zu sehen, was sie finden würde.
Bald war sie bei der Wohnung der Familie Park angelangt, die dem dritten Blatt in ihrer Scherenschnittwelt entsprach und offenbar unterhielten sich ihre Adoptiveltern gerade angeregt. Anaata machte es sich auf einem rostigen Eisenträger bequem, legte ein Ohr an die Innenseite der Wand und lauschte.
„Nein, die Göre ist unerträglich, die träumt nur herum und versteht nichts, genau wie du“, fuhr die Mutter mit gehässiger Stimme den Vater an.
„Also so schlimm wie sie bin ich nicht“, lallte er. „Ich sitze nicht nur vor meinem Databook und tue so, als würde ich lernen, ich bringe das Geld nach Hause.“
„Trotzdem war es eine Verschwendung in sie zu investieren“, rief sie wütend. „Bisher hat sie uns nur Unsummen gekostet und nichts gebracht.“
„Was willst du, so sind Kinder nun mal“, entgegnete er gelangweilt, gefolgt von dem Geräusch einer Flasche, die geöffnet wurde. Anaata hatte schon viel üblere Streitereien mitgehört, also lehnte sie sich noch immer ziemlich entspannt zurück und lauschte dem, was kommen mochte. Sie zuckte etwas zusammen, als sie den lauten Knall hören konnte, als die Mutter ihm eine Ohrfeige gab: „Verdammte Scheiße, das ist mir doch egal! Seit sie in dem Laden einen Korb Mandarinen gestohlen hat, haben die Bullen uns schon wieder auf dem Kieker. Andauernd klaut sie die blödesten Sachen und ich kriege dann eine Anzeige vom Jugendamt, wenn sie erwischt wird und die Deppen ein paar blaue Flecken an ihr sehen! Kind hin oder her, ich möchte sie am liebsten auf ein Schiff zum nächsten Planeten setzen und mich nicht mehr darum tun. Die hört einen ja nicht mal zu, wenn man spricht.“
„Wie auch immer“, stammelte ihr Vater, gefolgt von üblem Schluckauf. „Mir egal, wenn sie nicht mehr da ist. Aber sieh zu, dass sie was Vernünftiges lernt, immerhin werde ich nicht ewig jung sein und arbeiten können und dann brauchen wir sie. Deswegen haben wir das Gör ja erst zu uns geholt. Bisher hat sie sich nur querbeet alles angeschaut, was ihr gerade gefallen hat.“
Anaata seufzte und nahm einen Schluck aus der Wasserflasche, die sie jeweils auf ihre Ausflüge durch die Scherenschnittwelt mitnahm. Sie wusste bereits, dass ihre Adoptiveltern sie nach den Sommerferien auf ein richtiges Internat schicken wollten, schließlich wurde ein solche Institution vom Staat finanziert, doch sie freute sich darauf. Sie hatte nur verstanden, dass ihre momentane Familie sie mühsam und anstrengend fand, aus ihrer Sicht pure Ironie, da sie ihre Adoptiveltern genauso wenig erdulden wollte. Doch die Worte ihres Adoptivvaters gingen ihr noch immer durch den Kopf, früher oder später musste sie eine Karriere finden, mit der sie sich ernähren und auf eigenen Beinen stehen konnte und auch, wenn sie sich auf die Schauspielschule freute, die Vorstellung auf der Bühne zu stehen, fand sie weniger berauschend. Trotzdem war sie sich sicher, dass sich der Unterricht ausbezahlen würde. Schließlich wären schauspielerische Fähigkeiten außerordentlich nützlich, wenn es darum ging den Leuten ein A für ein O vorzugeben und sie so auszunehmen. Die Stimme der Mutter riss sie aus ihren Gedanken und sie hörte auf, mit ihrem staubbedeckten Haar zu spielen: „Welche sinnvollen Fähigkeiten hat denn diese Göre schon, um einen guten Job machen zu können? Sie träumt ständig rum, stiehlt im Laden Sachen und versteckt sich dann in irgendwelchen Nischen und wer weiß wo sonst noch. Die wird früher oder später eine echte Verbrecherin werden und das war’s dann mit dem Kindergeld.“
Anaata erstarrte und hätte nach einigen Sekunden beinahe vor Begeisterung laut ausgerufen, ja sie hätte gar ihre verhasste Adoptivmutter für diese Aussage umarmt. Das Mädchen hatte begriffen, was ihre Gabe war und wo ihre Fähigkeiten lagen. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen robbte Anaata zurück durch die Wand, denn sie wusste jetzt, sie würde die beste Einbrecherin der ganzen Galaxis werden.
Der Reisende
Er war der letzte wahre Extremophile, oder zumindest der einzige, den er kannte. Natürlich hinkte der Vergleich, denn als Mensch war er faktisch ein mesophiler Organismus (und wer hätte es gedacht, er funktionierte nur unter aeroben Konditionen), doch trotzdem konnte er unter den feindlichsten Bedingungen überleben. Natürlich würde er im Weltraum einen Astronautenanzug benötigen, aber darüber beschwerte er sich nicht, das war nicht seine Art. Er glaubte an etwas und dafür war er auch bereit, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, so einfach war das. Sie sagten wo er hingehen musste und er ging, sie nannten einen Auftrag und er führte ihn aus. Er war einer der letzten wahren Gläubigen, nicht im religiösen Sinne, sondern – wie eigentlich? Kurz haderte er mit sich selbst, denn das Wort „Patriot“ gefiel ihm nicht. Es ging nicht um die Vereinten Systeme, sein Zuhause, sondern um die Werte, für die sie eintraten. Freiheit. Demokratie. Gerechtigkeit. Wie auch immer man es nennen wollte. Und nicht nur, dass er an diese Werte glaubte, er war auch der unerschütterlichen Überzeugung, dass jedes Mittel recht war, um sie zu erhalten. So war er, der ehemalige Forschungsoffizier der Raumflotte, gerade deswegen, wegen seiner Vorstellung von einer gerechten Galaxis, beim Geheimdienst der Vereinten Systeme gelandet. Und was er tat war rasch und sauber, effizient. Niemand hätte ihn je erwischt oder ihm etwas nachweisen können, die meisten glaubten, dass er gar nicht existierte. Nur einige Verschwörungstheoretiker und verschrobene Raumfahrer erzählten sich in schummrigen Bars Gruselgeschichten über ihn. Doch niemand kannte seinen wahren Namen, alle nannten ihn immer nur den Reisenden.
Gab eigentlich die Opiumhöhle in Xperza, der Hauptstadt des Planeten Spes, im Vergleich zu manchen anderen Orten, an denen der Reisende schon gewesen war, Anlass dazu, über Extremophilie nachzudenken? Es war weder besonders gefährlich noch außerordentlich abstoßend hier und die wenigen Kunden schienen sich keinen Deut um den Reisenden zu scheren. Abgelegene Kolonien am Rand der besiedelten Galaxis und das Territorium der Kommunistischen Union, das waren die Orte gewesen, an denen sich der Reisende eine dicke Haut zugelegt hatte. Was er getan hatte, was er wusste, darüber durfte er nicht sprechen, sonst würde die ihm implantierte Kapsel sofort ein Gift freisetzen und ihn innert Sekunden töten. Niemand käme auf falsche Gedanken, denn es würde wie ein plötzlicher Herzstillstand aussehen, welcher dank der modernen Medizin ein seltenes, doch nicht minder gefährliches Ereignis geworden war. Dasselbe von einer genetisch veränderten Schnecke extrahierte Gift war auch seine liebste Waffe; ein paar Tropfen davon reichten, um sich den größten Wandschrank von einem Gegner ein- für allemal vom Hals zu schaffen. Der Reisende schätzte die Konfrontation nicht, er schlug meistens aus dem Hinterhalt zu, effizient und unauffällig. Und so war auch heute die Opiumpfeife seines Ziels längst präpariert, sodass seine Zielperson sich nur noch hinlegen und den ersten Zug davon nehmen musste.
Der Reisende seufzte zufrieden und lehnte sich entspannt zurück, nun galt es zu warten. Es gab keinen Grund, nervös zu sein, dies war bei weitem nicht sein erstes Mal und die Routine hatte ihn längst fest im Griff. Insgeheim fragte er sich, wie schlecht dieser feindliche Spion wohl sein musste, dass er einen festen Tagesplan hatte und zu allem noch opiumsüchtig war, sodass es jedem Gegner ein Leichtes war, ihn abzufangen. Die Kellnerin riss ihn aus seinen Gedanken, als sie zu ihm trat und ihm die zuvor bestellte Tasse Tee hinstellte. „Zucker?“, fragte sie höflich und schien nicht zu bemerken, dass er noch keinen Zug aus seiner Opiumpfeife genommen hatte. Der Reisende schüttelte den Kopf und bedankte sich. Während sie sich leicht verneigte und wieder im hinteren Teil des Raumes hinter einem Vorhang verschwand, lächelte er zufrieden. All diese Menschen auf all diesen Welten – Leben, welche sich nur kurz hier und da berührten oder überschnitten, flüchtig, beinahe bedeutungslos. Und dann kam er des Weges, meist mit einer Passage auf einem günstigen Reiseschiff, pickte ein einzelnes dieser unzähligen Leben heraus, zerstörte es und verschwand wieder, ohne dass jemand eine Ahnung davon hatte, was vor sich gegangen war. Nicht, dass er ein besonders philosophischer Mensch wäre, doch er hatte seine Momente, wo er sich gerne mit solchen Gedanken beschäftigte, auch wenn er sich insgeheim manchmal für das Gefühl der Überlegenheit etwas schämte. Genussvoll nahm er einen Schluck von seinem Tee. Auch, wenn er langsam eine schwache Anspannung und Vorfreude verspüren konnte, so war er doch sehr gelassen. Mochte kommen, was wolle.
Als die kleine Glocke über der Tür in einem hohen Ton bimmelte, wandte er sich möglichst unauffällig um. Ein frostiger Luftstoß wehte einige vom Wintersturm aufgewirbelte Schneeflocken in den Raum und ein Mann um die Vierzig trat ein. Der Reisende erkannte in ihm sofort seinen Widersacher, er hatte sich das Hologrammbild lange genug angesehen, um den Spion in einer großen Menschenmenge ausmachen zu können, bevor er es unwiderruflich gelöscht hatte. Der Fremde hängte seinen Mantel an den hölzernen Kleiderständer, als die Kellnerin hinzutrat und ihn zu seinem Stammplatz begleitete. Alles in dem Verhalten der beiden schien eingespielt zu sein, nichts war außergewöhnlich, so dass sein Widersacher keinen Grund zur Besorgnis hatte.
Unauffällig beobachtete der Reisende wie der andere Mann sich setzte und die Kellnerin nach einem kurzen Gespräch schließlich den Raum verließ. Mit einem Lächeln streckte sich der feindliche Spion auf der Liege aus und griff nun endlich nach seiner Pfeife. Nun käme gleich der Moment, dachte der Reisende sich zufrieden und nahm einen weiteren Schluck aus seiner Tasse, schon fast gelangweilt beobachtete er die ersten Symptome des Fremden, der wohl nie auch nur vermuten würde, dass er gerade das Opfer eines Anschlags geworden war.
Es hatte nicht lange gedauert und der Todeskampf des Spions war eher ein rasches Ableben denn ein wahrer Kampf gewesen. Keiner der Gäste hatte die Opiumhöhle verlassen dürfen, während der Gerichtsmediziner gleich vor Ort die Leiche untersucht hatte und schlussendlich zur Erkenntnis gelangt war, dass der Verstorbene natürlichen Umstanden zum Opfer gefallen war. Nun, da der Reisende entlastet war, erhob er sich, um sich auf den Heimweg zu machen. Es hatte ihm Spaß gemacht, den ahnungslosen Gesetzeshütern bei der Arbeit zuzusehen. Spaß führte zu Leichtsinn und war dumm, aber in diesem Fall einigermaßen ungefährlich, sodass er ihn sich erlauben konnte und vor allem, wollte.
Der Reisende streifte seinen Mantel über und trat unter der bimmelnden Türglocke hinaus in den winterlichen Vormittag. Auf den Straßen was verhältnismäßig wenig los, dachte er sich, während er durch den Schnee zum nächsten Starbus-Terminal stapfte, eine Passage hatte er sich bereits gebucht. Mit diesem Planeten wäre er vorerst fertig.
Mit einem Mal stolperte der Reisende und fiel der Länge nach auf die unter seinem Gewicht knirschende Schneedecke. „Verflucht“, murmelte er und versuchte aufzustehen, doch seine Beine gehorchten ihm nicht mehr. Verwirrt sah er sich um und fragte sich bereits, was der Grund für seinen Schwächeanfall sein mochte und überlegte sich, ob er wohl Fieber hätte. Seine Stirn fühlte sich glühend an und ihm war speiübel. Es dauerte einige Sekunden, in denen er viel schwächer wurde, bis sich eine eiskalte Angst in ihm breitmachte. Jemand musste ihm etwas in seinen Tee gemischt haben. Die Kellnerin? Doch wieso sollten sie ihn loswerden wollen? Diese Frage ließ ihn die letzten Augenblicke seines Lebens nicht mehr los, begleitet von einem raschen Gedanken an Extremophilie. Und so endete der Pfad des Reisenden auf einer unbedeutenden Welt, draußen im Schnee, während seine Nachfolgerin, die noch keine Sekunde an ihrer Aufgabe und ihren Werten gezweifelt hatte, sich in der Opiumhöhle umsah und schließlich ihren Mantel anzog, nur um dann mit einer billigen Passage auf eine andere Welt zu verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Die Reisende
Über den sandigen Straßen flirrte die Spätnachmittagshitze, als Lucy erst einem Kamel, und dann einer in ihre praktische, weiße Tunika gehüllten Frau mit Kinderwagen auswich. Wüstensiedlungen wie diese hatte sie in den letzten zehn Jahren zur Genüge besucht, genauso wie schäbige Ortschaften. Obschon sie grundsätzlich immer alleine reiste, hatte sie sich seit Ewigkeiten nicht so alleine gefühlt wie jetzt. Nun ja, bisher war auch noch nie der Geheimdienst hinter ihr her gewesen. Sehr zu ihrem Erstaunen war sie deshalb nicht aufgebracht, stattdessen einigermaßen gelassen; selbst die für sie untypischen Capri-Hosen störten sie mehr.
Unschlüssig blieb Lucy auf der Straße stehen, sah sich zwischen den ärmlichen Permanentlehmbauten um, entschied sich schließlich für eine Bar zu ihrer Linken und hielt zielstrebig darauf zu. Bei dieser Hitze konnte sie ihre Vorfreude auf ein kühles Bier kaum zügeln, also schritt sie eilig über die Schwelle. Nachdem sie in der Mitte des Raumes anlangte, stellte sie mit Entsetzen fest, in einer Karaokebar gelandet zu sein. Was wie ein grölender Betrunkener geklungen hatte, war Teil des Unterhaltungsprogramms. Die Menschheit mochte schneller als das Licht reisen, die ganze Milchstraße besiedelt haben, aber wer Karaoke auf jeden neuen Planeten exportierte, verdiente das Überleben nicht, befand Lucy. Sie hatte in ihrer Laufbahn einige abscheuliche Dinge getan, Dinge, die jedem vernünftigen Menschen Schande bereitet hätten, verglichen mit dem Katzengejammer des tätowierten Hünen war sie allerdings ein Unschuldslamm. Einzig die Sehnsucht nach einem erfrischenden Getränk brachte sie davon ab, fluchtartig das Weite zu suchen. Den untalentierten Sänger ignorierend schlenderte sie zur Bartheke und meinte zum Wirt: „Ein kaltes Bier.“
„Kommt sofort“, gab er über den Lärm zu verstehen und machte sich an die Arbeit und Lucy nutzte die Gelegenheit, die Menschenmenge genauer zu sondieren. Bislang konnte sie keine Bedrohungen erkennen. Die Betonung lag auf ‚bislang‘, denn früher oder später musste sie jemand aufspüren. Mit einem lauten Knall stellte der Barkeeper einen Bierkrug vor ihr hin. „Macht fünf Lipos.“
Sie kramte in ihrer Hosentasche und warf dem Mann einen Kreditchip zu. „Stimmt so.“
„Danke.“ Er zögerte, bevor er grunzte: „Sonst noch was? Chips, Nüsse …“
„Eine Schrumpfmaschine, um den Kerl auf der Bühne kleiner und leiser zu machen?“, schlug sie schief schmunzelnd vor.
Lachend winkte er ab. „Sorry, nicht im Angebot. Du kannst ihn gerne vertreiben und schöner singen, falls dir das liegt.“
Lucy unterdrückte knapp ein Glucksen; nein, eine Gesangskarriere stünde für sie keinesfalls in den Sternen. „Das lass’ ich mal lieber bleiben.“ Ihr fiel auf, wie neugierig ihr Gegenüber ihr Gesicht musterte und sie wartete auf die Frage, die sie schon dutzendfach gehört hatte. In der Tat rang der Wirt sich dazu durch, deutete mit dem Daumen auf ihre Wange und murmelte: „Große Narbe, was? Warst du in eine Barschlägerei verwickelt?“
„Nein, ich war Profikillerin und eines meiner Opfer hatte blöderweise ein Messer dabei. Kann den besten passieren.“
Mit geweiteten Augen starrte er sie an, dann brach er in Gelächter aus. „Meine Güte, für einen Moment hätt‘ ich dir das fast abgekauft, so ruhig, wie du das vorgetragen hast. Na, wenn du es für dich behalten willst, quetsch ich dich nicht länger aus.“ Mit einem amüsierten Schnauben wandte er sich dem nächsten Kunden zu, der eben an die Bar trat. Sie zuckte mit den Schultern und verbarg ihr Grinsen hinter dem Bierkrug. Niemand glaubte ihr die Wahrheit. Die alte Lucy, die Version ihrer selbst, die sie bis vor wenigen Wochen gewesen war, hätte sich nie Späße über ihren Job erlaubt, war eine jener gewesen, die mit größter Überzeugung einer vermeintlich höheren Sache dienten. Seit sie per Zufall etwas erfahren hatte, das sie nicht hätte wissen dürfen, war alles anders. Trotzdem bevorzugte sie es, sich keine Gedanken über das wie und was zu machen, für ihre momentane Situation spielte das sowieso keine Rolle. Zuvor war sie von Ort zu Ort gereist, um kleine, unauffällige Unfälle für Staatsfeinde zu inszenieren und nun war sie selbst der Staatsfeind und versuchte, nie lange auf einer Welt zu verweilen, denn wahrscheinlich war ihr Nachfolger auf ihren Fersen. Ihre einzige Option war, stets in Bewegung zu bleiben und dabei möglichst wenig aufzufallen. Idealerweise heuerte sie auf irgendeinem heruntergekommenen Frachter an, der ebenso heruntergekommene Planeten anflog.
Sie nahm einen letzten Schluck und rief dem Barkeeper zu: „Hey, noch so einen Fusel, das macht die Katzenmusik erträglicher!“
Er gab ihr ein bestätigendes Handzeichen und Lucy schaute sich in der Gaststätte nach einer passenden Sternenschiff-Crew um, als ihr jemand auf die Schulter tippte. Erschrocken fuhr sie herum und sah sich dem Hünen gegenüber, der bis eben das Lokal mit seinen zweifelhaften Singkünsten beschallt hatte. „Was hast du da gesagt?“
„Hey, ich will keine Probleme …“, setzte sie an. Der offensichtlich angetrunkene Bursche holte zu einem Hieb aus und Lucys trainierte Reflexe übernahmen die Kontrolle. Sie duckte sich derart flink weg, dass die Faust des Riesen einen anderen zwielichtigen Kerl ins Gesicht traf. „Ups“, lallte der gescheiterte Karaokesänger, da brüllte ihn sein versehentliches Opfer an: „Sag mal, hast du sie noch alle?“
Hastig zog sich Lucy einige Schritte zurück. Selbstverständlich wäre sie in der Lage, den stärkeren Gegner zu Boden zu bringen, dennoch war es ratsamer, Konflikte zu vermeiden; erst recht, wenn man nicht auffallen sollte. Während die beiden Kontrahenten aufeinander einprügelten und alle Aufmerksamkeit auf sich zogen, ging sie in Richtung des Ausgangs, wurde jedoch von einer rauen, weiblichen Stimme aufgehalten: „Hey, Narbengesicht!“
Rasch drehte sie sich um und stand einer dunkelhäutigen Frau gegenüber, die wie eine Raumfahrerin gekleidet war. „Was?“, knurrte Lucy, erpicht darauf, aus der Bar zu verschwinden, ehe die Keilerei ausartete.
„Du bist schnell. Kennst du dich mit Sternenschiffen aus?“
„Ein bisschen“, erwiderte Lucy und beobachtete den einige Meter entfernten Tumult, in den mittlerweile sechs Leute verwickelt waren. „Wer bist du und wieso willst du das wissen?“
„Natala“, stellte sich die Fremde mit dem Afro vor und bot ihr die Hand an. „Ich habe einen Frachter und bin auf der Suche nach einem ersten Maat.“
„Lucy.“ Sie schlug ein. „Können wir das bitte draußen besprechen, bevor wir in die Schlägerei verwickelt werden?“
„Klar, ich kenne da eine Bar in der Gegend, in der die Musik annehmbarer ist.“ Damit trottete Natala davon und Lucy folgte ihr die Stufen hoch auf die Straße. Wenn sie Glück hatte, wäre sie bald weg von hier und hätte einen halbwegs vernünftigen Job; vermutlich das Beste, auf das sie angesichts ihrer Vergangenheit hoffen konnte. Sie war sich zwar unsicher, ob sie auf lange Sicht ihren Verfolgern tatsächlich entkäme, aber vorerst wog sie sich in Sicherheit. Vielleicht, nur vielleicht, gab es sogar für ehemalige Profikiller sowas wie ungefährlicher Ruhestand.
Realität
Das große Portal, durch das ich in die Ritterburg eintrat, war mit unzähligen Fresken verziert und türmte sich imposant über mir auf. Ich ließ meinen Blick schweifen und bemerkte, wie alles Leben erstarrte, als ich in den Innenhof gelangte: Die stolzen Ritter, die mit ihren Lanzen als Wachen postiert waren, standen stramm. Die Magd, die einen großen Waschzuber trug, verneigte sich ehrfürchtig. Die Edelmänner, die eben von den Stallungen zum Schloss geschlendert waren, hielten inne und zogen ihre Hüte. „Einen wunderschönen Abend, edle Dame“, flötete einer von ihnen – ich erwiderte den Gruß etwas perplex. Gerne hätte ich behauptet, dass mir der Atem deswegen stockte, aber wenn ich ehrlich sein sollte, lag es eher an meiner Korsage. Ich konnte mir beim besten Willen keinen Reim darauf machen, wo genau meine Organe bei einer derart eng geschnürten Taille eigentlich Platz fanden. Dafür war das lange, königsblaue Kleid unten so weit, dass ich insgeheim die Befürchtung hegte, den Staub vom Hof zu wischen und damit dem Knecht, der mit dem Straßenbesen hantierte, die Arbeit abzunehmen. Doch das hatte so schon seine Richtigkeit, denn ich war die Herrscherin über diese Burg und diesen Landstrich. Eine Prinzessin zu sein hat viele Vorzüge, ich werde also mit den wenigen Unannehmlichkeiten leben können. Es gab auch nichts dagegen einzuwenden, dass ich zu alledem auch noch jung und hübsch war.
Wie in einem Traum wusste ich zwar, was es mit allem in dieser Welt auf sich hatte und trotzdem kam es mir fremd vor, ganz so, als würde ich es das erste Mal sehen. Ich mochte dieses Gefühl.
Heute wollte ich mich nicht damit beschäftigen, meinen Stab zu versammeln, ich verdiente meinen freien Tag. Zumindest war das der Plan gewesen, aber mein Kriegsminister, begleitet von zwei feinen Damen, deren Namen ich nicht kannte, unterbrach meinen Müßiggang. „Wollen Eure Hoheit uns bei einem Stück Himbeerkuchen zum Nachmittagstee Gesellschaft leisten?“
Ein solches Angebot ließ sich kaum ausschlagen. Dankend nahm ich an und folgte den Dreien in den kleinen Salon. Im letzten Augenblick schaffte ich es gerade noch, ein für eine Dame meines Standes unangebrachtes Seufzen zu unterdrücken. Ich erkannte zu spät, dass beinahe mein ganzer Stab in dem Raum beim Tee versammelt war, genauso gut hätte ich im Thronsaal sitzen und Audienzen geben können. Nun denn, Prinzessin Lucilda, du wirst heute wohl oder übel einen Krieg planen müssen, dachte ich sardonisch.
„Wir brauchen dich, oh Gebieterin“, erklang plötzlich eine nervtötende Stimme in meinen Gedanken. „Eile herbei!“
„Hau ab!“, gab ich so nachdrücklich zurück, wie es mir möglich war. Unverzüglich widmete ich mich wieder meiner eigentlichen Aufgabe: Mit meinen Untergebenen Tee zu trinken.
„Wir sind uns sicher, dass die Barbaren vom Süden angreifen werden“, erläuterte der Kriegsminister eben. Hatte ich es doch gewusst, es ging wie immer um Politik. Ich nickte geflissentlich und legte den silbernen Löffel weg, mit dem ich in meiner Tasse gerührt hatte.
„Natürlich, aber wenn wir unseren Spionen glauben wollen, haben wir noch etwas Zeit, oder?“
„Ich würde nichtsdestotrotz dazu raten, zuerst zuzuschlagen, Eure Hoheit“, wandte er ein. „Noch ist das gegnerische Heer nicht vollständig, was uns einen Vorsprung verschafft. Die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen.“
Ich bedankte mich und spielte gedankenverloren mit dem silbernen Löffel. Als ich das Für und Wider abwog, besah ich abwesend meinen Hofstaat – ein Haufen viel zu aufwändig gekleideter Leute, die prätentiös hier saßen und darüber diskutierten, wen unser Heer niedermachen sollte. Wieder machte mir die Korsage das Atmen schwer und ich konnte mir ein Seufzen diesmal nicht verkneifen. Wie unpraktisch, so eingeschnürt zu sein! Ich setzte dazu an, meine Entscheidung darzulegen, als mich wieder diese impertinente Stimme mit dem schelmischen Unterton unterbrach: „Prinzessen, Eure Untertanen wünschen Euch zu sprechen.“
„Nicht jetzt, verdammt!“ Nein, niemand hat gerne Stimmen im Kopf, erst recht nicht, wenn man für ein ganzes Reich verantwortlich war, das würde rasch zu verheerenden Fehlern führen. Ich durfte mich jetzt nicht ablenken lassen, oder meine Untertanen würden dafür mit dem Leben bezahlen. „Ich denke, wir sollten zuerst zuschlagen.“
Der Kriegsminister wirkte zufrieden, beinahe glücklich. „Eine weise Entscheidung, Gebieterin. Unser Heer wird heute Abend zum Aufbruch bereit sein.“
„Gut, ich überlasse die Details Ihnen, weil Sie mehr Ahnung davon haben.“ Voller Vorfreude griff ich nach dem Himbeerkuchen, sicher, dass ich jetzt endlich einen Moment der Ruhe verdient hatte, als die Stimme zurückkehrte, lauter als je zuvor in meinem Kopf hallte: „Lucy, verdammte Scheiße, ich brauche dich hier!“
Die Welt um mich herum erzitterte, begann zu beben. Ich ergriff einem Reflex folgend die Tischkante. Mein langes Kleid flatterte im aufkommenden Sog, alles begann zu wanken und kippte schließlich weg. Ich gönnte mir einen letzten bedauernden Blick auf meine porzellanweißen, perfekt manikürten Hände. Dann, abrupt, zerfiel das Bild in Fragmente, alle Klänge, Gerüche und Sinneswahrnehmungen waren wie weggewischt. Mein Magen drehte sich fast um, aber ich war an das Gefühl gewohnt, es störe mich nur noch geringfügig.