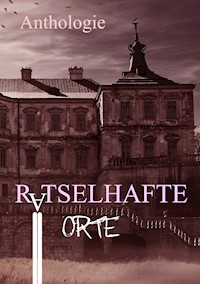
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shadodex - Verlag der Schatten
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gruselgeschichten über verlassene Orte
- Sprache: Deutsch
Verlassen liegen sie da. Niemand hat sie seit Jahren betreten. Es gibt sie in fast jedem Ort: alte, schon lange leer stehende Gebäude – verfallen, abbruchreif, die Fassade bröckelt, die Fenster sind blind oder gar gesplittert. Niemand wagt sich mehr hinein. Doch warum wurden diese Orte verlassen? Welche Geschichten erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand darüber? Und wieso werden manche dieser Gebäude sogar gemieden? Was ist dort geschehen? Neugierig geworden? Dann folgt uns einfach und betretet die besagten Hotels, Flughäfen, Läden, Kirchen, Industrieruinen, Gartenhäuschen, Altenheime, Gewächshäuser, Bahnhöfe oder Apartments. Lasst euch überraschen, welche Mysterien die Geschichten jeweils aufdecken werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rätselhafte
Orte
Anthologie
Alle Rechte, insbesondere auf digitale Vervielfältigung, vorbehalten.
Das Buchcover darf zur Darstellung des Buches unter Hinweis auf den Verlag jederzeit frei verwendet werden.
Eine anderweitige Vervielfältigung des
Coverbilds ist nur mit Zustimmung des Verlags möglich.
Die Namen und Handlungen sind frei erfunden.
Evtl. Namensgleichheiten oder Handlungsähnlichkeiten sind zufällig.
www.verlag-der-schatten.de
Erste Auflage 2022
© Coverbild: Depositphotos seregalsv
Covergestaltung: Verlag der Schatten
© Bilder: Depositphotos gluber, PantherMediaSeller (verfallene Hütte)luisrsphoto (kleines Haus), netfalls (Villa), ronniechua (Das panoptische Altenheim),[email protected] (Nicht von hier), jentara (Landgraf), ecrafts (Ein klopfendes Problem),michelecaminati (GottesHaus), Vovashevchuk (Gashadokuro),philopenshaw (Funkstörung), Pe3check (Dornröschen), massimosanti (Der Buchladen), Madrabothair (Apartment 44c), Mshake (Der alte Bahnhof), siloto (Villa hinten)
Wikipedia: Babushera UGSS SUI airport.jpg (Afterlife)
Surfin’ William (Meerblick, Strandkorb), Monika Grasl (Katzensteighaus)
Lektorat: Verlag der Schatten
© Verlag der Schatten, Ruhefeld 16/1, 74594 Kreßberg-Mariäkappel
ISBN: 978-3-98528-015-5
Raetselhafte
Orte
Anthologie
Verlassen liegen sie da.
Niemand hat sie seit Jahren betreten.
Es gibt sie in fast jedem Ort: alte, schon lange leer stehendeGebäude – verfallen, abbruchreif, die Fassade bröckelt, die Fenster sind blind oder gar gesplittert. Niemand wagt sich mehr hinein.
Doch warum wurden diese Orte verlassen?
Welche Geschichten erzählt man sich hinter vorgehaltenerHand darüber?
Und wieso werden manche dieser Gebäude sogar gemieden?
Was ist dort geschehen?
Neugierig geworden?
Dann folgt uns einfach und betretet die besagten Hotels, Altenheime, Läden, Kirchen, Industrieruinen, Gartenhäuschen, Gewächshäuser, Apartments, Bahnhöfe und Flughäfen. Lasst euch überraschen, welche Mysterien die Geschichten jeweils aufdecken werden.
Inhalt
© Surfin’ William
Das panoptische Altenheim
© Felix M. Hummel
Nicht von hier
© Marcel Sander
Der Landgraf
© Adrian Paddags
Der Laden
© Monika Grasl
Ein klopfendes Problem
© Tobias Lobeck
GottesHaus
© Kurt B. Wolf
Gashadokuro
© Jonas Höpfner
Funkstörung
© Andreas Tillmann
Dornröschen
© Susann Huschka
Der Buchladen
© Jon Padriks
Apartment 44c
© Camilla Grüner
Der alte Bahnhof
© P.C. Thomas
Afterlife
© A. Tupolewa
Villa Runghold und der Strandkorb 666
© Surfin’ William
An keinem Ort dieser Welt gibt es mehr leer stehende Häuser als auf Sylt! Die Lieblingsferieninsel der Deutschen. Residenz der Schönen und Reichen.
Tagsüber herrscht reges Treiben in den Straßen. Der Strand ist an seinen Hotspots – teutonisch üblich – überfüllt, doch am Abend sind fast alle Fenster unbeleuchtet, tot und leer. Sylt ist eine Geisterstadt, vor allem nach Mitternacht, ein Patient im Wachkoma!
Die wenigen hier noch lebenden Insulaner blicken die meiste Zeit des Jahres auf luxuriöse Anwesen, Pensionen, Ferienwohnungen, größere oder kleinere Hotels, die nur wenige Wochen im Jahr wirklich bewohnt werden; denn diese paar Tage Saison bringen mehr Geld als jede Vermietung. Wodurch Wohnraum unbezahlbar wird und jede Immobilie auf der Insel einen absurden Wert in mehrfacher Millionenhöhe erreicht. Geschwister, die ihr Elternhaus erben, können sich zu Lebzeiten nicht mehr auszahlen. Es bleiben nur die Möglichkeiten, es – im günstigsten Fall – selbst zu nutzen, ein Feriendomizil daraus zu gestalten oder es zu verkaufen.
Aus Familien werden Erbengemeinschaften, die über ihre Anwälte kommunizieren, und an so manchem einst prächtigen Anwesen nagt dadurch der Zahn der Zeit, während sich Mammon wortwörtlich ins Fäustchen lacht.
Andernorts werden solche Immobilien, je länger sie verwaisen, zu Spukhäusern, um die sich die Mythen wie der wild wuchernde Efeu an ihrer Fassade ranken.
Hier auf Sylt sind es die Personalwohnungen; in denen diejenigen leben, die wie meine Wenigkeit für die Schönen und Reichen arbeiten.
Vor nicht allzu langer Zeit wohnte ich dort in einer abbruchreifen Bäderstil-Villa der Gründerzeit. Die Villa Runghold. Ein ehemals gut laufendes Hotel direkt am Strand, das seine Türen vor etlichen Jahren – aus mir unbekannten Gründen – schloss und dem Verfall preisgegeben wurde. Wo einst rauschende Feste stattfanden, ließ jetzt das Personal die Champagnerkorken nach Feierabend knallen, während die Ratten durchs Zimmer huschten. Ein Leben zwischen Armut und Dekadenz im Schatten der oberen Zehntausend.
Der größte und am besten erhaltene Teil der Villa im Eingangsbereich wurde von einem Sylter Einrichtungshaus als Lager für Deko-Artikel und Designermöbel genutzt, wodurch wir uns die einst herrschaftlichen Räume in der darüber gelegenen einstigen Beletage wieder recht elegant einrichten konnten; mit Kissen für fünfhundert Euro, die den Schimmelfleck an der Wand verdeckten. Doch wenn der letzte Champagnerkorken seine Flasche verlassen hatte, wurde es unglaublich ruhig.
Totenstill!
Lediglich das Rauschen der Brandung war zu hören sowie die eine oder andere vereinzelt schreiende Möwe, oder war es eine Kollegin, die ebenfalls mitten in der Nacht keine Ruhe finden konnte?
Genau in jenen stillen Momenten meinte man ein Rumpeln zu vernehmen, das aber im Rauschen der Brandung und des Windes verschwamm. Nur bei sehr genauem Hineinlauschen in die Dunkelheit, wenn man seinen Atem anhielt und selbst der eigene Herzschlag zu laut war, schienen diese Geräusche aus dem Keller zu kommen.
Jeder von uns, der hier wohnte, wusste wahrscheinlich davon, aber niemand sprach darüber.
Bis eines Abends – an dem wir alle in der verwitterten Loggia zusammensaßen – in einem dieser absolut stillen Momente jene Geräusche zu vernehmen waren, die eindeutig aus dem Keller zu uns drangen. Dort hinunter führte, hinter der verstaubten Rezeption im Eingangsbereich, eine alte, verrostete Wendeltreppe, an deren Fuß sich eine Bunkertür mit einem Hakenkreuz darauf befand. Zu unserer größten Verwunderung war sie nicht verschlossen, aber was wir dahinter vorfanden, übertraf unsere kühnsten Vorstellungen. Ein feuchter, marode riechender Luftschutzkeller aus dem Zweiten Weltkrieg. Von den Wänden blätterte die Farbe ab und ließ hier und da altdeutsche Schrift und andere Nazi-Runen erkennen. Neben einem Fliegenfänger – der, gemessen an den Insekten, die an ihm klebten, seit dem letzten Luftangriff auf Sylt dort hängen musste – baumelte eine Glühbirne von der Decke. Ihr fahler Schein erhellte die einzelnen durch Maschendraht getrennten Verschläge, in denen ranzige Matratzen vom Sperrmüll lagen.
Und dann … kam uns jemand entgegen.
Wir waren nicht allein in diesem Haus! Im Keller schliefen die polnischen Saisonkräfte, die für einen der größten Sylter Gastronomiebetriebe arbeiteten.
Tags darauf schlenderte ich mit Lara am Strand entlang nach Westerland.
Seit ich auf Sylt lebte, kam sie immer öfter zu Besuch, allein schon weil ihre Kolleginnen vor Neid platzten, wenn sie kokettierte: »Je suis à Sylt!«, und am Wochenende mal wieder kurz auf die Insel fuhr. Es hatte in Hamburg keiner eine Ahnung, in was für einer Bruchbude wir hier hausten, aber von unserer Loggia, mit ihrer vom Winde verwehten Holz-Balustrade ließen sich sensationelle Fotos im Sonnenuntergang machen, und Champagner oder zumindest Champagner-Gläser waren immer vorhanden, was für die ideale Kulisse sorgte, mit der sie ihren Ausflug ins rechte Rampenlicht zu rücken wusste.
Lara lachte und fragte: »Wo steht hier eigentlich der Strandkorb 666?«
Neben uns war Korb 458, etwas weiter 501. Es ging schon mal in die richtige Richtung.
Drei schwarze Chihuahuas stellten sich uns laut kläffend in den Weg. Völlig außer Atem stürzte fluchend eine ältere, gefärbte sowie geliftete Blondine hinterher. Offensichtlich das Frauchen! Die Hunde verstummten mitleidig jaulend und obwohl sie uns mit ihren niedlichen dunklen Knopfaugen anguckten, blieb das Gefühl, unterschwellig ein Knurren zu hören.
Ihr Frauchen entschuldigte sich bei uns mit einem aufgesetzten Lächeln, herrschte ihre Hunde an: »Kommt jetzt!«, und zog erhaben weiter.
Ich schaute ihr hinterher. »Der Hund, das immer hörige Ersatzkind ohne Widerworte an der Leine oder eben auch der beste Freund!«
Lara erwiderte: »Na, wenn das die Anforderungen an einen solchen sind?«
Ein wenig weiter, bei Strandkorb 600, hatte ein kleines Mädchen mit Muscheln das Wort »Hoffnung« in den Sand geschrieben, das sogleich von einer Welle davongespült wurde.
Wir betraten den FKK-Strand. Dicke Männer mit Brüsten, auf die die geliftete Blondine neidisch gewesen wäre, und … ein auf der Insel als erzkonservativ bekannter Pfarrer standen glotzend bis zum Bauchnabel im Wasser.
Im Hintergrund die typische Urlaubs-Klangkulisse aus plärrenden Kindern, genervten Eltern, Jugendlichen, die zu laut Musik hörten, und angriffslustigen Möwen, die den Badegästen das Fischbrötchen im Sturzflug aus der Hand hackten.
Ich resümierte: »Der Sylt-Thrill! Erst von Hitchcock ›Die Vögel‹ gucken und sich dann ein Fischbrötchen holen!«
Lara ergänzte: »Dafür arbeiten die Leute das ganze Jahr!«
Im Korb 659 rieb sich eine adipöse Verwaltungsangestellte die Sonnenmilch zwischen die Fettfalten ihrer Orangenhaut.
Ein großer, zottiger Hund kam klatschnass aus dem Meer und schüttelte sich direkt vor ihr aus. Sie schrie: »Pfui Zerberus – Pfui!«, während ein Vater sein weinendes Kind immer wieder ins Wasser trieb und schimpfte: »Mann oder Memme? Du musst jetzt schwimmen lernen!«
Der ganze Strand roch nach Sonnenöl und alten Menschen.
Lara trällerte: »We’re on the highway to hell!«
Wir schauten uns um: Korb 667, Korb 668, Korb 665, Korb 663, aber kein Korb 666! Darum schrieb ich an den Insel-Sylt-Tourismus-Service mit der einfachen Anfrage, wo der Strandkorb 666 stehe und ob er zu reservieren sei? Die Antwort lautete:
»Moin Herr William,
die Strandkörbe mit den 600er-Nummern finden Sie im Abschnitt 4.32.5 Brandenburger Strand nördl. Nordhedig.
Je nach Verfügbarkeit ist der Korb buchbar.
Herzliche Grüße von Sylt
Dunja Jansen«
Abermals suchte ich daraufhin diesen Abschnitt auf, an dem ich bereits mit Lara gewesen war. Doch diesmal ging ich direkt zu dem Häuschen der Strandkorbvermietung.
Der freundliche, aber schon zur Mittagszeit alkoholisierte ältere Herr durchsuchte wieder und wieder seine Liste. Der Korb 666 stand nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich würde er sich zur Reparatur oder Reinigung in einer der Strandkorbhallen befinden.
Am Abend traf ich im »Alt Berlin« meinen alten Surfer-Kumpel Jack O’Neal, der bei »Sylt-Touristik« arbeitete. Ich erzählte ihm scherzhaft vom Korb 666, dass ich ihn gesucht hatte, um darin ein cooles Rockstar-Foto mit meiner Gitarre zu machen oder ein Video aufzunehmen, wo ich einen alten Robert Johnson Blues spielen würde, und heulte laut los: »Me and the devil – Walkin side by side – Uuuuuuuuuuuuuh!«
Alle Gäste schauten abrupt zu uns rüber.
Jack lächelte peinlich berührt. Ich ließ nicht locker, zu viele Ideen, was man alles im und mit dem Strandkorb 666 machen könne, und summte wieder: »Me and the devil …«
Vielleicht lag es an den nicht wenigen Pints of Guiness, die wir bereits getrunken hatten, vielleicht war es aber auch von Jack die Sorge, dass ich wieder laut losheulen würde, und so vertraute er mir mit schwerer, aber dennoch gelöster Zunge das Geheimnis an, dass der Korb 666 seit dem 11.09.2001 unter striktem Verschluss stand.
Als an jenem verhängnisvollen Tag die Flugzeuge von Terroristen ins World Trade Center gestürzt wurden, war ein Geschäftsmann an Bord, der auf Sylt nicht nur seinen Zweitwohnsitz, sondern auch den Strandkorb 666 reserviert hatte.
Ich schüttelte den Kopf. »Hör auf mich zu verkaspern, Jack! Was kommt als Nächstes? Dass der besagte Geschäftsmann ein Illuminat aus dem Hause Rothschild gewesen ist und zum geheimnisumwitterten Rat der Sylter Fünf gehörte?«
Jacks Miene verfinsterte sich. Was er mir dann offenbarte, klang noch viel unglaublicher:
Am 31.11.1999 fanden Spaziergänger am Strand von Westerland die Leiche des Theater-Schauspielers Ulrich Wildgruber. Im Strandkorb 666 lag sein Rucksack mit gut gefülltem Portemonnaie und einem letzten Gruß an seine Frau in Berlin.
September 1978. Europas größter Verleger von Stadtplänen, Gerhard Falk, war beim Strandsegeln in Kampen. Kurz nach dem Start sackte er zusammen. Die Rettungsschwimmer kamen zu spät! Der topfitte Sechsundfünfzigjährige erlitt einen nicht zu erklärenden Herzinfarkt. Er hatte sich zuvor im Strandkorb 666 umgezogen, in dem noch seine Sachen lagen.
Am 01.10.1967 gab es den wohl tragischsten Flugzeugunfall der Inselgeschichte. Die beiden Segelflugzeuge »K7« und »Rhönlerche« stießen im Flug frontal zusammen. Die »K7« zerbrach auf der Kuppe des »Roten Kliff« und die »Rhönlerche« zerschellte am Strand darunter. Direkt neben dem Strandkorb 666.
Als der Hindenburgdamm am 01.06.1927 vom Reichspräsidenten Paul v. Hindenburg höchstpersönlich eingeweiht wurde, erfasste der erste Zug auf dem Damm einen Streckenläufer und schleifte seine zerfetzte Leiche bis zum Bahnhof nach Klanxbüll. Seiner Witwe blieb nur ein Foto, wie er zuvor einen Urlaubstag genoss; im Strandkorb 666!
Wahrscheinlich hätte man es aber schon seit dem 19.09.1911 besser wissen müssen. Auf der Strandpromenade in Westerland ereignete sich der bislang größte Brand der Sylter Geschichte. Vier von den sieben hölzernen Strandhallen brannten nieder, lediglich ein Strandkorb stand am Ende verrußt, aber noch unversehrt in den rauchenden Trümmern: Korb 666!
Ich glaubte Jack kein Wort. Trotzdem recherchierte ich in den folgenden Tagen die Geschichte der Insel und erfuhr, dass wirklich jede dieser Horror-Storys wahr war!
Ich musste jenen Strandkorb unbedingt selbst sehen und suchte erneut Jack auf, der so gut wie jeden Abend im »Alt Berlin« anzutreffen war. Noch in derselben Nacht zogen wir zwar nicht zu einer Halle, wo die Strandkörbe für gewöhnlich gelagert wurden, sondern zu einem versteckten Bunkereingang in den Dünen zwischen Kampen und List.
»Und wie kommen wir da jetzt rein?«
Jack ging zu einem Stein neben der Bunkertür, unter dem der Schlüssel lag. Er öffnete die schwere, verrostete Eisentür und dahinter empfing uns gähnende Leere.
Der Strandkorb 666 war nicht mehr da!
Ich erzählte es Lara, die mich mitleidig ansah. »Ach komm, 666, das ist doch was für Heavy-Metal-Idioten, die wirklich glauben, dass Ozzy Osbourne einer Fledermaus den Kopf abgebissen hat! Wahrscheinlich hat irgendein Esoterik-Nazi den Strandkorb gekauft, der jetzt in seinem Vorgarten darin Aleister Crowley liest, während im Hintergrund ›Aphrodite’s Child‹ läuft, und seine Frau, der das Ganze peinlich ist, hat vor die Zahl 666 einen Korb mit Petunien gehängt!«
Sie nahm ein Glas Aperol in die Hand, hielt es der Sonne entgegen, die im Meer versank, und machte davon ein Foto.
Mit zunehmender Dunkelheit gingen der Aperol und mein Wein zur Neige. Ich nahm eine von den herumliegenden schwarzen Kerzen und steckte sie auf die Flasche, aber der Wind blies sie immer wieder aus. Wir verließen die Loggia, um unser Zimmer aufzusuchen. Seltsamerweise stand die Tür in der dunklen Ecke dahinter, die sonst verschlossen war, sperrangelweit offen, wie ein finsteres Portal in die Dunkelheit. Sie führte auf den Dachboden.
»Warst du schon mal oben?«
Ich sang: »You know that it would be untrue – You know that I would be a liar – If I was to say to you – Girl, we couldn’t get much higher!«
»Soso!« Lara nahm meine Hand und zog mich die Treppe hinauf. Ich entzündete die Kerze auf der Weinflasche.
Im flackernden Schein empfing uns wider Erwarten ein völlig leerer, staubiger Dachboden. Lediglich ein altes, graues Hanfseil baumelte von einem der Dachbalken.
Lara lächelte. »Wie praktisch, wenn du von allem genug hast, ist hier schon mal alles vorbereitet!«
Zurück in unserem Zimmer fand eine vereinzelt schreiende Möwe in dieser stillen Nacht wieder keine Ruhe.
Ende des Jahres mussten wir die Villa verlassen. Ein unbekannter Investor hatte sie erworben, um daraus das exklusivste Gästehaus der Insel zu gestalten. Die Abrissbagger rollten an!
Es schien kein guter Segen auf diesem Gemäuer zu liegen. Die Umbauarbeiten verzögerten sich immer wieder durch diverse Skandale. Es gab Proteste wegen einer Düne, die zum Teil widerrechtlich abgetragen wurde. Betonreste verstopften die städtische Kanalisation und am Ende meldete die Firma, die mit der Sanierung beauftragt war, Konkurs an.
Über ein Jahr stand eine entkernte Bauruine am Strand, in der man ganz oben im Gebälk des Dachstuhls ein altes, verwittertes, graues Hanfseil im Wind hin und her baumeln sah.
Nachdem mehrere Millionen in den Bau geflossen waren, wurde allen Widrigkeiten zum Trotz das Hotel »Villa Runghold« fertiggestellt.
Nun ließen hier prominente Gäste die Champagnerkorken knallen, wo wir vor nicht allzu langer Zeit unsere ausschweifenden Partys feierten.
Johnny Thunders hatte ohne Zweifel recht, wenn er sang: »You can’t put your arms around a memory!«, aber meiner sentimentalen Ader folgend spazierte ich manchmal an dem neuen Luxusressort vorbei.
Wie an dem Tag, als etwas weiter strandabwärts in Richtung Westerland ein Rettungswagen mit Blaulicht an mir vorbeischoss und kurz danach zum Halten kam.
Ich verabscheue generell die Sensationsgier der Schaulustigen, die sich sogleich und vor allem in ihrer Urlaubslangeweile um den Rettungswagen versammelten, und ging schnellen Schrittes weiter.
Etwas weiter stand dann dort auf einmal völlig unscheinbar, zwischen all den anderen Strandkörben, weiß wie die Unschuld der Strandkorb 666!
In ihm lag ein laut schnarchender Mann mit einer Bierdose in der Hand, der von dem ganzen Trubel nichts mitbekommen hatte.
Am nächsten Tag war in der Sylter Rundschau zu lesen, dass sich im Strandabschnitt 4.32.5 ein tragischer Badeunfall ereignet hat. Ein kleines Kind ertrank in der Nordsee, seine Mutter ertrank ebenfalls beim Versuch, ihr Kind zu retten. Der Vater, der schwer alkoholisiert im Strandkorb schlief und von all dem nichts mitbekam, hat sich später am Abend auf dem Dachboden des neu gebauten exklusivsten Hotels der Insel erhängt.
Unser altes Personalhaus!
Den Strandkorb 666 habe ich seitdem nicht mehr gesehen und auch Jack konnte ich um keine Auskunft bemühen, da er mittlerweile für eine große Surf-Firma arbeitete und Sylt verlassen hatte.
Das Hotel schloss nach diesem tragischen Vorfall seine Pforten. Das Haus stand wieder leer. Es verwahrloste mit der Zeit. Dunkle Fenster, vergilbte, zugezogene Gardinen, schwere Vorhänge und Rollos, die kein Licht nach außen ließen, wahrscheinlich wohnte wieder Personal aus der Gastronomie darin, das erst weit nach Mitternacht nach Hause kam.
Vom einst glorreichen Namen über dem Portal der Villa fehlten die Buchstaben R und G, was sie noch finsterer erscheinen ließ.
Ich traute mich bis heute nicht anzuklopfen oder mich hineinzuschleichen, um auf den Dachboden zu schauen.
Als ich irgendwann mit Lara zwischen Kampen und List durch die Dünen schlenderte und wir an dem versteckten Bunkereingang vorbeikamen, fragte sie mich: »Weißt du eigentlich noch, unter welchem Stein der Schlüssel lag?«
Der passionierte Schwarzträger Surfin’ William gründete die Psychedelic-Band: »Mandra Gora Lightshow Society«; betrieb das »Swamp Room Records Label« und verwandelte Hannover mit dem Gothic Club »Dark Star« in eine schwarze Messestadt. Zwischendurch warf er »Die Schatten des Dorian Gray« auf die Bühne und bewirtete mit seinem »Batcafe Catering« Stars im Backstage sowie auf Tour.
Nun kocht Surfin’ William auf Sylt, spielt bei Vollmond Gitarre am Strand und schreibt Geschichten, vielleicht auch für Euch!
Das panoptische Altenheim
© Felix M. Hummel
»Nur noch fünf Stockwerke«, rief Than versichernd von weit über meinem Kopf. Er hatte bereits drei Treppenabsätze mehr als Roswitha und ich gemeistert, während Li knapp vor uns aufstieg. »Die Hälfte haben wir also schon.«
Obwohl die Luft des frühen Morgens angenehm kühl war, keuchten und schwitzten wir. Roswitha hatte sich ihre Regenjacke umgebunden und Li sogar die Ärmel seines T-Shirts hochgekrempelt. Ich war mir nicht sicher, was das helfen sollte. Ich selbst behielt trotz der Anstrengung meine Jacke an, denn ich hatte die irrationale Angst, dass ich sie fallen lassen oder der Riemen meiner Kamera von meiner Schulter rutschen könnte. Ich war niemals gut auf Höhen zu sprechen gewesen. Und hier, hier war es unmöglich, nicht nach unten zu sehen.
Bereits als ich vom Boden aus die wackelige Metalltreppe hinaufgeblickt hatte, hatte ich ein ungutes Gefühl gehabt. Than hatte mir aber versichert, dass dies der beste Weg sei, um in das verfallende Altenheim hineinzukommen. Der Haupteingang war seiner Ansicht nach viel zu gut einsehbar und könne höchstens als Ausstieg verwendet werden, da es unwahrscheinlich sei, aufgehalten zu werden, wenn man sowieso schon ging. Nein, der einzige gute Weg, um hineinzukommen, hatte er gesagt, sei die Feuertreppe an der Rückwand hinaufzuklettern.
Und hier waren wir nun, Dutzende Meter über dem Boden, welcher an dieser Stelle ohnehin steil ins Tal abfiel und einen weiten Blick über den Schwarzkiefernwald erlaubte. Er war nicht groß, das Gewerbegebiet hatte ihn von allen Seiten her bis auf ein Dreieck mit ein paar Hundert Metern Seitenlänge vollständig eingemauert. Dennoch reichten seine Ausmaße, um zu dieser frühen Stunde Nebelschwaden ins Morgenrot aufsteigen zu lassen. Über den Baumkronen stehend hatte man fast das Gefühl, die Wolkengrenze bereits durchschritten zu haben. Auch dies half nicht gegen das prickelnde Gefühl in meiner Magengrube, ganz im Gegenteil.
Li musste bemerkt haben, dass ich zögerte, und drehte sich zu mir um. »Nicht stehen bleiben! Treppe nicht so stabil für viel Leute«, rief er mir in passablem Deutsch zu.
Ich nickte als Antwort und begann Stufe für Stufe zu Roswitha aufzuschließen. Er hatte wohl recht. Die Gitterroste der Treppe knarrten und quietschten mit jedem Schritt, die Stahlbolzen, die sie in der Betonwand verankerten, wirkten halb ausgebrochen und rostig. Dennoch zeugten Graffiti und in das falsche Fachwerk der Hauswand geritzte Schriftzeichen davon, wie oft dieser Weg in einschlägigen Kreisen benutzt wurde. Auch Than hatte sein Zeichen ganz unten in das Holz geschnitten und gemeint, er mache das immer so. Je weiter oben man schreibe, desto unhöflicher sei es. Im letzten, dem abgebrannten, Stockwerk oder gar im Inneren des Gebäudes sei es vollständig verpönt. Dort etwas zu beschädigen könne einem den Ruf in der Szene kosten. Gemacht würde es trotzdem.
Regeln wie diese und auch der Brauch, sich mit seinem geheimen Zeichen am Gebäude anzumelden, ließen mich erahnen, was für ein großes Privileg es war, dass Than und Li uns einen Einblick in etwas erlaubten, was auch den meisten Menschen in ihrem Land verschlossen blieb.
Roswitha und ich kannten Than schon seit Jahren. Er war damals als Austauschstudent an unsere Uni gekommen, hatte sich für ein freies Zimmer in unserer WG beworben und war zwei Semester lang geblieben. Es war eine sehr schöne Zeit gewesen: Wir hatten ihm Stadt und Kneipen gezeigt, er hatte dafür gesorgt, dass wir das W-LAN der Nachbarn anzapfen konnten. Danach hatte hauptsächlich Roswitha mit ihm oberflächlichen Kontakt über Facebook gehalten. Sie war es auch, die ihm angekündigt hatte, dass wir im Urlaub in seiner Heimatstadt vorbeikommen würden.
Erneut blieb ich stehen und bemühte mich, ruhig zu atmen. Wenn ich nach oben schaute, konnte ich schon seit geraumer Zeit die Oberkante des Gebäudes erkennen, aber sie schien mit jedem Treppenabsatz, den wir passierten, kaum näher zu kommen.
Plötzlich bemerkte ich, dass ich die anderen nicht mehr sehen konnte. Ein Schreck durchfuhr mich für eine Sekunde, bis ich mich sammelte und folgerte, dass sie das Dach bereits erreicht haben mussten. Also nahm ich mich zusammen und setzte den Weg fort.
Die letzten Meter vor dem Obergeschoss konnte ich schon Auswirkungen des Brandes, von dem Than gesprochen hatte, erkennen. Das Metall der Treppe war an einigen Stellen, die nicht von Hunderten Händen anderer Abenteurer wieder saubergestrichen worden waren, geschwärzt und wirkte an den dünneren Bereichen des Geländers verzogen. Zu meinem Entsetzen waren durch den Einfluss der Hitze auch mehrere Haltebolzen gerissen.
Mir war es, als könne ich spüren, wie das Gerüst im zunehmenden Wind und mit jedem meiner Schritte schwankte. Bog es sich nicht immer weiter von der Wand weg? War das Knirschen des Rostes zwischen den Verschraubungen nicht wesentlich lauter geworden? Ich versuchte mir einzureden, dass ich mir das alles nur einbildete, aber das funktionierte nicht. Ich streckte meinen Arm aus, um die Flanke des Gebäudes zu ertasten, ein Vorhaben, das mir ein eisiges Kribbeln in meinem Magen einbrachte. Ich konnte sie kaum erreichen. Ganz unten war dies problemlos möglich gewesen, aber jetzt? Ganz klar, die Feuertreppe war abgekippt, damals beim Brand – oder gerade eben?
»Gunther, Herrgott!«, hörte ich Roswitha von oben rufen. »Jetzt mach endlich. Wir haben nicht so viel Zeit, weißt du? Und es ist auch nicht so toll, wenn du ewig auf der Treppe rumlungerst. Irgendwann sieht dich noch jemand.«
Ich wollte etwas zurückrufen, aber mein Mund war so trocken, dass meine Zunge am Gaumen kleben blieb. Stattdessen klammerte ich mich am zur Wand hin gewandten Geländer fest und schob mich langsam seitlich vorwärts. So weit war es ja nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie lange ich auf diese Weise brauchte, aber irgendwann war ich oben angekommen. Meine Hände waren vollkommen verrußt, als ich die letzte Plattform erreicht hatte. Diese stand so geneigt, dass ich es deutlich spüren und auch sehen konnte. Zwischen ihr und dem Rand des Gebäudes hatte sich ein Spalt von gut einem Meter gebildet.
»Einfach springen!«, rief Than, der mit den anderen beiden ein Stück weiter weg wartete, ermutigend.
Ich schluckte und löste nur unwillig die Hände vom Geländer. Mir war, als würde mir bereits jetzt der Boden unter den Füßen weggezogen. Doch welche Wahl hatte ich? Wieder hinunterklettern und draußen auf die anderen warten? Roswitha würde mir den Kopf abreißen.
Es half nichts, wenn ich noch länger hier herumstand, würden wir vielleicht noch erwischt. Sollte ich fallen, würde mich vermutlich ohnehin das Gestänge der tieferen Etagen aufhalten – oder die gesamte Konstruktion mit mir zu Boden stürzen.
Ich dachte nicht mehr länger nach und machte einen großen Schritt über den Abgrund. Mehr war es nicht. Dann atmete ich tief durch und sah mich um. Wir standen nicht auf dem Dach, wie ich zunächst vermutet hatte, sondern inmitten der Brandruine eines Stockwerks, was ich nach Thans Erzählungen eigentlich hätte wissen müssen. Das Dach gab es nicht mehr.
Der Grundriss des Gebäudes war hier unförmig polygonal, aus mehreren Rechtecken zusammengesetzt. An verschiedenen Stellen, vornehmlich an den Kanten des Hauses, ragten verkohlte Holzpfeiler aus dem Beton. Der Estrich war geschwärzt und aufgesprungen, große Haufen aus verbackener Asche, Kohle und Schrott, halb geschmolzen durch die Regenfälle der Jahre, bedeckten ihn an verschiedenen Stellen. Moose, Gräser und andere Pionierkräuter begannen sich breitzumachen. Es war erkennbar, dass man sich einmal bemüht haben musste, den Schutt zum Teil aus dem Weg zu räumen, eventuell um an unbeschädigte Gegenstände heranzukommen, die Brandursache zu ermitteln, oder, das war nicht zu leugnen, vielleicht auch um die Körper von Opfern zu bergen. Danach hatte man den Rest einfach liegen lassen, als das Gebäude aufgegeben wurde.
»Hier können wir nur kurz bleiben, sonst sieht man uns«, begann Than und schlenderte in Richtung einer der wenigen noch intakten Strukturen in dieser Etage: eines großen, würfelförmigen Kastens etwa zwanzig Meter vor uns. »Wir kommen über die Treppe beim Aufzugschacht da vorn rein.«
»Und das Feuer ist hier ausgebrochen?«, fragte Roswitha, während sie ihre Jacke, die sie sich um die Hüfte geschlungen hatte, losband.
»Ja, hinten. Da.« Li deutete mit dem Kopf in eine unbestimmte Richtung. »Geht schnell. Alles voll Rauch, bevor Alarm.«
Li war früher Pfleger hier gewesen, wenn ich es richtig verstanden hatte. Ich wusste nicht, wie er es schaffte, nach dem Unglück immer wieder hierherzukommen. Vielleicht hatte er nur wenig davon mitbekommen?
»Warst du damals hier oben, Li?«, fragte ich.
Er schüttelte energisch den Kopf »Ganz unten. Im Bad.«
»Im Keller sind der Pool, Therapiebäder, die Sauna und die Massageräume«, schaltete sich Than ein. »Ich weiß nicht, ob wir am Ende noch genug Zeit haben, aber vielleicht kannst du ihnen deinen alten Arbeitsplatz zeigen?«
Li nickte und wies erneut mit dem Kopf, diesmal Richtung Aufzugschacht. »Los?«
Bevor ich den anderen folgte und durch die verzogene Eisentür trat, die kaum noch in den Angeln hing, sah ich mich ein letztes Mal auf dem Dach – dem ehemaligen obersten Stockwerk – um. Es wirkte, als hätte eine riesige Hand den gesamten Aufbau einfach heruntergerissen. Der Zementfußboden hatte Schlimmeres verhindert.
Vielleicht wäre auch überhaupt nichts weiter passiert, wenn man das Gebäude schnell genug evakuiert hätte, wenn die bettlägerigen Patienten nicht ganz oben untergebracht gewesen wären, wenn man hier nicht so viel Papier, Farben, Lacke und andere brennbare Dinge gelagert hätte. Oder wenn die Feuertür, durch welche wir nun das Altenheim betraten, ordentlich geschlossen gewesen wäre.
Die Treppe zum nächsten Stockwerk war so finster, dass wir unsere Taschenlampen einschalten mussten. Feuchtigkeit und Ruß umringten uns mit einem abgestandenen Brandgeruch. Die Wände mussten einmal vollständig geschwärzt gewesen sein, über die Jahre hinweg hatten sich hier jedoch so viele Menschen vorbeigeschoben, dass sie auf Schulterhöhe fast sauber waren. Darüber waren zahllose Zeichen erkennbar, die Besucher mit den Fingern in die Brandschicht gemalt hatten. So viel zum Ehrenkodex.
Die Treppe endete in der Mitte eines Flures. Als ich mich an den anderen vorbeischob, stolperte ich beinahe über die PVC-Platten, die sich teilweise vom Boden gelöst hatten. Unsere Taschenlampen glitten über stockfleckige Wände und von der Decke hängende Dichtungsmatten. Angelehnt stehende Türen offenbarten im Vorbeigehen kurze Einblicke in leer geräumte Patientenzimmer mit heruntergelassenen Jalousien. Vereinzelt konnte ich Betten mit dunkel verfärbten Matratzen und anderes Gerümpel erkennen.
Als ich eine der Türen weiter aufstoßen wollte, musste ich feststellen, dass sie wie verschweißt festsaß.
»Die Feuchtigkeit«, erklärte Than. »Hier oben ist alles komplett ruiniert, ohne Dach kommt alles durch. Fass nichts an, da bekommst du nur schwarze Finger. Oh und passt bitte beide auf, wohin ihr tretet. Der Boden ist nicht so sicher.«
Ich wischte meine Hand an der Hose ab und hielt einen Moment inne. Hier musste es die meisten Opfer gegeben haben. Fast alle sicherlich, bis auf die wenigen oben. Wahrscheinlich hatte in jedem dieser Zimmer, die nun dunkel und leer vor uns lagen, ein Mensch sein Leben verloren oder sogar mehrere. Schnell riss ich mich zusammen und folgte den anderen, die um eine Ecke gegangen waren.
»Oh«, entkam es Roswitha.
Gut die Hälfte des Flures vor uns war eingebrochen. Ein schmaler Streifen des Fußbodens rechts von uns war noch intakt und erlaubte ein, wenn auch sehr wagemutiges, Vorwärtskommen. Wie zum Hohn stand eine der Türen auf der nun unzugänglichen Seite weit offen und ließ sogar etwas Licht von draußen herein.
Ich trat, mich seitlich vorwärts schiebend und mein Gewicht weit nach hinten verlagernd, vorsichtig an das Loch heran. Von dieser Seite aus hing der eingebrochene Boden wie eine Rampe in das Stockwerk unter uns. Meine Taschenlampe fing eine offenbar recht frische Zeitung ein, die jemand auf halber Höhe gegen die nasse Wand geklebt hatte. Es handelte sich um ein englischsprachiges Lokalblatt und berichtete darüber, dass auf dem örtlichen Friedhof nach dem Monsun mehrere Grabgrüfte eingebrochen waren.
»Muss irgendein Scherzbold gewesen sein«, sagte Than, der meinen Blick bemerkt hatte. »Komm jetzt, die anderen sind schon fast drüben.«
Erst jetzt bemerkte ich, dass sich Li und Roswitha auf dem schmalen Sims zur anderen Seite vorarbeiteten. Mir drehte sich sofort der Magen um, ich glaubte, dass jeden Moment einer von beiden fallen könnte und ich aus irgendeinem Grund mit ihnen.
»Das pack ich nicht!«, keuchte ich Than zu. »Auf keinen Fall komm ich da rüber.«
»Ja, aber das ist der einzige Weg«, antwortete er und legte mir die Hand auf die Schulter. »Komm schon! Das ist schließlich gar nicht hoch.«
»Klar, aber so funktioniert meine Höhenangst nicht. Die ist nicht rational und hier gibt es kein Geländer. Keine Chance«, entgegnete ich. Innerlich verspürte ich den starken Drang, mich auf den Hosenboden zu setzen für den unwahrscheinlichen Fall, dass mich jemand weiter, näher an das Loch heranschieben wollte.
»Wie wäre es, wenn er sich einfach an dieser Seite runterlässt?«, fragte Roswitha Than. »Wie du sagst, es ist ja nicht hoch und hier kann man fast runterklettern.«
Er überlegte einen Moment und wechselte dann ein paar Worte in der Landessprache mit Li. »Das geht schon. Li meint, man kann versuchen einfach auf dem Bodenbelag nach unten zu rutschen, ohne sich was zu brechen. Wir müssten dich dann eben wieder aufsammeln, weil wir länger nach unten brauchen. Ist das okay für dich, Gunther?«
»Nein«, maulte ich. »Aber was soll ich schon sonst machen. Scheißdreck.«
Ich trat näher an den Abgrund und betrachtete noch einmal den schräg nach unten weisenden Abschnitt des Fußbodens. Fast wie eine Rutschbahn. Da meine Beine ohnehin zu versagen drohten, setzte ich mich ohne weiteres Zögern an den Rand des Loches und leuchtete den Boden unter mir ab. Moder und Dunkelheit, etwas Müll, die Zeitung mit dem Artikel über die eingebrochenen Gräber. Gefährlich sah es nicht aus.
»Dann wünscht mir Glück!«, rief ich kleinlaut den anderen entgegen.
»Du packst das!«, meinte Roswitha.
»Warte unten auf uns!«, setzte Than hinzu.
Ich schluckte, drückte mich, nachdem ich die Lampe sicher verstaut hatte, vom Rand ab und tauchte in die Dunkelheit. Nach einem kurzen, langsamen Rutsch berührten meine Füße wieder den Boden. Ich machte nicht sofort Licht, da ich nicht sehen wollte, welche glitschigen Papierreste ich von meinem Hosenboden entfernte.
»Alles in Ordnung da unten?«, rief Roswitha über mir.
»Klar«, antwortete ich. »Alles klar! Geht nur weiter.«
Erst als ich hörte, wie sich die Schritte der beiden entfernten, holte ich die Lampe hervor und schaute mich in der Umgebung um.
Der Flur ähnelte dem über mir, schien aber nicht ganz so sehr vom Feuer mitgenommen worden zu sein. An den Wänden war kaum Ruß zu erkennen. Als mein Lichtschein über die offene Tür neben mir glitt, bemerkte ich, dass man hier wenig von der Einrichtung entfernt hatte. Ich konnte aufgequollene Sperrholzschreibtische mit schimmelnden Papieren darauf und grellorange Plastikschalenstühle sehen. Schatten huschten über die Jalousien in der Ferne des Zimmers, als ich meine Funsel hin und her schweifen ließ.
Mich fröstelte langsam und ich wurde mir gewahr, dass meine Hose durchgeweicht war. Die Luft stank nach Pilzen und Verfall. Mit jeder Sekunde, die verging, wollte ich weniger hier sein.
Mir entkam ein erlöster Seufzer, als ich Schritte näher kommen hörte und der Schein zweier Taschenlampen hinter einer Biegung sichtbar wurde.
»Mensch, Gunther«, zischte Roswitha verärgert, als sie und Than bei mir waren. »Du hättest dort bleiben sollen, wo du runtergerutscht bist. Wir haben sicher zehn Minuten nach dir gesucht.«
Ich zuckte verwundert mit den Achseln. »Auch schön, dich wiederzusehen. Ich bin doch hier geblieben.« Mit dem Daumen hinter mich deutend fügte ich hinzu: »Da ist die Rampe.«
»Oh«, meinte Roswitha erstaunt.
Than pfiff durch die Zähne. »Das passiert hier leicht. Irgendwie sieht alles gleich aus, das war wahrscheinlich auch schon so, als noch alles in Schuss war. Wollen wir weiter? Jetzt wird es langsam interessant.«
Wir folgten Than die nächste Treppe hinunter und kamen in ein Stockwerk, welches vollständig intakt wirkte. Der Geruch von Moder und Rauch hatte abgenommen, die Luft war jedoch abgestandener und schwerer, fast dick. Auch schien es viel wärmer zu sein als in der klammen Etage darüber.
Than führte uns durch eine Art Büroraum, der jenem ähnelte, den ich durch die angelehnte Tür oben hatte erkennen können. Auch hier waren Unterlagen und Schreibmaterialien verstreut, aber auch einige persönliche Gegenstände von Angestellten waren zu sehen. Ein vertrockneter Kaktus, ein kleines Plastikfigürchen, ein paar Postkarten an der Wand. Dinge, die man leicht vergessen haben könnte.
»Das sind die Pflegebüros«, erklärte Than. »Die gibt es auf jeder Etage, nichts Besonderes. Aber nebenan, das ist etwas. Darum kommen die Leute überhaupt her.«
Wir überquerten den Flur und schoben uns durch ein kleineres Sekretariat, dessen Möbel zerschlagen und im Raum verteilt waren. Hinter einer weiteren halb offenen Tür hielten Roswitha und ich dann staunend inne. Das Zimmer ähnelte einem Antiquitätenhandel. Die dem Eingang gegenüberliegende Fensterfront war mit dicken, roten Vorhängen verdeckt, durch die tatsächlich ein wenig gedämpftes Tageslicht drang. Davor war eine Reihe Tische aufgestellt. Auf ihnen häuften sich Unmengen von Ramsch in Plastikkörbchen. Kleine Geschenkartikel, Ketten aus Halbedelsteinen, polierte Mineralien, billige Gussmetallminiaturen berühmter Sehenswürdigkeiten und dergleichen. Rechts stand eine bunte Ansammlung verschiedener Schränke, alt und neu. Nur links, in der Ecke hinter der Tür, war ein spärlicher Arbeitsplatz mit einem der einfachen Sperrholzschreibtische eingerichtet. Aber auch dieser war mit allem Möglichen vollgestellt. Die Wand dahinter war ein Wust aus verschiedenen Bildern, von grob aus Zeitschriften geschnittenen Ansichten bis zu einem großen Ölbild einer südeuropäischen Küstenlandschaft.
»Das war das Büro des Heimleiters«, begann Than und leuchtete über die Massen von Gegenständen.
»Und was macht der ganze Plunder hier?«, fragte Roswitha. »Sieht aus, als hätte er Souvenirs verkaufen wollen.«
Than zuckte mit den Schultern. »Das weiß niemand so genau. Er hat nie Angestellte in sein Büro kommen lassen, sondern sich immer mit ihnen im Vorzimmer unterhalten. Trotzdem hat hin und wieder jemand einen Blick reinwerfen können, also wussten die meisten ungefähr, wie’s hier aussieht. Mehr als Getuschel gab’s aber nicht.«
Ich trat an den Schreibtisch heran und betrachtete ein altes Mikroskop, das dort neben einer Lampe stand. Es war sehr schön und in bestem Zustand. Tubus und Ständer waren aus geöltem dunklen Holz und die anderen Teile aus Messing, das so makellos war, dass es wie eine Vergoldung wirkte. So etwas hatte ich auch immer haben wollen. »Mich wundert ja eher, dass das ganze Zeug noch da ist.«
»Schon«, stimmte Than zu. »Aber normalerweise nimmt man ja nichts mit, wenn man solche Orte aufsucht, das ist auch der Ehrenkodex … an den sich viele nicht halten.«
»Erstens das, aber auch vorher, meine ich. Wieso hat der Leiter denn seinen Krempel nicht mitgenommen?«
Than zog erneut die Schultern hoch. »Da musst du ihn selbst fragen, aber ich glaube, der ist schon tot. Vielleicht hat ihn die ganze Sache mit dem Brand zu sehr mitgenommen. Er war ja doch irgendwie verantwortlich.«
»Ging das eigentlich vor Gericht?«, fragte Roswitha, die uns den Rücken zugewandt hatte und ein kleines, mit bäuerlichen Blumen bemaltes Aufsatzschränkchen öffnete, das auf einer Kommode stand.
»Ich weiß nicht«, antwortete Than, der seine Taschenlampe abgelegt hatte und nun mit den Händen in den Hosentaschen herumstand. Er wartete wohl darauf, dass wir uns sattgesehen hatten. »Wahrscheinlich schon.«
Roswitha nahm eine Plastikschale mit allerlei Schmuck aus dem Schränkchen und stocherte mit einem Finger darin herum. »Merkwürdiges Zeug ist das. Seht mal!«
Sie holte eine winzige, flache Figur aus grünlichem Material ins Licht. Sie war nicht viel länger als ein Fingerglied und schien eine Art asiatischen Krieger oder Dämon mit gefletschten Zähnen und erhobenem Krummschwert darzustellen. Sämtliche Details waren nicht eingraviert, sondern durchbrachen das Material ganz. Entsprechend grob war es auch gearbeitet.
»Sieht für mich nach billigem Ramsch aus«, sagte ich.
»Ja.« Roswitha nickte und drehte das Männchen in den Fingern hin und her. »Wie aus Plastik oder Glas gepresst. Ich frage mich, ob überhaupt etwas davon echt ist.«
Mein Blick wanderte zurück zu dem Mikroskop auf dem Schreibtisch. Wenn ich es nur mitnehmen hätte können! »Manches schon, glaube ich«, entgegnete ich. Gleichzeitig ließ ich mir verschiedene Szenarien durch den Kopf gehen, wie ich das Gerät hinausschmuggeln hätte können, ohne dass die beiden etwas davon mitbekamen.
»Ja«, meinte Than, während er in dem engen Raum auf und ab schlenderte. »Hier gibt’s irgendwie fast alles aus aller Welt. Was meint ihr, gehen wir langsam weiter? Es gibt noch ein bisschen mehr zu sehen, auch wenn das leider der Höhepunkt war.« Er lehnte sich gegen einen der Tische und sah uns erwartungsvoll an.
»Nur noch einen Moment.« Roswitha streckte sich, um die Schale wieder zurück in das Schränkchen zu schieben.
Vermutlich wäre es ihr sogar egal gewesen, wenn ich das Mikroskop hätte mitgehen lassen. Aber sie hätte mich wohl aus reiner Gehässigkeit trotzdem verpfiffen. Und Than wäre sicher unheimlich enttäuscht gewesen und hätte mir die Freundschaft gekündigt. Ich hätte höchstens meine Jacke ausziehen und das Gerät darin einwickeln können. Aber das wäre viel zu auffällig gewesen. Mir fiel keine Möglichkeit ein und das machte mich mehr und mehr ärgerlich.
»Ach, dann gehen wir doch.«
Ein weiteres Mal zuckte Than mit den Schultern, klaubte seine Taschenlampe auf und bedeutete Roswitha ihm zu folgen. Sie warf mir einen stechenden Blick zu, als hätte ich sie bei etwas gestört. Im Flur leuchtete Than auf das ferne Ende, wo schemenhaft eine zweiflügelige Feuertür zu erkennen war. »Das ist der Speisesaal, da gehen wir als Nächstes hin.«
Roswitha und ich setzten uns in Bewegung, sprachen aber kein Wort miteinander. Ich wusste nicht, warum sie sauer auf mich war, und mir ging auf, dass auch sie keine Ahnung davon haben konnte, dass ich wegen des Mikroskops eingeschnappt war. Ich dachte auch nicht daran, ihr das zu erzählen.
So blieben wir stumm und wanderten weiter auf die Tür zu. Abermals zogen gähnende Zimmerfluchten an uns vorbei, die Türen standen fast ausnahmslos offen. Ich wagte nur ein oder zwei Mal hineinzuleuchten, denn irgendwie war mir die Lust an dieser Ruine vergangen. Je weiter wir kamen, umso schwerer schien es, zu atmen. Die ganze Atmosphäre wirkte eng, vollgestopft wie das Zimmer des Heimleiters, obwohl der Gang weitgehend leer war.
So war es Roswitha, die sich, nachdem wir beide einige Sekunden gezögert hatten, vorbeugte und die Feuertür aufzog. Der Saal dahinter lag in vollständiger Dunkelheit, die auch die Taschenlampen nur schwer zu durchschneiden schienen. Für mich wirkte es so, als erhelle sich das Zimmer gar nicht, und nur das, was direkt in den Lichtkegeln lag, würde überhaupt beleuchtet.
»Das soll ein Speisesaal sein?« Roswitha stieß verächtlich Luft aus. »Sieht eher wie ein Edelpuff aus.«
»Oder ein Kaffeehaus«, antwortete ich. »Schrecklich.«
Der Saal war ein Chaos, obwohl er nicht im Geringsten verwüstet war. Die Decke war wesentlich niedriger als im Flur und mit strukturierten PVC-Fliesen beklebt, die den Eindruck von hölzernen Kassetten erwecken sollten. Sie waren allerdings billig gemacht und wirkten plastikartig. Viele davon hatten sich außerdem gelöst und lagen verkrümmt überall verteilt. Die Möbel waren ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Sesseln, Sitzen, Ottomanen und Sofas um winzige Kaffeetische gruppiert. Schwere Vorhänge mit Troddeln und goldenen Kordeln bedeckten alle Wände, sodass man nicht sagen konnte, ob es irgendwo Fenster gab. Staub schien die Luft wie dünner Nebel zu füllen.
In einem unbedachten Moment ließ ich die Metalltür hinter mir zufallen. Ich schrie erschrocken auf und stürzte zurück, doch Roswitha hielt mich an der Schulter fest.
»Wo willst du denn hin?«
»Entschuldigung«, antwortete ich atemlos. »Es ist nur die Luft hier drinnen.«
»Entsetzlich stickig«, stimmte sie zu. »Komm, ich will sehen, was dahinten das Licht reflektiert.«
Widerwillig schob ich mich hinter Roswitha durch die staubigen Polstermöbel. Mein Knie stieß gegen einen Tisch und ließ eine Teetasse herunterfallen, die fast geräuschlos auf einem dicken Flokati aufschlug.
Roswitha leitete mich zu etwas, das ich zuerst für ein Fenster hielt. Zwei mit Kordeln gehaltene Samtvorhänge umrandeten eine Scheibe, die uneben und verzogen erschien, als ich meine Lampe bewegte. Sobald ich näher herangetreten war und Roswitha den Weg freimachte, konnte ich erkennen, dass es eine dünne Plexiglasplatte war, die vor einer kleinen Nische in der Wand angebracht war. Darin befand sich ein Diorama.
»Was soll das sein?«, fragte Roswitha, als würde sie tatsächlich meinen, ich könnte etwas von diesem Ort wissen, und leuchtete die Ansammlung aus Kulissen und Modellfiguren in dem Alkoven aus.
Ich antwortete nicht.
Vor dem grob gemalten Hintergrund aus blauem Himmel und grünen, detaillosen Bergen war aus Pappe eine Burgmauer aufgebaut, die quer durch den kleinen Raum lief. Auf dieser saßen Spielzeugfiguren eines mittelalterlichen Königspaars auf ihren Thronen, neben ihnen einige Wächter. Im angedeuteten Burghof standen Personen in bunten, frühneuzeitlichen Kleidern und ein kleiner Trupp amerikanischer Bürgerkriegssoldaten in Reih und Glied. Es wirkte, als hätte man einen Teil des Fußbodens eines Kinderzimmers in den Schaukasten gesetzt.
»Albern«, brummte Roswitha. »Gehen wir weiter. Wir wollten ja noch das Bad im Keller sehen.«
Ich blieb noch einen Moment stehen und starrte in die Nische. Irgendwie machte mich dieser Fund wehmütig. Vielleicht waren die alten Leute, die ihre Umwelt nicht mehr richtig wahrnahmen, Abend für Abend vor diesem Spielzeug gesessen und hatten es mit genauso viel Interesse und Aufmerksamkeit betrachtet wie das Fernsehprogramm. Ein solches Gerät hatte ich hier überhaupt noch nicht gesehen. Vielleicht hatten einige der Senioren auch die Kulisse gestaltet und die Plastikfiguren hatten einem verstorbenen Heimbewohner gehört. Nach seinem Tod hatten die Angehörigen sie dann nicht an sich genommen und man hatte sie nicht entsorgen wollen. Irgendetwas in dieser Art musste passiert sein.
»Kommst du jetzt?«, rief Roswitha vom anderen Ende des Saales aus.
Sie wartete bei einem Notausgang, dessen Tür offen stand und zu einer schmalen Treppe führte.
Ich schlenderte nachdenklich hinüber und trat in den Treppenschacht. Es war ebenfalls kein sehr einladender Ort, denn die eindringliche Finsternis des Speiseraums schien mir gefolgt zu sein. Auch die drückende Wärme und staubige Luft, die das Atmen erschwerten, wurden durch die blanken Zementwände und die sich eng windenden Stufen verstärkt. Ich verspürte wenig Lust, mir noch ein weiteres Stockwerk anzusehen. Es war eindeutig genug. Das ganze Gebäude war bedrückend, verwirrend und wirkte von Minute zu Minute feindseliger.
Mit der Hand auf dem Geländer konnte ich fast blind hinuntersteigen. Ich versuchte im Geiste mitzuzählen, wie viele Stockwerke ich noch zu gehen hatte, aber da ich nicht genau wusste, wo ich mich vorher befunden hatte und wie hoch das Gebäude genau war, funktionierte das nicht. Mir blieb nichts anderes übrig, als in jedem Stockwerk durch die Tür zu leuchten, um zu sehen, ob ich schon im Erdgeschoss angekommen war.
Irgendwann traf mein Licht statt auf die endlosen, farbig gestrichenen Wände auf hellgrüne Fliesen. Zögernd steckte ich den Kopf hinaus und blickte auf einen Gang, dessen Fußboden mit Putz- und Zementtrümmern übersät war. Die bis zur halben Höhe an den Wänden angebrachten Kacheln waren teilweise heruntergebrochen worden. Türen gab es nicht mehr, sie waren samt den Rahmen herausgerissen und hinterließen gähnende, unförmige Löcher. Der Lichtkegel strich über eine gemauerte Badewanne im Raum mir gegenüber.
Dies musste der Keller sein.
Ich konnte nun absolut nicht mehr verstehen, was mich an diesem Ort interessiert hatte. Ich würde keinesfalls einen Fuß in einen dieser dunklen Schlünde setzen, geschweige denn noch ein Stockwerk hinuntergehen.
Aber … wieso endete die Treppe hier nicht? Ich leuchtete über das Geländer in den Treppenschacht und mir wurde sofort schwindelig. Es musste noch mehrere Etagen unter der Erde geben, ich konnte nicht erkennen, wo der letzte Absatz war. So weit reichte das Licht meiner Lampe nicht.
Genug! Ich wollte hier nichts mehr. Ich machte auf dem Absatz kehrt und begab mich rasch in das Stockwerk darüber. Der Korridor hier war in einem wesentlich besseren Zustand, die Wände kahl und die Türen wie auch sonst überall offen oder angelehnt. Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen musste, aber wenn dies das Erdgeschoss war, dann war es ausgeschlossen, dass ich nicht herauskommen würde. Zur Not könnte ich sicher die Sperrholz- und Blechplatten, die die Fenster blockierten, mit einem Möbelstück aufbrechen. Aber das müsste der letzte Ausweg sein, denn dann würde ich mit Sicherheit auf mich aufmerksam machen.
Der Gang führte in einen größeren, offeneren Raum, der sich wohl an der Ecke des Gebäudes befinden musste. Breite Stufen führten zu einem sechseckigen Bereich, in welchem ein durcheinandergeworfener Haufen aus Caféstühlen und Gartentischen lag. Die Verstrebungen der Wände und Decken ließen darauf schließen, dass es einmal eine Art Wintergarten gewesen sein musste, die Glasfassade aber von innen und außen so dicht vernagelt worden war, dass kein Licht hereindrang. Vielleicht war dies eine Cafeteria, dann konnte der Haupteingang sicher nicht weit sein. Ich schlug die Richtung ein, die mir am vielversprechendsten erschien, und glaubte schon nach kurzer Zeit einen leichten grünen Lichtschimmer zu erkennen. Ich wagte es nicht, die Taschenlampe abzuschalten, um mich zu vergewissern, ob wirklich Helligkeit zwischen den merkwürdigen weißen Platten am fernen Ende des Ganges zu sehen war. Doch hielt ich weiter darauf zu.
Mir entfuhr ein freudiger Seufzer, als ich erkannte, dass dies vor mir tatsächlich nur eine Eingangshalle sein konnte. Die großen Flügeltüren waren mit Kunststoffpaneelen nur notdürftig verschlossen und Pflanzenwerk kroch durch die Ritzen und das geborstene Glas herein. Doch der Boden des Raumes fehlte. Es wirkte, als hätte man ein mehrere Meter großes Stück des Betons herausgeschnitten, auch wenn die Kanten am Rand eher unregelmäßig waren. Ich leuchtete in das Loch und konnte nur wenige Trümmer erkennen, es sah also nicht so aus, als wäre es eingebrochen. Einige große Maschinen, vielleicht Boiler oder Turbinen, standen verstaubt, aber unbeschädigt dort unten.
Ratlos und in respektvollem Abstand schob ich mich am Rande des quadratischen Schlundes vorbei, fand aber schon nach kurzer Zeit eine Stelle an einer Ecke, an welcher ich nur einen kleinen Sprung machen müsste, um auf die andere Seite, um in die Freiheit zu gelangen. Ein einziger großer Schritt, nicht mehr. Ich atmete tief durch. Ich konnte das.
Ich trat einen Schritt zurück, um besseren Stand zu bekommen, und zögerte. So hoch war es nun wirklich nicht. Ein dunkles Loch, doch nur vier Meter tief. Aber hier gab es nichts zum Festhalten. Und ein Sturz in diese Schwärze … Meine Knie wurden weich und mein Magen krampfte sich zusammen, sodass mir nichts übrig blieb, als mich sofort auf den Boden zu setzen.
Es war doch ganz einfach. Ich könnte den Gang zurückgehen, das Gebäude innen umrunden und sehen, ob ich einen anderen Ausgang entdeckte. Wie ich es schon geplant hatte, könnte ich ein verbarrikadiertes Fenster aufbrechen. Oder wenn ich gar nichts fände in den Keller hinuntergehen und dort nach einem offenen Lichtschacht suchen.
Ich leuchtete mit der Lampe hinter mich, dorthin, wo ich hergekommen war. Nein, in den Keller wollte ich sicher nicht noch einmal. Aber irgendetwas stimmte auch hier nicht. Mir war nicht aufgefallen, dass die Luft hier unten besser gewesen wäre als oben im Speisesaal. Doch jetzt, ganz langsam, schien sie noch stickiger, staubiger und drückender zu werden. Gleichzeitig kam es mir vor, als nehme der Schein meiner Taschenlampe im fernen Flur ab. Das Atmen wurde schwerer und ein Kribbeln stieg in mir auf, bahnte sich langsam einen Weg von meinen Füßen in meine Beine. Nein. Dorthin konnte ich nicht mehr. Ich musste weg. Ich versuchte so viel Luft in meine Lunge zu pumpen, wie ich nur konnte. Meine Hände waren so schweißnass, dass ich die Taschenlampe auf dem Boden liegen ließ, als ich aufstand. Ich brauchte sie nicht mehr, ganz gleich ob es gelänge oder nicht gelänge.
Meine Muskeln gestrafft wagte ich den Schritt.
Ein kurzes Straucheln, aber ich war schon auf der anderen Seite.
Ohne weiteres Zögern stürmte ich zur Eingangstür, drückte die spröden Plastikplatten weg und zwängte mich, die kratzenden Glasscherben ignorierend, hinaus ins Tageslicht. Ich rannte eine kurze Treppe hinab, über einen verkrauteten Parkplatz auf eine mit trockenem Laub bedeckte Straße. Erst als ich in eine der kleineren, von Birken und Kiefern gesäumten Alleen des Gewerbegebiets einbog, verlangsamte ich meine Schritte. Von hier aus konnte ich schon die Schnellstraße und die Autobahnbrücke mit den Industrieanlagen dahinter sehen. Irgendwo musste das Auto stehen. Ich konnte nur hoffen, dass dieser, wie hieß er noch, Li den Schlüssel in all der Aufregung nicht verloren hatte.
Mein Gott, Li! Roswitha und Than!
Wie hatte ich ohne sie gehen können? War Li überhaupt mit hineingekommen? Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Wo hatte ich Roswitha zuletzt gesehen? Ich hatte sie zurückgelassen, sie waren noch in der Ruine. Ich drehte mich um und rannte die Allee hinauf. Sicher musste ich nur ein wenig vor der Tür auf sie warten. Ich hatte ja ihre Handynummern, falls wir uns verlieren würden. Aber wo hatte ich mein Handy gelassen?
Keuchend blieb ich vor dem zugeketteten Tor einer Autoreparaturwerkstatt stehen. Hier war ich falsch, ich musste die Einfahrt verpasst haben. Ich hob den Kopf und reckte mich, um mich zu orientieren. Der schmutzig-weiße Turm des Altenheims lag etwas weiter zu meiner Linken, ganz wie ich vermutet hatte. Also lief ich die Straße wieder hinunter, fand aber nur eine andere, wesentlich breitere, die in die richtige Richtung verlief. Als ich, außer Atem, deren Ende erreichte, war ich bei der Baustelle eines kleinen, kastenförmigen Gebäudes angelangt. Das Pflegeheim lag nun weit rechts, fast hinter mir. Wie hatte ich auf diesem kurzen Stück einen falschen Weg einschlagen können? Ohne eine Möglichkeit mich von hier aus zurechtzufinden, beschloss ich zurück zu meinem – unserem! – Ausgangspunkt zu laufen.
Mit schmerzender Seite und brennender Lunge erreichte ich nach wenigen Minuten die Schnellstraße und konnte sogar Lis roten Seat etwas weiter unten am Hang sehen. Hier war ich richtig. Ich machte kehrt, um nun den korrekten Weg wieder hinaufzugehen, fand aber zwei Straßen vor, die v-förmig von mir wegführten. Das Gebäude lag in der Ferne im Wald zwischen ihnen. Welche ich auch nehmen würde, ich würde es verpassen. Ich musste versuchen den Weg zu nehmen, den wir am Morgen eingeschlagen hatten, um im weiten Bogen durch den Wald an die Rückseite zu kommen. Irgendwie würde ich ihn doch finden! Ich rannte los und hatte mich schon nach einigen Minuten verlaufen. Ich konnte die Stelle, an welcher wir durch das Loch im Zaun gekrochen waren, nicht finden. Ja, nicht einmal den Zaun! Und wo ich auch stand, ich konnte den weißen Turm sehen, nie mehr als fünfhundert Meter entfernt, manchmal auch nur einen Steinwurf. Hielt ich auch querfeldein darauf zu, ich verpasste ihn. Ich überstieg Mauern, durchbrach Brombeergestrüppe, rannte über Werkshöfe und das Gelände einer Raffinerie. Ich kam nicht näher heran und verlor mein Ziel doch nie aus den Augen.
Als die Schatten länger wurden und ich vor Durst fast umkommend, zerkratzt und blutend wieder an der Schnellstraße angekommen war, wusste ich, dass ich aufgeben musste.
Felix M. Hummel wurde 1986 in der Oberpfalz geboren und lebt heute mit seiner Frau in Deggendorf, Niederbayern. Er hat ein Archäologiestudium begonnen, schließlich aber eines der Zahnmedizin beendet, nur um dann in einem anderen Bereich zu arbeiten. Bisher hat er eine Handvoll Gedichte und Kurzgeschichten veröffentlicht, wobei ihm häufig Träume als Inspiration dienen.
Nicht von hier
© Marcel Sander
Es tut mir so unendlich leid.
Ich habe etwas ganz Schlimmes getan und bin mir sicher, dass ich uns alle verdammt habe. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es sofort tun. Doch ich befürchte, es ist bereits zu spät.
Überall ist dieser Nebel. Dieses furchtbare Graugrün. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Stunden, vielleicht Tage. Wochen wohl kaum. Ich kann es spüren und ich kann es sehen. Hier durch mein offenes Fenster. Ich wohne in der 2. Etage und kann sehen, wie sie umherschleichen wie Demenzkranke. Wie sie hüpfen.
Ja, sie hüpfen, aber nicht wie freudige Kinder. Fremde und Menschen, die mal meine Nachbarn waren, bewegen sich nun seltsam hüpfend fort. Der Anblick macht mir solche Angst. Ich sitze hier und schreibe alles nieder. Für eine Nachwelt, die es hoffentlich nach dem Ganzen noch geben wird. Doch ich bin pessimistisch. Niemand wird das hier lesen. Es ist zu schlimm, was geschehen wird. Es tut mir leid.
Ich schreibe es nur noch nieder, um eine Beschäftigung zu haben, während ich auf den Tod oder Schlimmeres warte.
Da, der Boden vibriert wieder. Als ob schwere Lastwagen in der Nähe Bauschutt abladen würden.





























